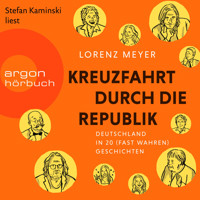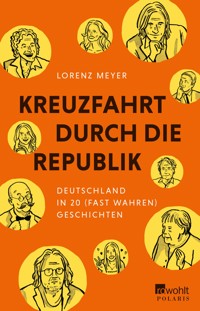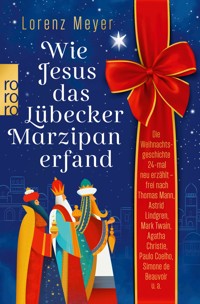
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer eine unkonventionelle und kreative Interpretation der biblischen Weihnachtsgeschichte lesen will, sollte zu diesem Buch greifen: Satire-Spezialist Lorenz Meyer versetzt die Geschichte über die Geburt Jesu in das literarische Setting bekannter Autor:innen. Er imitiert ihren Stil und haucht der altbekannten Erzählung mit viel Raffinesse und feinsinnigem Humor neues Leben ein. So wird jede Geschichte zu einer überraschenden Entdeckungsreise, die sowohl die Originalwerke als auch die Weihnachtsgeschichte in einem neuen, unterhaltsamen Licht erscheinen lässt. Und wem das nicht genug ist: Als kleine Zugabe, als «lyrischer Spekulatius», finden sich auch besinnlich-lustige Gedichte im Buch – besser kann Weihnachten nicht mehr werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lorenz Meyer
Wie Jesus das Lübecker Marzipan erfand
Die Weihnachtsgeschichte 24-mal neu erzählt - frei nach Thomas Mann, Astrid Lindgren, Mark Twain, Agatha Christie, Paulo Coelho, Simone de Beauvoir u.a.
Über dieses Buch
Besser kann Weihnachten nicht werden!
Wer eine unkonventionelle und kreative Interpretation der biblischen Weihnachtsgeschichte lesen will, sollte zu diesem Buch greifen: Der Satiriker Lorenz Meyer versetzt die Geschichte über die Geburt Jesu in das literarische Setting bekannter Autor:innen. Er imitiert ihren Stil und haucht der altbekannten Erzählung mit viel Raffinesse und feinsinnigem Humor neues Leben ein. Eine erfrischend andere Lektüre und ein perfektes Geschenk für alle, die das Fest der Liebe mit einer Prise Satire und Kreativität begehen wollen.
Vita
Lorenz Meyer ist Journalist und Medienkritiker (u. a. BILDblog) mit einem Faible für Satire. Er hat das Bullshit-Bingo bekannt gemacht (u. a. für den Spiegel) und bei der FAZ «Meyers Berufs-Phrasomat» bespielt. Außerdem versorgt er namhafte Comedians mit Inhalten für ihre Bühnenprogramme und arbeitete u. a. für Kurt Krömer, Jan Böhmermann und extra 3. Auf radioeins kommentiert er wöchentlich das aktuelle Mediengeschehen. In den sozialen Medien folgen ihm mehr als 175.000 Menschen. 2022 erschien «Kreuzfahrt durch die Republik» bei Polaris, 2023 «Sprechen Sie Beamtendeutsch?» bei rororo.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung zero-media.net, München
Coverabbildung FinePic®, München
ISBN 978-3-644-02098-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Idee zu diesem literarischen Experiment entsprang einer Mischung aus Ehrfurcht und spielerischer Neugier: Wie würden Thomas Manns tiefsinnige Betrachtungen die Weihnachtsgeschichte prägen, Mark Twains scharfzüngiger Witz sie auf den Kopf stellen oder Astrid Lindgrens warmherzige Schreibkunst ihr einen ganz neuen Charme verleihen? Wie könnten sich Größen wie George Orwell, Simone de Beauvoir oder Karl Marx in diesem Kontext mit den Themen Glaube, Liebe und Hoffnung auseinandersetzen? Dieses Buch versucht, diese Fragen zu beantworten, indem es die unverwechselbaren Stimmen dieser literarischen Ikonen mit der zeitlosen Erzählung der Weihnachtsgeschichte verwebt.
Die großen Denker der Literatur kommen in dieser Sammlung zusammen wie Verwandte am Weihnachtsabend – die einen liebenswert, die anderen herausfordernd. Jeder Beitrag in diesem Band ist eine Hommage an den Autor oder die Autorin, eine parodistische und satirische Auseinandersetzung, die sowohl die Besonderheiten ihrer Werke als auch die universellen Themen der Weihnachtsgeschichte untersucht. Mein Ziel war es, ein Werk zu schaffen, das gleichermaßen unterhält und zum Nachdenken anregt, das die Fantasie der Leserinnen und Leser beflügelt und dazu anregt, Altbekanntes mit neuen Augen zu sehen. Trotz des satirischen Ansatzes soll die Wertschätzung für die literarischen Vorbilder stets spürbar bleiben.
Aber Vorsicht: Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven! Es ist eine wilde Achterbahnfahrt durch die Welt der Literatur, die zum Lachen, Staunen und vielleicht auch zum Stirnrunzeln anregt. Und wer weiß? Vielleicht entdecken Sie ja gerade den einen oder anderen Autor, der bisher unter Ihrem Radar blieb und der Sie fortan durchs Leben begleiten wird – als unverhofftes Geschenk dieser literarischen Weihnachtsreise.
Worauf warten Sie also noch? Tauchen Sie ein in diese einzigartige literarische Welt und lassen Sie sich überraschen, was diese außergewöhnliche Weihnachtsanthologie für Sie bereithält!
Ihr Lorenz Meyer
Thomas Mann: Die Dahlmanns
Konsul Dahlmann erwachte abrupt aus seinem kurzen, nachmittäglichen Schlummer.
«Wer ist das? Wer – ist das …?»
Verwirrt deutete er auf einen schwarz gekleideten jungen Mann, der mitten im Salon des ehrwürdigen Patrizierhauses in der Lübecker Mengstraße stand.
«Ist es Gevatter Tod, der mich holen kommt? Ist meine Zeit schon gekommen?»
Maria, die Tochter des Hauses, ließ ein Lachen erklingen, das in seiner Melodie die jahrhundertealte Geschichte des Dahlmann’schen Geschlechts zu tragen schien. Mit einer Geste, die sowohl Respekt als auch innige Zuneigung verriet, legte sie dem Familienoberhaupt zärtlich die Hand auf die Wange.
«Aber Vater, haben Sie vergessen? Das ist Josef, der Zimmermann, den Sie persönlich beauftragt haben.»
Sie deutete auf den Handwerker, der ganz nach den Regeln seiner Zunft gekleidet war: die Beinkleider mit ausladendem Schlag, die Weste mit acht weißen Perlmuttknöpfen geschmückt und auf dem Haupt ein stattlicher Schlapphut mit breiter Krempe.
«Er ist hier, um das Dach zu begutachten. Ganz nach Ihrem Wunsch, Papa», wiederholte Maria, während sie schelmisch lächelte.
Der Konsul seufzte tief. Wenn seine Tochter nur von der heiklen Situation Kenntnis hätte, in der sein Geschäft sich gerade befand, so wäre ihr sicherlich nicht zum Scherzen zumute.
Dahlmann hatte durch den Handel mit exquisiten Gewürzen und edlen Stoffen aus dem Morgenland zu Wohlstand und Ansehen gefunden, auch wenn der Fokus eher auf dem europäischen und regionalen Handel lag. Der Verlust eines seiner Schiffe samt seiner kostbaren Fracht drohte ihn in den Ruin zu treiben. Es war nur eine Frage der Zeit, bis seine Kreditgeber das Vertrauen verlieren und er und seine Familie in Schuldknechtschaft geraten würden. Da kamen kostspielige Instandsetzungen am Haus höchst ungelegen.
Ehe das beklemmende Schweigen den Raum in seiner Gänze zu durchdringen drohte, regte sich aus einer Ecke des Zimmers eine Stimme, die in ihrer höflichen und fast demütigen Bescheidenheit die ersehnte Linderung schenkte.
«Herr Konsul Dahlmann, es ist mir ein Privileg, in Ihrer Gegenwart weilen zu dürfen. Ihr Renommee und Ihre Anerkennung sind mir von unermesslichem Wert, und ich bin fest entschlossen, Ihnen mit all meinem Können beizustehen.»
«Dann möge er sich seiner Aufgabe widmen», erwiderte der Konsul und wies seine Tochter an, Josef auf den Dachboden zu führen, wo der für seinen verheerenden Appetit berüchtigte Hausbockkäfer sein zerstörerisches Unwesen am Gebälk trieb.
In stiller Reflexion versuchte Dahlmann abzuschätzen, welcher Betrag ihn für Josefs Tätigkeit belasten würde. Sein Gesichtsausdruck verdüsterte sich wie eine jener Gewitterwolken, die für das Untergehen seines stolzen Dreimasters verantwortlich waren. Mit einem Seufzen griff er nach seiner vergoldeten Schnupftabakdose.
Indessen hatten Maria und Josef die steile, quietschende Treppe bezwungen und fanden sich, umgeben von Spinnfäden, im zugigen Dachgeschoss wieder.
«In welchem Jahre wurde dieses Anwesen errichtet?», erkundigte sich Josef, während er mit vertieftem Ernst die Qualität und Belastbarkeit der majestätischen Dachbalken inspizierte.
«Anno … verzeihen Sie …», sinnierte Maria, «es müsste um 1680 gewesen sein, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt.»
«1680», wiederholte Josef und betrachtete die junge Frau, die, obgleich sie erst die Schwelle zum achtzehnten Lebensjahr überschritten hatte, bereits die Anmut einer betörenden Schönheit in sich trug. Ihre Züge waren von harmonischer Symmetrie, ihr Teint von einem makellosen Weiß und ihre Gesten von einer Grazie, die nur einer Dame aus vornehmem Hause zu eigen war.
Maria entging das aufkeimende Interesse des jungen Mannes nicht, und sie spürte, wie ihr Herz von einer unbedachten Zuneigung zu diesem Jüngling erfüllt wurde.
Sie schüttelte sich, als versuche sie, einen unheilvollen Bann abzustreifen, und erwiderte mit kokettem Übermut: «Haben Sie alles gesehen, was Sie sehen wollten?»
Josef sah ihr tief in die Augen: «Oh ja. Ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte», und fügte nach einer kurzen Pause an, «… und was ich mit Freude weiter erblicken möchte.»
«Dann sei es so», sprach Maria und sprang die Stufen der Stiege hinunter, als ob sie Reißaus vor sich selbst und den aufkeimenden Gefühlen nehmen wollte.
Josef folgte ihr und überbrachte dem Konsul die missliche Nachricht, dass einige der tragenden Balken ersetzt werden müssten.
In den darauffolgenden Wochen fand Josef immer wieder Anlass, das Dahlmann’sche Domizil aufzusuchen. Mal galt es, eine essenzielle Skizze anzufertigen, zu anderen Zeiten ein unerlässliches Maß nachzutragen oder, wie er behauptete, ein vergessenes Werkzeug oder Material mitzubringen. Und das Schicksal schien es stets so zu fügen, dass er mit der Tochter des Konsuls zusammentraf, deren Empfinden nun gänzlich auf ihn ausgerichtet war.
Eines Tages, als die wachsende Zuneigung Marias ihren Höhepunkt erreichte, entwand sie in einem unbeobachteten Augenblick dem überraschten Josef seinen weiten Hut und schenkte ihm einen Kuss voll sinnlicher Zärtlichkeit, welchen Josef mit gleicher Innigkeit erwiderte.
Die Liebe zwischen Maria und Josef, die wie ein zartes Pflänzchen in den schützenden Mauern der Dahlmann’schen Residenz aufkeimte, entfaltete sich trotz der Vorbehalte von Marias Familie, die eine Liaison mit einer anderen renommierten Kaufmannsfamilie der Stadt bevorzugt hätte.
Vor allem der Konsul äußerte seine Besorgnis: «Maria, mein innigst geliebtes Kind, hast du in der Tiefe deines Herzens erwogen, ob du den Annäherungen deines Bewunderers nachkommen möchtest? Es gibt zahlreiche angesehene Geschlechter in Lübeck, die eine vorteilhaftere Verbindung für dich darstellen würden.»
Maria blickte ihrem Vater mit Entschiedenheit in die Augen und legte behutsam ihre Hand auf seinen Arm.
«Vater, ich achte Ihre Bedenken, doch mein Herz hat sich Josef zugewandt. Er ist ein Mann von außergewöhnlicher Integrität und Aufrichtigkeit. Gemeinsam werden wir unser Glück finden und ein Haus gründen, das von Liebe und Wahrhaftigkeit durchdrungen ist.»
Der Konsul ließ sich von Marias Bestimmtheit rühren und musterte Josef mit neuem Blick, beginnend, das zu erkennen, was seine Tochter in ihm sah.
«Maria, ich vertraue deinem Urteilsvermögen. Wenn du glaubst, dass Josef der rechte Mann für dich ist, so soll er im Hause Dahlmann willkommen geheißen werden.»
Strahlend schloss Maria ihren Vater in die Arme und jubilierte: «Mein Papa, Sie sind doch der Liebste, Beste, Feinste!»
Der Konsul schob sie sanft von sich, gleich einem ungestümen Kätzchen, aber mit einem Lächeln. Sein Innerstes indes wurde von Sorgen gänzlich anderer Natur heimgesucht. Die Kaufleute und sonstigen Honoratioren Lübecks würden von ihm erwarten, dass er ein opulentes Hochzeitsfest veranstalten würde, doch er stand am Rande des finanziellen Abgrunds. Seitdem er seine Wechsel ein letztes Mal verlängert hatte, war er der Gnade seiner Gläubiger ausgeliefert. Die drohende Schande eines wirtschaftlichen Ruins und der damit verbundene gesellschaftliche Abstieg lasteten schwer auf ihm. Er hoffte inständig auf eine günstige Wendung des Schicksals, um dieser Misere zu entkommen.
Inmitten dieser finanziellen Turbulenzen bemerkte der Konsul, dass Maria, die sonst so lebensfrohe und energische Tochter, immer öfter in sich gekehrt und nachdenklich wirkte. Ihre sonst so rosigen Wangen schienen blasser, und sie zog sich immer häufiger in ihre Gemächer zurück.
Eines Tages, geplagt von einem diffusen Unwohlsein, sah sie sich genötigt, den Hausarzt Doktor Martini zu konsultieren. Nach eingängiger Untersuchung, und nachdem er sein Hörrohr und den kleinen Reflexhammer mit dramatischer Geste verstaut hatte, verkündete Martini mit der nüchternen Miene eines Mediziners, der bereits alle Freuden und Leiden der Menschheit gesehen hatte: «Sie ist guter Hoffnung, Herr Konsul. Ihre Tochter erwartet ein Kind!»
Dahlmann schwankte ob dieser Nachricht und tastete nach dem festen Halt seines Lehnstuhls, sein Gesicht ein Bild bestürzter Konsternation und schlagartig gealtert.
«Das kann nicht sein. Das darf nicht sein!»
«Es liegt mir fern, Sie zu beunruhigen, Herr Konsul, doch das, was in Ihren Augen nicht geschehen sollte, hat sich dennoch ereignet. Denn ein neues Leben zu schenken, ist die erhabenste Gabe, die uns Sterblichen zuteilwerden kann.»
Mit Sorgfalt knöpfte der Arzt seinen Gehrock zu, ergriff seinen Stock und das kleine Medizintäschchen und verabschiedete sich. Doch nicht, ohne zuvor einen Umschlag mit seinem Honorar entgegengenommen zu haben.
Der Konsul ließ sich schwer in den Lehnstuhl sinken. Das Schicksal schien ihm nicht nur geschäftlich, sondern auch in persönlicher Hinsicht übel mitzuspielen. Ein Kind außerhalb der Ehe würde unweigerlich den dunklen Schatten der Schande über das Haus Dahlmann werfen.
Mit einem Blick, in dem sich Enttäuschung und Zorn mischten, trat er an Marias Bett heran und stellte die brennende Frage: «Hast du dich mit Josef in einer Weise vereinigt, die nur im heiligen Bund der Ehe ihren Platz hat?»
Das junge Mädchen brach in Tränen aus. «Nein! Nein! Nein! Ihr müsst mir glauben!» Verzweifelt suchte sie ihren Vater von ihrer Unschuld zu überzeugen, doch alle Beteuerungen, Erklärungen und Dementis waren vergebens.
«Verlasse sogleich mein Haus! Du wirst keine weitere Nacht unter diesem Dach verbringen. Du bist nicht länger meine Tochter, und ich bin nicht mehr dein Vater!»
Mit gebrochenem Herzen und unter Tränen verließ Maria das Patrizierhaus, begleitet von den mitleidigen Blicken der dem Konsul ergebenen Dienerschaft.
Draußen auf dem Kopfsteinpflaster eilte ihr eine Kammerzofe nach und raunte ihr eine Adresse zu. Maria solle sich zur Kanalstraße begeben und dort an der Pforte des baufälligen Eckgebäudes anklopfen. Alles Weitere werde sich ergeben. In der Zwischenzeit würde die aufmerksame Zofe Josef von der bedrückenden Wendung der Ereignisse unterrichten.
Wie ihr geheißen, machte sich Maria auf den Weg zur Kanalstraße und erreichte bald das heruntergekommene Anwesen, das sich als Refugium für werdende Mütter herausstellte, die aus vielfältigen Gründen in Bedrängnis geraten waren.
Maria versuchte alsbald, in dem ihr zugewiesenen kargen Raum eine Atmosphäre der Geborgenheit zu schaffen, was ihr in bester Manier gelang.
Josef, der die Nachricht von Marias Zustand und ihrer Vertreibung erhalten hatte, fühlte sich von einer tiefen Unruhe erfasst. Obwohl er wusste, dass er nicht der Vater des Kindes war, konnte er das Schicksal Marias nicht tatenlos mitansehen. Trotz der Bitterkeit und Enttäuschung, die er über die unerwartete Wendung empfand, beschloss er, Maria an ihrem neuen Zufluchtsort aufzusuchen, fest entschlossen, sie nicht im Stich zu lassen.
Die Wochen zogen ins Land, und unaufhaltsam näherte sich der Tag der Entbindung.
Eines Abends, als Josef unruhig die Stätte verließ, um unter dem sternenübersäten Himmel seiner Pfeife zu frönen, erblickte er über den schattigen Dächern der Hansestadt einen Stern von ungewöhnlicher Strahlkraft. Ein Zeichen, das die bevorstehende Geburt ihres Kindes verkündete? In den späten Stunden jenes Abends bewahrheitete sich diese Ahnung, als Maria einen gesunden Sohn zur Welt brachte, dem sie den Namen Jesus gab.
Kurz darauf, in der tiefsten Nacht, klopften drei vornehm gekleidete Herren an die bescheidene Tür des Hauses an der Kanalstraße. Sie präsentierten sich als Gesandte der benachbarten Hansestädte und trugen prächtige Gefäße in ihren Händen.
Mit ehrerbietiger Stimme verkündete der erste Gesandte: «Aus dem Herzen der Hansestadt Bremen bringe ich Rosenwasser, als Symbol der innigsten Liebe und Verehrung.»
Der zweite fügte hinzu: «Zerstoßene Mandeln aus der Hansestadt Hamburg, sie symbolisieren die mannigfaltigen Schicksalsschläge und Glücksmomente, die das Dasein für uns bereithält.»
Der Dritte, seine Stimme von einer tiefen Ehrfurcht getragen, schloss: «Und aus der Hansestadt Rostock reichen wir euch Puderzucker dar, als Allegorie für die Süße, die in den seltenen Augenblicken des Glücks verborgen liegt.»
Maria und Josef, von der unerwarteten Visitation und den exquisiten Gaben zutiefst berührt, dankten den Herren und stellten die Gefäße beiseite, ohne zu erahnen, welch eine Bestimmung sie in der Zukunft erfüllen würden.
Einige Jahre waren ins Land gezogen, als Jesus, nunmehr ein Knabe von wachem Geiste, jene Gefäße, die in einer verwaisten Ecke des Hauses ruhten, mit neugierigem Blick erspähte. Getrieben von kindlichem Forscherdrang und einer unbändigen Experimentierlust, vermengte er das Rosenwasser mit den fein zerstoßenen Mandeln und dem Puderzucker. Mit seinen zarten Fingern formte er daraus kleine Kugeln und kostete. Ein Leuchten, gleich dem ersten Licht des Morgens, erhellte seine Augen.
Maria und Josef, Zeugen dieses kreativen Schaffens, ließen sich von seinem Frohlocken anstecken und kosteten ebenfalls von der süßen Speise. Sie fanden sich entzückt von der Geschmackskomposition, einer harmonischen Verschmelzung von zarter Süße, nussigem Unterton und der blumigen Note des Rosenwassers.
«Diese Kreation könnte in Lübeck Anklang finden», sinnierte Josef, den Blick in die Ferne gerichtet. «Ein schlichtes Rezept zwar, doch aus solch erlesenen Ingredienzien könnte es uns zu neuer Blüte verhelfen.»
So begannen sie, die Delikatesse in der Stadt zu verkaufen. Schnell erlangte die Leckerei Beliebtheit, und viele Lübecker Bürger erfreuten sich an ihrem Geschmack.
Konsul Dahlmann aber, der von dieser neuen Köstlichkeit Kenntnis erlangte, sah darin eine Gelegenheit zur Versöhnung und unterbreitete Maria und Josef das Angebot, die Ware unter seinem renommierten Namen zu vertreiben. Er versprach ihnen einen Anteil von zehn Prozent des Profits – eine Provision, die er sonst niemandem zugestanden hätte, wie er betonte. Maria und Josef, dem Konsul sein Verhalten vor Jesu Geburt verzeihend und ebenfalls um Aussöhnung ringend, nahmen den Vorschlag an. Das Geschäft florierte, und die Familie, insbesondere der Konsul, erlangte Wohlstand und Ansehen in Lübeck.
Als Jesus heranreifte, ließ er seiner Experimentierfreude freien Lauf und kreierte neue Varianten. Eines Tages wälzte er die Kugeln in feinstem Kakaopulver. Der Konsul, stets auf der Suche nach neuen Geschäftsideen, schlug vor, diese neue Kreation «Jesus-Kugeln» zu nennen. Doch Jesus in seiner Bescheidenheit winkte ab.
«Es sind andere Bestrebungen, die mich rufen, Großvater», sprach er. «Andere Aufgaben, fernab dieser Heimat und meines bisherigen Wirkens erwarten mich. Und dafür bedarf es meines Namens in all seiner unberührten Reinheit. Nennen wir sie nicht ‹Jesus-Kugeln›. Nennen wir sie lieber ‹Marzipankartoffeln›.»
Und so geschah es.
Der aus einer Lübecker Patrizier- und Kaufmannsfamilie stammende Schriftsteller Thomas Mann(1875–1955) gilt als einer der bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Mit seinen tiefgründigen Romanen und Erzählungen prägte er die deutsche Literatur und erlangte weltweite Anerkennung. Für seinen Gesellschaftsroman «Buddenbrooks» erhielt er 1929 den Nobelpreis für Literatur und gilt bis heute als einer der einflussreichsten Erzähler der Moderne.
Marie Kondō: Aufräumen bei Maria und Josef
In der kühlen Abenddämmerung von Bethlehem rollt ein Fahrzeug über die staubigen, jahrtausendealten Wege. Abrupt hält es vor einem unscheinbaren Stall. Aus dem Wagen springen die japanische Aufräumexpertin Marie Kondō und fünf Mitglieder ihres TV-Teams. Sie wuchten ein dieselbetriebenes Stromaggregat aus dem Fahrzeug und beginnen, ihre Kameras, Mikrofone und Scheinwerfer aufzubauen.
Kondō trägt ihr charakteristisches weißes Outfit. Sie nähert sich dem Eingang zum Stall. Maria und Josef, die frischgebackenen Eltern, schauen überrascht auf.
«Guten Abend, ich bin Mari Kondō. Wir drehen eine Dokumentation darüber, wie man auch an den ungewöhnlichsten Orten aufräumt und ausmistet. Wir haben gehört, dass in diesem Stall ein neues Leben begonnen hat, und wir möchten Ihnen helfen, den perfekten Start in diese neue Ära zu schaffen.»
Maria und Josef tauschen verwirrte Blicke aus. Josef antwortet vorsichtig: «Wir wissen Ihr Angebot zu schätzen, aber wie Sie sehen, haben wir hier nicht viel …»
Kondō nickt verständnisvoll. «Genau deshalb sind wir hier. Es geht nicht darum, was man hat, sondern dass einem das, was man hat, Freude bereitet.»
Maria wiegt das Kind liebevoll in ihren Armen und sagt leise: «Das tut es schon.»
«Aber wenn ich mich hier im Stall umschaue, ist davon wenig zu sehen. Dabei kann Aufräumen Ihr Leben verändern. Indem Sie sich fragen, was Ihnen Freude bereitet und was nicht, erkennen Sie, was wirklich Bedeutung hat in Ihrem Leben. Dabei ist es wichtig, Dankbarkeit gegenüber den Dingen auszudrücken: gegenüber denjenigen, die Sie behalten wollen, und denjenigen, die ihren Dienst getan haben und entsorgt werden. Sind Sie denn dankbar?»
Bevor Maria und Josef antworten können, fährt Kondō fort. Es sei sehr wichtig, dass Maria und Josef ihre Dankbarkeit angemessen zeigen würden. Sie beginnt mit dem Stroh, das dem neugeborenen Jesus als Bett dient. «Lasst uns jedem Halm Stroh für seine Dienste danken», beginnt sie, während Maria und Josef sich weiterhin fragende Blicke zuwerfen.
Kondō schwärmt von der Wärme und Reinheit, die das Naturmaterial ausstrahlt, während Josef leise murmelt, dass eine Decke hilfreicher wäre.
Sofort dreht sich Kondō zu Josef um und schaut ihn prüfend an. «Ah, dann fangen wir mal mit Ihnen an. Was ist mit Ihrem zerschlissenen Gewand?», fragt sie. «Glauben Sie, dass es Ihnen noch Freude bereitet oder die Hoffnung widerspiegelt, die dieser Raum ausstrahlen soll?»
Josef, dem die Situation sichtlich unangenehm ist, stottert. «Das ist alles, was ich habe …», doch Marie unterbricht ihn sanft, aber bestimmt. «Es ist wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen und nur das zu behalten, was wirklich Freude macht.»
Sie fordert ihn auf, Stück für Stück seine Kleider auszuziehen und sie auf die Stapel «Behalten» oder «Dankbarkeit und Loslassen» zu legen.
Schließlich steht Josef nur noch in seiner Unterhose da. Neben ihm die Stapel mit den Kleidungsstücken, die nun aussortiert oder weggeworfen werden sollen. Marie nickt zufrieden. «Spüren Sie, wie viel freier Sie jetzt sind? Das ist der erste Schritt in ein neues, glückliches Leben.»
Josef nickt. Er zittert vor Kälte und bedeckt verschämt seine Blöße. Marie Kondō wendet sich den wenigen Habseligkeiten der Heiligen Familie zu. Ihr Blick fällt auf die Geschenke der drei Weisen aus dem Morgenland: Gold, Weihrauch und Myrrhe.
«Was ist mit diesen Dingen?», fragt sie und nimmt die kostbaren Gegenstände vorsichtig in die Hand. «Bringen diese Dinge Ihnen Freude?»
Maria, die bisher schweigend zugesehen hat, antwortet vorsichtig: «Nun, es sind Geschenke zur Geburt unseres Sohnes.»
«Es kommt nicht auf den materiellen Wert an, sondern auf die Freude, die sie Ihnen bereiten», entgegnet Kondō und betrachtet das Gold kritisch. Die Weisen, die sich bis dahin im Hintergrund gehalten hatten, tauschen besorgte Blicke aus, unsicher, wie sie auf den Gedanken reagieren sollen, dass ihre sorgfältig ausgewählten Geschenke nicht genug Freude bringen könnten.
Maria schaut unsicher.
«Ich sehe, Sie sind noch nicht bereit loszulassen. Dann lassen Sie uns die Dinge erst mal kategorisieren und sortieren. Man soll immer nach Kategorien aufräumen, nicht nach Orten. Das Gold sollte also zu den anderen Edelmetallen.»
«Aber wir haben doch gar keine anderen Edelmetalle … Das Gold hier ist das erste und einzige, das wir haben.»
«Gut, dann legen Sie die Myrrhe in die Schublade mit den Balsamiermitteln und den Weihrauch in die Schublade mit dem Räucherwerk.»
Maria und Josef schauen sich ratlos an. Im Stall gibt es keine Schubladen.
Doch Kondō beschäftigt sich schon mit den Tieren im Stall. «Was haben wir denn da? Schafe, einen Esel und Ochsen. Man könnte sie unterschiedlich sortieren, zum Beispiel nach ihrem Verhalten. Esel sind eher Einzelgänger. Schafe und Rinder sind Herdentiere. Oder nach ihrer Nutzung: Schafe und Rinder werden wegen ihrer Wolle, ihres Fleisches und ihres Leders gehalten. Esel werden als Lasten- und Reittiere genutzt. Oder nach Größe, Farbe und Temperament. Das müssen Sie im Prinzip selbst für sich entscheiden.»
Mit einer energischen Bewegung wendet sie sich den Hirten zu. «So, und jetzt zu euch. Ich zeige euch, wie ihr eure Mäntel zusammenlegt. Das spart Platz und Zeit und schafft Ordnung im Kopf.»
Sie nimmt einem der verdutzten Hirten den Mantel ab und demonstriert ihre berühmte Falttechnik. Fasziniert beobachten die Hirten, wie sich ihre wenigen Kleidungsstücke in ordentliche kleine Bündel verwandeln.
Schließlich richtet sich Marie mit einem bedeutungsvollen Lächeln an Maria und flüstert ihr zu: «Das Prinzip des Aufräumens lässt sich auch auf andere Lebensbereiche übertragen, zum Beispiel auf das Kennenlernen.»
Maria schaut sie fragend an.
«Dann sage ich es noch deutlicher: Gibt es in Ihrem Leben Beziehungen, die Sie gerne aufräumen würden, weil sie Ihnen keine Freude mehr bereiten?»
Kondō deutet verstohlen auf Josef, der immer noch in seiner Unterhose dasteht.
Maria zuckt verlegen zusammen. «Äh, ja, nein …»
«Nun ja, wie gesagt. Das müssen Sie selbst entscheiden. Ich kann Ihnen nur aufs Pferd helfen, reiten müssen Sie selbst.» Sie schaut auf ihre Armbanduhr. «Ich muss mich verabschieden. Wir müssen das Material noch schneiden.»
Auf ein kaum wahrnehmbares Zeichen von ihr hin bauen die Teammitglieder den Dieselgenerator und die restliche Ausrüstung ab und verstauen alles im Auto. Blitzschnell rast der Transporter in einer riesigen Staubwolke davon.
Maria schaut Josef an. Josef schaut Maria an. Die Hirten schauen sich an, die Weisen schauen sich an, selbst die Tiere scheinen sich anzuschauen.
Und so vergehen einige qualvoll lange Sekunden, bis Maria sagt: «Zieh dich wieder an, Josef!»
Marie Kondō wurde am 9. Oktober 1984 in Tokio geboren. Sie ist Autorin der Bestseller-Buchreihe «Magic Cleaning» und Begründerin der nach ihr benannten Aufräummethode KonMari. 2019 startete Kondō die Netflix-Serie «Aufräumen mit Marie Kondō», die ihre Popularität weiter steigerte. Die Aufräumkönigin, die mittlerweile auch allerlei Krimskrams verkauft, ist bekannt für ihre zentrale Frage: «Does it spark joy?» (Macht es glücklich?)
Mark Twain: Das Wunder von St. Petersburg
An einem klaren Sonntagmorgen, an dem selbst die Vögel fromme Melodien trällerten, fand sich Tom Sawyer in der stickigen Sonntagsschule wieder, eingepfercht zwischen knarzenden Holzbänken und ausdruckslosen Gesichtern. Die Fenster standen weit offen, aber die Luft war schwer und träge. Sie schien genauso gelangweilt wie Tom.
Mrs. Thatcher, deren strenge Miene und scharfe Nase sie auch äußerlich als Wächterin der Moral kennzeichneten, dozierte über einen Bibelvers, der Tom so fern war wie der Mond.
Toms Gedanken schweiften ab, weit weg von den trockenen Bibelversen. Er träumte von Piraten, verborgenen Schätzen und seinem treuen Gefährten Huckleberry Finn, den jeder bloß Huck nannte und der draußen unter Gottes freiem Himmel gewiss allerhand Schelmereien und Schabernack trieb.
«Thomas Sawyer!», donnerte Mrs. Thatcher mit einer Stimme, die jeden Sünder erzittern ließ. «Kannst du wiederholen, was König David in all seiner Weisheit verkündet hat?»
Tom, der von König David so viel wusste wie ein Fisch vom Baumklettern, stammelte: «Äh, er meinte wohl … äh … ‹Macht die Leinen los und hisst das Großsegel›?»
Ein Kichern ging durch die Reihen, und Mrs. Thatchers Gesicht nahm die Farbe einer reifen Tomate an. Tom kannte diesen Ausdruck nur zu gut und spürte, dass ein Donnerwetter im Anmarsch war. Er war sich sicher, dass ihm seine kecke Antwort einige Stunden Nachsitzen einbringen würde, es sei denn, er fände rasch einen Ausweg.
Schnell zog er den Frosch aus seiner Tasche, den er als Geisel für solche Gelegenheiten gefangen hatte, und setzte ihn auf den Boden.
Das Tier, dankbar für seine neu gewonnene Freiheit, hüpfte mit einer Begeisterung durch den Raum, die man bei einem solchen Geschöpf kaum erwartet hätte.
«Um des Himmels willen! Ein Frosch!», schrie Jenny Harper.
Das Klassenzimmer geriet in helle Aufregung. Die Kinder sprangen auf ihre Bänke, einige ließen spitze Schreie los, andere kicherten vergnügt. Sally schlug vor Entsetzen die Hände über dem Kopf zusammen. Billy sprang auf und versuchte, den Frosch mit schnellen Händen einzufangen. Doch das flinke Geschöpf entwischte ihm immer wieder aus den Fingern. In einer Ecke des Raumes zog die kleine Emily ihre Schürze über den Kopf und murmelte leise ein Gebet, in der Hoffnung, dass das Tierchen ihr nicht zu nahe kommen würde. Mrs. Thatcher, mit zitternden Händen und flatterndem Herzen, versuchte vergeblich, den wilden Haufen zu bändigen. Es war ein wildes Durcheinander aus Schreien, Lachen, Gekreische und geflüsterten Gebeten.
Inmitten des Tumults schlüpfte Tom aus der Tür und ließ die Sonntagsschule mit ihren frommen Lektionen hinter sich. Er spürte ein Gefühl der Befreiung, als er durch die staubigen Straßen von St. Petersburg schlenderte. Hier schienen jedes Haus und jeder Zaun eine eigene Geschichte zu erzählen. Er steuerte auf den Teil des Flusses zu, der breit und mächtig dahinfloss. Dieser wilde und freie Ort war der geheime Treffpunkt, an dem er und Huck ihre Streiche ausheckten.
Wie er es sich erhofft hatte, traf er dort auf Huckleberry Finn, der auf einem abgetretenen Steg saß. Mit den Füßen im Wasser baumelnd, einem zerfledderten Strohhut, der ihm Schatten spendete, und einem Lächeln, das Freiheit und Sorglosigkeit verriet, schien Huck der unbestrittene König dieses wilden Fleckchens Erde zu sein.
«Hey, Huck, Junge!», rief Tom. Seine Augen funkelten vor Übermut. «Du glaubst nicht, was ich gerade angestellt habe!»
Huck hob den Blick und schob seinen alten Strohhut zurück. «Ich wette, du hast wieder die Sonntagsschule geschwänzt, oder, Tom?», fragte er grinsend. «Mrs. Thatcher wird sicher nicht erfreut sein.»
Tom lachte: «Das kann man wohl sagen! Aber warte, das ist noch nicht alles. Weißt du noch den Frosch, den ich gestern gefangen habe?»
Huck nickte neugierig. «Ja, was hast du mit ihm angestellt?»
Tom grinste breit: «Nun, ich habe ihn mitten ins Klassenzimmer gesetzt, genau während Mrs. Thatcher ihre Lektion hielt. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen, Huck!»
Huck lachte laut und klopfte ihm auf die Schulter: «Tom, du bist der schlimmste und feinste Kerl, den ich kenne.»