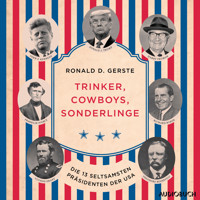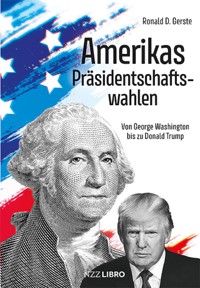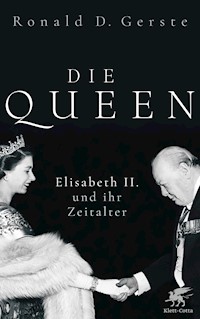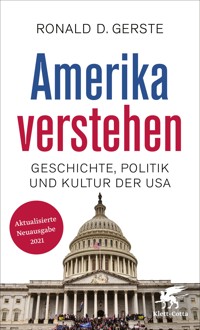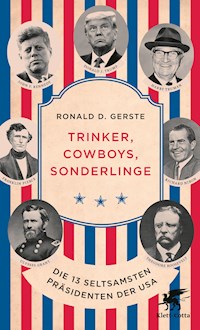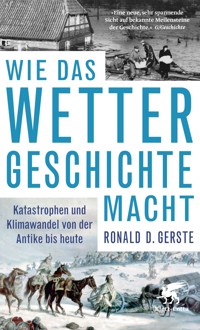10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Pest, Syphilis und Aids haben die Menschen in ihren Epochen bedroht, geprägt und in ihrem Bewusstsein Spuren hinterlassen. Eindrucksvoll zeigt Roland Gerste, wie Seuchen und die Krankheiten der Mächtigen zu Entscheidungsfaktoren in der Geschichte wurden – bis heute. Eine englische Königin, die das Land zusammen mit ihrem Mann, dem spanischen König, wieder katholisch machen will, scheint schwanger zu sein. Doch es ist ein Tumor – wäre sonst Spanien die Supermacht in unserer Welt? Ein deutscher Kaiser gilt als Hoffnungsträger der Liberalen, könnte Deutschland auf den Weg zu einer konstitutionellen, fortschrittlichen Monarchie führen. Doch er hat Kelhlkopfkrebs, ihm sind nur 99 Tage an der Macht vergönnt - wäre durch ihn der Erste Weltkrieg vermeidbar gewesen? Die Krankheiten von Staatenlenkern haben wiederholt in den Ablauf der Geschichte eingegriffen und die Weichen des Weltgeschehens oft auf dramatische Weise in eine andere Richtung gestellt. Doch Krankheiten bestimmen auch das Leben, die Kultur und das Bewusstsein der Völker. Die Pest und Aids, die Cholera und die Syphilis haben ganze Zeitalter geprägt. Der Arzt und Historiker Ronald D. Gerste nimmt den Leser mit auf eine spannende Reise zu den medizinischen Wegmarken unserer Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ronald D. Gerste
Wie Krankheiten Geschichte machen
Von der Antike bis heute
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2019, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung folgender Abbildungen:
Maria I. Tudor © akg-images, Bildnr. AKG14 623
Begräbnisfeier für Tizian, gestorben an der Pest in Venedig,
© akg-images/Erich Lessing, Bildnr. AKG358 877
John F. Kennedy © gettyimages, Bildnr. 615298296
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
ISBN 978-3-608-98418-7
E-Book: ISBN 978-3-608-11584-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Das Deutschland, das nie war
Friedrich
III
.
England und Spanien vereint – beinahe …
Mary Tudors Scheinschwangerschaft
Tod in Babylon
Das frühe Ende Alexanders des Großen
Imperium Romanum
Die Kaiser und der »Cäsarenwahn«
Der Schwarze Tod in Europa
Die Pest
Stupor mundi
Das Staunen der Welt und das Ende der Staufer
Ein tödlicher Schatten auf der Liebe
Die Syphilis
Tod bei Lützen
Gustav
II
. Adolf verliert die Orientierung
Vorsicht, ansteckend!
Die Pocken
Todbringende Heiler
Der Chevalier und der Thomaskantor Johann Sebastian Bach
Frühneuzeitliches Leiden
Die Gicht
Die letzte Reise zweier Brüder
Lawrence und George Washington
Globale Epidemie
Das Sterben in Zeiten der Cholera
Die Saat des Misstrauens
Woodrow Wilson
Tödlich erkältet
Die Grippe
Das verkalkte Gehirn der Weltrevolution
Wladimir Iljitsch Lenin
Staatsmann und Symbolfigur der Weimarer Republik
Friedrich Ebert
Die »ästhetischste« Krankheit
Tuberkulose
Der hypochondrische Patient
Hitler
Todkrank in Jalta
Franklin D. Roosevelt
Paranoia im Kreml und im Weißen Haus
Stalin und Nixon
Gallenkolik und Suezkrise
Premierminister Anthony Eden ist nicht auf der Höhe
Zu viele Hormone, zu wenige oder beides
Die geheime (Patho-)Biografie des John F. Kennedy
Lügenpalast Élysée
François Mitterrand
Drum prüfe auch, wer sich nur kurzfristig bindet
Aids
Die Moskauer Gerontokratie
Breschnew, Andropow und Tschernenko
Epilog
Kaisers Ärmchen, Kanzlers Herz und der gesündeste Präsident aller Zeiten
Anhang
Anmerkungen
Bildnachweis
Für Jacqueline, Chester, Amelia und Victoria
Vorwort
Keinen Sport zu treiben, Whisky und Champagner praktisch täglich zu trinken, die Mahlzeiten alles andere als knapp zu bemessen und dazu noch Zigarren zu rauchen – und auf diese Weise ein erfülltes Leben zu führen und im hohen Alter relativ friedlich diese Welt zu verlassen. Das ist der Traum all jener, die es mit gesundheitlichen Ratschlägen nicht allzu genau nehmen und ihr Dasein gern mit ein wenig Genuss aufheitern. Deren Held ist Winston Churchill, der trotz ungesunder Gewohnheiten das 91. Lebensjahr erreichte: eine der großen Persönlichkeiten der europäischen Geschichte, von Zeitgenossen wie nachfolgenden Generationen vor allem als entschlossener Gegner Hitlers, der Großbritannien ab Frühjahr 1940 mit Krieg überzog, und der Nazityrannei geschätzt.
Nicht alle Akteure der Geschichte hatten wie Churchill eine so robuste Gesundheit und dies auch noch trotz eines Lebenswandels, welcher jeden Arzt und Ernährungsberater an den Rand der Verzweiflung bringen würde. Nicht selten wurden die Handelnden der Geschichte gerade in entscheidenden Momenten von Krankheiten heimgesucht. Und dies mit manchmal schicksalhaften Konsequenzen, wie etwa im Falle Napoleons, der bei der entscheidenden Schlacht von Waterloo nicht auf der Höhe seiner körperlichen und geistigen Kraft war.
Es bestehen wenig Zweifel, dass Krankheiten einen historischen Faktor darstellen. So ist beispielsweise der als »Schwarzer Tod« bezeichnete Zug der Beulenpest um die Mitte des 14. Jahrhunderts, dem rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung zum Opfer fiel, in seinen sozialen und ökonomischen Auswirkungen eingehend untersucht worden. Doch neben diesem Makroeffekt gibt es einen »Impact« von Leid, Krankheit und unzeitigem Tod auf einer Mikroebene: den eines signifikanten politisch Handelnden. Dass sogenannte große Persönlichkeiten den Gang der Ereignisse entscheidend bestimmen, ist zwar bei manchen universitären Historikern eine etwas verpönte Vorstellung. Indes fällt es den meisten Menschen schwer sich vorzustellen, welche Entwicklung Europa im 20. Jahrhundert wohl ohne Hitler genommen hätte. Oder ob es zu einem so friedlichen Ende des Kalten Krieges gekommen wäre, wenn nicht Michail Gorbatschow 1985 in der Sowjetunion den Parteivorsitz angetreten hätte.
Wo viel Macht in den Händen einiger Weniger liegt, können scheinbar banale Faktoren einen signifikanten Einfluss auf den Gang der Geschichte ausüben – so auch eine Erkrankung des Mächtigen. Dies gilt natürlich in ganz besonderem Maße für Autokratien, für die Kaiser und Könige vergangener Zeiten, doch auch moderne Demokratien sind anfällig für solche Verschiebungen – wenn sie viel Macht in die Hände einer Person legen, die plötzlich zu einem Patienten werden kann. Die amerikanische Demokratie ist das vielleicht beste Beispiel. Wir werden mehrere Präsidenten kennenlernen, deren Krankheiten Schicksal spielten.
Die Pathobiografie, die Verknüpfung von Medizin und biografischer Geschichtsschreibung, verleitet fast automatisch zu der spekulativen Frage »Was wäre gewesen, wenn …?«. Doch das Kontrafaktische ist stets ein Aspekt unserer Beschäftigung mit Geschichte. Kaum jemand, der sich mit dem Attentat auf Hitler im Juli 1944 befasst, wird nicht der Versuchung erliegen zu spekulieren, wie die Geschichte verlaufen wäre, hätten Graf Stauffenberg und seine Mitverschwörer Erfolg gehabt. Oder wie unsere Welt aussähe, hätten Ende Mai 1940 die deutschen Panzertruppen nicht unweit Dünkirchens Halt gemacht, sondern das britische Expeditionskorps eingekesselt und Großbritannien – unter einem dann vielleicht nur sehr kurzzeitig regierenden Premierminister Winston Churchill – zum Frieden gezwungen. Zum Grabesfrieden eines Europa unter dem Hakenkreuz.
Krankheiten haben verschiedentlich den Ausschlag für den Verlauf der Geschichte gegeben. Wir werden in diesem Buch einige berühmte Patienten auf ihrem Leidensweg begleiten. Und natürlich wird sich die Frage aufdrängen, welchen Weg Klio, die Göttin der Geschichte, bei einem anderen Verlauf eingeschlagen hätte. Dies gilt ganz besonders für die Patienten in den beiden ersten Kapiteln dieses Buches, die ihre Länder, zwei der entscheidendsten für Europas Schicksal, nur sehr kurz regierten. Doch es gilt auch jenen Krankheiten zu folgen, die in fast gleichem Maße die Mächtigen und die Untertanen bedrohten und ganze Zeitalter prägten, wie die Pest, die Cholera, die Syphilis.
Es sind somit zwei Ebenen, denen wir auf den folgenden Seiten nachgehen werden: den großen Krankheiten und den Krankheiten der Großen, der Entscheidungsträger. Dieses Konzept ähnelt jenem, das ich bei der Untersuchung eines anderen historischen Faktors, dem des Wetters und des Klimas, verfolgt habe. Den Lesern dieses 2015 erschienenen Werkes bin ich sehr dankbar dafür, dass sie ihm zu mehreren Auflagen verholfen haben. Jedoch ist dieses neue Buch kein »Nachfolgemodell«, sondern verfügt über eine viel längere Genese. Denn der Einfluss von Krankheiten auf den Ablauf der Geschichte fasziniert mich bereits seit den schon etwas zurückliegenden Tagen meiner eigenen Jugend. Nach zwei Semestern Humanmedizin begann ich zusätzlich mit dem Studium der Geschichtswissenschaft. Beide Studiengänge brachte ich zu einem Abschluss, wenn auch nicht gerade in der vorgeschriebenen Mindeststudienzeit, sondern, wie man in Britannien mit landestypischem Understatement sagen würde, in due time. Ich hatte das Glück, in beiden Fächern akademische Lehrer zu haben, die mich darin bestärkten, die Gemeinsamkeiten dieser faszinierenden Wissenschaften im Auge zu behalten, das Verbindende von Klio und Äskulap. Dankbar dafür bin ich vor allem Klaus Müller und Dietmar Kienast in der Geschichte, Hans Schadewaldt und Volrad Deneke in der Medizingeschichte sowie Hans Pau, Johannes Grüntzig und Guido Kluxen in meiner schließlich gewählten medizinischen Disziplin, der Augenheilkunde, deren Begeisterung für die Entwicklung dieses Faches in unterschiedlichen Weltregionen ansteckend war. Glücklich kann ich mich seit vielen Jahren schätzen, für meinen Verleger Reinhard Kaden schreiben zu dürfen, in dessen medizinischen Fachzeitschriften ich Artikel über einige der im Folgenden beschriebenen berühmten Patienten und die meisten der ganze Zeitalter prägenden Krankheiten veröffentlichen durfte. Und ein Privileg ist es auch, mit einem gleichermaßen kenntnisreichen wie aufgeschlossenen Lektor wie Christoph Selzer zusammenzuarbeiten und sich von ihm inspirieren zu lassen.
Und wenn es um Dank und Respekt geht, müssen natürlich jene vier Menschen genannt werden, die mir am nächsten stehen und mit den Wunderlichkeiten eines schreibenden Mediziners und eines gern und viel redenden Historikers vertraut sind – und diese mit erstaunlicher Gelassenheit tolerieren: Jacqueline und Chester, Amelia, Victoria. Ihnen ist dieses Buch gewidmet.
Den Leserinnen und Lesern dieses Buches hoffe ich ebenso Anregungen zu geben wie Unterhaltung. Und wo es vielleicht etwas zu spekulativ wird, mag man mir die Neigung, das »Was wäre wenn …« zu reflektieren, verzeihen. Die Geschichte ist das, was sich tatsächlich ereignet hat, manchmal zum Besseren, manchmal vielleicht auch nicht. Und sicher wird der aufmerksame Leser Fehler finden, die kleingedruckte Demütigung jedes Autors. Trost gibt mir der amerikanische Präsident Theodore Roosevelt (er amtierte von 1901 bis 1909) mit seiner durch Selbsterkenntnis geprägten Weisheit: The only man who makes no mistakes is the man who never does anything.
Das Deutschland, das nie war
Friedrich III.
Ein Kaiser im Wartestand – und im Wettlauf mit dem Tod: Friedrich Wilhelm wartet in San Remo auf die Nachricht vom Ableben seines Vaters und den Beginn seiner Regierungszeit, die nur 99 Tage dauern wird.
»Heiserkeit, meine Herren, verhindert mich, Ihnen etwas vorzusingen!« Die zum Empfang im Berliner Schloss angetretenen Herren des Reichstagspräsidiums reagierten pflichtschuldigst mit verhaltenem Schmunzeln auf diese scherzhaft gemeinte Erklärung, vielleicht ergänzt durch Bemerkungen wie »Köstlich, Kaiserliche Hoheit, köstlich …«. Keiner der Anwesenden, am allerwenigsten wohl der Mann, der diese Worte zur Begrüßung mit einem müden Lächeln sprach, konnte ahnen, dass sie den Anfang einer Tragödie markierten – eines menschlichen, aber auch eines politischen Dramas. Man schrieb den 8. März 1887, und der Sprecher war der Thronfolger, Kronprinz Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen, Sohn des Königs von Preußen und ersten deutschen Kaisers, Wilhelms I.
Das Deutsche Kaiserreich war erst 16 Jahre zuvor gegründet worden, im Spiegelsaal von Versailles, auf dem Höhepunkt des siegreichen Krieges von Preußen und anderen deutschen Staaten gegen Frankreich. Auf der machtpolitischen Bühne Europas war es ein Neuling, von den übrigen Großmächten mit Misstrauen (und im Falle Frankreichs mit Revanchegelüsten) betrachtet. Quasi von einem Moment zum anderen war im Zentrum des Kontinents ein Gigant entstanden: Das Deutsche Reich wies ein enormes demografisches wie ökonomisches Wachstum auf und schickte sich an, die führende Industrienation Europas zu werden. Seine Armee, im Kern die preußische, galt nach drei kurzen und mit höchster Effizienz siegreich geführten Waffengängen – 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich, 1870/71 gegen Frankreich – als ein Machtinstrument sondergleichen. Die politischen Strukturen des Newcomers waren nicht dazu angetan, bei den beiden demokratisch konstituierten Großmächten (wobei »demokratisch« im 19. Jahrhundert nicht die Bedeutung hat wie in unserer Zeit; so gab es beispielsweise selbst im weithin als fortschrittlich gepriesenen Großbritannien kein Wahlrecht für Frauen), der französischen Republik und der konstitutionellen Monarchie England Vertrauen zu stiften. An der Staatsspitze Deutschlands stand die preußische Hohenzollernmonarchie; der Lenker und Gestalter der deutschen Politik war der konservative Junker Otto von Bismarck, der als Reichskanzler gerade in den 1880er Jahren einen energischen Kampf gegen »Reichsfeinde« führte, nach seiner Einschätzung in erster Linie die Sozialdemokraten und die Katholiken.
Für viele politisch engagierte Bürger des Reiches und für seine fortschrittlichen, an einer Erweiterung demokratischer Grundrechte interessierten Kräfte war der Mann, dessen Heiserkeit an jenem Frühjahrstag schnell wieder vergessen war, ein Hoffnungsträger. Friedrich Wilhelm galt ihnen und seither vielen, wenngleich nicht allen Historikern und Biografen als »Deutschlands liberale Hoffnung«.[1] In diesen Kreisen galt es als ausgemacht, dass Friedrich Wilhelm nach Ablauf der Bismarck-Ära das Steuer ergreifen und einen neuen Kurs fahren, eine Abkehr von Restriktion und Autoritarismus vornehmen würde. Kaum ein Dokument drückt die Erwartung oppositioneller Kreise so deutlich aus wie das Jahre später mit verklärter Erinnerung von Anton von Werner geschaffene Gemälde »Kaiser Friedrich III. als Kronprinz auf dem Hofball 1878«, auf dem dieser mit führenden liberalen Politikern eine abseits des Treibens stehende Gruppe bildet – Männer, denen die Zukunft zu gehören schien.
Der Kronprinz war als Anhänger des britischen Systems bekannt, eines soliden Parlamentarismus mit checks and balances und einem über den Parteien thronenden Monarchen. Die Neigung des preußisch-deutschen Kronprinzen, der im Gegensatz zu den meisten seiner Landsleute (und seinen Familienmitgliedern) fließend Englisch sprach, zum weltumspannenden British Empire war nicht nur von seiner bei zahlreichen Besuchen erworbenen Vertrautheit mit den britischen Verhältnissen geprägt, sondern hatte auch einen ganz persönlichen Grund: Seine Frau Victoria kam aus England und war die Tochter der gleichnamigen englischen Königin, die der ganzen Epoche den Namen geben sollte: das Viktorianische Zeitalter. Im Gegensatz zu anderen Töchtern des europäischen Hochadels war Prinzessin Victoria, die Friedrich Wilhelm als Achtjährige bei einem Englandbesuch kennengelernt hatte und die bei ihrer Hochzeit mit dem preußischen Prinzen 17 Jahre alt war, kein unpolitisches Wesen. Ihr Vater, Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha, hatte für eine exzellente Erziehung seiner Erstgeborenen gesorgt und ihr in vielen Gesprächen die Vorzüge seiner Wahlheimat Großbritannien deutlich gemacht. Als die Vermählung mit dem neun Jahre älteren Friedrich Wilhelm anstand, beschwor Albert seine Tochter und seinen künftigen Schwiegersohn, die politische Zukunft Deutschlands (das noch nicht unter preußischer Führung geeint war) läge allein in einer dem britischen Vorbild ähnlichen konstitutionellen Monarchie und in der Schaffung und Wahrung demokratischer Grundrechte. Victoria vermisste ihr geliebtes Heimatland nach dem Umzug nach Berlin wohl mehr als je zuvor: Die Aufnahme durch die Hofkreise und durch reaktionäre Politiker wie Bismarck – ihr lebenslanger Intimfeind – war kalt bis feindselig. Für die einflussreichen Kreise sollte sie stets »die Ausländerin«, »die Engländerin« bleiben – selbst für ihren ältesten Sohn, den späteren Kaiser Wilhelm II., der das deutsche Kaiserreich in den Untergang führen sollte. Eine unverbrüchliche Stütze hatte Victoria, im Familienkreis Vicky genannt, allerdings in Berlin: ihren Mann. Friedrich Wilhelm war seiner Frau in einem so hohen Maße ergeben, dass seine vermeintlich submissive Haltung gegenüber »Frauchen«, wie er Vicky nannte, Anlass für hinter vorgehaltener Hand geäußerten Spott bei Hofe war. Für zahlreiche Parlamentarier hingegen, wie für den Wortführer der Liberalen, den Arzt Rudolf Virchow, war diese Anhänglichkeit an die englische Patriotin Grund zur Hoffnung. Es ist eine bemerkenswerte Facette der sich anbahnenden Tragödie, dass gerade Virchow, eine der großen Persönlichkeiten in einer goldenen Epoche medizinischen Fortschritts, in dem Drama um Friedrich Wilhelm eine besonders armselige Figur abgeben sollte.
Der heisere Mann, auf dem so viele Erwartungen ruhten, war indes nicht mehr jene geradezu heroische Gestalt aus den drei Kriegen. Groß gewachsen, mit einem vollen, beinahe blonden Bart und blauen Augen, verkörperte er für viele seiner Landsleute das männliche Herrscherideal der Epoche, wurde mit Siegfried und anderen deutschen Mythengestalten verglichen. Doch der immer noch volle Bart war von Grau durchzogen, und die Herren des Reichstagspräsidiums mochten aus den Zügen des Kronprinzen eine gewisse Müdigkeit, sogar Frustration herauslesen. Denn seine Existenz schien für Friedrich Wilhelm allein darin zu bestehen: zu warten. In diesem Frühjahr stand der Kronprinz im 56. Lebensjahr und wurde an die Langlebigkeit erinnert, die in Monarchien zum Hemmschuh des Wandels werden kann: Seine Schwiegermutter Victoria stand vor dem goldenen Thronjubiläum, und – für Friedrich Wilhelm weit schlimmer – sein Vater, Kaiser Wilhelm I., würde in wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag begehen. Der alte Kaiser, der fünf Attentatsversuche überlebt hatte, schien jede biologische Gesetzmäßigkeit Lügen strafen zu wollen.
Die scheinbar rüstige Gesundheit des Vaters erschien Friedrich Wilhelm schon bald wie bittere Ironie. Denn seit einigen Monaten ließ ihn die eigene Gesundheit im Stich. Im Jahr zuvor, 1886, hatte er eine Maserninfektion überstanden. Danach erschien der Kronprinz manchen Hofbeobachtern nicht mehr von alter Tatkraft zu sein. Im Januar 1887 begannen die Probleme mit immer wiederkehrender Heiserkeit. Der Kronprinz und seine Umgebung zogen Professor Karl Gerhardt von der Charité zu Rate. Der Leiter der medizinischen Klinik – eher Internist als Spezialist für Halserkrankungen – mag etwas Ernstes vermutet haben: »Das Uebel soll unter Erkältungserscheinungen begonnen haben und galt auch im Anfange als katarrhalische Heiserkeit. Jedoch waren in den nächsten Monaten Husten und andere katarrhalische Erscheinungen nicht vorhanden; nur trockene Heiserkeit, und die verschiedenen gegen Katarrhe sonst wirksamen Arzneimittel und Einathmungen waren gänzlich erfolglos geblieben.«[2] Der Kronprinz rauchte leidenschaftlich gern Pfeife und Zigarre – die karzinogene Wirkung der in Tabakprodukten enthaltenen Gifte wurde allerdings erst im 20. Jahrhundert entdeckt.
Am 6. März – zwei Tage vor dem Empfang für das Reichstagspräsidium – nahm Gerhardt erstmals eine Kehlkopfspiegelung vor, eine damals noch neue Untersuchungsmethode. Er beschrieb den Befund mit den Worten: »Sah man am Rande des linken Stimmbandes zwischen Stimmfortsatz und Stimmbandmitte, ersterem näher, eine blasse, zungen- oder lappenartige, anscheinend etwas unebene Vorragung. Die Länge derselben betrug etwa 4, die Höhe 2 mm. Die Diagnose wurde gestellt auf pulpöse Verdickung des linken Stimmbandes.«[3] In den nächsten Wochen unternahmen die Ärzte mehrere Versuche, den vermeintlichen Polypen mit einer Drahtschlinge, dann mit einer Version, die zum Glühen gebracht werden konnte, abzutragen. Die Behandlungsversuche müssen eine Tortur für den Patienten gewesen sein, auch wenn es erste Möglichkeiten einer lokalen Betäubung mit Kokain gab – eine Methode, die erst drei Jahre zuvor von dem Augenarzt Carl Koller in Wien entdeckt worden war. Nicht nur Frustration über den hartnäckigen Befund, sondern auch eine Spur der Hoffnung klingt bei dem klinischen Bericht von Gerhardt und seinen Kollegen an: »Am 14. abends [März 1887] wurde zum ersten Male der glühende Platindraht angewandt. Am 16. wurde in ganzer Ausdehnung, vorzugsweise in der Mitte die Geschwulst angeglüht. Diesmal wenig Schmerz. Vom 18. bis 26. musste die Behandlung ruhen wegen der Geburtstagsfeier Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm. Nun wurden am 26., 27., 29. und von da an bis zum 07. April täglich mit dem Glühdrahte Zerstörungen der Neubildung vorgenommen, Alles, was vorragte, weggebrannt und am 07. noch der Stimmbandrand mit einem flachen Brenner überfahren und geglättet.«[4]
Friedrich Wilhelm und seine Frau begaben sich nach dieser anstrengenden Behandlung in den bevorzugten Kurort der Hohenzollern, nach Bad Ems[5], wo der Kronprinz vermeintlich entzündungshemmende Inhalationen vornahm. Als er Mitte Mai in die Hauptstadt zurückkehrte, zeigte sich bald, dass von einer Heilung keine Rede sein konnte: Nicht nur war das Geschwür wieder nachgewachsen, seine gerötete Oberfläche sah alles andere als gutartig aus. Am 18. Mai erörterte ein Ärztekonsil, zu dem Professor Ernst von Bergmann, einer der führenden deutschen Chirurgen der Epoche gehörte, die mögliche Natur des Befundes. Eine entzündliche Genese – zum Beispiel aufgrund einer Tuberkulose oder einer Syphilis – konnte dabei aufgrund der Symptome (der Patient hatte kein Fieber, keinen Husten, keine Lymphknotenschwellung) ausgeschlossen werden. Erstmals machte nun das Wort »Krebs« die Runde.
Zu den Maßnahmen, die man mit dem Kronprinzen besprach, gehörte eine recht radikale Operation, die Spaltung des Kehlkopfes und die Entfernung der Geschwulst. Die Erfolgschancen wurden als relativ gut beurteilt, doch konnte nicht davon ausgegangen werden, dass nach einem solchen Eingriff der künftige deutsche Kaiser bei voller Stimme sein würde. Auch eine totale Entfernung des Kehlkopfes wurde nicht ausgeschlossen – ein lebensgefährlicher Eingriff, der nur selten gelang. Bergmann begann vorsichtshalber, die Operation an einer Leiche zu üben. Man beschloss, einen Arzt hinzuzuziehen, der auf dem sich entwickelnden Gebiet der Laryngologie, der Lehre von den Krankheiten des Kehlkopfes, als führender Experte galt. Diese Entscheidung fand die enthusiastische Unterstützung der Victorias: Die Koryphäe nämlich war ein Landsmann der Kronprinzessin, der englische Arzt Morell Mackenzie. Der Brite hatte ein auch in Deutschland beachtetes Lehrbuch über Kehlkopfkrankheiten geschrieben; er war unter britischen Ärzten geachtet, wenn auch nicht unumstritten: Sein waches Auge für die finanziellen Aspekte ärztlichen Wirkens und eine gehörige Portion Selbstgefälligkeit fanden manche seiner Kollegen ehrenrührig.
Am 20. Mai nahm Mackenzie eine erste Untersuchung vor und vermeinte, Hinweise auf eine eher gutartige Veränderung zu erkennen. Es war der Beginn einer zunehmend schwierigen Kooperation mit den deutschen Ärzten und schließlich einer gegenseitigen feindseligen Blockade. Die deutschen Ärzte waren von der Bösartigkeit des Befundes überzeugt, Mackenzie deutete in seinen meist sibyllinischen Statements durchweg Benignität an. Wundert es da, welcher Seite die Kronprinzessin und damit auch der Patient, der stets auf seine Frau hörte, mehr Glauben schenkten? Mackenzie verkörperte Hoffnung; von Bergmann, Gerhardt und die anderen deutschen Ärzte hingegen schienen für Vicky Sendboten einer düsteren Zukunft: mit einem vielleicht stummen und siechen, vielleicht aber auch toten Friedrich Wilhelm.
Tatsächlich stand die Methodik des klinischen Vorgehens von Morell Mackenzie in Einklang mit heutigen diagnostischen Prinzipien, wie der österreichische Pathologe Professor Roland Sedivy jüngst dargelegt hat: »Mackenzie [war] seiner Zeit sehr voraus und vertrat damals schon einen modernen Standpunkt in der Tumordiagnostik, denn die … krebsige Natur müsse durch mikroskopische Untersuchung bewiesen werden ….« Seiner Auffassung gemäß führte Mackenzie zur Klärung der Art der Veränderung am 21.5.1887 mit einer Kehlkopfzange (Forceps laryngis) eine Biopsie durch, die mehrere Gewebeteile zutage brachte, welche an Rudolf Virchow (1821–1902) in Berlin übersandt wurden.[6]
Virchows Diagnostik und sein Verhalten in den kommenden Monaten sind ein wenig rühmliches Kapitel in der Vita dieses großen Wissenschaftlers. Dreimal wurden Virchow Proben des Gewächses zugesandt, dreimal vermochte er keinen Hinweis auf Malignität zu finden. Selbst ein in der Endphase von Friedrich Wilhelms Leben von dem Schwerkranken ausgehustetes Gewebestück – das vierte – zeigte ihm unter dem Mikroskop keine Anzeichen von Krebs. Seine Diagnosen fokussierten auf warzenähnliche Veränderungen. Vermutungen sind laut geworden, dass Virchows politische Einstellung – er war einer der profiliertesten Kritiker Bismarcks, ohne auch nur annähernd über dessen Sprachgeschick, Schlagfertigkeit und Charisma zu verfügen – sein Urteilsvermögen getrübt hat, dass auch er – ähnlich wie Victoria – nicht sehen wollte, welches Schicksal der Hoffnung der liberalen Kräfte drohte. Doch bei Gewebeuntersuchungen ist es nicht ungewöhnlich, dass die jeweilige Probe – die Biopsie – keine malignen Zellen enthält, auch wenn sie aus einem von Krebs befallenen Organ entnommen wurde. Roland Sedivy nimmt den Begründer der Zellularpathologie aus der Sicht eines heutigen Experten denn auch in Schutz: »Sehr modern und verantwortungsbewusst hat Virchow allerdings auf die potenzielle Fehlerhaftigkeit hingewiesen. Auch uns modernen Pathologen ist sehr bewusst, dass aus Proben, die für den Tumor nicht wirklich repräsentativ sind, ein falscher Schluss gezogen werden kann. Virchow schreibt: »[Ob ein] … solches Urteil in Bezug auf die gesamte Erkrankung berechtigt sei, lässt sich aus den exstirpierten Stücken mit Sicherheit nicht ersehen.«[7]
Im Juni 1887 reiste Friedrich Wilhelm zu den Feierlichkeiten des goldenen Thronjubiläums seiner Schwiegermutter nach England und nahm an der großen Parade zu Ehren von Queen Victoria teil, die ein halbes Jahrhundert zuvor als 18-Jährige auf den Thron gekommen war. Zwar sollen einige Besucherinnen der Parade beim Anblick des deutschen Kronprinzen hoch zu Ross an Lohengrin erinnert worden sein, doch ein Mediziner im Publikum hatte einen schärferen Blick: »Das Gesicht des Kronprinzen wirkte weiß, fast schon gelblichweiß. Bewegungslos, wie er auf dem Pferd saß, glich er eher einer weißen Statue als einem lebenden Menschen. Seine Augen lagen tief, und mir war, als drückten sie eher das ahnungsvolle Gefühl eines schmerzlichen Abschieds als ein stolzes Bewusstsein der Bewunderung aus, die ihm entgegenströmte.«[8] Mackenzie nahm in diesen Tagen zwei weitere Abtragungen mit der Schlinge vor und Friedrich Wilhelm war so mit der Betreuung zufrieden, dass er seiner Schwiegermutter die Nobilitierung empfahl – sein seelisches Wohlbefinden rührte auch daher, dass Mackenzie, wohl wider besseres Wissen, dem Patienten gegenüber das Leiden als geheilt bezeichnete. So wurde aus dem Pionier der Laryngologie Sir Morell Mackenzie – was seiner Beliebtheit bei der Kollegenschaft in London wenig zuträglich war.
Der Kronprinz und seine Frau unternahmen eine mehrmonatige Erholungsreise mit Tirol, Venedig und schließlich San Remo als Stationen, jedoch ohne Erfolg. Im November musste man erkennen, dass der inzwischen wiederholt abgetragene Tumor erneut nachgewachsen war, größer und nunmehr bei der Laryngoskopie auch schrecklicher aussehend als je zuvor. Plötzlich änderte auch Mackenzie seine Diagnose: »Now it looks like a cancer.«[9] Restlos offen gegenüber dem Patienten waren die Mediziner nicht; Friedrich Wilhelm notierte am 11. November: »Dr. von Schrötter an der Spitze … unter Frauchens Beisein teilte deren Ansicht dahin mit …. vorliegender Fall ein ernster sei …. Ich fragte ob er es Krebs nenne, worauf er erwiderte: wenigstens mit demselben verwandt …«[10]
Den Ärzten war nunmehr klar, dass einzig die gefährliche Totaloperation noch das Überleben des Patienten sichern konnte, der indes ablehnte: »… schon nach wenigen Minuten kam die schriftliche Willensäußerung Seiner Kaiserlichen Hoheit zu uns zurück, in die große Operation nicht zu willigen und nur seinerzeit den Luftröhrenschnitt ausführen zu lassen.«[11] Der Luftröhrenschnitt, die Tracheotomie, wurde unumgänglich, da das Tumorwachstum so fortgeschritten war, dass dem Patienten das Atmen schwerfiel. Zu dieser Intervention kam es am 9. Februar 1888, nachdem »… das Athmungsgeräusch so zugenommen [hatte], dass man bei Tische fast jeden Athemzug des Kronprinzen an den entgegengesetzten Enden der Tafel hörte«.[12]
Der Kronprinz war damit dem Erstickungstod entronnen, doch seine Stimme würde er nie wieder erheben können; von nun an konnte Friedrich Wilhelm nur noch per handgeschriebenem Zettel mit seinem Umfeld kommunizieren. Der Eingriff ging den Ärzten relativ leicht von der Hand und mag als Zeichen dafür stehen, in welchem Umbruch sich die Medizin in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts befand. Grandiose Fortschritte waren in jüngerer Vergangenheit erzielt worden: die Einführung zunächst der Allgemeinnarkose ab 1846 – vielleicht die Sternstunde der Menschheit schlechthin – und schließlich der Lokalanästhesie kurz vor Friedrich Wilhelms Leidenszeit, die Identifizierung von Krankheitserregern unter den Mikroskopen von Robert Koch, von Louis Pasteur. Gegen zähen Widerstand wurden strengere Hygienevorschriften und im Klinikbetrieb die Antisepsis, für die vor allem der schottische Chirurg Joseph Lister verantwortlich war, durchgesetzt. Doch während die Menschen in Deutschland und Europa mit Sorge die Berichte über den Gesundheitszustand des nächsten deutschen Kaisers und damit eines der potenziell mächtigsten Männer Europas in den Gazetten lasen, hing über ihrem Alltagsleben stets das Damoklesschwert schwerer, plötzlich ausbrechender und ungeachtet allen Fortschritts unheilbarer Erkrankungen. Und diese Gefahr prägte das Bewusstsein der Menschen im von so viel technischem Fortschritt gekennzeichneten 19. Jahrhundert ebenso wie es die Pest, die Pocken, die Syphilis in früheren Epochen getan hatten. In Lübeck lebte in jenem Jahr 1888, das als Dreikaiserjahr in die deutsche Geschichte eingehen sollte, ein 13-jähriger Junge namens Thomas Mann. Er würde den beiden großen Krankheiten des 19. Jahrhunderts unvergleichliche literarische Denkmäler setzen: der Tuberkulose im Zauberberg, der Cholera im Tod in Venedig. Beide Infektionen werden uns bei der Betrachtung des Einflusses von Krankheiten auf die Geschichte – jenen, die weite Teile der Bevölkerung heimsuchten, und jenen, die den Großen und Mächtigen das Zepter aus der Hand nahmen – noch begegnen.
Dann kam die Nachricht in San Remo an, auf die Friedrich Wilhelm lange, zu lange gewartet hatte und die nun zu spät kam: Am 9. März 1888 war sein greiser Vater endlich heimgerufen worden. Der Kranke würde als Friedrich III. den Thron besteigen. Franz Herre dürfte die leicht resignative Gefühlslage des stummen Kaisers richtig erfasst haben: »Der vom Tode Gezeichnete wusste, dass seine Tage gezählt waren. Doch er zeigte sich dankbar, dass ihm noch ein wenig Macht und ein Hauch von Herrlichkeit vergönnt wurde.«[13]
Durch einen Schneesturm bahnte sich sein Sonderzug den Weg nach Berlin. Reichskanzler Bismarck empfing ihn höflich und weitgehend ohne erkennbare Anteilnahme; in der machtpolitischen Fantasie des Staatsmannes dürften die widerstreitenden Szenarien miteinander gerungen haben. Was war wohl besser – oder weniger katastrophal – für ihn, für seine Politik und für Deutschland: die wahrscheinlich kurze Herrschaft Friedrichs III. oder eine sehr viel längere des sprunghaften neuen Kronprinzen Wilhelm, der erst 29 Jahre alt war und dem sich die Hofkreise wie einer aufgehenden Sonne schnell zuwandten ? Friedrich III. und Kaiserin Victoria – dies war nun ihr Titel – zogen ins Schloss Charlottenburg ein. Wenn es das Wetter und sein Zustand erlaubten, machten sie täglich kurze Ausfahrten in einer Kutsche, von der Berliner Bevölkerung mit einer Mischung aus Sympathie, Neugier und vor allem Mitleid betrachtet.
Der Bart des Monarchen versteckte die silberne Kanüle der Tracheotomie vor den Blicken der Öffentlichkeit. Die behandelnden Ärzte hingegen erlebten die schrecklichen Manifestationen der Krankheit, reinigten die Kanüle von übelriechendem Ausfluss. Voller Frustration darüber, dass er bereits ein Dreivierteljahr zuvor die düstere Prognose gestellt hatte, aber an der von Mackenzie und dessen Gönnerin Victoria um den Patienten errichteten Mauer der Realitätsverweigerung gescheitert war, rief Ernst von Bergmann kurz vor der Thronbesteigung seines Patienten aus: »Jetzt kann jeder sehen, dass das, was aus dem Munde des Kronprinzen fließt, Krebsjauche ist!«
Die Regierung Friedrichs III. dauerte genau 99 Tage. Der Kaiser starb am 15. Juni 1888. Die Obduktion, von Virchow geleitet, zeigte allzu deutlich, was der hochgeehrte Wissenschaftler unter seinem Mikroskop nicht erkannt hatte oder hatte erkennen wollen. Der Krebs hatte den Kehlkopf völlig zerstört, Teile der Luftröhre und der Lunge waren, wie es im Obduktionsbericht hieß, brandig geworden und zeigten eine Abszessbildung. Mackenzie, der sich sein ärztliches Wirken mit der astronomischen Summe von fast einer Viertelmillion Goldmark hatte belohnen lassen, veröffentlichte noch im selben Jahr ein Buch über die Krankheit des illustren, von ihm als Frederick the Noble titulierten Patienten. Er überlebte diesen um nur vier Jahre und starb 1892 mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt.
Zu Grabe getragen wurde mit Friedrich III. auch die Vision eines ganz anderen Deutschland. Ob der Verstorbene die Hoffnungen der Liberalen erfüllt hätte oder in den Machtstrukturen eines nur begrenzt demokratischen, obrigkeitszentrierten Staatswesen gefangen gewesen wäre, darüber kann nur spekuliert werden. Der Historiker Volker Ullrich, ein exzellenter Kenner der Epoche (und Autor einer herausragenden Hitler-Biografie) zweifelt nach Untersuchung der Tagebücher des Kronprinzen, dass Friedrich III. einen wirklich radikalen Wandel zu vollziehen in der Lage – und willens – gewesen wäre: »Die Sympathien des Kronprinzen für die liberalen Ideen seiner Frau gingen keineswegs so weit, dass er etwa einen Systemwechsel hin zum Parlamentarismus angestrebt hätte. Obwohl er Kontakte zu freisinnigen Politikern pflegte, blieb er dem militärischen Milieu am preußischen Königshof stark verhaftet.«[14]
Und dennoch: Wir wissen nicht, wie dieses kontrafaktische Deutschland ausgesehen hätte. Es wäre eine deutsche Nation gewesen, der Friedrich III. – eine normale Gesundheit und die zur Langlebigkeit prädisponierenden Gene seines Vaters vorausgesetzt – von 1888 bis vielleicht 1910, bei Erreichen eines Alters wie sein Vater gar bis 1920 – vorgestanden hätte. Angesichts des Einflusses seiner Frau auf ihn ist eine weitere Kanzlerschaft Bismarcks in diesem Szenario sehr unwahrscheinlich. Wir wissen indes, wie das reale Deutschland von 1888 bis 1918 unter seinem Sohn Wilhelm II. aussah. Führend in Industrie und Wissenschaft, aber politisch mit einem sprunghaften, oft irrationalen Kaiser und einer Abfolge schwacher und unfähiger Kanzler war es ein Unruheherd im europäischen Konzert der Mächte. Mit dem wilhelminischen Deutschland verbinden wir »schimmernde Wehr« und Säbelrasseln, maritimes Wettrüsten gegen England und als Folge dessen Abdriften ins Lager der gegenüber Deutschland immanent feindlichen Mächte Frankreich und Russland. Wilhelm II. stand für Großmäuligkeit und Chauvinismus und letztlich für eine entscheidende Rolle – als Handelnder, aber auch als Getriebener – auf dem Weg in die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, das unsägliche Massensterben des Ersten Weltkrieges. Angesichts dieser Bilanz kann man sich fast sicher sein: Unter Friedrich III. wäre es – auf welche Art auch immer – anders gekommen. Und besser.
England und Spanien vereint – beinahe …
Mary Tudors Scheinschwangerschaft
Eine Königin, deren Porträt keine Gnade und Huld ausstrahlt und stattdessen einen Eindruck gibt, warum Mary Tudor als »Bloody Mary« in die Geschichte eingegangen ist.
Die Königin war nicht als Ausbund von Frohsinn und guter Laune bekannt, doch Beobachter am Hofe konnten nicht umhin, eine gewissen Erheiterung auf den sonst so strengen Gesichtszügen der Queen auszumachen. Bald machte die Neuigkeit im Umfeld des St. James Palace und dann auch in London die Runde: Her Majesty is with child! Die Kunde von der Schwangerschaft der 38-jährigen Königin wurde umgehend von den in der Hauptstadt Englands ansässigen Diplomaten an ihre Regierungen übermittelt, so auch in einer Nachricht an Kaiser Karl V., der über das Deutsche Reich und über Spanien sowie dessen Besitzungen in der neuentdeckten Welt hinter dem westlichen Horizont herrschte: »Die Königin ist ganz eindeutig schwanger, denn sie spürt das Baby. Es gibt weitere und typische Anzeichen dafür, so auch der Zustand ihrer Brüste.«[1] Den Adressaten, in dessen Reich nach einem damals aufkommenden geflügelten Wort die Sonne nicht unterging, dürfte diese Neuigkeit in hohem Maße erfreut haben. Denn die englische Königin war seit einigen Monaten, seit Juli 1554, mit seinem Sohn, dem Prinzen Philipp, verheiratet.
Sowohl die Hochzeit in jenem Sommer als nun auch die schnell an allen europäischen Höfen die Runde machende Nachricht von der Schwangerschaft der nach damaligem Empfinden schon sehr reifen Königin lösten je nach politischem – präziser: religionspolitischem – Standpunkt Freude oder Sorge aus. Im zweiten Fall war es oft buchstäblich Sorge um das eigene Überleben. Denn Queen Mary I. hatte sich zum Ziel gesetzt, England wieder in den Schoß der katholischen Kirche zurückzuführen, und sie scheute dabei auch vor grausamen Mitteln nicht zurück. Man erinnert sich an ihre Herrschaft als eine Zeit, in der die Scheiterhaufen brannten. Auf diese grausige Art ließ sie Ketzer hinrichten – und ein Ketzer war für sie faktisch jeder Protestant. Die Geschichte würde dieser Königin später (wenn auch noch nicht zu ihren Lebzeiten) den Beinamen Bloody Mary geben – ein vernichtendes Verdikt, das auch nicht durch die Existenz des gleichnamigen Cocktails gemildert wird.
Man muss einen Moment innehalten, um sich die Konsequenzen vorzustellen, die sich in scheinbar so ferner Vergangenheit anbahnten und die dennoch unsere heutige Welt geprägt hätten – wenn die Geschichte so verlaufen wäre, wie es sich für die Zeitgenossen zu jener Jahreswende 1554/1555 andeutete. Der Mann, der bald über das mächtigste Reich der Welt gebieten würde (Kaiser Karl V. dankte 1555 ab, und der Gatte Marys wurde damit König Philipp II. von Spanien), hatte durch seine Heirat eine Union mit der aufstrebenden maritimen Macht England gebildet. Philipp und Mary waren überzeugte und angesichts des Glaubenseifers der Epoche geradezu fanatische Katholiken. Marys Vater Heinrich VIII. hatte Englands Gläubige aus dem Griff Roms herausgelöst und die Church of England mit ihm (und seinen Nachfolgern) als Oberhaupt gegründet. Diesen Vorgang wollte Mary umkehren und England zu einer Bastion des Katholizismus machen. Wie würde es angesichts dieser Machtkonstellation um den gerade entstandenen Protestantismus auf dem europäischen Festland bestellt sein? Martin Luther war gerade etwas mehr als zehn Jahre tot, der neue Glaube selbst dort, wo er Wurzeln geschlagen hatte, kaum etabliert: im deutschsprachigen Zentrum des Kontinents, in den unter spanischer Herrschaft stehenden Niederlanden (die einen fast 80 Jahre währenden Unabhängigkeitskrieg gegen Philipp und seine Nachfolger führten) und in Skandinavien. Angesichts der Machtkonzentration und der Tatsache, dass der einzige ernst zu nehmende Rivale der Achse Spanien-England aus dynastischen, nicht religiösen Gründen die ebenfalls katholische französische Monarchie des Hauses Valois war, fällt es nicht schwer sich vorzustellen, dass es zu einem roll-back gekommen wäre – zu einer zweifellos blutigen Rekatholisierung mit dem Schwert der spanischen Heere und dem Feuer (den Scheiterhaufen) und der Folter der Inquisition. Das Europa der Nationalstaaten, das sich unter diesen Umständen im 16. und 17. Jahrhundert gebildet hätte, wäre gänzlich anders gewesen als das faktische, das Grundlage unserer realen Geschichte und Gegenwart ist. Freiheitliche Geistesströmungen und vor allem die Aufklärung, die sogenannte Morgenröte unserer Gegenwart im 18. Jahrhundert, hätten kaum oder mit großer Verzögerung erblühen können. Es bleibt Spekulation, doch unsere Gegenwart in Europa wäre eine weniger liberale, eine weniger weltoffene. Und welche Supermacht würde eine auf dieser Basis entstandene Moderne prägen? Angesichts der Ressourcen und des Potenzials der für Mary, Philipp und ihre Zeitgenossen wahrhaft neuen Welt, des fernen Amerika, würde dieses wohl auch in diesem kontrafaktischen Geschichtsverlauf eine führende Rolle einnehmen. Vielleicht würden die Estados Unidos gar als eine Art Gralshüter über Europa wachen und Reformen der einst geschaffenen Ordnung bremsen oder verhindern? Es ist eine ganz andere Welt und doch eine, die möglich war. Die Störungen der Funktion des menschlichen Körpers, eines menschlichen Körpers, die Pathologie anstelle der Physiologie, ließ damals die Waagschale des Schicksals in eine andere Richtung neigen. Die Biografie und vor allem die Pathobiografie der Mary Tudor ist eines der prägnantesten Beispiele für das Thema dieses Buches, der Änderung und Beeinflussung historischer Abläufe durch Krankheiten – solcher, die weite Bevölkerungsschichten heimsuchten, und jener wie in diesem Fall, die einen Entscheidungsträger, eine Entscheidungsträgerin, vom scheinbar vorgezeichneten Kurs abbrachten. Und damit ganze Völker.
Bevor wir uns der Körperlichkeit der Mary Tudor zuwenden ist es sinnvoll, einen Blick auf ihre Dynastie zu werfen. Denn die Tudors faszinieren auch nach fünf Jahrhunderten; kaum ein anderes Herrschergeschlecht dürfte so viele Publikationen, Verfilmungen, Theaterstücke und andere Inszenierungen ihres Wirkens nach sich gezogen haben. In der Gegenwart sind sie geradezu zu Popstars geworden, seit die TV-Serie mit Jonathan Rhys-Myers als Heinrich VIII. und Natalie Dormer als Anne Boleyn Zuschauer auf fünf Kontinenten in Bann geschlagen hat. In England sind die Schauplätze aus der Tudorzeit Touristenmagneten der Extraklasse, von Hampton Court bis zum Tower, der über gut ein Jahrtausend hinweg eine besondere historische Bedeutung besaß. Für viele Besucher indes ist er vor allem der Ort, an dem zwei der Ehefrauen Heinrichs VIII. ihren Kopf auf den chopping-block haben legen müssen, auf dem ihr Haupt vom Körper getrennt wurde. Die Auswahl an entertainment dinners ist vor allem in London groß, bei denen ein als Heinrich VIII. verkleideter und meist stattlicher Schauspieler den Touristen mit seiner Showeinlage das fade Essen aus der Großküche vergessen lässt. Die Tudors regierten nur 118 Jahre und brachten lediglich fünf Herrschergestalten hervor, doch dürfte der Buchautor C. J. Meyer, der eine einbändige Geschichte ihrer Epoche verfasst hat, recht haben mit seiner Einschätzung, dass aus ihnen der berühmteste König und die berühmteste Königin in der Geschichte nicht nur Englands, sondern Europas und wahrscheinlich der Welt hervorgegangen ist.[2]
Es war eine Epoche der Gewalt und des Terrors, der Rebellion und der Kriege, in der nicht nur das Leben der einfachen Bevölkerung, sondern oft auch das jener, die gerade noch mächtig waren, wenig wert war. Die Günstlinge und Berater, die noch kurz zuvor die Gunst des Herrschers oder der Herrscherin hatten, dann aber in Ungnade fielen, gingen mit erschreckender Regelmäßigkeit den Weg in die Folterkammer, zum Richtblock oder zum Scheiterhaufen. Blutvergießen markiert auch den auf den Tag genau zu datierenden Beginn der Tudorzeit: Zu dem Blut, das am 22. August 1485 auf dem Schlachtfeld von Bosworth floss, gehörte auch das Blut eines Königs. Auf jener Walstatt endete das lange Zeitalter der Rosenkriege zwischen den verfeindeten Häusern von Lancaster und York, als der nicht sehr geradlinig mit dem Lancastergeschlecht verwandte Henry Tudor nach seiner Rückkehr aus jahrelangem Exil in Frankreich mit seinem Heer gegen das des Königs Richard III. obsiegte. Noch auf dem Schlachtfeld und im Angesicht des geschändeten Leichnams Richards wurde Henry zum neuen König von England ausgerufen: Als Heinrich VII. war er der Gründer der Tudor-Dynastie. Seine 24 Regierungsjahre waren von Vorsicht geprägt, der Machterhalt war oberstes politisches Ziel des neuen Herrschers. Dass er Elizabeth von York, die Nichte des besiegten Königs, heiratete, wurde als ein Zeichen der Versöhnung gesehen. Auch sie ging durch eine Fernsehserie, The White Princess (2017), in die Gegenwartskultur ein. Teil des Machterhalts war wie zu allen Zeiten und in allen Systemen die Regierungspropaganda. Was vor Henry gewesen war, musste als denkbar negativ dargestellt werden. So wurde Richard III., der letzte bei einer militärischen Auseinandersetzung gestorbene englische König, zum Schurken schlechthin, der wegen seines bösen Charakters durch einen besseren Herrscher – eben Henry Tudor und seine Nachfahren – abgelöst werden musste. Auch William Shakespeare ließ rund einhundert Jahre nach den Geschehnissen in seinen Königsdramen Richard als eine der düstersten Persönlichkeiten der Geschichte erscheinen. Richard war zumindest ein schwieriger Charakter, aber – wie sein Ende zeigt – zweifellos ein Mann von beträchtlicher Tapferkeit. In unserer Zeit ist ihm ein wenig Gerechtigkeit widerfahren. Seine sterblichen Überreste, die seit Bosworth als verschollen galten, wurden 2012 nach einer von örtlichen Hobbyhistorikern initiierten Suche unter einem Parkplatz in der Stadt Leicester gefunden. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung (Tausende von weißen Rosen, das Symbol des Hauses York, wurden während der Prozession seiner Gebeine auf seinen Sarg und das diesen transportierende Fahrzeug geworfen) erhielt er 530 Jahre nach seinem gewaltsamen Ende eine würdige Ruhestätte in der Kathedrale von Leicester – und die Stadt ein sehr schönes, seinem Leben und der archäologischen Entdeckung gewidmetes Museum. Neben der DNA-Analyse konnten die Gebeine auch deshalb als die Richards identifiziert werden, weil die Knochen deutliche Zeichen einer Skoliose, einer Verbiegung der Wirbelsäule, aufwiesen, die von Shakespeare und anderen Richard III. wenig gewogenen Quellen als »Buckel« bezeichnet wurde.
Krankheiten und plötzliche Todesfälle begleiteten die Tudors von der ersten Generation an. Im Jahr nach Bosworth und nur knappe neun Monate nach der Hochzeit Heinrichs VII. mit Elizabeth von York wurde dem Paar im September 1486 ein Sohn geboren, der auf den Namen Arthur getauft wurde und als Prinz von Wales automatisch als Thronfolger galt. Der englischen Diplomatie gelang ein bemerkenswerter Coup: Bei der Suche nach einer künftigen Ehepartnerin bereits im frühen Kindesalter – über Jahrhunderte ein übliches Vorgehen im europäischen Hochadel – gewann man die Zusagen der aufstrebenden Weltmacht Spanien. Im Alter von 14 Jahren sollte Arthur mit Katharina von Aragon, der jüngsten Tochter des spanischen Königspaares, verheiratet werden. Im November 1501 wurde die Trauung vollzogen. Ob die beiden jungen Menschen (Katharina war wenige Monate älter als ihr Bräutigam) die Ehe je vollzogen haben, wurde angesichts künftiger Ereignisse zu einem hochbrisanten politischen und kirchlichen Streitpunkt. Arthurs kecke Bemerkung nach der vermeintlichen Hochzeitsnacht, er sei mitten in Spanien gewesen, ist wohl eher als Ausdruck der verbalen Großspurigkeit privilegierter Pubertierender männlichen Geschlechts zu interpretieren.
Viel Zeit blieb ihnen nicht: Im April 1502 starb Arthur plötzlich. Als mögliche Todesursachen werden unter anderem die Pest, die Grippe und eine damals wiederholt in England grassierende, nicht restlos aufgeklärte Seuche, die »englische Schweißkrankheit« diskutiert. Völlig unerwartet wurde nun der zweite Sohn des Königspaares zum Thronfolger. Er hieß wie sein Vater und bestieg nach dessen Tod 1509 als Heinrich VIII. den Thron. Da das Bündnis mit Spanien als enorm wichtig galt, wurde die junge Witwe innerhalb der Familie kurzerhand weitergereicht: Katharina von Aragon wurde die erste der sechs Ehefrauen des Herrschers. Das biblische Gebot, nicht des Bruders Weib zu begehren, wurde durch päpstlichen Dispens umgangen; der Nichtvollzug der Ehe mit Arthur wurde Teil der Staatsräson. Zwanzig Jahre später änderte Heinrich seine Interpretation der Vergangenheit: Nun wollte er die frühere Ehe vollzogen wissen, um eine Auflösung seiner eigenen Verbindung mit Katharina durch den Papst zu erreichen. Als sich dieser weigerte, brach er mit Rom und führte England und seine Kirche auf einen Sonderweg: die Church of England mit dem König oder der Königin als Oberhaupt.
Heinrich wollte nicht nur deshalb die Auflösung der Ehe mit Katharina, weil er den Reizen der jungen und mit einer gehörigen erotischen Ausstrahlung ausgestatteten Anne Boleyn erlegen war, sondern vor allem, weil seine Ehe nicht zu dem aus dynastischen Gründen unverzichtbaren Resultat geführt hatte: der Geburt eines männlichen Erben. Oder, besser gesagt, eines überlebenden Thronfolgers. Denn es gab kein Infertilitätsproblem. Nach einer frühgeborenen Tochter gebar Katharina am 1. Januar 1511 einen Sohn, der jedoch nach drei Tagen starb. 1513 kam ein weiterer Sohn auf die Welt; er war entweder eine Totgeburt oder starb umgehend. 1514 folgte erneut ein Sohn, der immerhin getauft werden konnte, bevor auch er verschied. Im Januar 1516 dann kam Mary auf die Welt, gefolgt von einem weiteren totgeborenen Prinzen im Jahr 1518. Das tragische Schicksal dieser Kinder zeigt, welch eine Gefahr der Lebensbeginn für ein Baby und oft auch für die Mutter über Jahrhunderte war. Die Kindersterblichkeit war hoch, in den Hütten der Bauern ebenso wie in den Palästen des Hochadels. Es würde bis ins 19. und 20. Jahrhundert dauern, bis Grundlagen der Hygiene bekannt waren und praktiziert wurden und die moderne Geburtshilfe sowie die Neonatologie auch zu früh geborenen Kindern eine gute Überlebenschance gaben. In den Epochen zuvor war eine Schwangerschaft stets ein zwiespältiges Ereignis – Anlass zur Vorfreude für die Eltern, aber auch ein Damoklesschwert über den Köpfen von Mutter und Kind.
Im Falle Heinrichs VIII. und seiner ersten Frau kam möglicherweise über die allgemeine Gefahr des Gebäraktes in jener Epoche hinaus ein weiterer Faktor hinzu, der zu den Früh- und Totgeburten beigetragen haben könnte. Es erscheint heutigen Pathobiografen als wahrscheinlich, dass sich Heinrich vor der Ehe mit der spanischen Prinzessin mit der Syphilis infiziert hatte. Die Übertragung der zu Beginn des 16. Jahrhunderts plötzlich durch Europa ziehenden Geschlechtskrankheit (die Gegenstand eines eigenen Kapitels ist) auf seine Frau bzw. auf seine Frauen könnte das Schicksal der kleinen Prinzen besiegelt haben. Auch Anne Boleyn erlitt zumindest eine Früh- oder Totgeburt.[3]
Die Syphilis war, wenn diese Verdachtsdiagnose stimmte, nur eines von zahlreichen gesundheitlichen Problemen, die den König plagten und dazu beitrugen, aus dem charmanten und stattlichen jungen Prinzen einen monströsen, brutalen Tyrannen zu machen. Auch wenn fraglich ist, ob er je so gut aussah wie Jonathan Rhys Meyers, der ihn in der TV-Serie The Tudors