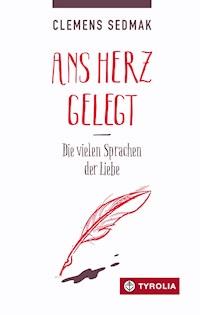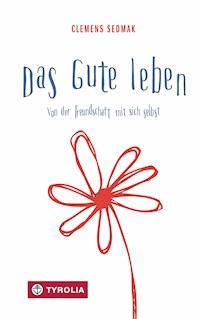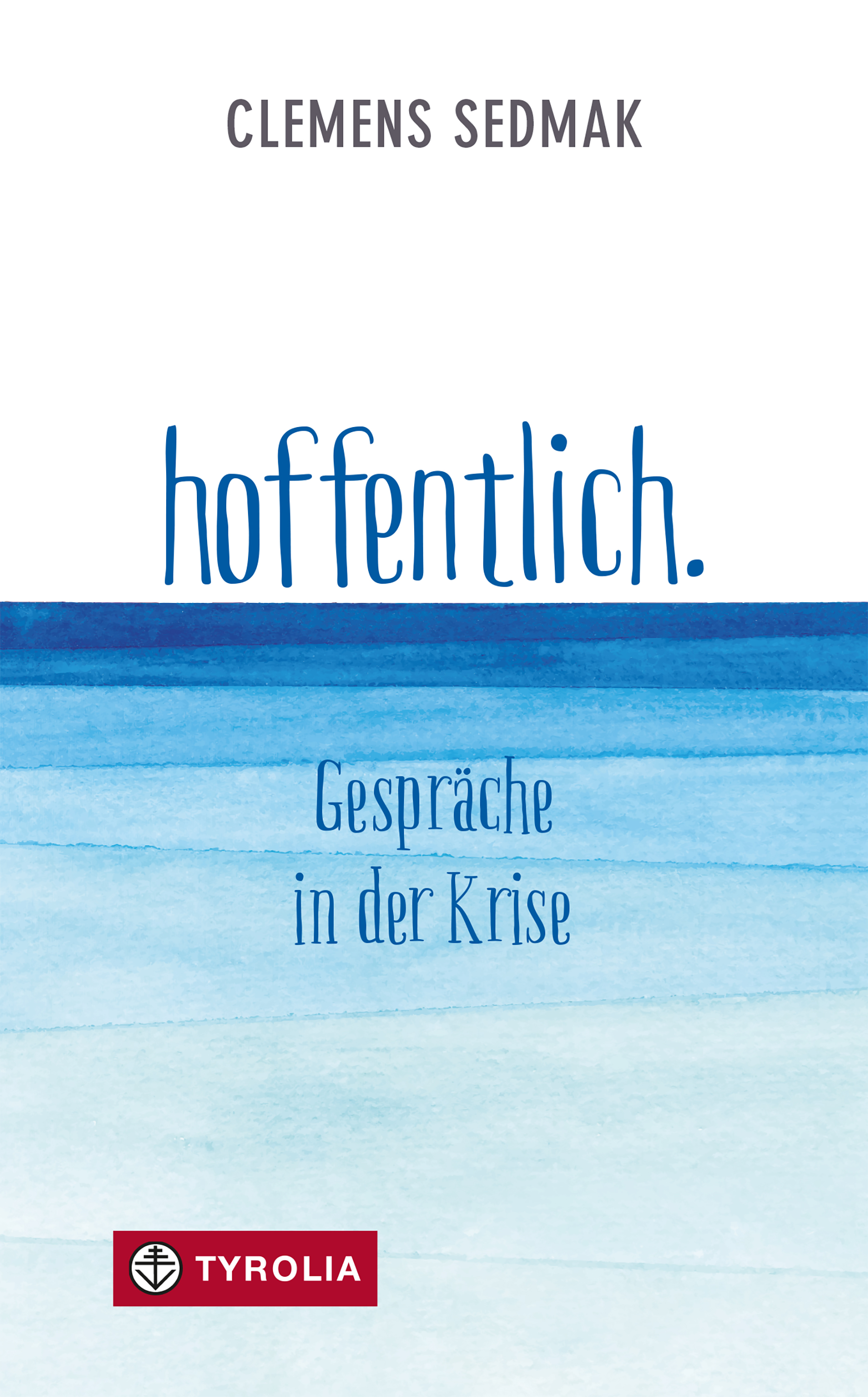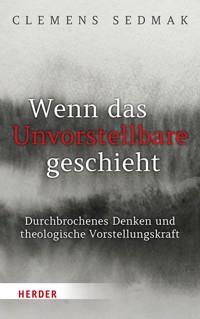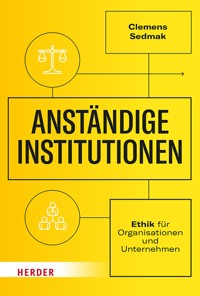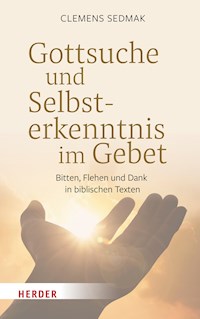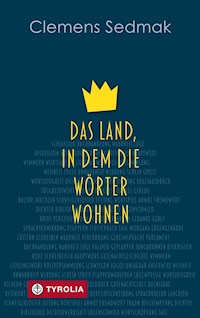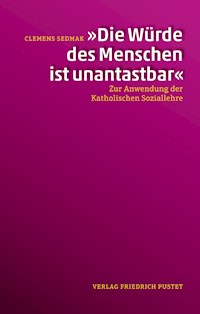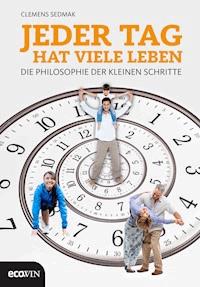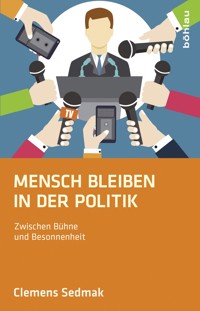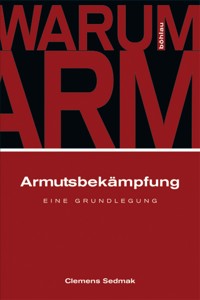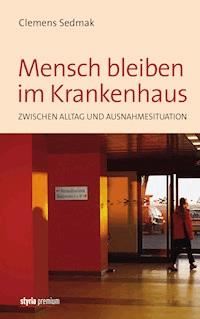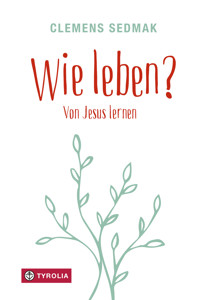
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tyrolia
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In der Lebensschule Jesu Christi Ein Weg der bewussten Selbsterneuerung Das Leben kann hart und schwierig sein; was ist wichtig, was ist wirklich wichtig? Wie sollen wir unser Leben aufbauen und gestalten? Jesus von Nazareth hat durch das Beispiel seines Lebens gezeigt, wie menschliche Lebensführung gelingen kann. Dieses Buch will einen tieferen Blick auf das Leben Jesu werfen und damit "Lebensschule" sein. Die vierzig Kapitel des Buches können als vierzigtägige Exerzitien im Alltag genutzt werden. Jedes Kapitel setzt sich mit einer Stelle der vier Evangelien auseinander und lädt dazu ein, sich auf eine Facette des Lebens Jesu einzulassen. Das Buch geht vier Fragen nach: Wie lebt Jesus sein Leben? Wie sieht Jesus die Welt? Welche Fragen stellt (uns) Jesus? Wozu fordert Jesus (uns) auf? So lädt es zu einer inneren Wanderung ein, die zu einer Erneuerung durch Christus führen will. Der spirituelle Wegweiser eines erfahrenen und erfolgreichen Autors, der Menschen zeigt, wie sie am Beispiel Jesu ihr Leben neu ausrichten können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Clemens Sedmak
Wie leben?
CLEMENS SEDMAK
Wie leben?
Von Jesus lernen
Nachhaltige Produktion ist uns ein Anliegen; wir möchten die Belastung unserer Mitwelt so gering wie möglich halten. Über unsere Druckereien garantieren wir ein hohes Maß an Umweltverträglichkeit: Wir lassen ausschließlich auf FSC®-Papieren aus verantwortungsvollen Quellen drucken und verwenden Farben auf Pflanzenölbasis. Wir produzieren in Österreich und im nahen europäischen Ausland, auf Produktionen in Fernost verzichten wir ganz.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 42h UrhG („Text- und Data-Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“
© 2025 Verlagsanstalt Tyrolia Ges.m.b.H., Exlgasse 20, A-6020 Innsbruck
Umschlaggestaltung: stadthaus 38, Innsbruck
Layout und digitale Gestaltung: Tyrolia-Verlag
Druck und Bindung: Florjančič, Maribor
ISBN 978-3-7022-4297-8 (gedrucktes Buch)
ISBN 978-3-7022-4298-5 (E-Book)
www.tyrolia-verlag.at
Dieses Buch ist Erzbischof Franz Lackner in Dankbarkeit gewidmet.
INHALTSVERZEICHNIS
WIE LEBEN?
I. Wie lebt Jesus sein Leben?
1 IN ALLER FRÜHE, ALS ES NOCH DUNKEL WAR, STAND ER AUF UND GING AN EINEN EINSAMEN ORT, UM ZU BETEN (MK 1,35)
2 ER LEHRTE SIE, WIE ER ES GEWOHNT WAR (MK 10,1)
3 ER NAHM SIE FREUNDLICH AUF (LK 9,11)
4 ER WIES SIE ZURECHT (LK 9,55)
5 ER SPRACH DAS DANKGEBET (MT 15,36)
6 ER BLIEB DORT ZWEI TAGE (JOH 4,40)
7 AUCH SEINE BRÜDER GLAUBTEN NÄMLICH NICHT AN IHN (JOH 7,5)
8 JESUS LIEBTE MARTA, IHRE SCHWESTER UND LAZARUS (JOH 11,5)
9 JESUS (ABER) GING ZUM ÖLBERG (JOH 8,1)
10 ICH HABE MICH SEHR DANACH GESEHNT … (LK 22,15)
II. Wie sieht Jesus die Welt?
11 KEIN STEIN WIRD AUF DEM ANDERN BLEIBEN (MK 13,2)
12 WER IN SEINEM EIGENEN NAMEN SPRICHT, SUCHT SEINE EIGENE EHRE (JOH 7,18)
13 WEM NUR WENIG VERGEBEN WIRD, DER ZEIGT NUR WENIG LIEBE (LK 7,47)
14 MEINT IHR, DASS NUR SIE SCHULD AUF SICH GELADEN HATTEN? (LK 13,4)
15 INS VERDERBEN DER HÖLLE (MT 10,28)
16 AUS DEM HERZEN KOMMEN BÖSE GEDANKEN (MT 15,19)
17 KEIN MENSCH KANN ZWEI HERREN DIENEN (LK 16,13)
18 DIE ARMEN HABT IHR ALLEZEIT BEI EUCH (JOH 12,8)
19 DER SINN DES LEBENS BESTEHT NICHT DARIN, DASS EIN MENSCH AUFGRUND SEINES GROSSEN VERMÖGENS IM ÜBERFLUSS LEBT (LK 12,15)
20 MEIN VATER WÜRDE MIR SOGLEICH MEHR ALS ZWÖLF LEGIONEN ENGEL SCHICKEN, WENN ICH IHN DARUM BITTE (MT 26,53)
III. Welche Fragen stellt Jesus?
21 WAS IST LEICHTER? (MK 2,9)
22 WAS MACHT IHR EUCH DARÜBER GEDANKEN, DASS IHR KEIN BROT HABT? (MK 8,17)
23 WAS NÜTZT ES EINEM MENSCHEN, WENN ER DIE GANZE WELT GEWINNT, DABEI ABER SEIN LEBEN EINBÜSST? (MK 8,36)
24 WARUM MISSACHTET IHR GOTTES GEBOT, UM EURER ÜBERLIEFERUNG WILLEN? (MT 15,3)
25 WAS SOLL ICH DIR TUN? (MK 10,51)
26 WILLST DU GESUND WERDEN? (JOH 5,6)
27 WEN SUCHT IHR? (JOH 18,4)
28 WENN DU KANNST? (MK 9,23)
29 WER VON EUCH KANN MIR EINE SÜNDE NACHWEISEN? (JOH 8,46)
30 SCHON SO LANGE BIN ICH BEI EUCH UND DU HAST MICH NICHT ERKANNT, PHILIPPUS? (JOH 14,9)
IV. Wozu fordert Jesus auf?
31 KEHRT UM UND GLAUBT AN DAS EVANGELIUM! (MK 1,15)
32 GEH! (MK 10,52)
33 ACHTET AUF DAS, WAS IHR HÖRT! (MK 4,24)
34 FÜRCHTE DICH NICHT! (LK 5,10)
35 MÜHT EUCH NICHT AB FÜR DIE SPEISE, DIE VERDIRBT! (JOH 6,27)
36 GEBT IHR IHNEN ZU ESSEN! (MT 14,16)
37 SAMMELT DIE ÜBRIG GEBLIEBENEN BROTSTÜCKE, DAMIT NICHTS VERDIRBT! (JOH 6,12)
38 GIB MIR ZU TRINKEN! (JOH 4,7)
39 HALTE MICH NICHT FEST! (JOH 20,17)
40 WIE ICH EUCH GELIEBT HABE, SO SOLLT AUCH IHR EINANDER LIEBEN! (JOH 13,34)
EPILOG
ANMERKUNGEN
WIE LEBEN?
Die Frage, wie wir leben sollen, ist eine der unausweichlichen Fragen, die das Leben an uns heranträgt. Das Leben kann hart sein, schwierig ist es allemal. Die Sorgen des Alltags können verwirren (vgl. Lk 21,34). Was ist wichtig, was ist wirklich wichtig, was ist wirklich wirklich wichtig? Wie sollen wir unser Leben aufbauen und gestalten? Welche Struktur sollen wir unserem Leben geben? Auf welche großen und kleinen Entscheidungen sollen wir unser Leben gründen? Wie sollen wir uns auf das vorbereiten und mit dem umgehen, was wir nicht in der Hand haben?
Christinnen und Christen glauben, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist – das Konzil von Nizäa hat im Jahr 325 diese Glaubenswahrheit festgehalten. Die „Fleischwerdung Gottes“ (Inkarnation) bedeutet auch, dass wir aus dem Leben Jesu lernen können und sollen. „Die wesentliche Botschaft des Evangeliums“, so schreibt der Jesuit Franz Jalics, „ist, daß Gott Mensch geworden ist und unter uns gelebt hat. Er hat sein Zelt in unserer Mitte aufgeschlagen und ist der Freund der Armen, der Verlassenen, der Witwen und Kranken geworden. Er hat sich uns genähert, um erreichbar zu sein. Er hat uns nahegebracht, daß der Weg zu ihm über den Menschen führt.“1
Christinnen und Christen glauben, dass Jesus von Nazaret uns durch das Beispiel seines Lebens gezeigt hat, was es heißt, als Mensch zu leben. Der Blick auf das Leben Jesu, der Blick auf die fundamentale Lebenspraxis Jesu geben Antwort auf die Frage nach gelingender menschlicher Lebensführung.
Wie also leben, wenn wir an Jesus Christus glauben?
EIN BESONDERES UND SCHWERES LEBEN
Jesus von Nazaret hat ein besonderes Leben unter besonderen Umständen gelebt. Jesu Stammbaum wird am Anfang des Matthäusevangeliums geschildert; es ist keine allgemeine und keine austauschbare Geschichte. Die Familiengeschichte zählt – und die besonderen Menschen, die darin vorkommen. Wir treffen im Stammbaum Jesu, wie er im Matthäusevangelium vorgestellt wird, auf Tamar, die von ihrem Schwiegervater schwanger wurde (Mt 1,3 – siehe Gen 38,18), auf die moabitische Frau Rut (Mt 1,5), auf die Frau des Urija (Mt 1,6), die David mit Gewalt aus der Ehe ihres Mannes gelöst hatte (siehe 2 Sam 11). Es ist eine Familiengeschichte, die das Drama und Dunkel der menschlichen Existenz zeigt.
Das Leben Jesu war, wenn wir es von außen betrachten, ein schweres Leben: Vor seiner Geburt wollte sich sein nachmaliger Ziehvater von seiner Mutter trennen; er wurde in ein von Besatzungsmächten kontrolliertes Land hineingeboren, erblickte aufgrund dieser Besatzung und der auferlegten Steuerpflichten in Betlehem und nicht in seiner Heimatstadt Nazaret das Licht der Welt, die Familie wurde zur Flucht nach Ägypten gezwungen, ging also ins Exil. Als Jude war Jesus im Römischen Reich Bürger zweiter Klasse. Später wird er in seiner eigenen Heimat abgelehnt (Mk 6,5) und schließlich am Ende seines Lebens von einer wütenden Menge in eine grausame Hinrichtung gehetzt (Mt 27,22). Jesu Leben war schwer. Jesus zeigt nicht, wie man „möglichst leicht“ durchs Leben kommen kann. Solche Ratschläge, wie wir ein möglichst bequemes Leben führen können, gibt es viele. Wir finden sie zum Beispiel in Baltasar Graciáns berühmtem Handorakel und Kunst der Weltweisheit, einer Sammlung von Sinnsprüchen aus dem 17. Jahrhundert, die Wege zum angenehmen und mit wenigen Widerständen durchzogenen Leben zeigen. Ähnlich einflussreich wie dieses Buch sind auch die Ratschläge für ein möglichst frohes und leichtes Leben, die wir in Dale Carnegies klassischem Buch Sorge dich nicht – lebe! finden. Solche Anleitungen zur Lebensleichtigkeit kann man Jesu Leben nicht entnehmen.
Wenn man Jesu Leben in groben Zügen beschreiben wollte, würde man festhalten können, dass Jesus einen schwierigen Lebensanfang hatte, dann viele Jahre unscheinbar gelebt haben muss, obwohl er als Zwölfjähriger einzigartige Gaben zeigte. Er stellte Gott in den Mittelpunkt seines Lebens, war aber den Menschen – lehrend, heilend, nährend – zugewandt. Er ordnete sich in Traditionen und in die Geschichte des Volkes Israel und dessen heiligen Texten ein, pflegte Freundschaften und Gemeinschaft. Jesus lebte sein Leben ohne Hast, aber auch ohne Müßiggang, mit Anstrengungen, die ihn auch ermüdeten (Joh 4,6). Jesus verzichtete auf die Macht, König zu sein (Joh 6,15); tatsächlich können Verzicht und Entbehrung als Signaturen des Lebens Jesu gelten (siehe Phil 2,6–7). Das steht dann einer Idee, „möglichst viel aus dem eigenen Potential“ zu machen, entgegen. Diese Idee einer Maximierung des eigenen Lebenspotentials ist in der westlichen Welt (man denke an die Idee der „Eudaimonia“ nach Aristoteles) tief verankert. Jesu Leben erzählt hier eine andere Geschichte vom guten Leben; es ist nicht die Geschichte, „möglichst viel“ aus dem eigenen Leben herauszuholen, wie es etwa die philosophische Position des effektiven Altruismus nahelegt. Ein Leben, das den Willen Gottes verwirklichen möchte, ist ein anderes als ein Lebensentwurf, der an der Idee der Selbstverwirklichung ausgerichtet ist.
SPERRIGE STELLEN
Jesu Leben war schwer und so manche Evangelienstelle ist sperrig. Wir stoßen auf Stellen, denen wir gerne ausweichen – oder Stellen, an die wir mit subtilen Auslegungskünsten herangehen. Manche Worte sind hart (etwa Mt 5,29: „Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird“ – ähnlich Mt 18,8 – oder auch Mt 7,22: „Lass die Toten ihre Toten begraben!“); wir mögen mit Gerichtsankündigungen hadern (Mt 10,15: „Dem Gebiet von Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt“ – siehe auch Mt 11,22.24) oder mit der Warnung vor demjenigen, „der Seele und Leib ins Verderben stürzen kann“ (Mt 10,28). Worte von der Hölle sind hart (Mt 13,42: „Sie werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen“). Jesus bezeichnet die Schriftgelehrten und Pharisäer als Nattern und Schlangenbrut, die kaum dem Strafgericht der Hölle entrinnen werden (Mt 23,33). Die Botschaft, dass Jesus nicht gekommen ist, Frieden zu bringen, sondern das Schwert (Mt 10,34) und Spaltung (Lk 12,51), ist ebenso schwierig wie das Wort von der Sünde (Lästerung gegen den Geist), die nicht vergeben werden könne (Mt 12,31–32; Mk 3,29) oder das Wort vom Unkraut, das ins Feuer geworfen wird (Mt 13,30) – „jede Pflanze, die nicht mein Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden“ (Mt 15,13). Was heißt es, dass wir uns Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons machen sollen (Lk 16,9), wie ist das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, dessen Klugheit gelobt wird, zu verstehen (Lk 16,1–8)?
Auch manche der in den Evangelien erzählten Taten Jesu sind nicht leicht anzunehmen (oder werden symbolisch interpretiert) – etwa die Szene mit der Schweineherde, die sich auf das Wort Jesu hin den Abhang hinunterstürzt und in den Fluten umkommt (Mt 8,32), zweitausend Tiere seien ertrunken (Mk 5,13). Oder die anfängliche Weigerung Jesu, der kanaanäischen Frau zu helfen (Mt 15,23–24) – das hier zitierte Wort: „Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen“ (Mt 15,26; Mk 7,27), ist hart. Schwer verständlich ist es auch, wie Jesus einen Feigenbaum verflucht, der keine Frucht trägt, weil es nicht die Zeit der Feigenernte ist (Mk 11,13–14). Am Wort: „Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre“ (Mt 26,24), das auf Judas Iskariot gemünzt ist, mag man auch hängenbleiben; ähnlich sperrig der Satz über einen Menschen, der Verführung verschuldet: „Es wäre besser für ihn, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer werfen, als dass er einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt“ (Lk 17,2). Wenig später lesen wir im Lukasevangelium von einem König, der seine Feinde vor seinen Augen niedermachen ließ (Lk 19,27). Auch das Wort: „Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen wurde, sollt ihr sagen: Wir sind unnütze Sklaven“ (Lk 17,10), mag harte Kost sein.
Diese Stellen stemmen sich auch der Idee einer widerspruchsfreien, versöhnten Deutung der Evangelien entgegen. Diese Stellen sind Hindernisse auf dem Weg, einen harmlosen und sanften Jesus zu sehen und das Evangelium als Erbauungsschrift zu lesen, durch dessen Lektüre man sich wohl und besser fühlt. Jesus spricht von der engen Tür und davon, dass es vielen nicht gelingen wird, durch diese Tür zu gelangen (Lk 13,24). Hier wird ein anspruchsvolles Leben nahegebracht, das dem Menschen nicht nur einiges, sondern alles abverlangt („Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken“ – Lk 10,27). Jesus hat Menschen auch in Wut versetzt (etwa Lk 4,28 und Lk 6,11) und die Worte: „Was er sagt, ist unerträglich“ (Joh 6,60), provoziert. Wenn Jesus kulturelle und soziale Grenzen seiner Zeit überschreitet, so kann man sich fragen, was das für die heutige Zeit heißen könnte. Wer sind „die Zöllner und die Sünder“ (vgl. Lk 5,30) heute? Gegen wen richten sich die Weherufe (Lk 6,24–26: Weh euch, die ihr reich seid und satt seid und lacht und von den Menschen gelobt werdet) heute?
Das Leben von Jesus von Nazaret wirft Fragen auf, ist ein fragwürdiges Leben. Jesus von Nazaret hat ein Leben gelebt, das Anlass zu vielen Fragen gibt; Menschen fühlten sich durch sein Leben, seine Worte und sein Tun provoziert, Fragen zu stellen: Wie kann der die Schrift verstehen, ohne dafür ausgebildet zu sein? (Joh 7,15) Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? (Mk 2,16) Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? (Mk 4,41) Woher hat er die Weisheit und die Kraft, Wunder zu tun? (Mt 13,54) Woher hast du das lebendige Wasser? (Joh 4,11)
Jesu Leben ist Quelle von Fragen und gleichzeitig richtungsweisend. Jesu Leben bekommt in den Evangelien auch durch sperrige Stellen ein Gesicht.
EINE EINLADUNG ZUR ERNEUERUNG
Wenn wir uns ernsthaft und aufrichtig mit dem Lebensbeispiel Jesu beschäftigen wollen, dann ist dieses Unterfangen eine Einladung zu einem neuen Blick auf unser Leben, eine Einladung zur Selbsterneuerung. „Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden“, lesen wir im zweiten Korintherbrief (2 Kor 5,17). Vermutlich ist das Wort „Selbsterneuerung“ schlecht gewählt, geht es doch nicht um Selbsterneuerung, sondern um Erneuerung durch Gott.
Eine solche Erneuerung sehen wir im elften Kapitel des Johannesevangeliums. Sie gestaltet sich in Jesu Aufforderung: „Nehmt den Stein weg!“ (Joh 11,39).
Der Hintergrund: Jesus kommt nach Betanien; sein Freund Lazarus ist gestorben; die beiden Schwestern von Lazarus sind von der Trauer niedergedrückt. Jesus geht zur Grabstatt, die durch einen Stein verschlossen ist. Er fordert die Umstehenden auf, den Stein wegzunehmen. Marta entgegnet: „Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag“ (Joh 11,40). Jesus erwidert: „Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen“ (Joh 11,41) – da wälzen sie den Stein weg und Lazarus wird von Jesus zurück ins Leben gerufen.
Die Aufforderung, den Stein wegzunehmen, ist eine Aufforderung, den Wall, der das Reich der Lebenden und das Reich der Toten trennt, niederzureißen. Jesus will Öffnung und Durchlässigkeit. Nachdem der Stein weggewälzt ist, ist das Grab offen und durchlässig, hin zur Welt, in der die Menschen leben. Martas Widerstand deutet an, dass es seinen guten Zweck hat, ein Grab zu verschließen und damit die Toten von den Lebenden abzutrennen.
Was bedeutet diese Aufforderung im Leben? Wofür steht die Grabstatt? Wofür steht ein Stein? Steht ein Stein für Verhärtung (Versteinerung), für das, was sich nicht mehr bewegt, für das, was den Bewegungsfluss hemmt, für das, was nicht mehr lebt und Leben versperrt? In welchem Zusammenhang steht diese Stelle mit der Zusage, das Herz aus Stein aus der Brust zu nehmen (Ez 36,26: „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch“)? Was ist tot in uns?
Der weggewälzte Stein ist Voraussetzung dafür, dass Jesus seinen Freund Lazarus auferwecken kann. Den Stein wegzuwälzen, ist eine menschliche Anstrengung – und zwar sicherlich keine geringe. Jesus fordert zu dieser Anstrengung auf, fordert sie ein. Augustinus kommentiert: „Der Herr rief am Grabe des Lazarus, und der vier Tage tot war, stand auf. Der schon roch, trat ans Tageslicht hervor; er war begraben, ein Stein war darübergelegt, die Stimme des Herrn ging durch die Härte des Steines, und dein Herz ist so hart, dass dich jene göttliche Stimme noch nicht bricht? Steh auf in deinem Herzen, geh hervor aus deinem Grabe!“2
Jesu machtvolles Wort macht klar: Was tot ist in den Augen der Menschen, schläft im Urteil Gottes. So sagt er es auch bei der Auferweckung der Tochter des Jairus (Mk 5,39: „Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur“). Gott kann Neues aus dem Tod schaffen – durch das Wegwälzen des toten Steins, durch das neue Herz, durch den kraftvollen Ruf: „Komm heraus!“ (Joh 11,43).
Das vorliegende kleine Buch könnte auch heißen „Leben lernen von Jesus Christus“. Oder auch „Neu mit Christus“.
Dieser Text will einen tieferen Blick auf das Leben Jesu werfen. Es ist eine Einladung, das Leben Jesu ernsthaft anzuschauen in der Absicht, für das eigene gute Leben zu lernen. Nachfolge ist nicht Nachahmung. Jesu Leben schenkt dennoch Anhaltspunkte für tiefes Leben, das wir uns auf je persönliche Weise zu eigen machen können.
Die vierzig kurzen Kapitel des Buches können als vierzigtägige Exerzitien im Alltag genutzt werden. Jedes Kapitel lädt dazu ein, sich auf eine Facette des Lebens Jesu einzulassen, und setzt sich mit einer Stelle der vier Evangelien auseinander. Wenn wir auf Jesus von Nazaret und sein Leben blicken, wie es in den vier Evangelien beschrieben wird – was können wir lernen? Ich will vier Fragen stellen: Wie lebt Jesus sein Leben? Wie sieht Jesus die Welt? Welche Fragen stellt Jesus? Wozu fordert Jesus auf?
So lädt das Buch zu einer inneren Wanderung ein, die zu einer Erneuerung durch Christus führen will.
I.Wie lebt Jesus sein Leben?
1 IN ALLER FRÜHE, ALS ES NOCH DUNKEL WAR, STAND ER AUF UND GING AN EINEN EINSAMEN ORT, UM ZU BETEN(MK 1,35)
Jesus zieht sich zurück – im Lukasevangelium heißt es an einer Stelle: „an einen einsamen Ort, um zu beten“ (Lk 5,16). Der einsame Ort ist ein Ort ohne Ablenkung. Der einsame Ort ist ein Ort der Stille. Einsamkeit ist Zeit der Rollenfreiheit, der Freiheit, keinen sozialen Erwartungen entsprechen zu müssen. Einsamkeit ermöglicht ungeteilte Zeit mit Gott.
Jesus hat einen Rhythmus entwickelt, hat seinem Leben einen auf Gott ausgerichteten Takt gegeben: „Tagsüber lehrte er im Tempel; abends ging er zum Ölberg hinaus und verbrachte dort die Nacht“ (Lk 21,37). Hier zeigt sich Disziplin auf Gott hin, aber auch: Durst nach Gott. Jesus sucht geschützte Orte auf, schützt seine Zeit – um zu beten. Vor der großen Entscheidung über den innersten Jüngerkreis (die Wahl der Zwölf) verbringt er die Nacht im Gebet (Lk 6,12). Jesus betet in der Einsamkeit und die Frucht des Gebets sind wichtige Fragen an seine Jünger: „Für wen halten mich die Leute?“ und „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ (Lk 9,18.20). Das Beten verwandelt Jesus tiefgreifend: „während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes“ (Lk 9,29). Jesus wird durch das Gebet verklärt. Nachdem Jesus einmal an einem Ort gebetet hat, bitten ihn die Jünger darum, sie beten zu lehren (Lk 11,1). Diese Bitte kann nur dem tiefen Eindruck entspringen, den Jesu Beten auf die Jünger gemacht hat. Beten erscheint als ein „Gehen zur Quelle“ – Jesus hebt die Bedeutung der „Zudringlichkeit“ im Gebet (Lk 11,8) und auch der Initiative (Anklopfen: Lk 11,10) hervor. Er fordert die Jünger auf, darum zu beten, „dass ihr nicht in Versuchung geratet“ (Lk 22,40). Jesus lädt ein, allezeit zu beten (Lk 18,1) und nicht nachzulassen.
Jesus lebt sein Leben als Leben auf eine Mitte hin, die durch Beten erschlossen und geschützt wird. Er betet auch für seine Jünger; er sagt zu Petrus, der ihn bald darauf verraten wird: „Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt“ (Lk 22,32); er bittet für diejenigen, die ihn erkannt haben – „für sie bitte ich“ (Joh 17,9).
Jesus trägt das, was er liebt, im Gebet vor Gott; er bringt diejenigen, die ihm am Herzen liegen, betend in Gottes Gegenwart.
Er bittet, wie es an der Stelle heißt, „in aller Frühe, als es noch dunkel war“. Er betet zu einer Zeit, in der „die Welt“ noch schläft; er betet am Anfang eines Tages, bevor die Anforderungen und Erwartungen des Tagewerks an ihn herangetragen werden. Er betet in der Dunkelheit, die den Menschen zwingt, sich nach innen zu kehren. Er betet wohl zu einer Zeit, wo die meisten noch schlafen. Auch er ruht im Gebet äußerlich, verrichtet keine körperliche Arbeit; doch sein Geist ist wach.
Jesus sucht die rechte Zeit für das Gebet – und den rechten Ort. Sein Beten ist mit der Mühe verbunden, aufzustehen und an den einsamen Ort zu gehen. Das kleine Detail mag bedeutsam sein: Jesus steht nicht einfach nur „in aller Früh, als es noch dunkel war“, auf, um zu beten. Nein, er steht auf und geht an einen einsamen Ort, um zu beten. Er entfernt sich also vom Ort seiner Arbeit und seines Ruhens, vom Ort seiner Gemeinschaft, von seiner Bleibe. Er sucht einen anderen, einen einsamen Ort auf. Wir können uns vorstellen, dass auch das Hingehen zu diesem Ort eine Vorbereitung auf das Gebet ist, eine Vorbereitung auf die Gottesbegegnung. Man mag sich an die Schilderung im Buch Exodus erinnert fühlen, die von Mose erzählt, der zu Gott auf den Berg stieg (Ex 19,3). Auch Jesus finden wir betend auf dem Berg (Lk 9,28). Er zieht sich auf einen Berg zurück, „er allein“ (Joh 6,15). Und wir können davon ausgehen, dass der Aufstieg auf den Berg den Geist auf Gott hin einstellte.
Es kostet durchaus Überwindung und einen Kraftaufwand, aus dem Schlaf zu erwachen, aus dem Bett zu steigen und einen abgelegenen Ort aufzusuchen. Nicht das Beten scheint anstrengend, aber doch die Vorbereitung auf das Beten.
Auf den Berg zu steigen, ist mit Anstrengung verbunden – muss man das Geschenk der Gottesberührung im Gebet unter Mühen vorbereiten? Schenkt sich die Frucht des Betens denjenigen, die das Beten absichtsvoll angehen, entsprechend Raum und Zeit bereiten, und nicht einfach „zwischendurch“ geschehen lassen? Leibhaftes Beten ist Beten zu bestimmter Zeit und an bestimmtem Ort.
Jesu Beten hat nicht mit vielen Worten zu tun; er lehrt die Jünger auf deren Bitte das kurze „Vater Unser“, er warnt vor Beten als „Plappern“ und vor der Idee, dass man im Beten „viele Worte“ machen müsse (Mt 6,7). Beten ist Ausdruck von Vertrauen und Nähe – es geht nicht darum, Gott zu sagen, was Gott schon weiß („Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet“ – Mt 6,8). Gebet ist Suche nach der Nähe Gottes „im Verborgenen“, wie Jesus in der Bergpredigt betont (Mt 6,6). Beten ist verborgene Suche nach Gottnähe.
Aus dem Beten nimmt Jesus die Kraft für sein Lehren und Heilen. Er wirkt in der Öffentlichkeit, ist deswegen tagsüber stets vielen Menschen ausgesetzt. Das Gebet an den Randzeiten – spätnachts, in aller Frühe – ist die geschützte Zeit mit Gott.
Wenn wir unser Leben am Leben Jesu ausrichten wollen, dann ist eine der Stützen dieses Lebens das Gebet, das Bemühen, Zeit und Raum zu schaffen für das Beten. Gerade die Randzeiten des Tages, Beginn und Ende, haben etwas Heiliges, etwas, das von der Geschäftigkeit des Alltags und dem Tagesgeschäft abgesondert ist.
Das bringt uns zur schlichten Frage:
Wie können wir das gute Beten schützen?
2 ER LEHRTE SIE, WIE ER ES GEWOHNT WAR(MK 10,1)
Jesus geht in die Synagoge – „wie er es gewohnt“ war. Wir finden diesen Punkt auch in Lk 4,16 („Jesus ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge“). Jesus ging also immer wieder, regelmäßig in die Synagoge; es war nicht überraschend, Jesus in der Synagoge anzutreffen. Man konnte sich darauf verlassen, Jesus in der Synagoge zu finden. Es wäre überraschend gewesen, Jesus zu einer bestimmten Tageszeit dort nicht zu sehen. All dies sind Umschreibungen dafür, dass sich Jesus das Lehren in der Synagoge zur Gewohnheit gemacht hatte. Im Lukasevangelium heißt es: „Er kam auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge“ (Lk 4,16). Hier zeigt sich, dass der Sabbat besondere Gewohnheiten im Unterschied zu den „gewöhnlichen“ Wochentagen mit sich bringt und auch dass Jesus an seiner Sabbatgewohnheit festhält, ob er sich nun in Nazaret oder an einem anderen Ort befindet.
Gewohnheiten schaffen eine Wohnung für das eigene Tun an verschiedenen Orten; die Orte können wechseln, die Gewohnheiten bleiben bestehen. Gewohnheiten sind wie ein Gewand, an dem man einen Menschen erkennt.
Eine Gewohnheit strukturiert das eigene Leben. Wir finden Jesus etwa auch immer wieder betend in der Einsamkeit – spätabends, nachts, in aller Frühe, wie wir eben im ersten Kapitel reflektiert haben. Jesus hat seinem Leben durch Gewohnheiten eine Struktur gegeben. Gewohnheiten sind verfestigte Handlungen, die so sehr in eine Haltung übergehen, dass es einer Person schlussendlich schwerer fällt, gegen die Gewohnheit zu handeln als im Einklang mit ihr.
Gewohnheiten sind nicht angeboren, sie werden erworben; man eignet sich Gewohnheiten durch Wiederholung und Regelmäßigkeit an. Jesus ging, so lesen wir, „wie er es gewohnt war, zum Ölberg“ (Lk 22,39). Jesus muss oft und immer wieder zum Ölberg gegangen sein, damit dieser Satz bestehen kann. Der Ölberg ist ein besonderer Ort; während alle nach dem Streit um die Herkunft des Messias nach Hause gingen, geht Jesus zum Ölberg (Joh 8,1). Tagsüber lehrt Jesus im Tempel, abends geht er zum Ölberg (Lk 21,37). Wir finden ihn auch auf dem Ölberg sitzend, gegenüber dem Tempel (Mk 13,3), der Ölberg ist auch Ort der Unterweisung der Jünger (Mt 24,3). So wird der Ölberg zu einem Ort, an dem sich Jesus regelmäßig, gewohnheitsmäßig, aufhält.
Gewohnheiten sind wie Geländer, an denen man sich festhalten kann. Wenn Jesus, wie wir den Evangelien entnehmen dürfen, die Gewohnheit hatte, den Tag im Gebet zu beginnen und auch im Gebet zu beenden, dann sind diese beiden Gewohnheiten wie Pflöcke, zwischen denen der Tag aufgespannt wird; sie sind gleichsam Rahmung des Lebens. Es sind zweifellos entscheidende Fragen des menschlichen Alltags: Wie beginnt der Tag, wie endet der Tag?
Jesus hat sich Gewohnheiten zu eigen gemacht und diese Gewohnheiten sind auch alltagsbildend. Sie sorgen dafür, dass die Lebenstage einander ähneln. Jeder Tag beginnt im Gebet, jeder Tag endet im Gebet. Dadurch wird der Tag strukturiert, dadurch wird Alltag möglich.
An eine Gewohnheit muss man sich gewöhnen – sie ist wie die Zähmung einer Handlung; wenn man eine Handlung mit einem Tier vergleichen wollte, dann ist eine Gewohnheit ein Haustier, ein gezähmtes Tier. David, der – nicht kampferprobt – den Kampf gegen Goliat aufnehmen wollte, war es etwa nicht gewohnt, in der schweren Rüstung des Saul zu gehen. Er konnte sich darin nicht bewegen (1 Sam 17,39: „Ich kann in diesen Sachen nicht gehen, ich bin nicht daran gewöhnt“). Er konnte sich die Rüstung nicht zu eigen machen, er konnte sich nicht an sie gewöhnen, er konnte das Tragen der Rüstung nicht zähmen.
Wenn wir im Leben Jesu Gewohnheiten beobachten können, dürfen wir anerkennen, dass Gewohnheiten einen besonderen Wert und Platz haben. Wir finden den Propheten Daniel mit der Gewohnheit, dreimal täglich den Lobpreis zu verrichten (Dan 6,11), wir finden Paulus mit der Gewohnheit, in der Synagoge zu reden (Apg 17,1), wir finden im Hebräerbrief eine ernsthafte Ermahnung, da das Fernbleiben von Zusammenkünften „einigen zur Gewohnheit geworden ist“ (Hebr 10,25).