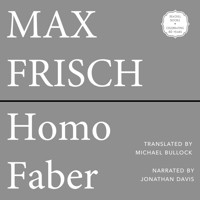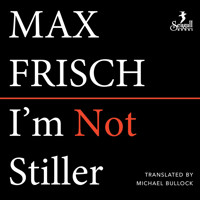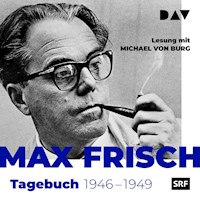18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Schriftsteller sind beliebte Interviewpartner, aus zweierlei Gründen: Man erhofft sich von ihnen Aufschluss über ihre eigenen Werke und Aufklärung über die allgemeine Weltlage. Das Schriftstellerinterview ist eine Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln der Mediensprache. Es lebt von der Unmittelbarkeit, mit der sich Schriftsteller zu Wort melden und zu literarischen, gesellschaftlichen und politischen Themen Stellung beziehen.
Max Frisch war der Inbegriff eines Schriftstellers, der sich einmischt und gehört wird. Er hat unzählige Interviews gegeben, obwohl er sie eigentlich gar nicht mochte. Umso virtuoser beherrschte er sie: Er war ein master conversationalist, wie sich Jodi Daynard ausdrückt, die ihn in den achtziger Jahren drei Tage lang interviewte.
Nun erscheint erstmals eine Auswahl der besten Interviews und Gespräche mit Max Frisch. Einige davon werden zum ersten Mal überhaupt oder zum ersten Mal in voller Länge oder zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht. Im Gespräch über Themen wie Vernunft und Utopie, Ideologie und Kritik, Hass und Gewalt, aber auch über Fakt und Fiktion, Poesie und Polemik werden Fragen beantwortet, die bis heute aktuell sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Schriftsteller sind beliebte Interviewpartner, aus zweierlei Gründen: Man erhofft sich von ihnen Aufschluss über ihre eigenen Werke und Aufklärung über die allgemeine Weltlage. Das Schriftstellerinterview ist eine Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln der Mediensprache. Es lebt von der Unmittelbarkeit, mit der sich Schriftsteller zu Wort melden und zu literarischen, gesellschaftlichen und politischen Themen Stellung beziehen.
Max Frisch war der Inbegriff eines Schriftstellers, der sich einmischt und gehört wird. Er hat unzählige Interviews gegeben, obwohl er sie eigentlich gar nicht mochte. Umso virtuoser beherrschte er sie: Er war ein master conversationalist, wie sich Jodi Daynard ausdrückt, die ihn in den achtziger Jahren drei Tage lang interviewte.
Nun erscheint erstmals eine Auswahl der besten Interviews und Gespräche mit Max Frisch. Einige davon werden zum ersten Mal überhaupt oder zum ersten Mal in voller Länge oder zum ersten Mal in deutscher Sprache veröffentlicht. Im Gespräch über Themen wie Vernunft und Utopie, Ideologie und Kritik, Hass und Gewalt, aber auch über Fakt und Fiktion, Poesie und Polemik werden Fragen beantwortet, die bis heute aktuell sind.
Max Frisch, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich, starb dort am 4. April 1991. In fast sechs Jahrzehnten entstanden Romane, Theaterstücke, Tagebücher, Erzählungen, Hörspiele und Essays. Viele davon wurden zu Klassikern der Weltliteratur.
Thomas Strässle lehrt Neuere deutsche und vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und leitet an der Hochschule der Künste Bern das transdisziplinäre Y Institut. Er ist Präsident der Max Frisch-Stiftung an der ETH Zürich.
Von und über Max Frisch erschienen zuletzt im Suhrkamp Verlag:
Julian Schütt : Max Frisch. Biographie eines Aufstiegs, 2011
Aus dem Berliner Journal, 2014
Ignoranz als Staatsschutz ?, 2015
Max Frisch
»Wie Sie mir aufden Leib rücken!«
Interviews und Gespräche
Ausgewählt und herausgegebenvon Thomas Strässle
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der Ausgabe:
Erste Auflage 2017
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-75090-2
www.suhrkamp.de
»Wie Sie mir auf den Leib rücken!«
Inhalt
Vorwort
I Gespräch mit einem jungen Autor (1934)
II [Jede Zeit hat ihre ideologischen Klischees] (1959)
III Werkstattgespräch mit Max Frisch (1961)
IV Soll der Onkel auf die Barrikade steigen? (1964)
V Wir müssen unsere Welt anders einrichten (1967)
VI Noch einmal anfangen können (1967)
VII Rückzug auf die Poesie (1974)
VIII Ich singe aus Angst – das Unsagbare (1981)
IX Polemik – ein Gespräch mit Max Frisch (1981)
X Jedes Wort ist falsch und wahr (1981)
XI [Die Literatur sollte Möglichkeiten aufzeigen] (1984)
XII [Ist ein Individualist jemand, den die Gesellschaft nicht brauchen kann?] (1985)
XIII Ohne Widerstand – keine Hoffnung (1986)
XIV
Vorwort
Schriftsteller sind beliebte Interviewpartner, aus zweierlei Gründen: Zum einen verspricht man sich von ihnen Aufklärung über ihre eigenen Werke. Sie sollen berichten, wie sie auf die Idee oder den Stoff für ihr Buch gestoßen sind, wie sie daran gearbeitet haben, ob sich darin biografische Elemente wiederfinden, welche Interessen sie damit verfolgen usw. Solche Fragen zielen darauf ab, aus dem Mund der Autoren selbst privilegierte Informationen zu erhalten über die Texte, die sie vorlegen. Zum andern erhofft man sich von Schriftstellern in Interviews Aufklärung über die allgemeine Weltlage. Ihnen wird eine Sprecherposition eingeräumt, die nicht in Tagesgeschäfte verstrickt ist und es erlaubt, ebenso unbefangen wie unbestechlich zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen.
Gegenüber etwa Musikern oder Malern haben Schriftsteller den Vorteil, dass sie sich in Interviews in ihrem angestammten Medium ausdrücken können. Der Vorteil hat aber auch seine Tücken: Welchen Status hat das Schriftstellerwort in Interviews? Inwiefern gehört es zum literarischen Diskurs hinzu, oder ist es bloß eine mediale Wortmeldung wie andere auch? In welchem Verhältnis stehen literarischer und publizistischer Text?
Das Schriftstellerinterview ist eine viel beachtete, aber wenig erforschte Textgattung. Ihre Spannbreite reicht vom Interview als eigener Kunstform bis zum Interview als Abfallprodukt der Vermarktungsmaschinerie. So viel steht immerhin fest: Das Schriftstellerinterview ist ein zwitterhaftes Wesen, eine Fortsetzung der Literatur mit den Mitteln der Mediensprache. Nicht zuletzt darin liegt sein Reiz.
*
Max Frisch war ein gefragter Interviewpartner. Sein schriftstellerisches Naturell kam dem Format auch sehr entgegen: Er war ein Autor, über dessen Texten sich umgehend die Frage nach den Entstehungshintergründen, insbesondere den autobiografischen, stellte, und er war ein Intellektueller, der das Zeitgeschehen aufmerksam verfolgte und kommentierte.
Frisch hat ein Schriftstellerleben lang Interviews gegeben. Dabei mochte er sie gar nicht. Das vorstrukturierte Spiel aus Frage und Antwort war ihm zuwider. Lieber führte er Gespräche: mit gleicher Rollenverteilung und offenem Ausgang und Verlauf, ohne Aufzeichnung und Zwang zur letztgültigen Formulierung – Gespräche im Sinne von Begegnungen, nicht im Sinne eines Abrufens von Statements.
Unter Journalisten hatte sich dies herumgesprochen. Nicht selten nehmen sie in den Artikeln darauf Bezug, selbst schon im Titel oder zum Einstieg: Kein Interview mit Max Frisch … aber ein Gespräch über Mittag bei einem Pot-au-feu – aus der Erinnerung aufgezeichnet von Hans Rudolf Hilty, lautet die Überschrift eines Beitrags in der linksliberalen National-Zeitung von 1976.1 Und Michel Contat begann 1982 ein Interview für Le Monde Dimanche mit der Frage: »Was haben Sie gegen Interviews?« Er bekam zur Antwort: »Für einen Schriftsteller ist es die unbedeutendste Ausdrucksform. Entweder lässt man ihn noch einmal sagen, was er in seinen Büchern oder Artikeln geschrieben hat, und er sagt es natürlich weniger gut. Oder man verleitet ihn dazu, über etwas zu reden, was er nicht kennt, und das ist lächerlich.«2
Wer Frisch interviewen wollte, erhielt von ihm mitunter ebenso genaue wie großzügige Auflagen, unter denen das Gespräch stattzufinden hätte. Die Brigitte-Redakteurin Heidi Schulze-Breustedt schildert es 1970 so: »Er hat was gegen Tonbänder. Schon das unterscheidet ihn von den meisten anderen schreibenden Leuten. Die nämlich legen zumeist Wert darauf, was sie sagen, silbengetreu abgedruckt zu sehen. Max Frisch dagegen mag nicht zitiert werden. Er mag überhaupt keine Interviews im Frage-Antwort-Stil. Er mag nur Gespräche. ›Lassen Sie uns miteinander reden, dann bin ich Ihr Material, und was Sie daraus machen, ist Ihre Sache …‹ Das sagte er bei einer Zigarre nach gutem Essen in einem Zürcher Spezialitäten-Restaurant.«3
Frischs Abneigung gegen das Interview galt der ritualisierten Form ebenso wie der Endgültigkeit, mit der die verschriftlichte Fassung daherkommt. Häufig lesen sich Interviews so, als hätte der Befragte auf alles sofort eine druckreife Antwort parat, ohne Suchen und Zögern, ohne Umschweife und Unsicherheiten. In diese Rolle des umstandslosen Auskunftgebers wollte sich Frisch nicht drängen lassen. Die Lebendigkeit der Gesprächssituation sollte möglichst anschaulich werden.
In einem Artikel von Josef Rennhard, der 1986 für die Zeitschrift Beobachter ein Gespräch mit Frisch führte, werden die Vorbehalte noch genauer gefasst. Die Skepsis bezog sich insbesondere auf das eigene Medium Schrift: »Die Spielregeln für das Beobachter-Gespräch hat Max Frisch schon in einer telefonischen Vorbesprechung klar umschrieben: Kein Fotograf, kein Tonbandgerät, höchstens ein sinngemäßes zusammenfassendes Zitiertwerden. ›Die Leute können ja meine Bücher lesen; Interviews tönen immer so endgültig, so zurechtgestutzt … Am Radio ist es anders, da hört man die Stimme, den Tonfall, das Zögern. Und im Fernsehen ist's nochmals anders, da wird das Ringen um den Ausdruck auch in der Mimik sichtbar …‹«4
Zu den grundlegenden Bedenken gegenüber Interviews scheint bei Max Frisch spätestens im letzten Lebensjahrzehnt eine gewisse Müdigkeit hinzugekommen zu sein angesichts der Rolle, die Schriftstellern – und ihm selbst in ausgeprägtem Maß – von Medien und Öffentlichkeit zugeschrieben wird. In den Entwürfen zu einem dritten Tagebuch von 1982 findet sich am Ende eines Eintrags, der erbarmungslos auf die verbliebenen Möglichkeiten der eigenen Existenz blickt, die Sequenz aus Frage und Antwort: »Was erwartet man von einem Schriftsteller? / Dass er Interviews gibt.« Im Lebensabendhaus, das er sich gegen Ende des Tagebuchs ausmalt, gibt es dafür jedenfalls keinen Platz. Erleichtert hält er fest: »Ich gebe keine Interviews mehr …«5
*
Frischs Widerwille gegen das Interview hatte aber zugleich zur Folge, dass er die Gattung selbst auf die Probe zu stellen begann und ihre ritualisierten Spielregeln aufzulockern versuchte – indem er beispielsweise den Spieß umdrehte und seinem Interviewer Fragen stellte oder indem er die Interviewsituation thematisierte, etwa die Auswirkungen eines mitlaufenden Tonbandes. Am weitesten ging in dieser Hinsicht das filmische Experiment Max Frisch interviewt sich selbst (1967), produziert von einem Fernsehteam der BBC, das die Probe auf die Gattung bis zum Kurzschluss trieb: Man sieht Max Frisch einerseits als Interviewer und andererseits als Interviewten, unterschiedlich gekleidet; er stellt sich selbst diejenigen Fragen, die er vermutlich längst nicht mehr hören konnte: »Wie viel privates Material verwenden Sie?« oder »Geht es in Andorra um Antisemitismus?« Das Filmdokument ist eine virtuose Parodie auf das Schriftstellerinterview als solches.6
Doch bei aller Abneigung gegen das Interview und aller Vorliebe für das Gespräch: Es ist schwierig, eine prinzipielle Unterscheidung zwischen diesen beiden dialogischen Formen zu treffen. Die Übergänge sind fließend. Unter formalen Gesichtspunkten sind Interview und Gespräch oftmals gar nicht auseinanderzuhalten, und auch die besprochenen Themen sind vielfach identisch.
Es lassen sich aber graduelle Unterschiede feststellen, was die Rolle der involvierten Personen und deren Interessenlage betrifft: Während das Interview gezielt auf Auskünfte aus ist, die es beim Interviewten einzuholen gilt, hält sich das Gespräch offener hinsichtlich seiner Schwerpunktsetzungen; während das Interview keine Ebenbürtigkeit bedingt, da es normalerweise eine klare Rollenaufteilung in Interviewer und Interviewte, in Fragende und Befragte gibt, findet das Gespräch zwischen Teilnehmenden statt, die sich gleichermaßen einbringen und idealerweise auf Augenhöhe befinden; und während das Interview auf eine gewisse Schnelllebigkeit setzt, bietet das Gespräch Gelegenheit zu vertieftem Austausch. Vielleicht lassen sich die Unterschiede auf die Formel bringen: Interviews wollen Informationen beschaffen, Gespräche wollen Erkenntnisse befördern.
*
Wenn nun eine Auswahl der Interviews und Gespräche mit Max Frisch erscheint, so geschieht dies vornehmlich aus zwei Gründen: Erstens ist es eine Tatsache, dass Frisch viele Gespräche geführt und viele Interviews gegeben hat; unter einem erweiterten Literaturbegriff sind diese Texte als integraler Bestandteil seines Gesamtwerks zu sehen, waren aber bislang nur sehr verstreut und in einigen Fällen gar nicht oder bloß auszugsweise greifbar. Zweitens zeichnete sich Frisch, wie gerade die Interviews und Gespräche belegen, in seiner Zeitzeugenschaft ebenso wie in seiner schriftstellerischen Selbstreflexion durch eine Grundsätzlichkeit und Weitsicht aus, die seine Äußerungen unvermindert lesenswert machen.
Die vorliegende Ausgabe versammelt erstmals Interviews und Gespräche mit Max Frisch, ohne die Absicht zu verfolgen, sie vollzählig zu dokumentieren. Vielmehr legt die Auswahl den Akzent auf diejenigen Texte, die über den engeren Rahmen ihrer Entstehung hinausweisen und auch für ein heutiges Publikum von Interesse sind. In erster Linie fanden Interviews und Gespräche Aufnahme, die in Feuilletons und Zeitschriften veröffentlicht wurden und in den jeweiligen Fassungen mutmaßlich von Frisch autorisiert sind. Dabei handelt es sich immer um Texte, in denen der Autor in Originalzitaten vernehmbar wird – trotz seiner Ablehnung von Aufnahmegeräten, auf der er glücklicherweise nicht konsequent beharrte. Allerdings muss in vielen Fällen offenbleiben, inwieweit die Aussagen vor der Drucklegung nachbearbeitet wurden.
Keine Berücksichtigung fanden hingegen die zahlreichen journalistischen Erlebnisberichte, in denen eine Begegnung mit Max Frisch geschildert wird, auch wenn sie natürlich Produkte seiner Aversion gegen das situative Zitiertwerden sind. Verzichtet wurde auch auf Transkriptionen von Radio- und Fernsehinterviews, da das Medium Schrift die Lebendigkeit der Gesprächssituation nur unzureichend abzubilden vermag und Frisch sich überdies im Zusammenhang mit den filmischen Gesprächen im Alter (1985/86) vertraglich gegen die Veröffentlichung von Transkriptionen gewandt hat.7
Ediert wurden die Interviews und Gespräche nach dem Wortlaut der Fassungen, in denen sie in den entsprechenden Feuilletons und Zeitschriften erschienen sind. Es gab keine Eingriffe in den Text, abgesehen von stillschweigenden Korrekturen offensichtlicher Druckfehler und Vereinheitlichungen im Sinne der neuen deutschen Rechtschreibung. Wo sich von Frisch handschriftlich korrigierte oder autorisierte Typoskripte erhalten haben, wurden sie beigezogen und in die edierte Fassung eingearbeitet.
Einige der Texte erscheinen hier zum ersten Mal überhaupt oder zum ersten Mal in voller Länge oder zum ersten Mal in deutscher Sprache. Die näheren Angaben dazu finden sich in den kurzen, kursiv gesetzten Einleitungen des Herausgebers, in denen auch das jeweilige publizistische, zeitgeschichtliche und biografische Umfeld skizziert wird.
*
Es gibt viele Gründe, weshalb Interviews und Gespräche so lesenswert und aufschlussreich sind. Einer davon liegt in der Unmittelbarkeit, mit der die Stimmen der Beteiligten vernehmbar werden – immer im Bewusstsein, dass es sich dabei um eine Inszenierung handelt und auch um ein Spiel mit Intimität und Indiskretion. Man meint den sprechenden Personen bei einer Unterhaltung zuzuhören, als säße man daneben, und erfährt Dinge, die in dieser Direktheit den literarischen Texten nur selten zu entnehmen sind.
Ein Reiz besteht auch in der Vielfalt an Dynamiken, mit denen Interviews und Gespräche verlaufen können, abhängig von den Charakteren, die aufeinandertreffen, und den Rollen, die sie einnehmen. Auf Seiten der Interviewer reicht das Spektrum im vorliegenden Fall vom ehrfürchtigen Stichwortgeber bis zum ebenbürtigen Gesprächspartner und vom munteren Herausforderer bis zum verbissenen Kontrahenten. Entsprechend zeigt sich auch der Interviewte von verschiedenen Seiten. Frisch geht auf jede Frage ein und reagiert auf jeden Tonfall, der ihm gegenüber angeschlagen wird. Er erweist sich als master conversationalist, wie sich Jodi Daynard ausdrückt, die ihn in den achtziger Jahren drei Tage lang interviewt hat.8
Interviews und Gespräche mit Max Frisch: Das ist auch deshalb ein besonderer Fall, weil Frisch wie kaum ein anderer als Meister der Fragen in die Literaturgeschichte eingegangen ist – der Fragen an sich selbst und an die Leser. Weltberühmt sind seine Fragebögen aus dem Tagebuch 1966-1971, die so offen gehalten sind und doch so zielgenau treffen, dass sie eine bleibende Herausforderung bilden. Umso faszinierender, Frisch nun als denjenigen zu erleben, dem Fragen gestellt werden und der Antworten zu finden hat – mitunter gar auf Fragen aus den eigenen Fragebögen.
Nicht zuletzt entsteht aus der Abfolge der Interviews und Gespräche mit Max Frisch eine Skizze seiner intellektuellen Biografie und ein dichtes Geflecht seiner Themen und Positionen. Die zahlreichen Verweise zwischen den Texten lassen die Entwicklungen und Verschiebungen in seinem Denken und Schreiben sichtbar werden. Sei es, dass der Interviewer die Themen aufbringt, oder sei es, dass Frisch selber darauf zu sprechen kommt: Die Interviews und Gespräche drehen sich immer wieder um Vernunft und Utopie, Ideologie und Kritik, Macht und Moral, Hass und Gewalt, Hoffnung und Widerstand, das Politische und das Private, das Ich und die anderen, Mann und Frau, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, Fakt und Fiktion, Poesie und Polemik, Fabel und Parabel, Tod und Freitod, Schweiz und Heimat. Im Dialog über diese Themen wird nicht nur die Persönlichkeit von Max Frisch, sondern eine ganze Epoche lebendig – mit Fragen, die bis heute aktuell geblieben sind.
Thomas Strässle
1
Ausgabe vom 30. 04. 1976, S. 3.
2
»Max Frisch: la subversion par l'écriture«, Interview mit Michel Contat, in: Le Monde Dimanche, 19. 09. 1982, S. IX (Übersetzung des Herausgebers).
3
»›Es kommen aufregende Zeiten – für die Frau‹«, Gespräch mit Heidi Schulze-Breustedt, in: Brigitte 5/1970, S. 159.
4
»Ich widerspreche, also bin ich. Max Frisch wird 75«, Gespräch mit Josef Rennhard, in: Beobachter 9/1986, S. 90.
5
Max Frisch: Entwürfe zu einem dritten Tagebuch, hrsg. und mit einem Nachwort von Peter von Matt, Berlin: Suhrkamp, 2010, S. 27 und 145.
6
Ausgestrahlt vom Bayerischen Rundfunk am 20. 04. 1969. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=o1ZLxOJzeQY.
7
Vereinbarung zwischen Max Frisch und Philippe Pilliod vom 17. 05. 1985, Punkt 5: »Ausgeschlossen ist die Veröffentlichung des Textes als Transkript.« (Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek Zürich)
8
Mail an den Herausgeber vom 12. 01. 2016.
Gespräch mit einem jungen Autor
(1934)
Den Auftakt macht ein Kuriosum: ein Gespräch mit Max Frisch, an dem er gar nicht beteiligt war. Es ist das früheste und wohl auch wunderlichste Gesprächsdokument, das im Zusammenhang mit Frisch vorliegt. Als er 1934 als 23-Jähriger mit dem Roman »Jürg Reinhart« debütierte, erschien in der Neuen Zürcher Zeitung ein »Gespräch mit einem jungen Autor«, das sich wie ein Interview liest.
Tatsächlich handelt es sich jedoch um ein fingiertes Gespräch, in dem sowohl die Fragen als auch die Antworten von Eduard Korrodi (1885-1955) stammen, dem damals mächtigen Feuilletonchef der NZZ. Mit den Mitteln des Interviews bespricht er Frischs Buch und entwirft ein Porträt des Künstlers als eines jungen Mannes, den er nicht bloß aus dessen Roman, sondern auch aus eigener Anschauung kannte, da Frisch zu der Zeit brotberuflich für die NZZ als freier Journalist arbeitete. Es stellt sich nur die Frage, wer eigentlich der Interviewer und wer der Interviewte ist.
*
Max Frisch Herr Doktor, es überrascht mich, dass Sie über mein Buch Jürg Reinhart nicht schreiben. Da haben Sie doch in einem Vortrag geklagt, es fehlen der schweizerischen erzählenden Kunst die Rekruten. Und nun, da es Rekruten gibt, mangelt es an Aushebungsoffizieren.1
Der Andere Mein Kompliment, Herr Frisch. Sie schreiben und reden, wie Sie heißen. In Ihrer Erzählung gibt es des Entzückenden viel, Sie sind ein Zauberer im Buch, wo Sie es mit Erde, Sonne, Mond und Sternen zu tun haben. Wenn Sie das Meer einer Segelfahrt zur Verfügung stellen, so entsteht immer etwas bewegt Schönes. Weder Hilde noch Inge erfahren so viel Aufmerksamkeit der Beschreibung, wo Sie dem Meer antun. Einmal malen Sie das Wasser als »bierflaschengrün«, einmal wie schweren Samt, und wenn die Sonne sich im Meer zerspiegelt, so haben Sie das rechte Bild für »dieses jauchzende Glitzern, als hätte man Quecksilber vergossen«; immer wieder finden Sie für die unerschöpfliche Farbenfreude des Meeres neue Vergleiche. Sie hätten das Zeug in sich, einen Roman ohne Menschen zu schreiben, der sogar kurzweilig wäre – auch wenn Sie statt der Zauberküste Ragusa nur mit dem Zürichsee vorliebnehmen müssten.
[Max] Frisch Sie mögen recht haben, die landschaftliche Stimmung mag das Reifere sein, da ein junger Mensch von 22 Jahren vor der Landschaft eher die klärende Entfernung hat als den Mitmenschen gegenüber, die aus der überlegenen Götterperspektive zu sehen und nachzuzeichnen vielleicht erst der Segen eines vollendeten Menschendaseins ist. Aber auch die Menschen des Romans liegen mir sehr am Herzen und andern nicht?
Der Andere Ich fände, um kritisch zu sein, Ihre Gestalten interessanter, wenn sie manchmal verschwiegener wären. Jede spricht so geschliffen wie in einem Drama.
Max Frisch Mein Roman war auch ein Kammerspiel im ersten Wurf, das zu lyrisch ausfiel. –
Der Andere Die Umschmelzung ehrt Ihre künstlerische Selbstkritik. Vielleicht wird in Ihrem Roman zu geistreich gesprochen.
Max Frisch Kann man »zu« geistreich sein?
Der Andere Wer es »zu« ist, hört auf, es zu sein. Was den Leser an Ihrer Erzählung fesseln wird, ist weniger der spielerische und gekonnte Dialog, als die durchhaltende Anmut, das Fluidum und die Erregtheit Ihres Erzählens, weniger der frühe virtuose Zug als die Redlichkeit, mit der Sie das Bildnis, die éducation sentimentale Jürg Reinharts zu zeichnen sich bemühen. Irre ich mich?
Max Frisch Gewiss nicht, wenn Sie herausfühlen, was ich darstellen wollte: das geheimnisvolle Entfalten einer Jünglingsseele, die angesichts des Todes männliche Stärke und Reife erringt; denn es handelt sich um eine Freundin, die unheilbar erkrankt liegt, um eine mütterlich Führende, welche diesen gehemmten Nichthandelnden, dieses Hamletchen der Liebe, hineinreißt in eine große Tat, hineinreißt durch die Gewalt seiner Liebe. Und dass Jürg, der in so viel Gewöhnlichem versagte, dieser ungewöhnlichen Tat gewachsen bleibt, nachdem sie geschehen ist und er ihre Tragweite erkennen muss: darin besteht sein Mannsein, das er also ganz anderswo gefunden hat, nicht im Erlebnis der Frau, welche ihm noch das große Geheimnis bedeutet, sondern in einem Ereignis, das vor allem Mut, Selbstüberwindung und freilich auch Liebe verlangte, aber verzichtende Liebe. Es ist das große Opfer, was uns vielleicht allein den Eingang zum Mitmenschen erschließt, und so wird er einer Freundschaft teilhaftig, die ihn weit übers Geschlechtliche hinaushebt, das ihn zu zerbrechen drohte, einer geläuterten Verbundenheit, die auch über die Grenze zwischen Leben und Tod gilt, ja, die ihm diese so fremd gewesene Welt erst eröffnet und ihn endlich frei macht fürs Leben.
Der Andere Möge nun dieser Jürg Reinhart würken [sic] und aus seiner insularen Existenz im tätigen Menschenkontakt aufgehen, denn das Leben boxt ihn in aufregende Probleme hinein. Sie jagen ihm ja schließlich auch den Ernst des Lebens in Herz und Hirn, denn nach dem lyrischen Anfang werden Sie tragisch, spannen den dramatischen Bogen, behandeln sogar das Problem des Tötendürfens aus Liebe in einem, wie Sie meinen, erschöpfend motivierten Fall – und überspannen den Bogen Ihrer Erzählung, denn auf dem Raum, den Sie dieser dunkelschweren Episode geben, wird das Schwere nur romanhaft erkannt.
Max Frisch Wenn mir aber das wirkliche Leben diese Episode auferlegt hätte? Wenn ich nicht anders konnte?
Der Andere Das ist ja das Lebendige Ihrer Erzählung, dass Sie in ihr mitten drin stehen, mitleiden, selbst, wenn Sie im wichtigsten Augenblick mit Ihrem Ebenbild nach Istanbul entwischen und durch falsche und echte Perserteppich-Erlebnisse abgelenkt werden.
*
Jetzt käme wieder Max Frisch das Wort zu. Und zweifellos hätte er Triftiges erwidern können, denn eines so auffallenden Erstlings Fehler – sind ebenso Quellen der Vorzüge. Der Autor scheint aber den Tasso gelesen, ja beherzigt zu haben und Lob und Tadel ertragen zu können. Es spricht für den werdenden Dichter Max Frisch. Und der Andere wünschte sich im Stillen, dass der Autor, seinem Namen treu, etwas Erfrischendes im künftigen Schrifttum werde.
k.
[Jede Zeit hat ihre ideologischen Klischees]
(1959)
Der Schriftsteller und Intellektuelle Enrico Filippini (1932-1988) war ein gebürtiger Tessiner, wanderte aber jung nach Italien aus, wo er zunächst bei Feltrinelli als Lektor und später bei der Tageszeitung La Repubblica als Journalist arbeitete. Er war ein bedeutender Vermittler deutschsprachiger Literatur in Italien, nicht zuletzt durch seine zahlreichen Interviews, in denen er sich als ebenso gewandter wie bewanderter Gesprächspartner erwies.
Mit Max Frisch führte Filippini mehrere Interviews, das erste im Jahr 1959, als bei Feltrinelli die italienische Übersetzung von »Homo faber« erschien (und Frisch kurz davor stand, nach Rom überzusiedeln). Das Interview wurde aber allem Anschein nach nie publiziert. Weitere Interviews folgten in den siebziger und achtziger Jahren. Zudem übersetzte Filippini Frischs »Wilhelm Tell für die Schule«, das »Dienstbüchlein« und einige der Theaterstücke.
Filippini und Frisch verband eine Freundschaft, die über lange Jahre bestand. Als Filippini 1988 im Alter von nur 56 Jahren starb, erschien im Corriere del Ticino ein Nachruf Frischs, in dem er den verlorenen Freund würdigt als »Kenner der deutschen Literatur, wach im Zuhören und kritisch im Urteil, auch im Disput noch galant«, und als einen, der »Freude ausstrahlte, Freude an Geist«.
Das erste Interview der beiden von 1959, das bei den schriftstellerischen Prägungen Frischs ansetzt und bis zu den Rollenspielen des modernen Menschen hinführt, wird hier erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht. Textgrundlage bilden die Typoskripte, wie sie im Archivio Enrico Filippini an der Biblioteca Cantonale di Locarno greifbar sind. Die Fragen Filippinis wurden vom Herausgeber des vorliegenden Bandes, von dem auch der Titel des Interviews stammt, aus dem Italienischen übersetzt; Frisch selbst wird zitiert nach dem Wortlaut des deutschsprachigen Typoskripts, das nur die Antworten enthält und von Frisch signiert ist.
*
Enrico Filippini Wenn Sie Ihre intellektuelle Herkunft angeben müssten, den Ursprung Ihrer Inspiration, welche Autoren, welche kulturelle Atmosphäre würden Sie anführen?
Max Frisch Mit 23 Jahren habe ich die Schriftstellerei aufgegeben. Nach einem kurzen Studium der Literatur an der Universität Zürich und nach der Veröffentlichung eines konventionellen Erstlings. Zehn Jahre später, als ich es nochmals mit der Schriftstellerei versuchte, war ich Architekt, diplomiert, Inhaber eines Ateliers. Der Kontakt mit der deutschen Emigration in der Schweiz, mit Antifaschisten liberaler, katholischer, kommunistischer Herkunft, und die problematische Lage der Schweiz zwischen Hitler und Mussolini, die Nähe des Krieges, der uns anders vor Augen geführt worden ist als den Kriegführenden, das machte mich zum Schriftsteller, der Bankrott einer Kultur, der wir angehört haben. Das wurde das Thema meiner ersten Stücke Nun singen sie wieder, 1945, und Die Chinesische Mauer, 1946, auch Graf Öderland, 1950, vor allem auch das Tagebuch 1946-1949, das eine persönliche und konkrete Registration der Nachkriegszeit und ihrer Hoffnungen versuchte. Also der Ursprung meiner Schriftstellerei war das akute Engagement, wenn auch nicht das Engagement an eine Partei; das naive Vergnügen am Theater kam hinzu, das artistische Interesse, erst später (aus einer gewissen Enttäuschung über das heutige Theater als Institution ohne gesellschaftliche Funktion) das Interesse am Roman. Nicht nur die politische Stagnation in der Schweiz und die Resignation angesichts der deutschen Entwicklung unter Adenauer, sondern auch eine größere Menschenerfahrung führten dazu, dass sich die Thematik verlagerte; ich glaube, mein wesentliches Problem ist die verlorene Identität des Menschen mit sich selbst, Stiller, Homo faber. Mein bisher letztes Stück Biedermann und die Brandstifter, 1957, ist eine politische Komödie des Bürgers, der mit seiner Ideologie nicht mehr identisch ist und daher dem Untergang geweiht.
Filippini Welchen deutsch- oder fremdsprachigen Autoren fühlen Sie sich besonders verbunden?
Frisch Entscheidend für mich war die persönliche Bekanntschaft mit Brecht.2
Filippini In Ihrem Tagebuch sprechen Sie von der Möglichkeit, Brechts Thesen zur Verfremdung auf die Epik zu übertragen. Haben Sie es versucht? Könnte man zum Beispiel den Umstand, dass Homo faber »Ein Bericht« ist, in diesem Sinne interpretieren, ihn folglich lesen als Versuch, eine Pseudoeinfühlung zu erzeugen?
Frisch Die These von Brecht, dass das Theater als bewusstes Spiel aufzufassen ist, dass es nicht Illusion gibt, sondern Modell, zielt auf ein Problem, das auch den modernen Romancier beschäftigt, unabhängig von Brecht. Die Notiz3 aus dem Tagebuch, die Sie hervorheben, war eine Notiz einer ersten Ahnung davon. Heute bin ich überzeugt, dass die Epik einen analogen Weg geht: nicht Illusion, sondern Modell. Der Leser braucht nicht zu glauben; erzählt wird ein Spiel, das uns als Spiel bewusst sein soll. Im Homo faber wird es dadurch versucht, dass eine höchst unwahrscheinliche Geschichte – unwahrscheinlich wie die antike Tragödie – von einem Ingenieur geschrieben wird im Ton eines Rapportes, was in diesem Fall eine durchaus ironische Form ist. Im Stiller liegt die Ironie darin, dass Stiller, der nicht mit sich identisch ist, Stiller beschreibt als eine fremde Person. Aber in Zukunft möchte ich viel weiter gehen! Es müsste gelingen, die Illusion gänzlich aufzulösen, das heißt, ich möchte nicht erzählen, als ob die Geschichte je geschehen wäre, sondern Fiktion erzählen als Fiktion. Der Mensch ist keine Geschichte, oder anders gesagt: jedes Ich hat hundert Geschichten, die nie geschehen sind, und was in Wirklichkeit mit ihm geschieht, ist nur die Folge von Fiktionen. Noch weiß ich nicht, wie man das darstellt.
Filippini Jedes Ihrer Werke enthält auch einen kritischen Beitrag zu unserer Zeit. Denken Sie, dass der Roman heutzutage besonders diesem Zweck dient?
Frisch Der Roman muss nicht zeitkritisch sein, aber dass er sich eignet für Zeitkritik, ist bekannt.
Filippini Kann die Tatsache, dass Sie Schweizer sind und in der Schweiz leben, dazu beigetragen haben, jenes »Gefühl der Fremde« literarisch fruchtbar zu machen, von dem Sie in Ihrer Rede über Das Engagement des Schriftstellers heute4 sprechen? Und glauben Sie, dass es irgendeinen objektiven Grund dafür gibt, dass, wie es beispielsweise Paolo Milano oder Cesare Cases festgestellt haben,5 heute die besten deutschsprachigen Romane von Schweizern geschrieben werden?
Frisch Ich schätze Dürrenmatt als Dramatiker sehr hoch. Warum die Deutschen zurzeit keinen Dramatiker haben, weiß ich nicht. Was Paolo Milano und Cesare Cases sagen mit Bezug auf Dürrenmatt und mich, nämlich dass die beste deutschsprachige Literatur zurzeit von Schweizern gemacht werde, halte ich für einen Irrtum. Es gibt zwei oder drei deutsche Lyriker, junge, von Format, und in der Epik sehe ich auch zwei oder drei jüngere Deutsche am Start, die mir so aussehen, als werden sie Leute wie Robbe-Grillet schon in der ersten Runde überholen. Glauben Sie, dass Robbe-Grillet so bedeutend ist, wie die Franzosen glauben müssen, weil sie ungern über Paris hinausblicken?
Filippini In Ihrer genannten Rede sprechen Sie von der Notwendigkeit einer »Zersetzung der Ideologie«. Sie haben diese Notwendigkeit sehr früh verspürt, sie hat sich Ihnen aufgedrängt, und heute wird diese Notwendigkeit von allen anerkannt. In welchem Ausmaß halten Sie diese Zersetzung für möglich? Kann Homo faber in dieser Hinsicht gelesen werden?
Frisch Zersetzung der Ideologie – das ist ein gefährliches Wort, was ich da gesagt habe. Ich halte es für eine Wirkung jedes echten Schriftstellers, ja, aber ich kann meine eignen Werke nie als Beispiel nehmen, denn sie sind nicht das, was ich will, sondern nur, was ich kann. Darum habe ich es gesagt am Beispiel von Georg Büchner, aber Sie können auch andere große Autoren nehmen, alte und neue. Jede Zeit hat ihre ideologischen Klischees, denen wir mit Ja oder Nein verfallen: beides bedeutet Unheil. Sowohl das Ja wie das Nein verfehlt die Wahrheit. Brecht schrieb über seinen Arbeitstisch: Die Wahrheit ist konkret.6 Das gilt als Voraussetzung für jede dichterische Produktion, die mehr ist als Publizistik. Der Publizist illustriert eine Ideologie; der Dichter lässt sogar seine eigene Ideologie, ob er will oder nicht, scheitern an der Wahrheit, die konkret wird durch ihn – und damit befreit er Leben.
Filippini Im Hintergrund von Homo faber sieht man ein dunkles Schicksal aufblitzen, wohl zerstörerische, antike Mythen. Eine Art von Nemesis. Sehen Sie unsere Zeit bedroht von einer Nemesis dieser Art?
Frisch Wir sind bedroht, das glaube ich allerdings. Ich habe einen Techniker dargestellt; unter allen Arten von Zeitgenossen ist es der Techniker, dessen Hybris am größten und dümmsten ist. Die Geschichte, die unser Held erleidet, kann nur einem Blinden widerfahren. Nemesis? Sie mögen es so nennen, ja, mit einem Begriff, der ihm fremd ist, nicht weil er zu wenig Bildung hat, sondern weil ihm das Leben fremd ist. Und das Leben ist ihm fremd, weil er ohne den Tod zu leben versucht … Aber ich will nicht mein eigner Interpret sein! – nur noch dies: Ist dieser Walter Faber, Ingenieur, wirklich der homo technicus, oder spielt er sich nur in diese Rolle hinein? Es gibt ja Rollen, die ein Zeitalter uns anbietet, und Millionen von Menschen übernehmen die Rolle, die ihnen imponiert. Ist es nicht merkwürdig, dass dieser Faber immerzu imponieren will? Imponieren mit seinem »understatement«. Wem imponieren? Sich selbst. Warum? Weil er nicht weiß und nicht zu wissen wagt, wer er selbst ist. Ich glaube, dass die allermeisten Leute seiner Art tatsächlich eine Rolle spielen; sie sind nicht, wie sie tun; sie kokettieren mit ihrem Mangel an Transzendenz; sie sind sehr viel reicher, als sie meinen. Jedenfalls gilt das für Faber; er hätte die Welt erleben können. Ich glaube nicht, dass er der moderne Mensch ist; er posiert einen Typus, den er für den modernen Menschen hält und der eine Fiktion ist.
–
PS.
Warum fragen Sie mich nicht, wo ich am liebsten leben möchte im heutigen Europa? Dann würde ich Ihnen sagen: in Norditalien, Lago di Varese, Lago di Como, Lago di Garda, und vielleicht würde ein Leser, der unser Interview liest, mir schreiben, wo das Haus zu finden ist, das ich suche.
Werkstattgespräch mit Max Frisch
(1961)
Angeregt durch ein Interview mit William Faulkner in der amerikanischen Literaturzeitschrift The Paris Review (vgl. dazu auch →) beschloss der Schriftsteller Horst Bienek (1930-1990), Werkstattgespräche mit deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen zu führen, darunter Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt, Uwe Johnson, Marie Luise Kaschnitz, Wolfgang Koeppen und Martin Walser. Grundgedanke der Gespräche war, den individuellen Arbeitsweisen, den »Phasen des schöpferischen Prozesses«, auf die Spur zu kommen. Dazu besuchte Bienek die Autoren an ihren Arbeitsorten und bereitete die Gespräche mit ihnen gemeinsam vor. Sie wurden auf Band aufgezeichnet, verschriftlicht und von beiden Seiten gegengelesen.
Mit Max Frisch sprach Bienek in dessen römischer Wohnung in der Via Giulia, kurz nach Beendigung von »Andorra«. Im Zentrum von Bieneks Interesse stand Frischs Verhältnis zum Tagebuch, doch berührt das Gespräch auch Grundfragen der modernen Epik und Dramatik oder die Frage nach der fiktionalen Grundlage der Existenz. Seine Eindrücke des Gesprächs schildert Bienek wie folgt: »Frisch ist von wohltuender Sachlichkeit. Ich habe ihm am Vortage meine Fragen gestellt, er hat sich dazu Notizen gemacht und formuliert jetzt präzise und überlegt. Er sitzt da, in einem tiefen Sessel, zieht an seiner Pfeife, die ständig ausgeht, die er aber unermüdlich und sehr geduldig immer wieder anzündet. Es ist Sommer 1961.«
*
Horst Bienek Herr Frisch, ich darf mit einer ganz einfachen Frage beginnen: Wie kamen Sie darauf, Theaterstücke zu schreiben? Sie haben doch zunächst nur Prosa publiziert. In einer autobiographischen Skizze7 erwähnen Sie, dass nach der Veröffentlichung des Romans Die Schwierigen Kurt Hirschfeld, damals Dramaturg, jetzt Direktor am Zürcher Schauspielhaus, Sie zum Stückeschreiben ermuntert habe. War dies der eigentliche Anlass?
Max Frisch Nein. Der eigentliche Anlass, das wissen Sie als Schriftsteller auch, ist geheimnisvoller. Aber Sie haben insofern recht, als Kurt Hirschfeld mich zum Stückeschreiben ermunterte, ohne wissen zu können, dass ich als Gymnasiast meine Stücke geschrieben habe im Tempo eines Lope de Vega; ich war ein Mann über dreißig, Architekt, einer, der nicht seine Lust am Theater, aber seine Hoffnung, die Bühne zu seinem Bauplatz machen zu können, längst begraben hatte. Was heißt Ermunterung? Ich kann einen Maler, zum Beispiel, noch so herzhaft ermuntern, ein Fresko zu versuchen, und es heißt gar nichts, wenn ich ihm nicht eine Wand, so groß wie meine Ermunterung, zur Verfügung stelle. Das hat das Zürcher Schauspielhaus getan, damals die einzige lebendige Bühne deutscher Sprache. Man ließ mich zu den Proben von Brecht, Sartre, Lorca, Giraudoux, Claudel unter der einzigen Bedingung, im Dunkeln nicht zu rauchen und nicht zu husten. Proben, Sie wissen es, sind unwiderstehlich. Zwei Monate später – ich hatte mein Architektur-Atelier und tagsüber keine Zeit – brachte ich mein erstes Stück fertig.
Bienek Welches war Ihr erstes Stück, und hatten Sie auch gleich damit Erfolg?
Frisch