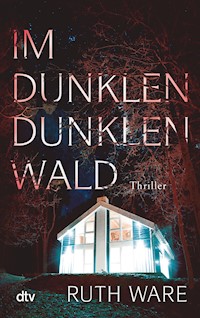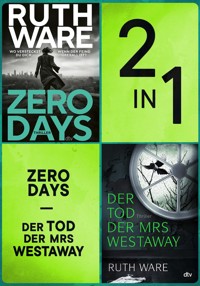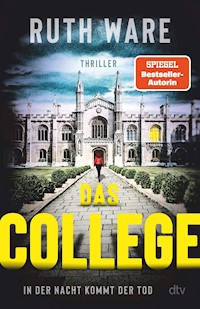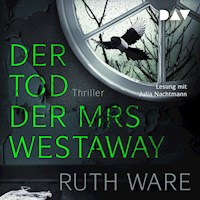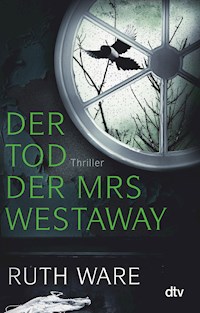9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ich konnte das Buch einfach nicht mehr weglegen.« Reese Witherspoon Ein harmloses Spiel um Wahrheit und Lüge – mit schrecklichen Folgen Packend, atmosphärisch, voller Überraschungen und Wendungen: Der New-York-Times-Bestseller jetzt im Taschenbuch. »Ich brauche deine Hilfe.« Mehr steht nicht in der Nachricht, die Isa von einer alten Schulfreundin bekommt. Aber die wenigen Worte genügen. Isa lässt alles stehen und liegen und fährt nach Salten – dem Ort, wo sie einst mit ihren drei Freundinnen Kate, Thea und Fatima das glücklichste und zugleich grauenvollste Jahr ihres Lebens verbracht hat. Was am Ende jenes Jahres geschah, wird keine von ihnen je vergessen. Nun ist an der Küste eine Leiche gefunden worden. Sie alle wissen, wer es ist. Und sie wissen auch, wie die Leiche dort hingekommen ist, damals, vor siebzehn Jahren. Meisterhaft erzählte Frauen-Psycho-Spannung Vier Freundinnen kehren an den Ort zurück, wo sie gemeinsam zur Schule gegangen sind. Als sie fünfzehn waren, ist etwas Grauenvolles passiert. Und jetzt droht es ans Licht zu kommen – was sie um jeden Preis verhindern müssen. »Ware hat eine einzigartige Fähigkeit, Köder auszulegen und dann eine gänzlich unvorhergesehene Wendung zu machen. Eine sehr originelle Story über vier Freundinnen, die ein – zunächst ganz harmloses – Lügenspiel erfinden, das schreckliche Folgen haben wird.« Marie Claire »Es ist nur eine kurze, kryptische Nachricht:›Ich brauche deine Hilfe.‹ Aber sie genügt, um vier Freundinnen in einem englischen Küstenort wieder zusammenzubringen – und den Lesern zu signalisieren, dass sie sich in den Händen einer Könnerin befinden.« The New York Times Von Ruth Ware sind bei dtv außerdem folgende spannende Thriller erschienen: Woman in Cabin 10 Hinter diesen Türen Wie tief ist deine Schuld Im dunklen, dunklen Wald Der Tod der Mrs Westaway Das Chalet Das College Zero Days
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über das Buch
»So viele Rätsel … bis zur allerletzten Seite! Ich konnte das Buch einfach nicht mehr weglegen.« (Reese Witherspoon)
»Ich brauche deine Hilfe.« Mehr steht nicht in der Nachricht, die Isa von ihrer alten Schulfreundin Kate bekommt. Aber die wenigen Worte genügen. Isa lässt alles stehen und liegen und fährt nach Salten – dem Ort, wo sie einst mit ihren drei Freundinnen Kate, Thea und Fatima das glücklichste und zugleich grauenvollste Jahr ihres Lebens verbracht hat. Sie waren damals fünfzehn und eine eingeschworene Clique mit dem Ruf, unberechenbar, wild und gefährlich zu sein, nicht zuletzt wegen des »Lügenspiels«, das sie mit ihrer Umgebung spielten. Was am Ende jenes Jahres geschah, wird keine von ihnen je vergessen. Nun ist an der Küste allerdings eine Leiche gefunden worden. Sie alle wissen, wer es ist. Und sie wissen auch, wie die Leiche dort hingekommen ist, vor siebzehn Jahren …
Von Ruth Ware sind im dtv außerdem erschienen:
Im dunklen, dunklen Wald
Woman in Cabin 10
Der Tod der Mrs Westaway
Hinter diesen Türen
Das College
Das Chalet
Zero Days
Ruth Ware
Wie tief ist deine Schuld
Thriller
Deutsch von Stefanie Ochel
Für Hel, mit (siebzigmal) Liebe
Weit und ruhig ist der Reach an diesem Morgen, am zartblauen Himmel ziehen rosa Schäfchenwolken, die schwache Brise hinterlässt kaum ein Kräuseln auf dem Meer. Es ist so still, dass das plötzliche Bellen des Hundes wie ein Pistolenschuss durch die Luft hallt und einen Schwarm Möwen in die Flucht treibt, die nun schreiend am Himmel kreisen.
Regenpfeifer und Seeschwalben fliegen erschreckt auf, als der Hund ausgelassen die wellige Düne hinabspringt, über spitze Gräser bis zum schilfbewachsenen Schlickboden des Ufers, dort, wo sich Süß- und Meerwasser durchmischen.
In der Ferne ragt schwarz und marode die Gezeitenmühle in den kühlen Morgenhimmel, als einziges menschengemachtes Gebilde in einer bröckelnden Landschaft, die Stück für Stück wieder vom Meer verschlungen wird.
»Bob!«, schallt die Stimme der Frau durch das wilde Gebell, als sie keuchend zu ihm aufschließt. »Bob, du Rabauke! Aus! Aus! Lass los! Was hast du da?«
Der Hund zerrt wieder, und beim Näherkommen sieht sie einen Gegenstand im Schlamm stecken. Ungeduldig versucht der Hund, ihn herauszuziehen.
»Bob, du versifftes Viech, guck dich mal an. Lass los. Aus! O Gott, nicht schon wieder ein totes Schaf.«
Ein letzter entschiedener Ruck, dann taumelt der Hund ein paar Schritte zurück, er hat etwas im Maul. Triumphierend trägt er den Gegenstand das Ufer hinauf und legt ihn vor seiner Besitzerin ab.
Und als sie da steht, sprachlos, mit dem hechelnden Hund zu ihren Füßen, kehrt die Stille in die Bucht zurück, wie die einlaufende Flut.
Regel Nr. 1 Verbreite eine Lüge
Ein Standardton meldet den Eingang der Nachricht, ein leises Piep-Piep in der Nacht, das Owen nicht weckt und auch mich nicht geweckt hätte, wäre ich nicht längst wach, mit einem Baby an der Brust, das nicht so richtig saugen und nicht so richtig loslassen will.
Ich stutze einen Moment – was kann das sein? Wer schreibt mitten in der Nacht? Von meinen Freundinnen ist um diese Zeit keine wach … es sei denn, Milly liegt schon in den Wehen … Gott, hoffentlich ist es nicht Milly! Ich hatte ihr versprochen, mich um Noah zu kümmern, falls ihre Eltern es aus Devon nicht rechtzeitig hierher schaffen würden, um ihn zu nehmen, aber ich hatte nicht geglaubt …
Aus meiner Sitzposition komme ich nicht ganz an das Telefon ran, also schiebe ich Freya einen Finger in den Mundwinkel, um sie von meiner Brust zu lösen. Sanft wiegend lege ich sie auf den Rücken, woraufhin sie milchsatt gluckst und die Augen nach hinten rollen lässt wie auf Droge. Ich betrachte sie noch einen Moment, lege meine Hand sachte auf ihren kleinen festen Körper, fühle ihr winziges Herz hinter den Rippen flattern wie ein Vogel im Käfig.
Allmählich dämmert sie weg. Ich greife zum Telefon, spüre, wie mein eigenes Herz schneller wird, ein schwaches Echo des ihren.
Ich tippe meine PIN ein, kneife die Augen zu gegen das grelle Leuchten des Bildschirms und mahne mich zur Ruhe – es sind noch vier Wochen bis zu Millys errechnetem Termin, und wahrscheinlich ist es nur Werbung. Beantragen Sie noch heute Ihre exklusive GoldCard.
Aber dann ist der Bildschirm entsperrt, und die Nachricht ist nicht von Milly. Und sie besteht aus nur drei Wörtern.
Ich brauche euch.
Es ist halb vier Uhr morgens, doch ich fühle mich mit einem Mal sehr, sehr wach, haste auf den kalten Küchenfliesen auf und ab und kaue an meinen Fingernägeln, um das plötzliche Verlangen nach einer Zigarette zu stillen. Fast zehn Jahre habe ich nicht mehr geraucht, aber in Stress- und Angstmomenten wie diesem fällt es mir immer noch schwer.
Ich brauche euch.
Ich frage mich nicht, was die Nachricht bedeuten soll – ich weiß es, ebenso wie ich weiß, von wem sie stammt, auch wenn ich die Nummer nicht kenne.
Kate.
Kate Atagon.
Schon der Name genügt, damit die Erinnerung mich einholt wie ein Sinnesrausch: der Duft ihres Shampoos, die Sommersprossen auf ihrer Nase, Zimtbraun auf Olivenhaut. Kate. Fatima. Thea. Und ich.
Mit geschlossenen Augen stehe ich da und stelle sie mir alle vor, während ich das Handy in der Tasche meiner Pyjamahose fest umschließe, auf ihre Antworten warte.
Fatima wird schlafen, sich an Alis Rücken gekuschelt haben. Ihre Antwort wird gegen sechs eintreffen, wenn sie aufsteht, um Nadia und Samir vor der Schule Frühstück zu machen.
Thea – Thea kann ich mir schwerer vorstellen. Falls sie Nachtschicht macht, wird sie im Casino sein, wo Handys für die Mitarbeiter verboten sind und in Schließfächern verstaut werden. Gegen acht wird sie Schluss machen. Und dann? Vielleicht geht sie mit den Kolleginnen noch etwas trinken, noch aufgeputscht von einer gelungenen Nacht unter Glücksspielern, in der sie Jetons austeilen und nach Profizockern und Betrügern Ausschau halten musste. Doch dann wird sie antworten.
Und Kate. Kate ist wach – sie hat die Nachricht schließlich geschickt. Sie wird am Arbeitstisch ihres Vaters sitzen, der inzwischen ihr eigener ist, vor dem Fenster mit Ausblick auf den Reach, der im Licht der frühen Dämmerung hellgrau schimmert und auf dem sich die Wolken und der dunkle Rumpf der Mühle spiegeln. Sie wird eine Zigarette rauchen. Sie wird die Gezeiten beobachten, die ständig wechselnden, strömenden Gezeiten auf diesem Landstrich, der sich nie ändert, und doch von einem Moment zum nächsten nie der Gleiche ist – genau wie Kate selbst.
Ihre langen Haare hat sie zurückgebunden, sodass sie den Blick freigeben auf ihre feinen Züge und die Fältchen, die zweiunddreißig Jahre Küstenwinde um ihre Augen gezeichnet haben. Ihre Finger sind mit Ölfarbe befleckt, die in die Nagelhaut und bis unter die Nägel gedrungen ist, und ihre Augen funkeln in einem dunklen Schieferblau, tief und unergründlich. Sie wartet auf unsere Antworten. Aber sie weiß bereits, was wir sagen werden – was wir immer gesagt haben, immer wenn diese Nachricht kam, diese drei Wörter.
Ich komme.
Ich komme.
Ich komme.
Ich komme!« Meine Stimme hallt durchs Treppenhaus nach oben, wo Owen mir über Freyas müdes Quengeln hinweg etwas zuruft.
Als ich ins Schlafzimmer komme, läuft er mit ihr im Arm auf und ab, sein Gesicht noch gerötet und zerknautscht von den Kissen.
»Sorry«, sagt er mit einem unterdrückten Gähnen. »Ich wollte sie beruhigen, aber keine Chance. Du weißt, wie sie ist, wenn sie Hunger hat.«
Ich lasse mich aufs Bett sinken, rutsche rückwärts gegen die Kissen bis zum Kopfteil und nehme Owen Freya ab, die mir aus ihrem rot angelaufenen Gesicht einen beleidigten Blick zuwirft, bevor sie sich mit einem zufriedenen Grunzer an meiner Brust zu schaffen macht.
Bis auf ihr gieriges Schmatzen ist es still im Raum. Owen gähnt erneut, wuschelt sich durch die Haare und nach einem kurzen Blick auf die Uhr schlüpft er in seine Unterwäsche.
»Stehst du schon auf?«, frage ich verwundert.
»Macht keinen Unterschied mehr. Um sieben muss ich sowieso raus. Scheiß Montag.«
Ich sehe auf die Uhr. Schon sechs. Ich muss länger durch die Küche gewuselt sein als gedacht.
»Warum bist du überhaupt auf?«, fragt er. »Hat die Müllabfuhr dich geweckt?«
Ich schüttle den Kopf.
»Nein, ich konnte einfach nicht mehr schlafen.«
Eine Lüge. Fast hatte ich vergessen, wie sie sich auf der Zunge anfühlen, aalglatt und widerlich. In meiner Tasche spüre ich das harte Gehäuse meines Handys. Bald wird es vibrieren.
»Ach so.« Er unterdrückt ein weiteres Gähnen und knöpft sich das Hemd zu. »Ich mach Kaffee – möchtest du auch einen?«
»Ja, gern«, sage ich. Dann, gerade als er das Zimmer verlässt: »Owen …«
Aber da ist er schon außer Hörweite.
Zehn Minuten später kommt er mit dem Kaffee zurück, genug Zeit, um mir die Worte zurechtzulegen und darüber nachzudenken, wie ich sie möglichst lässig über die Lippen bringen kann. Trotzdem muss ich schlucken, mein Mund ist vor Anspannung staubtrocken.
»Owen, gestern hat Kate mir geschrieben.«
»Kate von der Arbeit?« Mit einem dumpfen Geräusch setzt er die Tasse vor mir ab, ein wenig Kaffee schwappt über, den ich mit dem Ärmel aufwische und so mein Buch schütze. Die Panne gibt mir Zeit, meine Antwort zu formulieren.
»Nein, Kate Atagon. Von meiner Schule, erinnerst du dich?«
»Ach, die Kate. Die ihren Hund mit zu dieser Hochzeit genommen hat?«
»Genau. Shadow war das.«
Ich sehe ihn vor mir. Shadow – der weiße deutsche Schäferhund mit der schwarzen Schnauze und dem rußgesprenkelten Rücken. Der in der Tür steht und jeden Fremden anknurrt, aber denen, die er mag, voller Begeisterung einen schneeweißen Bauch zum Kraulen entgegenstreckt.
»Also?«, hakt Owen nach, und ich merke, dass ich den Faden verloren habe.
»Ach ja. Sie hat mich eingeladen, sie zu besuchen, und eigentlich hätte ich Lust.«
»Klingt nach ’ner guten Idee. Wann würdest du denn hinfahren?«
»Also eigentlich sofort … sie hat mich spontan eingeladen.«
»Und Freya?«
»Die würde ich mitnehmen.«
Was denn sonst, würde ich am liebsten hinzufügen, aber halte mich zurück. Freya hat die Flasche noch nie angenommen, trotz unserer unermüdlichen Versuche. An einem Abend, als ich auf einer Party war, brüllte sie von 19 Uhr 30 bis Punkt 23 Uhr 58 unbeirrt durch, genau bis zu dem Moment, als ich zur Tür hereinstürmte und sie aus Owens schlaffen, erschöpften Armen an mich riss.
Wieder entsteht eine Pause. Freya lässt den Kopf zurückkippen und betrachtet mich einen Moment lang mit leicht gerunzelter Stirn, bevor sie einen kleinen Rülpser von sich gibt und sich wieder der ernsten Aufgabe des Gestilltwerdens zuwendet. Ich sehe Owen an, was ihm durch den Kopf geht … dass er uns vermissen wird, aber auch, dass er das Bett für sich allein haben wird, ausschlafen kann …
»Ich könnte dann mit dem Kinderzimmer weitermachen«, sagt er schließlich. Ich nicke, auch wenn wir schon seit Ewigkeiten über dieses Thema diskutieren – Owen hätte am liebsten das Schlafzimmer – und mich – wieder für sich und glaubt, dass Freya mit sechs Monaten so weit ist, in ihrem eigenen Zimmer zu schlafen. Ich glaube das nicht. Das ist ein Grund, warum ich bis jetzt noch nicht die Zeit gefunden habe, das Gästezimmer zu entrümpeln und in babyfreundlichen Farben zu streichen.
»Klar«, sage ich.
»Also, von meiner Seite aus steht deinem Trip nichts im Wege«, sagt Owen schließlich. Er dreht sich um und beginnt, seine Krawatten zu durchsuchen. »Willst du das Auto nehmen?«, fragt er über die Schulter.
»Nein, nicht nötig. Wir fahren mit dem Zug. Kate holt mich vom Bahnhof ab.«
»Sicher? Willst du wirklich Freyas ganzen Kram im Zug mitschleppen? Ist die gerade?«
»Was?« Ich stutze kurz, aber dann begreife ich – er meint die Krawatte. »Ach so, ja, kerzengerade. Und nein, das mit dem Zug ist kein Problem. Es ist sogar einfacher, so kann ich sie stillen, wenn sie wach wird. Ich stopfe einfach all ihre Sachen unten in den Kinderwagen.« Er antwortet gar nicht, wahrscheinlich geht er in Gedanken schon die Tagesplanung durch, hakt eine Aufgabe nach der anderen von der Liste ab, wie ich es selbst vor ein paar Monaten noch tat – heute fühlt es sich wie ein fremdes Leben an. »Dann würde ich also heute noch fahren, wenn das okay für dich ist.«
»Heute?« Er nimmt seine Münzen von der Kommode, steckt sie sich in die Hosentasche und kommt auf mich zu, um sich mit einem Kuss auf die Stirn zu verabschieden. »Warum die Eile?«
»Gar keine Eile«, sage ich. Ich spüre, wie ich rot anlaufe. Ich hasse Lügen. Einst war es ein Spaß – bis zu dem Moment, als ich keine Wahl mehr hatte. Ich denke kaum noch darüber nach, vielleicht, weil ich es schon so lange tue, aber im Hintergrund ist es immer irgendwie da, wie ein Zahnschmerz, an den man sich gewöhnt hat, der sich aber hin und wieder mit einem jähen, heftigen Stich in Erinnerung ruft.
Vor allem aber hasse ich es, Owen zu belügen. Irgendwie ist es mir bisher gelungen, ihn aus den Verstrickungen herauszuhalten, und jetzt wird er doch hineingezogen. Es ist, als ob das Gift aus Kates Nachricht heraussickert und ins Zimmer strömt – und alles zu zerstören droht.
»Für Kate passt es gerade gut, weil sie im Moment keinen Auftrag hat … und ich muss ja in ein paar Monaten schon wieder arbeiten, also ist der Zeitpunkt eigentlich ideal.«
»Okay«, sagt er und scheint zwar verwundert, aber nicht misstrauisch. »Dann gebe ich dir wohl besser einen richtigen Kuss.«
Und diesmal küsst er mich leidenschaftlich und führt mir wieder vor Augen, warum ich ihn liebe, warum ich es hasse, ihn zu belügen. Dann lässt er von mir ab und gibt Freya einen Kuss. Die hält irritiert inne und wirft ihm einen skeptischen Seitenblick zu, bevor sie mit jener unbeirrbaren Entschlossenheit weiternuckelt, die ich an ihr so liebe.
»Ich liebe dich auch, kleiner Vampir«, sagt Owen zärtlich. Und dann, zu mir: »Wie lang dauert die Fahrt?«
»Vier Stunden ungefähr. Kommt auf die Verbindung an.«
»Na, dann habt auf jeden Fall eine gute Zeit, und melde dich, wenn ihr angekommen seid. Was meinst du, wie lang du bleiben wirst?«
»Ein paar Tage«, werfe ich in den Raum. »Vor dem Wochenende bin ich zurück.« Noch eine Lüge. Ich weiß es einfach nicht. Habe nicht die geringste Ahnung. So lange eben, wie Kate mich braucht. »Mal sehen, heute Abend weiß ich mehr.«
»Okay«, sagt er noch einmal. »Lieb dich.«
»Ich dich auch.« Endlich etwas, das der Wahrheit entspricht.
Ich erinnere mich auf den Tag genau, fast auf die Stunde, die Minute genau, an meine erste Begegnung mit Kate. Es war im September. Mein Plan war, einen frühen Zug nach Salten zu erwischen, um rechtzeitig zum Mittagessen in der Schule zu sein.
»Entschuldigung!«, rief ich nervös und mit heiserer Stimme über den Bahnsteig. Das Mädchen vor mir drehte sich um. Sie war hochgewachsen und wunderschön, mit leicht hochmütigem Ausdruck, der an ein Modigliani-Porträt erinnerte. Ihr hüftlanges schwarzes Haar war an den Spitzen blondiert, der Übergang von Gold zu Schwarz fließend, und sie trug Jeans mit Rissen an den Oberschenkeln.
»Ja?«
»Entschuldigung, ist das der Zug nach Salten?«, rief ich keuchend.
Sie musterte mich abschätzig von oben bis unten, registrierte meine Salten-Uniform, den noch steifen Stoff des marineblauen Hemds und den funkelnagelneuen Blazer, den ich an diesem Morgen zum ersten Mal aus dem Schrank geholt hatte.
»Ich weiß nicht«, sagte sie schließlich, worauf sie sich ihrer Begleiterin zuwandte. »Kate, ist das der Zug nach Salten?«
»Sei kein Arsch, Thee«, antwortete das Mädchen. Ihre rauchige Stimme ließ sie älter klingen, als sie vermutlich war – sie konnte höchstens sechzehn oder siebzehn sein. Sie trug ihr hellbraunes Haar kurz geschnitten, sodass es ihr Gesicht einrahmte, und als sie mich anlächelte, verzogen sich die muskatbraunen Sommersprossen auf ihrer Nase. »Ja, der fährt nach Salten. Aber pass auf, dass du in der richtigen Hälfte einsteigst, der Zug wird nämlich in Hampton’s Lee geteilt.«
Dann drehten sie sich um und waren schon fast am Ende des Gleises angekommen, bevor mir einfiel zu fragen, welche Hälfte die richtige war.
Ich blickte hoch zur Anzeigetafel.
Vorderer Zugteil zur Weiterfahrt Richtung Salten, stand dort, aber welcher war der vordere? Wie war die Fahrtrichtung?
Es war weit und breit kein Mitarbeiter zu sehen, den ich hätte fragen können, aber da mir nur noch eine Minute bis zur Abfahrt blieb, zerrte ich meinen schweren Koffer bis zum anderen Ende und stieg ein, wo die beiden Mädchen hineingegangen waren.
Kurz darauf fand ich mich in einem Abteil mit nur sechs Sitzen wieder. Kaum hatte ich die Tür zugezogen, war auch schon die Pfeife des Schaffners zu hören, und mit der furchtbaren Ahnung, doch im falschen Zugteil gelandet zu sein, ließ ich mich auf den Sitz sinken. Ich weiß noch, wie der Wollbezug an meinen Beinen kratzte.
Mit Scheppern und metallischem Quietschen setzte sich der Zug in Bewegung, und kaum hatten wir das Dunkel des Bahnhofsgewölbes verlassen, flutete grelles Sonnenlicht das Abteil. Ich legte den Kopf zurück, schloss die Augen gegen die gleißenden Strahlen und fragte mich, während der Zug Fahrt aufnahm, was wäre, wenn ich gar nicht in Salten einträfe, wo mich die Hausleiterin schon erwarten würde. Was, wenn ich in Brighton, Canterbury oder ganz woanders landen würde? Oder noch schlimmer – wenn ich bei der Zugteilung in zwei Hälften gerissen würde und fortan zwei halbe, in entgegengesetzter Richtung verlaufende Leben führen müsste, die sich immer weiter von dem Ich, das ich hätte sein sollen, entfernen würden.
»Hallo«, sagte plötzlich eine Stimme, und ich schlug die Augen auf. »Du hast den Zug also erwischt.«
Es war das große Mädchen, zu dem das andere Thee gesagt hatte. Sie stand lässig an den Türrahmen meines Abteils gelehnt und spielte mit einer noch nicht angezündeten Zigarette in ihren Fingern.
»Ja«, antwortete ich etwas mürrisch. Ich nahm es ihnen übel, dass sie mir nicht gesagt hatten, welche Zughälfte die richtige war. »Hoffe ich zumindest. Das hier ist das richtige Ende für Salten?«
»Ist es«, sagte das Mädchen knapp. Wieder musterte sie mich von oben bis unten, klopfte dabei mit der Zigarettenspitze gegen den Holzrahmen und sagte dann mit etwas gönnerhaftem Ausdruck: »Nimm’s mir nicht übel, aber du solltest wissen, dass man die Uniform nicht im Zug trägt.«
»Was?«
»Man zieht sich in Hampton’s Lee um. Es ist … ich weiß nicht. Es ist halt so. Ich dachte, ich sag’s dir besser. Nur die im ersten Jahr und die ganz Neuen tragen sie während der ganzen Fahrt. Damit fällst du einfach auf.«
»Das heißt … du bist auch in Salten?«
»Jepp. Zu meiner Schande.«
»Thea sammelt Schulverweise«, sagte eine Stimme hinter ihr, und ich sah das andere, kurzhaarige Mädchen mit zwei Kaffeebechern in der Hand im Korridor stehen. »Von drei anderen Schulen ist sie geflogen. Salten ist ihre letzte Chance. Keiner wollte sie mehr aufnehmen.«
»Wenigstens bin ich keine Almosenempfängerin«, konterte Thea, aber die Art, wie sie es sagte, ließ keinen Zweifel daran, dass die beiden Freundinnen waren und dieses Geplänkel Teil ihrer Show. »Kates Vater ist der Kunstlehrer«, erklärte sie. »Da ist ein kostenloser Platz fürs Töchterchen inbegriffen.«
»Thea jedenfalls dürfte für Almosen nicht infrage kommen«, sagte Kate. Lautlos formte sie mit den Lippen die Worte Goldener Löffel und zwinkerte mir zu. Ich verkniff mir ein Lächeln.
Kate und Thea warfen sich einen Blick zu, und es kam mir vor, als würden sie stumm Frage und Antwort austauschen, bevor Thea wieder das Wort ergriff.
»Wie heißt du?«
»Isa«, sagte ich.
»Also, Isa.« Sie blickte mich herausfordernd an. »Warum setzt du dich nicht zu uns? Unser Abteil ist da hinten.«
Ich holte tief Luft und mit einem Gefühl wie vor dem Sprung vom Dreimeterbrett nickte ich wortlos. Als ich meinen Koffer nahm und Thea und Kate schweigend folgte, ahnte ich nicht, dass dieser kurze Moment mein Leben für immer verändern würde.
Wieder in der Victoria Station am Bahnsteig zu stehen, fühlt sich seltsam an. Der Zug nach Salten ist neu, mit offenen Abteilen und automatischen Türen, nichts erinnert mehr an das altmodische Teil mit Zuknall-Mechanik, das uns damals zur Schule brachte. Der Bahnhof allerdings hat sich kaum verändert, und mir wird plötzlich klar, dass ich diesen Ort in den letzten siebzehn Jahren unbewusst gemieden habe – dass ich alles gemieden habe, was an jene Zeit erinnerte.
Mit einem Kaffee in der Hand hieve ich Freyas Kinderwagen in einem gewagten Manöver in den Zug. Drinnen angekommen stelle ich den Becher auf einen freien Tisch und beginne den langen, immergleichen Kampf beim Versuch, den Babykorb vom Gestell zu lösen – ein umständliches Herumnesteln an Schnallen und Klippverschlüssen, die einfach nicht aufgehen wollen. Da fast nichts los ist im Waggon, bleibt mir zumindest die peinliche Situation erspart, dass vor und hinter mir Leute Schlange stehen müssen, und Drängler sind zum Glück auch keine zu befürchten. Endlich, gerade als der Schaffner pfeift und der Zug sich ächzend und wankend in Bewegung setzt, löst sich der letzte Klipp. Ich hebe den leichten Korb mit der immer noch schlafenden Freya heraus und lege ihn sicher auf einer Sitzbank ab.
Als ich zurückgehe, um mich um die Taschen zu kümmern, nehme ich den Becher mit. Ich habe Schreckensszenarien im Kopf – dass der Zug plötzlich ruckelt und sich der heiße Kaffee über Freya ergießt. Natürlich ist das irrational, sie liegt auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges. Aber so bin ich, seit ich sie habe. All meine Ängste – die sich früher auf halbierte Züge, sich schließende Aufzugtüren, zwielichtige Taxifahrer und Unterhaltungen mit fremden Menschen verteilten –, all diese Ängste haben sich zu einer Angst um Freya gebündelt.
Endlich haben wir es beide bequem, ich mit meinem Buch und meinem Kaffee, Freya im Tiefschlaf, die Schmusedecke fest an ihre Wange gepresst. In der hellen Junisonne sieht sie aus wie ein Engel, ihre Haut ist so klar und zart – und plötzlich werde ich von einer Welle der Liebe erfasst, so glühend heiß, als hätte sich der brühende Kaffee über mein Herz ergossen. Hier im Zug, in diesem Moment, bin ich nichts als die Mutter dieses Babys, und auf der ganzen Welt gibt es niemanden außer uns beiden in dieser Blase aus Glück und Sonnenschein.
Und dann merke ich, dass mein Handy vibriert.
Fatima Chaudhry steht auf dem Bildschirm. Mein Herz macht einen kleinen Sprung.
Mit zitternden Fingern öffne ich die Nachricht.
Ich komme, steht da. Fahre heute Abend los, sobald die Kinder im Bett sind. Bin zwischen neun und zehn bei euch.
Es hat begonnen. Noch keine Nachricht von Thea, aber sie wird noch kommen. Der Zauber ist vorbei, die Illusion – Freya und ich allein auf dem Weg zu einem Urlaub an der Küste – ist zerstört. Ich erinnere mich an den wahren Grund meiner Reise. Ich erinnere mich an das, was wir getan haben.
Habe den Zug 12.05 von Victoria genommen, schreibe ich an alle. Kate, holst du mich in Salten ab?
Keine Antwort, aber ich weiß, sie wird mich nicht im Stich lassen.
Ich schließe die Augen und lege eine Hand auf Freyas Brust, damit ich weiß, dass sie da ist. Und dann versuche ich zu schlafen.
Ein schleifendes Geräusch und ein unsanfter Stoß lassen mich hochfahren, mit klopfendem Herzen greife ich instinktiv nach Freya. Es dauert einen Moment, bis ich den Lärm und die Bewegung einordnen kann: Der Zug wird geteilt, wir müssen in Hampton’s Lee sein.
Freya windet sich missmutig in ihrem Korb, mit etwas Glück wird sie vielleicht wieder einschlafen – doch als es erneut knallt, heftiger als beim ersten Mal, schlägt sie erschrocken die Augen auf und schreit mit wut- und hungerverzerrtem Gesicht drauflos.
»Sch …«, säusle ich und hebe ihren warmen, strampelnden kleinen Körper aus dem Kokon aus Decken und Stofftieren. Ihre dunklen Augen funkeln empört. »Sch … ist doch gut, Mäuschen, alles in Ordnung, mein Spatz. Alles ist gut.«
Während ich mein Hemd aufknöpfe, drückt sie ihr kleines Motzgesicht forsch gegen meine Brust, und schon spüre ich die Milch einströmen, ein inzwischen bekanntes, doch immer noch fremdartiges Gefühl.
Sie beginnt zu trinken, und als es kurz darauf ein weiteres Mal rumst und quietscht und die Pfeife ertönt, setzen wir uns in Bewegung, hinaus aus dem Bahnhof, vorbei an den Nebengleisen, Häuserreihen, schließlich an Feldern mit Leitungsmasten.
Das alles kommt mir so erschütternd vertraut vor. London hat sich in den Jahren, seit ich dort lebe, ständig verändert. Die Stadt ist wie Freya, jeder Tag bringt etwas Neues. Hier eröffnet ein Laden, dort schließt ein Pub. Neue Gebäude wie das Gherkin oder TheShard sprießen aus dem Boden, aus Industriebrachen werden Supermärkte, und Bürotürme scheinen sich wie Pilze zu vermehren, schießen aus feuchter Erde und Betonschutt über Nacht in die Höhe.
Aber diese Zugfahrt, diese Strecke – nichts hat sich verändert.
Da steht die ausgebrannte Ulme.
Da hinten der alte Weltkriegsbunker.
Dieselbe klapprige Brücke, das hohle Geräusch der Räder, als der Zug sie überquert.
Ich schließe die Augen und bin zurück in jenem Abteil mit Kate und Thea, höre sie lachen, als sie sich die Röcke ihrer Uniform über die Jeans ziehen und sich die Hemden über ihren sommerlichen Trägertops zuknöpfen. Ich sehe Thea vor mir, wie sie Nylonstrümpfe über ihre sagenhaft schlanken Beine hochrollt und mit einem geübten Griff unter dem vorschriftskonformen Rock die Strapse befestigt. Ich weiß noch, wie ich rot wurde, als ich einen kurzen Blick auf ihren nackten Schenkel erhaschte, und wie ich den Blick abwandte, mit klopfendem Herzen aus dem Fenster auf die herbstlichen Weizenfelder blickte und dann hörte, wie sie über meine Verklemmtheit lachte.
»Du solltest dich beeilen«, raunte Kate Thea zu. Sie war schon umgezogen und hatte Jeans und Stiefel bereits in ihrem Koffer verstaut. »Gleich kommt Westridge, wo die Strandfanatiker zusteigen – du willst doch den Touris keinen Herzinfarkt bescheren.«
Thea streckte ihr die Zunge heraus, beeilte sich aber, die Strumpfbänder einzuhaken, und sie strich sich den Rock genau in dem Moment glatt, als wir in den Bahnhof Westridge einfuhren.
Wie Kate vorausgesagt hatte, hatte sich eine Gruppe Strandtouristen am Bahnsteig versammelt, und Thea stöhnte auf. Unser Abteil hielt auf gleicher Höhe mit einem Elternpaar und ihrem etwa sechsjährigen Sohn, der Schaufel und Eimer in der einen und ein tropfendes Schokoladeneis in der anderen Hand hielt.
»Noch Platz für drei?«, fragte der Vater kumpelhaft, bevor sie in unser Abteil einfielen und die Tür lautstark zuzogen. Das Abteil fühlte sich auf einmal heillos überfüllt an.
»Es tut mir sehr leid«, sagte Thea, und es klang, als täte es ihr wirklich leid. »Wir würden Sie gern zu uns bitten, aber meine Freundin hier«, sie deutete auf mich, »hat heute Freigang, allerdings mit der strikten Auflage, jeglichen Kontakt zu Minderjährigen unbedingt zu vermeiden. Das hat der Richter unmissverständlich klargemacht.«
Der Mann sah uns etwas irritiert an, seine Frau kicherte nervös. Der Junge hörte gar nicht zu, sondern war damit beschäftigt, Schokoladensplitter von seinem T-Shirt zu picken.
»Es geht mir nur um das Wohl Ihres Kindes«, sagte Thea mit ernster Miene. »Außerdem will Ariadne wirklich nicht zurück in die Jugendstrafanstalt.«
»Das Abteil nebenan ist frei«, sagte Kate, die sich sichtbar das Lachen verkneifen musste. Sie stand auf und zog die Abteiltür auf. »Es tut mir außerordentlich leid. Wir wollen Ihnen keine Umstände machen, aber ich glaube, es ist für die Sicherheit aller Beteiligten das Beste.«
Der Mann warf uns einen letzten misstrauischen Blick zu und trat dann mit seiner Frau und seinem Sohn hinaus auf den Korridor.
Kaum waren sie weg und die Tür noch nicht ganz zu, prustete Thea schon los, aber Kate schüttelte den Kopf.
»Dafür gibt’s keinen Punkt«, sagte sie. Ihr Gesicht zuckte vor unterdrücktem Lachen. »Die haben dir nicht geglaubt.«
»Ach, komm!« Thea zog eine Zigarette aus der Schachtel in ihrer Manteltasche, zündete sie an und nahm dem Rauchverbotsschild auf dem Fenster zum Trotz einen tiefen Zug. »Sie sind doch gegangen, oder?«
»Ja, aber bloß, weil sie dachten, dass du wahnsinnig bist. Das zählt nicht!«
»Ist das … ein Spiel?«, fragte ich verunsichert.
Ein langes Schweigen folgte.
Thea und Kate sahen einander an, und wieder beobachtete ich ihr stummes Zwiegespräch, es war, als läge ein elektrisches Knistern in der Luft. Sie schienen sich auf eine Antwort zu einigen. Und dann lächelte Kate ein kleines, fast verstohlenes Lächeln, lehnte sich zu mir vor, so nah, dass ich die dunklen Streifen in ihren graublauen Augen sehen konnte.
»Es ist nicht ein Spiel«, antwortete sie. »Es ist das Spiel. Das Lügenspiel.«
Das Lügenspiel.
Die Erinnerung holt mich ein, so scharf und lebendig wie der Geruch des Meeres und die Schreie der Möwen über dem Reach, und ich begreife nicht, wie ich das alles fast vergessen konnte – die Strichliste über Kates Bett, übersät mit den kryptischen Zeichen ihres ausgefeilten Punktesystems. So viel für ein neues Opfer. So viel, wenn jemand dir die Geschichte wirklich abkauft. Bonuspunkte für besonders ausgeschmückte Details oder dafür, jemanden wieder an die Angel zu bekommen, der den Bluff eigentlich schon durchschaut hatte. Ich habe eine halbe Ewigkeit nicht mehr daran gedacht, doch auf eine Art habe ich es über all die Jahre weitergespielt.
Ich seufze, als ich Freyas friedliches Gesicht betrachte, während sie an meiner Brust liegt, voll und ganz in den Moment vertieft. Und ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich zurückgehen kann.
Was ist passiert, dass Kate uns alle mitten in der Nacht so plötzlich und so dringend ruft?
Mir fällt nur ein einziger Grund ein … und ich kann den Gedanken nicht ertragen.
Als mein Handy zum letzten Mal piept, fahren wir gerade in Salten ein. Ich rechne damit, dass es Kate ist, die bestätigt, dass sie zum Bahnhof kommt. Aber sie ist es nicht. Es ist Thea.
Ich komme.
Der Bahnsteig in Salten ist fast menschenleer. Als das Geräusch des wegfahrenden Zugs allmählich verebbt, hält die ländliche Ruhe wieder Einzug, und mit ihr die typischen Laute eines Sommertags in Salten – das Zirpen der Grillen, der Vogelgesang, von den Feldern her das Klappern eines Mähdreschers. Früher stand immer der dunkelblaue Minibus des Internats bereit, wenn ich hier ankam. Heute ist der Parkplatz eine einzige staubige Leere, und es ist weit und breit kein Mensch zu sehen, nicht einmal Kate.
Mit der schweren Tasche über der Schulter schiebe ich den Kinderwagen zum Ausgang und überlege, was ich tun könnte. Kate anrufen? Ich habe zwar nichts von ihr gehört, aber ich gehe davon aus, dass sie meine Nachricht bekommen hat. Vielleicht ist ja ihr Akku leer. Die Mühle hat kein Festnetz, eine andere Nummer habe ich nicht.
Ich stelle die Bremse am Kinderwagen fest und will gerade mein Telefon hervorkramen, als ich ein Motorengeräusch höre, das durch den schmalen Hohlweg weiter anschwillt. Ich drehe mich um und sehe ein Auto auf den Parkplatz einbiegen. Eigentlich habe ich mit dem riesigen verdreckten Landrover gerechnet, mit dem Kate vor sieben Jahren bei Fatimas Hochzeit aufgekreuzt war; ich habe noch die langen Sitzbänke vor Augen und Shadow, der hechelnd den Kopf aus dem Fenster steckte. Stattdessen fährt ein Taxi vor. Erst bin ich nicht sicher, ob sie es wirklich ist, doch dann sehe ich sie hektisch von innen an der Klinke hantieren, und mein Herz macht einen kleinen Sprung. Für einen kurzen Augenblick bin ich keine Verwaltungsjuristin und Mutter mehr, sondern einfach ein Mädchen, das am Bahnhof seiner Freundin in die Arme läuft.
»Kate!«
Sie hat sich nicht verändert. Dieselben schmalen, knochigen Handgelenke, ihr nussbraunes Haar und honigfarbenes Gesicht, die Stupsnase mit den Sommersprossen, genau wie früher. Die Haare trägt sie zwar länger, mit einem Gummi zusammengebunden, und in der feinen Haut um ihre Augen und ihren Mund sind kleine Fältchen zu sehen, aber ansonsten ist sie einfach Kate, meine Kate. Als wir uns umarmen, atme ich ihren Geruch ein, der immer noch der gleiche ist, die unverwechselbare Mischung aus Zigarettenrauch, Terpentin und Shampoo. Ich fasse sie an den Armen und merke, wie ich, den Umständen zum Trotz, über beide Ohren grinse.
»Kate«, wiederhole ich in meiner albernen Stimmung, und sie zieht mich wieder an sich, drückt ihr Gesicht in meine Haare und hält mich so fest, dass ich ihre Knochen spüren kann.
Und dann höre ich ein Wimmern aus dem Kinderwagen und erinnere mich daran, wer ich bin, die Person, die ich geworden bin – und an alles, was passiert ist, seit Kate und ich uns zum letzten Mal gesehen haben.
»Kate«, sage ich noch einmal, genieße den Klang ihres Namens auf meiner Zunge, »Kate, darf ich dir meine Tochter vorstellen?«
Ich schiebe den Sonnenschirm zurück, hebe das strampelnde, quengelnde Etwas aus dem Wagen und halte es Kate entgegen.
Kate nimmt sie an, etwas zögerlich zwar, doch kurz darauf legt sich ein Lächeln auf ihr schmales, bewegtes Gesicht.
»Du bist ja eine Schöne«, sagt sie zu Freya, ihre Stimme genau so sanft und rauchig, wie ich sie in Erinnerung habe. »Genau wie deine Mama. Sie ist wahnsinnig süß, Isa.«
»Ja, oder?« Ich blicke Freya an, wie sie verzückt in das neue Gesicht starrt, Kates blaue Augen mit ihren blauen Augen fixiert. Sie streckt eine pummelige Hand nach Kates Haaren aus, doch dann hält sie inne, schaut gebannt auf einen Lichtreflex. »Sie hat Owens Augen«, sage ich. Als Kind wollte ich immer blaue Augen haben.
»Na dann, komm«, sagt Kate schließlich, aber zu Freya, nicht zu mir. Sie nimmt Freyas Hand in ihre, streichelt über die zarten, rundlichen Babyfinger, die Grübchen auf den Fingerknöcheln. »Fahren wir los.«
»Was ist mit deinem Wagen?«, frage ich, als wir zusammen zum Taxi gehen, Kate mit Freya im Arm, ich mit dem Kinderwagen, in dem ich die Tasche abgelegt habe.
»Ach, der ist schon wieder kaputt. Ich will ihn noch in die Werkstatt bringen, bin aber wie immer pleite.«
»Ach, Kate.«
Ach Kate, wann suchst du dir endlich einen richtigen Job?, könnte ich fragen. Wann wirst du die Mühle verkaufen und irgendwohin ziehen, wo man deine Arbeit schätzt, anstatt dich auf den schwindenden Touristenstrom nach Salten zu verlassen? Doch ich kenne die Antwort. Niemals. Kate wird die Gezeitenmühle nie verlassen. Sie wird Salten nie verlassen.
»Zurück zur Mühle, meine Damen?«, ruft der Taxifahrer durchs Fenster, und Kate nickt.
»Danke, Rick.«
»Den Kinderwagen packe ich in den Kofferraum. Er lässt sich doch zusammenklappen?«
»Ja.« Wieder kämpfe ich mit den Schnallen, als es mir mit einem Schreck einfällt: »Verdammt. Ich hab die Autoschale vergessen. Ich habe nur den Babykorb mitgenommen, weil ich dachte, sie kann darin schlafen.«
»Ach, hier kommt sowieso keine Polizei vorbei«, will Rick mich beruhigen, während er den zusammengeklappten Wagen sicher im Kofferraum verstaut. »Außer Marys Junior, aber der wird keinen meiner Passagiere verhaften.«
Um die Polizei geht es mir gar nicht, will ich erwidern, doch der Name lässt mich aufhorchen.
»Marys Sohn?« Ich sehe Kate fragend an. »Doch nicht Mark Wren?«
»Genau der«, sagt Kate und verzieht den Mund zu einem trockenen Lächeln. »Sergeant Wren inzwischen.«
»Ist der nicht viel zu jung?«
»Er ist doch nur ein paar Jahre jünger als wir«, widerspricht Kate, und mir wird klar, dass sie recht hat. Dreißig ist mehr als alt genug, um Polizist zu sein. Aber ich kann mir Mark Wren einfach nicht als Dreißigjährigen vorstellen – für mich ist er ein vierzehnjähriger Junge mit Pickeln und Oberlippenflaum, der immer etwas gebückt ging, um seine fast eins neunzig große Statur zu verstecken. Ob er sich noch an uns erinnert? An das Spiel?
»Sorry«, sagt Kate, als wir uns anschnallen. »Du musst sie wohl auf den Schoß nehmen – es ist nicht ideal, ich weiß.«
»Ich fahr vorsichtig«, sagt Rick, und schon holpern wir über den zerfurchten Boden des Parkplatzes auf den Hohlweg zu. »Und es sind ja nur ein paar Kilometer.«
»Über die Marsch noch weniger«, sagt Kate. Sie drückt meine Hand und ich weiß, sie denkt an all die Tage, an denen sie und ich diesen Weg genommen haben, uns einen Weg über die Salzwiesen zur Schule und zurück bahnten. »Aber mit dem Kinderwagen ist das keine Option.«
»Ganz schön heiß für Juni, oder?«, fragt Rick, als wir um die Kurve biegen, wo sich die Baumkronen lichten und gleißende Sonnenstrahlen zwischen den Blättern flirren, die auf meinem Gesicht brennen. Ich muss blinzeln und frage mich, ob ich meine Sonnenbrille eingepackt habe.
»Brüllend«, sage ich. »In London war es nicht annähernd so heiß.«
»Und was bringt Sie wieder zurück?« Rick blickt mich im Rückspiegel fragend an. »Sie waren doch mit Kate auf der Schule, oder?«
»Genau«, sage ich und stocke. Was treibt mich eigentlich zurück? Eine SMS? Drei Wörter? Ich sehe Kate an. Als sich unsere Blicke treffen, ist klar, dass sie jetzt nichts sagen kann, nicht vor Rick.
»Isa ist für das Ehemaligentreffen hier«, sagt Kate unerwartet. »In Salten House.«
Wahrscheinlich gucke ich irritiert, denn sie drückt mahnend meine Hand, doch als wir über die Bahnschienen fahren und das Taxi ruckelt und holpert, muss ich meine Hand wegziehen, um Freya mit beiden Händen festzuhalten.
»Ganz schön nobel, diese Dinner in Salten House, wie man hört«, sagt Rick. »Meine Jüngste kellnert da manchmal für ein bisschen Extrataschengeld, die erzählt Sachen: Pavillons, Champagner, das volle Programm.«
»Ich war noch nie dabei«, sagt Kate. »Aber unsere Klasse hat vor fünfzehn Jahren den Abschluss gemacht, und da dachte ich, dieses Jahr sollten wir es versuchen.«
Fünfzehn? Kurz denke ich, sie hat sich verrechnet, aber dann fällt der Groschen. Für uns sind es zwar siebzehn Jahre, aber wir sind vorzeitig von der Schule abgegangen. Hätten wir die Oberstufe gemacht, würde es stimmen. Für den Rest der Klasse wird es das fünfzehnjährige Jubiläum.
Wir nehmen eine weitere Kurve, und ich denke mit klopfendem Herzen an den fehlender Kindersitz und drücke Freya noch fester an mich. Wie idiotisch von mir, ihn zu vergessen.
Rick blickt mich im Rückspiegel an. »Kommen Sie noch oft hierher?«
»Nein«, sage ich. »Ich … ich war schon lange nicht mehr hier. Wie es eben so ist.« Nervös rutsche ich auf dem Sitz herum und weiß, dass ich Freya zu fest halte, doch fühle mich nicht imstande, meinen Griff zu lösen. »Man findet einfach nicht die Zeit.«
»Ist ’ne wunderschöne Gegend«, erwidert Rick, ohne auf mich einzugehen. »Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, irgendwoanders zu wohnen, aber vielleicht ist das anders, wenn man nicht hier aufgewachsen ist. Woher kommen Ihre Eltern?«
»Sie sind – waren …« Ich stocke plötzlich, doch dann spüre ich Kates Halt an meiner Seite und atme durch. »Mein Vater lebt heute in Schottland, aber ich bin in London aufgewachsen.«
Wir ruckeln über ein Viehgitter, die Reihen der Bäume lichten sich, und wir fahren hinaus auf die Marsch.
Und da ist er. The Reach. Weit und grau und schilfbewachsen erstreckt er sich vor uns, Wolkenschlieren spiegeln sich auf der vom Wind gekräuselten Wasseroberfläche. Das Licht, die Klarheit und die Weite dieses Anblicks schnüren mir die Kehle zu.
Kate beobachtet mich von der Seite, und aus dem Augenwinkel sehe ich, dass sie lächelt.
»Du hattest vergessen, wie es ist?«, fragt sie sanft. Ich schüttle den Kopf.
»Nie.« Es ist nicht wahr – ich hatte es vergessen. Ich hatte vergessen, wie es sich anfühlt, hier zu sein. Es gibt keinen anderen Ort wie den Reach. Ich habe viele Flüsse und Flussmündungen gesehen. Nirgendwo war es so atemberaubend schön wie in dieser Landschaft hier, wo Land und Himmel und Meer verschmelzen, ineinander sickern, sich durchmengen und vermischen, bis man kaum sagen kann, wo die Wolken enden und wo das Wasser beginnt.
Hier verengt sich die Straße auf eine einzige Fahrspur und wird schließlich zu einem Schotterweg mit Grasbüscheln zwischen den Spurrillen.
Und da steht sie – die Gezeitenmühle; schwarz zeichnet sich ihre Silhouette vor dem wolkenbetupften Wasser ab, sie wirkt noch maroder und schiefer, als ich sie in Erinnerung habe. Sie scheint weniger ein Gebäude als vielmehr ein Haufen Treibholz, von den Winden zusammengepeitscht, in ständiger Gefahr, von ihnen wieder zerstört zu werden. Mein Herz zieht sich zusammen, längst verschüttete Erinnerungen strömen ungebeten auf mich ein, hämmern von innen gegen meine Schläfen.
Thea, wie sie nackt im Sonnenuntergang im Reach schwamm, ihre Haut, die im Abendrot golden schimmerte, die langen Schatten der sturmschiefen Bäume auf dem feuerroten Wasser des Reach, die an das Fell eines prächtigen Tigers erinnerten.
Kate, wie sie sich an einem Wintermorgen, als der klirrende Frost Eisblumen auf die Scheibe gemalt und sich wie Pelz über das Schilfrohr und die Strandsimse gelegt hatte, aus dem Fenster lehnte, ihre Arme weit ausbreitete und eine weiße Atemwolke in die Luft blies.
Fatima, wie sie sich in ihrem winzigen Badeanzug auf dem Holzsteg in der Sonne aalte, ihre Haut schon mahagonifarben wie immer im Sommer, und die riesige Sonnenbrille im Gesicht, die das flirrende Licht der Wellen reflektierte.
Und Luc – und hier verkrampft sich mein Herz, ich muss den Gedanken verdrängen.
Wir erreichen ein verriegeltes Gatter auf dem Fahrweg.
»Lass uns am besten hier raus«, bittet Kate Rick. »Gestern Nacht war Flut, der Boden ist immer noch sehr weich.«
»Ganz sicher?« Er dreht sich zu ihr um. »Ich kann auch einen Versuch wagen.«
»Nein, wir gehen zu Fuß.« Sie öffnet die Tür und hält ihm einen Zehner hin, doch er winkt ab.
»Behalt das Geld, Schätzchen.«
»Rick, bitte.«
»Nichts Rick, bitte. Dein Vater war ein anständiger Kerl, ganz gleich, was die Leute hier sagen, und man muss dir hoch anrechnen, dass du trotz all dem Klatsch hier die Stellung gehalten hast. Bezahlen kannst du ein andermal.«
Kate schluckt, und ich sehe, dass sie nach Worten sucht, also springe ich ein.
»Vielen Dank, Rick«, sage ich. »Aber ich möchte gern bezahlen. Bitte.«
Und ich halte ihm meinen Zehnpfundschein hin.
Er zögert, doch ich lege den Schein in den Aschenbecher und steige mit Freya im Arm aus, während Kate meine Tasche und den Buggy aus dem Kofferraum holt. Endlich, gerade als ich Freya sicher verschnallt habe, nickt er.
»Na gut. Aber hört zu, falls die Damen irgendwohin müssen, ruft ihr mich bitte an, in Ordnung? Tag und Nacht. Die Vorstellung, dass ihr hier draußen ohne Auto seid, gefällt mir gar nicht. Dieses Teil …«, und er deutet mit dem Kopf auf die Mühle, »wird früher oder später zusammenbrechen, und wenn ihr irgendwo hingefahren werden wollt, meldet ihr euch, egal, ob ihr ’nen Zehner habt. Verstanden?«
»Verstanden«, antworte ich und nicke bekräftigend.
Der Gedanke hat durchaus etwas Beruhigendes.
Als Rick weg ist, stehen wir nur da, spüren die sengende Sonne auf unseren Köpfen und sehen einander wortlos an. Ich will Kate nach der Nachricht fragen, aber etwas hält mich zurück.
Bevor ich die Sprache wiedergefunden habe, dreht Kate sich um, öffnet das Tor und schließt es hinter uns wieder. Gemeinsam laufen wir den Rest des Weges bis zu dem kurzen Holzsteg, der die Gezeitenmühle mit dem Ufer verbindet.
Die Mühle selbst steht auf einer kleinen Sandfläche, die kaum breiter ist als das Gebäude selbst und einst Teil des Ufers war. Beim Bau der Mühle wurde ein schmaler Kanal gegraben, der die Mühle vom Land abschnitt und das steigende und fallende Wasser durch das Mühlrad leitete, das sich damals in diesem Graben befand. Das Rad gibt es schon lange nicht mehr, das Einzige, was daran erinnert, ist ein geschwärzter Holzpfahl, der im rechten Winkel aus der Wand ragt. An seiner Stelle führt nun der hölzerne Steg über den etwa drei Meter breiten Graben. Ich weiß noch, wie wir manchmal gleichzeitig zu viert darüber rannten, und kann heute kaum fassen, wie wir darauf vertrauen konnten, dass er uns halten würde.
Die kleine Brücke ist schmaler, als ich sie in Erinnerung habe, die Bretter vom Salzwasser gebleicht und an einigen Stellen morsch, und ein Geländer gibt es immer noch nicht, doch Kate schreitet trittsicher und unerschrocken mit meiner Reisetasche voran. Mit angehaltenem Atem und klopfendem Herzen folge ich ihr, versuche, die Bilder von nachgebenden Planken und meinem ins Wasser stürzenden Kind in meinem Kopf zu ignorieren, und schiebe den Buggy ruckelnd über die heimtückischen Bretter. Erst als ich sicher auf der anderen Seite bin, atme ich wieder aus.
Wie immer ist die Tür nicht abgeschlossen, Kate drückt die Klinke und hält sie mir auf, damit ich Freya über die Holzstufe hineinschieben kann.
Sieben Jahre ist es her, dass ich Kate zum letzten Mal gesehen habe, aber in Salten war ich mehr als doppelt so lange nicht mehr. Im ersten Augenblick fühlt es sich an wie eine Zeitreise, ich bin wieder fünfzehn und lasse die baufällige Schönheit dieses Ortes zum ersten Mal auf mich wirken. Da sind sie wieder, die länglichen, asymmetrischen, kaputten Fenster mit Blick auf die Mündung, das hohe Deckengewölbe mit den schwarz gewordenen Balken, hinten die knarzende Treppe, die sich schwindelerregend von einem klapprigen Absatz zum nächsten windet, an den Schlafzimmern vorbei bis oben zum Dachboden. Ich sehe den rußigen Ofen mit dem geschwungenen Rohr, das niedrige Sofa mit den gesprungenen Federn, und vor allem sehe ich die Bilder, überall Bilder. Manche kenne ich nicht, die müssen von Kate sein, aber dazwischen hängen andere, die mir vertraut sind wie alte Freunde.
Dort, in dem Goldrahmen über der rostigen Spüle, ist Kate als Baby mit rundlichem Gesicht, hoch konzentriert auf den Versuch, an einen Gegenstand knapp außer Reichweite heranzukommen.
Da hinten zwischen den beiden langen Fenstern hängt die Leinwand mit dem unvollendeten Bild der trichterförmigen Mündung, frostklirrend an einem Wintermorgen, ein einsamer Reiher fliegt tief über dem Wasser.
Neben der Tür zur Außentoilette sehe ich ein Aquarell von Thea, deren Züge an den Rändern des rauen Papiers verschwimmen.
Und über dem Schreibtisch entdecke ich eine Bleistiftskizze von Fatima und mir, eng umschlungen in einer improvisierten Hängematte, und wir lachen, lachen, lachen, als könnte uns nichts und niemand auf der Welt etwas anhaben.
Tausend Erinnerungen strömen auf einmal auf mich ein, krallen sich an mir fest, wollen mich zurück in die Vergangenheit zerren – doch dann reißt mich ein lautes Bellen aus meinen Gedanken, und als ich hinunterblicke, sehe ich ein weißgraues Knäuel auf mich zuspringen. Shadow. Spielerisch wehre ich ihn ab und versuche, ihn zu beruhigen, indem ich ihm den Kopf tätschle, den er aufgeregt gegen mein Bein drückt. Shadow ist nicht Teil der Vergangenheit, der Bann ist gebrochen.
»Es ist alles wie früher«, sage ich und weiß sofort, dass es albern klingt. Kate zuckt mit den Schultern und macht sich daran, die Gurte von Freyas Buggy zu lösen. Dann nimmt sie sie in den Arm.
»Nicht ganz. Ich musste den Kühlschrank ersetzen.« Sie deutet mit dem Kopf auf ein Gerät in der Ecke, das, wenn überhaupt, älter und kaputter wirkt als sein Vorgänger. »Und natürlich musste ich viele von den besten Bildern meines Vater verkaufen. Einige Lücken hab ich mit meinen eigenen gefüllt, aber es ist nicht das Gleiche. Sogar ein paar meiner Lieblingsbilder musste ich weggeben – das Skelett des Regenpfeifers und den Windhund auf der Sanddüne … aber von einigen konnte ich mich wirklich nicht trennen.«
Über Freyas Kopf hinweg lässt sie den Blick zärtlich über die verbleibenden Bilder schweifen, mit einer Spur von Wehmut betrachtet sie jedes einzelne.
Ich nehme ihr Freya ab und lege sie über meine Schulter. Ich verschweige, was ich wirklich denke, nämlich, dass sich das Haus wie ein Museum anfühlt, wie eines dieser Häuser berühmter Männer, eingefroren in dem Moment, als sie es verließen. Prousts Schlafzimmer, originalgetreu rekonstruiert im Musée Carnavalet. Kiplings Arbeitszimmer, museal konserviert in seinem Alterswohnsitz Bateman’s.
Nur trennen hier keine Seile den Besucher von den Objekten, und es gibt Kate, die an diesem Ort weiterlebt, in diesem Denkmal für ihren Vater.
Um den Gedanken zu verdrängen, stelle ich mich mit Freya ans Fenster, streichle über ihren warmen, festen Rücken, wohl mehr, um mich selbst zu beruhigen, und starre hinaus auf den Reach. Obwohl Ebbe ist, ragt der Anlegesteg nur ein kleines Stück aus dem plätschernden Wasser heraus, und ich drehe mich überrascht zu Kate um.
»Ist der Steg abgesunken?«
»Nicht nur der«, sagt Kate mit bedrückter Stimme. »Das ist das Problem. Das ganze Haus sinkt ab. Ich hatte schon einen Gutachter hier, der meinte, es gibt überhaupt kein richtiges Fundament, und würde ich heute eine Hypothek beantragen, könnte ich’s vergessen.«
»Aber … Moment, was soll das heißen? Es sinkt? Kann man es nicht von unten stützen, unterfüttern? Kannst du das nicht machen?«
»Leider nicht. Unten drunter ist nur Sand. Die Unterfütterung hätte auch keinen Halt. Man könnte es vermutlich hinauszögern, aber früher oder später würde es einfach weggeschwemmt.«
»Ist das nicht gefährlich?«
»Eigentlich nicht. Also, natürlich wackelt es ab und zu in den oberen Stockwerken, wodurch der Boden etwas uneben ist, aber es wird nicht über Nacht zusammenkrachen, falls du dir da Sorgen machst. Problematisch ist es eher wegen der Elektrizität.«
»Was?«Erschrocken starre ich den Lichtschalter an, als könnte er jeden Moment Funken sprühen. Kate lacht.
»Keine Sorge, als es brenzlig wurde, habe ich einen riesigen Mega-Sicherungsautomaten installieren lassen. Wenn’s irgendwo zischt, schaltet sich alles aus. Das bedeutet allerdings, dass bei Flut ab und an das Licht ausgeht.«
»Ist das Haus überhaupt versichert?«
»Versichert?« Sie blickt mich belustigt an, als wäre die Frage reichlich absurd. »Was soll ich denn mit einer Versicherung?«
Ich schüttle den Kopf. »Was machst du hier bloß? Kate, das ist doch wahnsinnig. So kannst du doch nicht leben.«
»Ich kann hier nicht weg, Isa«, erklärt sie geduldig. »Wie denn? Die Mühle ist komplett unverkäuflich.«
»Dann verkauf sie halt nicht – geh einfach. Gib der Bank die Schlüssel. Und zur Not meldest du Privatinsolvenz an.«
»Ich kann nicht weg«, beharrt sie und geht dann zum Herd, dreht den Hahn der Gasflasche auf und zündet den kleinen Brenner. Kurz darauf beginnt der Kessel auf dem Herd zu zischen, während Kate zwei Tassen und eine zerbeulte Teedose hervorholt. »Du weißt, warum.«
Und ich kann nichts erwidern, denn sie hat recht. Ich weiß sehr wohl, warum. Aus genau dem Grund, aus dem ich selbst zurückgekommen bin.
»Kate«, hebe ich an und spüre, wie sich etwas in mir zusammenzieht. »Kate – deine Nachricht …«
»Nicht jetzt«, sagt sie. Sie steht mit dem Rücken zu mir, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen kann. »Es tut mir leid, Isa – es wäre nicht fair. Wir müssen warten, bis die anderen hier sind.«
»Okay«, sage ich leise. Aber plötzlich scheint nichts mehr okay.
Fatima trifft als Nächste ein.
Fast bricht schon die Abenddämmerung herein, ein warmes, träges Lüftchen weht durch die offenen Fenster und ich blättere in einem Roman, um mich von meinen düsteren Gedanken abzulenken. Ein Teil von mir will Kate schütteln, will endlich wissen, was los ist. Ein anderer, ebenso großer Teil aber fürchtet sich vor dem, was kommt.
Doch wenigstens für diesen einen Moment ist alles friedlich, hier bin ich mit meinem Buch und da ist Freya, die im Buggy döst, Kate am Herd mit der kleinen Bratpfanne, aus der herzhaft-würzige Düfte steigen. Etwas in mir möchte so lange wie möglich an diesem Augenblick festhalten. Vielleicht – wenn wir einfach nicht darüber reden – vielleicht können wir dann so tun, als wäre es das, was ich Owen erzählt habe: ein Treffen alter Freundinnen.
Als es plötzlich in der Pfanne zischt, zucke ich zusammen, und im selben Moment bellt Shadow in einem wilden Stakkato drauflos. Dann höre ich, wie ein Fahrzeug auf den Kiesweg zum Reach einbiegt.
Ich verlasse meinen Fensterplatz, öffne die Tür zur Uferseite der Mühle und sehe die Lichter eines großen schwarzen Geländewagens auf dem Marschland. Seine holprige Fahrt schreckt Schwärme von Sumpfvögeln auf. Schließlich kommt er mit einem Ratschen der Handbremse knirschend auf dem Schotter zum Stehen. Der Motor wird ausgeschaltet, und von einer Sekunde auf die andere ist die Stille zurück.
»Fatima?«, rufe ich, als sich die Fahrertür öffnet, und laufe ihr über den Holzsteg entgegen. Am Ufer fallen wir uns in die Arme und drücken uns so fest, dass wir fast keine Luft mehr bekommen.
»Isa!« Ihre Augen leuchten so schwarz wie die eines Rotkehlchens. »Wie lange ist das jetzt her?«
»Ich weiß es nicht!« Ich drücke ihr einen Kuss auf die Wange, die halb versteckt ist unter einem Seidenkopftuch und noch kühl von der Klimaanlage des Autos. Ich trete einen Schritt zurück, um sie richtig anzusehen. »Ich glaube, das war nach Nadias Geburt, da bin ich doch vorbeigekommen, das war vor … Himmel, vor sechs Jahren?«
Sie nickt und greift nach den Nadeln, die ihr Kopftuch zusammenhalten, und für einen kurzen Moment glaube ich, dass sie es abnehmen wird, so als wäre es ein Accessoire à la Audrey Hepburn. Aber nein, stattdessen steckt sie es ein wenig fester, und jetzt begreife ich: Es ist nicht einfach ein modisches Tuch – es ist ein Hidschab. Das ist neu. Also, neu, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, nicht nur neu seit der Schulzeit.
Als Fatima meinen Blick bemerkt, lächelt sie, während sie die letzte Nadel hineinschiebt.
»Etwas ungewohnt, oder? Ich hatte schon ewig mit dem Gedanken gespielt, und nach Sams Geburt dann … ich weiß nicht, es hat sich einfach richtig angefühlt.«
»Ist es wegen – hat Ali …«, fange ich an und ärgere mich sofort über mich selbst, als Fatima mir einen spöttischen Blick zuwirft.
»Isa-Schatz, habe ich je auf einen Kerl gehört?« Sie seufzt. Der Seufzer gilt mir, aber vielleicht auch all den anderen, die ihr diese Frage schon gestellt haben. »Ich weiß nicht«, fährt sie fort. »Vielleicht habe ich durch die Kinder ein paar Dinge neu hinterfragt. Oder vielleicht ist es eine Art Rückkehr, an der ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt glücklicher bin, als ich es je war.«
»Ja, also, ich …« Ich zögere, während ich versuche, meine Gefühle zu ordnen. Beim Anblick ihres hochgeschlossenen Tops und präzise gebundenen Hidschabs muss ich unwillkürlich an ihr wunderschönes Haar denken, das sich wie ein Fluss über ihre Schultern hinabwellte, ihr Bikinitop vollständig bedeckte, sodass es aussah, als wäre sie in nichts anderes gehüllt. Lady Godiva hatte Ambrose sie einmal genannt, aber die Anspielung verstand ich erst später. Und jetzt … jetzt ist es weg. Versteckt. Aber ich verstehe auch, warum sie diesen Aspekt ihrer Vergangenheit hinter sich lassen will. »Ich bin irgendwie beeindruckt. Und Ali? Ist der auch – ich meine, macht der auch das volle Programm, mit Ramadan und allem drum und dran?«
»Ja, es scheint, als hätten wir uns beide dahin entwickelt.«
»Deine Eltern sind bestimmt froh.«
»Ich weiß nicht. Schwer zu sagen – auf eine Art schon.« Sie wirft sich die Tasche über die Schulter, und wir setzen uns in Bewegung, überqueren vorsichtig im letzten Schein des Sonnenuntergangs den Holzsteg. »Ich glaube schon, dass sie es gut finden; auch wenn meine Mutter immer klargemacht hat, dass sie es akzeptiert, wenn ich kein Kopftuch trage, freut sie sich insgeheim bestimmt. Und Alis Eltern … lustigerweise finden die es weniger gut. Seine Mutter meint immer, aber Fatima, die Leute in diesem Land mögen keine Frauen mit Hidschab, du wirst am Arbeitsmarkt Probleme haben, in der Schule werden dich die anderen Eltern für eine Extremistin halten. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass sie in der Praxis unendlich froh sind, eine weibliche, Urdu sprechende Ärztin zu haben, die auch noch Vollzeit arbeiten will, und dass die Freunde der Kinder zur Hälfte sowieso aus muslimischen Familien stammen, aber das beruhigt sie nicht.«
»Und wie geht es Ali?«
»Dem geht’s super! Er ist seit kurzem Oberarzt. Er arbeitet zwar zu viel, aber das geht uns ja allen so.«
»Mir nicht.« Ich lache etwas zerknirscht. »Ich trödle im Mutterschutz vor mich hin.«
»Ja, klar.« Sie grinst mich von der Seite an. »Ich erinnere mich noch gut an dieses Herumtrödeln mit Schlafentzug und rissigen Brustwarzen. Da übernehme ich lieber die Fußsprechstunde, vielen Dank.« Dann sieht sie sich um. »Wo ist denn Freya? Kann ich sie sehen?«
»Die schläft gerade, ist völlig fertig von der Reise. Aber bestimmt wacht sie bald auf.«
»Isa …«, sagt sie gedehnt, und ich weiß, ohne dass sie es aussprechen muss, was sie denkt und was sie mich fragen wird. Ich schüttle den Kopf.
»Keine Ahnung. Ich hab Kate schon gefragt, aber sie wollte warten, bis wir alle hier sind. Sie meinte, es wäre sonst nicht fair.«
Sie lässt die Schultern hängen, und plötzlich erscheint alles so schal – das nichtssagende Geplänkel liegt staubtrocken auf meinen Lippen. Ich weiß, dass Fatima so nervös ist wie ich und dass wir beide nur diese Nachricht von Kate im Kopf haben und versuchen, nicht darüber nachzudenken, was wohl dahintersteckt.
»Bereit?«, frage ich. Aus gespitzten Lippen atmet sie tief aus und nickt.
»Vom Rumstehen wird es nicht besser. Scheiße, das wird bestimmt seltsam.«
Und dann macht sie die Tür auf, und ich sehe zu, wie die Vergangenheit sie überrollt, so wie kurz zuvor auch mich.
Als ich an jenem Tag mit Thea und Kate in Salten aus dem Zug stieg, war der Bahnsteig leer, bis auf ein zierliches, dunkelhaariges Mädchen von etwa elf oder zwölf Jahren, das am anderen Ende stand. Sie blickte sich unsicher um, bevor sie begann, auf uns zuzulaufen. Als sie näher kam, sah ich, dass sie eine Salten-Uniform trug, und aus nächster Nähe war offensichtlich, dass sie viel älter sein musste, als ich sie eingeschätzt hatte – fünfzehn mindestens –, nur eben sehr zierlich.
»Hi«, sagte sie. »Fahrt ihr nach Salten?«
»Nein, wir sind eine pädophile Gang und tragen die Uniformen, um Kinder anzulocken«, blaffte Thea und schüttelte gleich darauf den Kopf. »’tschuldigung, das war doof. Ja, wir fahren auch nach Salten. Bist du neu?«
»Ja«, sagte sie, und folgte uns in Richtung Parkplatz. »Ich heiße Fatima.« Sie hatte einen Londoner Akzent, mit dem ich mich sofort zu Hause fühlte. »Wo sind denn all die anderen? Ich dachte, der Zug wäre voller Salten-Mädels.«
Kate schüttelte den Kopf.
»Die meisten Eltern fahren ihre Kinder, besonders nach den Sommerferien. Und die Mädchen im Tages- und Wocheninternat fangen eh erst am Montag an.«
»Sind viele im Tagesinternat?«
»Etwa ein Drittel der Schülerinnen. Ich selbst mache eigentlich Wocheninternat, ich bin jetzt nur hier, weil ich ein paar Tage mit Thea in London war und wir zusammen zurückfahren wollten.«
»Woher kommst du?«, fragte Fatima.
»Von da drüben.« Kate deutete über das Marschland hinaus auf ein schimmerndes Gewässer in weiter Ferne. Ich blinzelte angestrengt. Ich konnte kein Haus erkennen, doch es war schon möglich, dass da eines war, versteckt hinter einer Düne oder einem der verkümmerten Bäume entlang der Bahnschienen.
»Und du?« Fatima wandte sich an mich. Sie hatte ein rundes, freundliches Gesicht und wunderschönes schwarzes Haar, das sie sich mit einem Clip aus dem Gesicht gebunden hatte. »Bist du schon lange hier? Welche Jahrgangsstufe?«
»Ich bin fünfzehn und komme in die Zehnte. Ich bin auch neu und werde ganz im Internat wohnen.« Auf die Einzelheiten wollte ich nicht eingehen – die Krankheit meiner Mutter, ihre langen Krankenhausaufenthalte, während derer mein dreizehnjähriger Bruder Will und ich allein zu Hause blieben, weil mein Vater bis spät in die Nacht in der Bank arbeitete … der Schock, als er aus heiterem Himmel entschied, uns beide wegzuschicken. Dabei hatte ich ihm doch nie Ärger gemacht! Ich hatte nicht rebelliert, keine Drogen genommen und nie gegen ihn aufbegehrt. Wenn überhaupt, hatte die Krankheit unserer Mutter mich nur noch gewissenhafter gemacht. Ich war fleißig und half viel im Haushalt mit. Ich kochte, kaufte ein und bezahlte die Putzhilfe, wenn mein Vater es vergessen hatte.
Und dann seine Ausreden! Das Beste für euch … viel lustiger als alleine … stabile Umgebung … Schulleistungen dürfen nicht leiden … gerade jetzt vor den Prüfungen …
Ich wusste nichts zu sagen. Ich war wie in Trance. Will hatte nur genickt, zeigte wie immer keine Regung, doch in der Nacht hörte ich ihn weinen. Ihn brachte unser Vater heute nach Charterhouse, weshalb ich allein gekommen war.
»Mein Vater hat heute zu tun«, hörte ich mich sagen. Die Worte klangen lässig, wie einstudiert. »Sonst hätte er mich auch gefahren.«
»Meine Eltern leben im Ausland«, sagte Fatima. »Sie sind Ärzte und machen gerade einen Freiwilligendienst bei einer Entwicklungsorganisation. Ein ganzes Jahr ohne Bezahlung.«
»Krass«, sagte Thea. Sie schien beeindruckt. »Mein Vater würde kein Wochenende für den guten Zweck opfern, von einem Jahr ganz zu schweigen. Bekommen sie überhaupt kein Geld?«
»Nicht wirklich, nur eine Art Stipendium als Aufwandsentschädigung. Das ist aber den Gehältern vor Ort angepasst, also nicht viel. Darum geht es ihnen aber nicht – sie tun es aus religiösen Gründen, es ist ihre Form von Sadaqa.«
Im nächsten Moment bogen wir um das kleine Bahnhofshäuschen herum, hinter dem schon ein blauer Minibus wartete. Daneben stand eine Frau in Rock und Jackett und mit einem Klemmbrett unter dem Arm.
»Hallo, Mädels«, begrüßte sie Thea und Kate. »Hattet ihr einen guten Sommer?«
»Ja, danke, Miss Rourke«, antwortete Kate. »Das hier sind Fatima und Isa. Wir haben uns im Zug getroffen.«
»Fatima …?« Miss Rourke ging mit dem Stift die Liste durch.
»Qureshy«, sagte Fatima. »Q, U, R …«
»Hab’s«, sagte Miss Rourke knapp und hakte den Namen ab. »Und du musst Isa Wilde sein.«
Sie sprach es »Iiisa« aus, aber ich nickte.
»Habe ich es richtig ausgesprochen?«
»Eigentlich soll es sich auf ›leiser‹ reimen.«