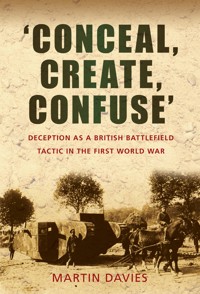7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tief im Herzen von Hannesford Court liegt ein dunkles Geheimnis London 1919. Eigentlich wollte Tom nie mehr nach Hannesford Court zurückkehren. Doch der Krieg hat viel verändert, und so nimmt er die Einladung von Lady Stansbury an. Der Landsitz der Familie seines toten Freundes war für Tom früher ein idyllischer Zufluchtsort. Bis zu jenem Rosenball, der mit einem mysteriösen Todesfall endete. Nun setzt Tom alles daran, herauszufinden, was 1914 wirklich geschah. Und auch Anne Gregory kehrt zurück nach Hannesford. Als sie Tom wiedertrifft, erwachen Gefühle in ihr, die sie längst vergessen geglaubt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Martin Davies
Wiedersehen in Hannesford Court
Roman
Deutsch von Susanne Goga-Klinkenberg
Nie gab’s ein Jahr wie das, das jüngst vergangen; Womöglich sind des Vaters Worte wahr: Das Warum zählt nicht mehr, hat es erst angefangen: Doch alles ist verbrannt, wenn auch nicht ganz und gar.
Charlotte Mew, The Quiet House
Während die Männer weg waren, ertrank eine Frau im River Hanna. Sie wurde in dem dunklen Teich unterhalb von Hannesford Court gefunden, nicht weit von der Stelle, an der der Fluss gurgelnd aus dem Moor tritt. Kein Stein wurde auf dem Friedhof aufgestellt, und das Gras dort wächst rasch, so dass sich nur wenige an sie erinnern. Das Gedächtnis ist ein unzuverlässiger Zeuge.
Besucher von Hannesford, die sich zu der alten Brücke verirren, achten nur selten auf den unruhigen Teich, in dem sie gefunden wurde. Ihre Augen werden von dem honigfarbenen Stein des Herrenhauses und den hohen Schornsteinen angezogen, die den Blick auf das dahinterliegende Moor lenken. Später erinnern sie sich an die Rasenflächen von Hannesford, die sich im Sonnenschein erstrecken, an die duftenden Gärten und das kleine blau-weiße Sommerhaus, das zwischen den Bäumen verborgen steht. Nie aber an das wirbelnde Wasser.
1
Im Jahr 1919 war London eine Stadt der Schatten. Ich kam spät am Abend an, die Uniform noch schmutzig vom Staub Flanderns, und nahm ein Zimmer im Mecklenburg Hotel, weil ich vor der Leere in meiner Wohnung am Rudolph Square zurückscheute. Es war eine einsame Reise gewesen, das Schiff ruhig, der Zug beinahe verlassen, und ich war ziemlich bedrückt. Ich war in Gesellschaft von Freunden in den Krieg gezogen, von Menschen, die ich gut kannte. Nun kehrte ich allein in eine Stadt zurück, in der ich mich als Fremder fühlte.
Drei Tage vor Weihnachten hätte die gesellschaftliche Saison eigentlich ihren Höhepunkt erreicht haben müssen, doch London wirkte trostlos und seltsam stumm. Die großen Stadthäuser wären früher im Lichterglanz erstrahlt, auf den Straßen davor hätten sich die Automobile gedrängt. Selbst auf dem Höhepunkt des Gemetzels hatte die Stadt eine ruhelose Fröhlichkeit bewahrt, eine nahezu verzweifelte Entschlossenheit, den Augenblick zu genießen. Ich hatte hohlwangige Offiziere auf Heimaturlaub gesehen, die sich binnen weniger Stunden in die schneidigen jungen Kerle zurückverwandelten, an die sich ihre Freunde erinnerten, die im Mimosa’s dinierten, im Clarion tanzten und immer die Ersten waren, wenn es um Mädchen oder Alkohol ging. Lediglich die Schatten in ihren Augen waren verräterisch, und das auch nur für jene, die wussten, wohin sie schauen mussten. Doch seit damals hatte sich vieles verändert. Jetzt erstreckte sich die Zukunft bis zu einem ferneren Horizont, und nur wenigen gelang es, so zu feiern wie früher. Und so lagen die Stadthäuser im Dunkeln, düstere Denkmäler für die Verlorenen, und ich saß allein im prachtvollen, halb leeren Speisesaal des Mecklenburg und aß ein bescheidenes Kotelett.
Ich hätte früher zurückkehren sollen. Als ich die blassen, unvertrauten Gesichter der anderen Gäste betrachtete, wurde mir klar, dass mir etwas entgangen war. Wäre ich unmittelbar nach dem Ende der Kämpfe zurückgekommen, als sich die Stadt noch immer wie in einem Rausch befand, hätten mich Jubelschreie und Hupen und eine Nation im Ausnahmezustand begrüßt; Straßenlaternen und Fenster mit offenen Läden, die im Dunkeln erstrahlten; Kirchturmuhren, die trotzig nachts die volle Stunde schlugen, nachdem sie zuvor wegen der Zeppeline hatten schweigen müssen. Es hätten Geschrei und Aufregung geherrscht, und der ganze Trubel hätte mir gezeigt, dass es wirklich vorbei war.
Doch in den Tagen nach dem Waffenstillstand, als mich die Stille auf den Schlachtfeldern beunruhigte und ich mich daran zu erinnern versuchte, wer ich wirklich war, war mir nicht nach Feiern zumute gewesen. Die Toten blieben tot, auch wenn die Waffen schwiegen; ich hatte keine Ahnung, weshalb ich nicht unter ihnen war. Und dann hatte die Grippe das Lager erreicht, es fehlte an Offizieren, und alle, die in Frankreich geblieben waren, schienen in Gedanken stets bei ihren Frauen und Kindern zu sein. Ich sah sie Briefe nach Hause schreiben und bekam ein schlechtes Gewissen. Die meisten waren noch nicht lange in Uniform. Ich kannte sie weniger gut als viele der Männer, die noch draußen auf den Schlachtfeldern lagen. Aber was waren nach so langer Zeit schon ein paar Monate für mich? Ohne lange zu überlegen, deutete ich an, dass ich es nicht besonders eilig hatte, den Kanal zu überqueren.
In England schien es niemanden zu beunruhigen, dass sich meine Rückkehr verzögerte. Meine Schwester kannte mich zu gut, um gekränkt oder überrascht zu sein. Sie schrieb mir gewissenhaft freundliche, liebevolle Briefe, in denen sie von meinen Neffen berichtete und mir ein herzliches Willkommen in Derbyshire versprach, sobald ich aus der Armee entlassen wurde. Und meine Mutter, die mitsamt ihrer Sekretärin, ihrer Schriftstellerei und dem Ausblick auf Cap Martin ruhig und heiter in Südfrankreich lebte, schrieb mir von ihrem Briefträger und ihrem Verleger und den herrlichen fruits de mer aus der Bucht unterhalb ihres Hauses, als hätte sich nichts auf der Welt verändert. Ich war entschlossen, beide zu besuchen, sobald ich meinen Abschied bekam. Danach wollte ich mir eine schönere Wohnung in London suchen, mit Blick auf einen Park, und entscheiden, was ich mit der Zukunft, die mir so unerwartet zuteilgeworden war, anfangen sollte.
Doch wenn die anderen abends in der Offiziersmesse über England sprachen, dachte ich an das Moor bei Hannesford. Wenn sie davon sprachen, Weihnachten zu Hause zu sein, erinnerte ich mich an die Stechpalmenzweige, die den Kamin von Hannesford Court schmückten. Und als ein fröhlicher Bursche, der die Fahrkarte über den Kanal schon in der Tasche hatte, seine Verwandten in Devon erwähnte, dachte ich an die Stansburys. Mir würden bei Devon immer die Stansburys einfallen.
Während ich gegen Ende des Jahres in Dieppe noch immer auf meine Demobilisierung wartete, kam der Brief von Freddie Masters. Ein seltsamer Brief, in dem es um den Tod von Professor Schmidt ging. Der Professor war in jenen letzten Monaten vor dem Krieg, als Deutschsein in Großbritannien noch nicht als Verbrechen galt, in Hannesford zu Gast gewesen; ein sanfter Mann, der sich für Motten und englische Dorfkirchen interessierte und auf dem Höhepunkt des berühmten Rosenballs an einem Herzinfarkt gestorben war. Masters erkundigte sich ganz beiläufig, ob mich jemals etwas am Tod des Professors beunruhigt habe. Es war eine absurde und ziemlich bizarre Frage. Sein Tod war nicht geheimnisvoll gewesen. Sein Herz hatte ausgesetzt. Ich hatte ihn sterben sehen.
Masters war ein geschwätziger Narr.
Doch als ich im Winter 1919 an Deck stand, während die belgische Küste zum Abschied ironisch im Sonnenlicht aufblitzte, war ich mir über meine Pläne noch immer nicht im Klaren. Auf einer Postkarte aus Cap Martin hatte meine Mutter geschrieben, sie habe einen neuen Roman begonnen. Meine Schwester wollte Weihnachten bei der Familie ihres Mannes in Perthshire verbringen und wäre mit Kindern, Besuchern und angeheirateten Verwandten beschäftigt. In wenigen Tagen würde ich nach fünf Jahren meine Uniform ablegen und die Armee verlassen. Der Gedanke war seltsam beunruhigend.
Also beschloss ich, zunächst nach London zu fahren, und ließ mir meine Sachen ins Mecklenburg schicken. Ich wollte etwas Anständiges essen und ein sehr, sehr ausgiebiges Bad nehmen. Nach dem luxuriösen Bad erwarteten mich drei Briefe: säuberlich beschriftete Umschläge von drei verschiedenen Absendern. Ich sah auf den ersten Blick, dass einer von Margot Stansbury stammte. Obwohl meine Finger kurz darüber verweilten, öffnete ich ihn nicht als Erstes. Ich wartete, bis ich mich in einem der straff gepolsterten, grünen Ledersessel in der Hotelbibliothek niedergelassen hatte, und widmete mich zunächst dem Schreiben, mit dem ich schon gerechnet hatte: einer Nachricht von Lady Stansbury auf festem cremefarbenem Papier, in der sie mich einlud, Weihnachten in Hannesford Court zu verbringen. Seit ich die Stansburys kannte, hatte ich jedes Jahr eine solche Nachricht erhalten, bis der Exodus der jungen Männer diese Tradition beendete. Die gleiche Handschrift, das gleiche Briefpapier, sogar der gleiche, ganz schwache Hauch von Veilchen.
Lieber Tom,
wir hoffen sehr, dass Sie uns hier besuchen …
Es waren mehr als fünf Jahre vergangen, seit ich zuletzt dort gewesen war. Danach hatten die undurchschaubaren, komplizierten Mechanismen der Militärmaschinerie eine solche Reise stets verhindert. Entweder bekam ich Urlaub, wenn die Stansburys verreist waren, oder die Zeit war einfach zu knapp. Doch davor, vor den Feindseligkeiten, hatte ich nur selten die Gelegenheit verpasst, das neue Jahr gemeinsam mit Margot Stansbury und ihren Geschwistern zu begrüßen.
Margot. Ihr Brief wartete auf der Armlehne meines Sessels, während ein sehr betagter Kellner mir umständlich ein Glas des Mecklenburg’schen Hausbrandys servierte. Nein, danke, sonst nichts. Ja, Frankreich. Ja, es war schlimm. Ja, vielleicht wird jetzt alles besser … Ich wartete, bis der Mann davongeschlurft war, bevor ich Margots Brief öffnete.
War ich enttäuscht? Vielleicht, obwohl ich nicht mehr genau weiß, was ich erwartet hatte. Der Stil war lakonisch, ein bisschen belustigt, leicht respektlos. Typisch Margot.
Du musst kommen, Tom. Mutter besteht darauf, die Tradition weiterzuführen, und du bist doch praktisch Bestandteil der Tradition. Außerdem müssen wir irgendwie den Gedenkgottesdienst für Harry überstehen, da können wir jede Aufmunterung gebrauchen. Es wird grauenhaft, wenn du nicht dabei bist …
Es gab keine Anspielung auf vergangene Ereignisse, auf unsere letzte Begegnung. Auch das war typisch Margot.
Der dritte Brief war sehr viel überraschender. Ich hatte Freddie Masters klar und deutlich mitgeteilt, dass mich die Art und Weise, in der Professor Schmidt gestorben war, nicht im Geringsten beunruhigte; aus irgendeinem Grund hatte Masters es jedoch für nötig befunden, mir noch einmal zu schreiben. Seine Hartnäckigkeit war erstaunlich, da er mir nie sehr beharrlich erschienen war. Wir waren einander oft in Hannesford Court begegnet, ohne uns nahezustehen. Selbst nach den Maßstäben, die für Harry Stansburys Freundeskreis galten, war Masters eine schillernde, eher lächerliche Figur gewesen. Er hatte bei Kriegsausbruch einen sicheren Posten in einem Ministerium gehabt, und ich war daher ziemlich überrascht, als ich ihm wenige Jahre später im Strand begegnete und feststellte, dass er als Offizier in einem Infanterieregiment diente. Die Begegnung war recht herzlich gewesen, doch Masters hatte mich keineswegs als Vertrauten behandelt. Deshalb erregte der Inhalt dieses neuen Briefes wohl auch meine Neugier.
Vielen Dank für deine Antwort, alter Junge. Alles sehr beruhigend. Dennoch, falls du rechtzeitig zu Weihnachten zu Hause bist, solltest du versuchen, nach Hannesford zu kommen. Ich werde die ganze Zeit dort sein – bis die Champagnerkorken verstummen –, und ich wollte mit dir über etwas reden. Es ist ziemlich heikel – Gott behüte, womöglich sogar geschmacklos –, so dass ich dir sehr verbunden wäre, wenn du es gegenüber Sir Robert und seiner werten Lady oder irgendeinem anderen Mitglied des Clans nicht erwähnen würdest. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, alter Junge, aber es hat mit Schmidt zu tun. Wenn ich mich recht entsinne, wart ihr Freunde …
Und es stimmte. Auf unsere Weise waren wir wohl Freunde gewesen. Aber ich musste mir auch eingestehen, dass Hannesford Court in jenen letzten Tagen so viele Ablenkungen für mich bereitgehalten hatte, dass ich nicht so auf den Professor geachtet hatte, wie ein Freund es hätte tun sollen.
Das menschliche Gedächtnis ist eigenwillig. Ich habe erlebt, wie es von einem winzigen Splitter glühenden Stahls zerschmettert wird, wie eine Kirche von Granaten. Bestimmte Teile werden zertrümmert, andere bleiben auf geheimnisvolle Weise unversehrt. Doch es kann sich auch hartnäckig halten wie das Gras auf den Ebenen Flanderns und langsam zurück ins Sonnenlicht kriechen, nachdem die Bombardierung vorüber ist. Von dem Abend, an dem der Professor starb, sind mir lebhafte Bruchstücke in Erinnerung geblieben: die dunkle Terrasse, die Hitze, der schwere Duft der Rosen; die samtenen Schatten, in denen ich stand, erfüllt von Selbstmitleid; die Kapelle, die den ›Fairy Waltz‹ spielte. Und die leicht absurde Gestalt des Professors, der langsam die Stufen vom Rasen heraufkam, sich plötzlich an die Brust griff und in sich zusammensackte. Ich konnte mich erinnern, dass Anne Gregory vor mir bei ihm gewesen war. Sie hatte Tränen in den Augen gehabt.
Der Abend, an dem der Professor starb, war mein letzter Abend in Hannesford gewesen. Es war der Abend, an dem ich mir geschworen hatte, Margot Stansbury nie wieder freiwillig gegenüberzutreten.
Als es hieß, er käme heim, schnitten sie gerade Stechpalmen in den Wäldern unterhalb von Hannesford Court.
Ich hörte das Gerücht vom Pfarrer. Es war einer dieser strahlenden Dezembermorgen, an denen der Boden hart gefroren und der Himmel sehr klar ist, an denen der Frost sein Muster in jeden Zweig und jeden Busch und jedes Spinnennetz prägt.
Es war ein gutes Jahr für Beeren gewesen – die Hecken waren voll davon –, und die dornenbesetzten Zweige, mit denen Hannesford Court am Heiligen Abend verschwenderisch geschmückt sein würde, leuchteten in prachtvollem Scharlachrot.
Die Bäume waren wild gewuchert, solange man sie vernachlässigt hatte, wurden nun aber wieder geschnitten. Nach einer Reihe bitterer, lautloser Winter hatte die Familie Stansbury beschlossen, dass Weihnachten wieder gefeiert werden sollte.
»Anne, ich habe Neuigkeiten. Es heißt, Tom Allen werde demobilisiert«, erzählte mir der Pfarrer bei seiner Rückkehr ins Pfarrhaus. »Ich habe es von Lady Stansbury, die es wiederum von jemandem im Ministerium gehört hat. Was für eine Gnade, dass er das alles überstanden hat, nicht wahr?« Er sprach in munterem Ton. Nur wenige aus Hannesford hatten es überstanden. »Es wäre wunderbar, ihn wiederzusehen. Vielleicht begegnen Sie ihm sogar in London, Anne. Oder wir treffen ihn hier. Er ist doch immer an Weihnachten hergekommen, oder?«
»Ja, das stimmt.« Ich hatte meine Näharbeit beiseitegelegt, um ihn zu begrüßen, nahm seinen Hut und Mantel in Empfang und platzierte die Handschuhe behutsam auf der Ablage im Hausflur.
»Aber das war vorher. Vieles hat sich verändert. Wer weiß, was er jetzt vorhat?«
Eigentlich hatte ich keine Zweifel. Ich würde nicht nach Hannesford zurückkehren. Es wäre nicht schwer, einfach wegzubleiben; ein Sommer im Ausland, Weihnachten bei meiner Schwester, eine höfliche Lösung alter Verbindungen, die ja beinahe zufällig zustande gekommen waren. Ich wäre den Stansburys natürlich in der Stadt begegnet; die Welt war zu klein, um das zu vermeiden. Doch sie bewegten sich in sehr viel vornehmeren Kreisen als ich, unsere Wege würden sich nicht allzu oft kreuzen.
In Frankreich hatte ich geglaubt, ich hätte alles hinter mir gelassen. Dass meine Erinnerungen an Hannesford von den Kanonen zu Staub zertrümmert worden wären. Doch als ich an diesem ersten Morgen in London ins blasse Sonnenlicht blinzelte, war nichts wie früher. Früher hatte ich keine Mühe gehabt, meine Tage in der Stadt auszufüllen. Jede Begegnung führte zu einer Einladung. Es gab Diners und Bälle, es gab das Theater, ich verbrachte jeden Abend in Gesellschaft. Diesmal aber waren es Zusammentreffen anderer Art. Wie freundlich, dass Sie mich besuchen kommen … Ein so schrecklicher Verlust … Schmerzlich vermisst von allen, die ihn kannten … In manchen Häusern traf ich niemanden an. Sie waren verschlossen, verlassen von Familien, die dem Leben in der Stadt für eine gewisse Zeit aus dem Weg gehen wollten.
Nachdem ich also einen Morgen lang über die kalten, grauen Gehwege gegangen war, fühlte ich mich ernüchtert und ein bisschen einsam und wollte weg aus der Stadt. Außerdem besaß der Gedanke an Hannesford durchaus seinen Reiz. Gewiss, ich hatte mir geschworen, nie mehr dorthin zu fahren, doch alles, was mir vor dem Krieg zugestoßen war, erschien plötzlich seltsam verschwommen. Ich verspürte den starken Drang, wieder übers Moor zu laufen und meine Lungen mit der Luft von Devon zu füllen. Und ich hätte Gesellschaft in Hannesford – dazu Musik und Lärm und Betriebsamkeit. Gewiss würden mir einige Tage auf dem Land ganz guttun. Meine Zukunft konnte ich immer noch planen.
Also tat ich, wozu mich die Briefe gedrängt hatten, und telegrafierte die entsprechenden Antworten. Am frühen Nachmittag begab ich mich erneut zur Paddington Station und nahm den nächsten Zug nach Hannesford. Zuerst machte mich die Vertrautheit nervös. Der Bahnhof schien unverändert, als wäre ich in die Zeit vor den Schützengräben zurückgekehrt. Dasselbe hohe Dach und die zischenden Lokomotiven, der gleiche aufreibende Kampf mit Paketen und Zugtüren, die gleichen unmissverständlichen Geräusche von Abfahrt und Abschied. Die Menge war unverändert, hochgestellte Krägen, in die Stirn gezogene Hüte. Beißende Kälte. Kaum jemand in Uniform.
Doch als ich noch einmal hinschaute, bemerkte ich Unterschiede. Der Bahnhof sah doch größer aus? Und auch schäbiger. Die Gesichter … waren es noch dieselben? Waren sie härter oder schmaler oder trauriger als früher? Ich konnte es nicht sagen. Es war ein törichtes Spiel. Mit einem leichten Schauder machte ich mich auf die Suche nach Zigaretten.
So etwas passierte mir recht häufig, eine Art wiederkehrender Schwindel, das flüchtige Gefühl, dass sich nichts verändert hatte. Doch diese Augenblicke waren nie von Dauer, irgendetwas brach stets den Bann. Diesmal war es der Streichholzverkäufer unter der Bahnhofsuhr, der sich, blass vor Kälte, auf Krücken stützte. Als ich mich näherte, richtete er sich auf und versuchte zu salutieren.
»Seit einem Monat sieht man kaum noch Uniformen, Sir«, sagte er mit einem anerkennenden Blick. »Wir werden wieder zu einer Nation von Ladenbesitzern. Frankreich, nehme ich an, Sir?«
Die vertraute Frage.
»Die meiste Zeit. Und Sie?«
»Ebenso, Sir. Aber nicht lange. Meine Batterie wurde in Loos getroffen.«
»Das ist Pech.«
Ein verlorenes Feuerzeug im Schlamm, eine zerbrochene Uhr, ein Bein, das am Knie abgerissen war. Pech, alter Junge, Pech. Die Welt war ins Chaos gestürzt, die Sprache aber irgendwie gleich geblieben, geprägt in einer Zeit, in der man von Pech sprach, wenn ein Ball nicht gefangen oder ein Aufschlag auf dem Tennisplatz schlecht platziert wurde. In einer Welt, in der die Streichholzverkäufer Jungen waren, die noch alle Gliedmaßen besaßen.
»Es ist tatsächlich schwer, Sir«, fuhr der Mann fort und beantwortete eine Frage, die ich nicht gestellt hatte. »Aber ich kann jetzt ganz gut mit den Dingern umgehen, und wenn Feierabend ist, kommt meine Frau und hilft mir. Oder mein Sohn. Ein prächtiger Bursche. Haben Sie Kinder, Sir?«
Ich schüttelte den Kopf. »Leider nicht. Ich bin nicht verheiratet.«
Der Mann lächelte. Er schien kein Selbstmitleid zu empfinden, was mich demütig werden ließ. »Nun, da Sie es überstanden haben, bleibt dafür genügend Zeit.«
Er nahm die Münze entgegen, die ich ihm anbot, und schob sie in seinen Mantel. Dann versuchte er erneut, strammzustehen. Als ich mich an der Sperre noch einmal umdrehte, schien sein Geschäft zu florieren. Doch mir fiel auf, dass nur wenige Leute lange genug verweilten, um dem Verkäufer in die Augen zu sehen.
Der Zug, der Paddington an diesem Dezembernachmittag verließ, war bei weitem nicht voll, und ich fand ein Abteil in der Ersten Klasse, in dem außer mir nur eine ältere Dame saß. Sie nickte kurz und widmete sich wieder ihrem Buch. In den ersten zwanzig Minuten saßen wir schweigend da, und ich verfiel durch die gleichförmige Bewegung des Zuges in eine Art Träumerei, als sie mich plötzlich mit Namen ansprach.
»Ich hoffe, Sie verzeihen die Störung, aber ich glaube, wir kennen uns. Captain Allen, nicht wahr?«
Ich hatte auf die vorbeieilenden Felder und Hecken geschaut, drehte mich nun aber höflich um und richtete mich auf. Ihr Gesicht war mir unbekannt.
»Ja, ich bin Tom Allen. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe ungeniert vor mich hin geträumt. Und es tut mir leid … aber ich kann mir Gesichter so schlecht merken …«
»Keine Ursache, keine Ursache«, sagte sie rasch und tat meine Entschuldigung ab. »Ich bin Miss Westerley, die Tante von Lieutenant Farrell. Wir haben uns einmal ganz kurz im Savoy kennengelernt. Ich habe gar nicht erwartet, dass Sie sich an mich erinnern. Es ist schon drei Jahre her, und seither ist natürlich viel passiert …«
Ich versuchte, mich auf einen Ort und eine Zeit zu konzentrieren, die mir unvorstellbar weit weg erschienen.
»Ja, natürlich, jetzt erinnere ich mich …« Und es stimmte, denn ich erinnerte mich schwach an einen Abend mit Farrell, an dem ich irgendwelchen Leuten vorgestellt worden war.
»Vermutlich ist es mir sehr viel besser im Gedächtnis geblieben als Ihnen«, fuhr Miss Westerley fort. »Damals habe ich James zum letzten Mal gesehen. Ich muss oft daran denken.« Sie gestattete sich eine flüchtige Pause, bevor sie weitersprach. »Sie waren damals noch kein Captain. Ich gratuliere zur Beförderung.«
Ich zuckte verlegen mit den Schultern und murmelte etwas von wegen Glück und was für ein feiner Kerl Farrell gewesen sei, bis sie mich mit einer unwilligen Handbewegung zum Schweigen brachte.
»Ich bin mir sicher, Ihr Glück war wohlverdient, Captain. Haben Sie weit zu fahren?«
»Bis nach Hannesford. In Devon.«
»Ja, ja, ich kenne Hannesford. Sind Sie mit den Stansburys befreundet?«
»Ich kenne sie schon eine ganze Weile, obwohl ich lange nicht mehr dort gewesen bin. Ich habe sie einige Jahre vor dem Krieg kennengelernt, als meine Mutter im Sommer ein Haus in der Nähe gemietet hatte. Die Kinder waren etwa in meinem Alter.«
»Ach ja!« Ein belustigter Ausdruck huschte über ihr Gesicht. »Harry und Margot, die berühmten Stansbury-Kinder. Es gab noch mehr, nicht wahr?«
»Insgesamt fünf. Aber Harry und Margot waren die, die jeder kannte.«
»Das kann man wohl sagen.« Sie sagte es in einem eher trockenen Ton, als wäre sie nicht ganz davon überzeugt, dass sie die Aufmerksamkeit verdienten. »Ich kann mich an eine Zeit erinnern, in der alle über sie sprachen. Sie haben London im Sturm erobert. Waren sie wirklich so bemerkenswert?«
Nicht zum ersten Mal war ich unschlüssig, wie ich diese Frage beantworten sollte. Wie konnte man dieses Paar beschreiben, das die elegante Gesellschaft einmal derart betört hatte? Man hatte mich oft danach gefragt, und doch fiel mir noch immer keine passende Antwort ein.
»Das ist schwer zu sagen«, erwiderte ich ausweichend. »Sie wurden gewiss sehr bewundert.«
Miss Westerley schüttelte traurig den Kopf. »So viele unserer klügsten und besten …«, murmelte sie. Ein Satz, den man nicht vervollständigen musste. »So eine furchtbare Geschichte. Lebt Ihre Mutter noch in Hannesford, Captain Allen?«
Ich entgegnete, sie sei schon vor dem Krieg nach Südfrankreich gezogen. Miss Westerley nickte und sah mich prüfend an.
»Sie sind noch in Uniform, Captain. Heißt das, Sie wollen Ihre Armeelaufbahn fortsetzen?«
»Ganz und gar nicht.« Das Entsetzen stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn sie lächelte. »Das ist mein letzter Urlaub. Die Entlassungspapiere müssten jeden Tag eintreffen.«
»Waren Sie lange dabei?«
»Seit November ’14. Ich kannte jemanden, der mir ein Offizierspatent bei den Dorsets verschafft hat, als es damals losging.«
»Dann wundert es mich, dass Sie nicht schon längst zu Hause sind.«
Ich zuckte mit den Schultern. Mir gefiel ihre brüske, gebieterische Art. »Es ist meine eigene Schuld. Ich habe es irgendwie immer geschafft, mich ans Ende der Schlange zu stellen.«
»Daraus schließe ich, dass Sie nicht verheiratet sind, Captain. Aber vielleicht wartet jemand in Hannesford auf Sie …«
»Nein«, erwiderte ich entschieden. »Da wartet niemand.«
Sie nickte bei sich und schaute mich über ihre Brille hinweg an. »Sie waren lange weg, Captain. Sie werden feststellen, dass sich vieles verändert hat.«
Es entstand eine kurze Pause. Dann kam sie auf die Theaterstücke zu sprechen, die in dieser Saison in London Erfolge feierten, und die Aussicht auf Schnee, falls das Wetter kälter werden sollte.
Es war schon dunkel, als der Zug den Bahnhof von Hannesford erreichte. Er wirkte düster, viel düsterer, als ich ihn in Erinnerung hatte, und wurde nur von einer einzelnen Lampe beleuchtet, die den Bahnsteig in einen faden Schein tauchte und den Rauch der Lokomotive krankhaft gelb färbte. Der Bahnsteig lag verlassen da, und außer mir stieg nur noch ein Passagier aus, der in der Zweiten Klasse ganz am Ende des Zuges gesessen hatte, wo es jetzt am düstersten war. Ich musste zweimal hinschauen, bevor ich die Gestalt erkannte.
»Anne!«, rief ich. »Miss Gregory!« Ich ließ meine Taschen fallen und eilte auf sie zu.
Beim Klang meiner Stimme drehte sie sich um, und das Licht fiel auf ihr Gesicht. Einen geisterhaften Moment lang glaubte ich, ich hätte mich geirrt, doch zu meiner Erleichterung lächelte sie zurück.
»Hallo, Tom!« Ihre Stimme klang warm, wenn auch nicht sonderlich überrascht. »Ich hatte mich schon gefragt, ob wir vielleicht im selben Zug sitzen.«
»Sie sind es wirklich, Anne! Ich habe Sie kaum erkannt.«
Und das stimmte. Für mich war Lady Stansburys Gesellschafterin immer eine junge Frau gewesen. Ihr Gesicht so frisch und faltenlos wie mein eigenes.
»Soll ich mich jetzt geschmeichelt fühlen?« Sie wirkte belustigt. »Nach so langer Zeit dürfte ich mich wohl kaum zu meinem Vorteil verändert haben.«
Ich spürte, wie ich rot wurde. »Ganz und gar nicht. Sie sehen sehr gut aus. Verzeihen Sie, natürlich haben Sie sich vorteilhaft verändert …« Ich hielt verwirrt inne und sah zu meiner Erleichterung, dass sie immer noch lächelte. »Verdammt, Anne, es ist wunderbar, Sie zu sehen. Wie lange ist es her?«
»Fünf Jahre, denke ich. Letzten Sommer waren es fünf Jahre. Eine lange Zeit.«
Als ich sie genauer anschaute, wurde mir klar, dass meine gemurmelte Entschuldigung vielleicht gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt gewesen war. Gewiss, ihr Gesicht wirkte schmaler als früher, ebenso ihre Figur, doch sie hatte immer noch das gleiche angenehm offene Gesicht. Wie alt war sie bei unserer letzten Begegnung gewesen? Fünfundzwanzig? Sechsundzwanzig? Etwa in meinem Alter. Damals hatte ich sie als jung empfunden, doch sie kam schon in die Jahre, in denen sich die Heiratsaussichten einer Frau verschlechtern. Inzwischen hatte sie die jugendliche Weichheit verloren, an die ich mich erinnerte. Ohne sie wirkte sie unscheinbarer. Doch als wir die Stelle erreichten, an der ich meine Taschen fallen gelassen hatte, war da etwas in der Weise, wie sie dastand und mich im rauchigen, gelben Licht betrachtete … Auf eine Art, die ich nicht genau benennen konnte, hatte sie an Präsenz gewonnen.
Irgendwo hinter mir war der Bahnhofsvorsteher aufgetaucht, der Zug stand zur Abfahrt bereit. Anne verzog das Gesicht, als der Lärm über uns zusammenschlug.
»Sie sehen auch anders aus, Tom«, sagte sie, als es wieder still wurde. »Sie sind so dünn geworden. Und es ist seltsam, Sie in Uniform zu sehen. Von allen haben Sie immer am wenigsten militärisch gewirkt.«
Jahrelang hatte ich kaum an Anne Gregory gedacht, freute mich aber ungemein über das Wiedersehen. Die Einsamkeit, die ich in London empfunden hatte, verflüchtigte sich allmählich.
»Und was ist mit Ihnen, Anne? Wie ich hörte, waren Sie Pflegerin im Lazarett.«
»Krankenschwester«, korrigierte sie mich. »Wie Sie vielleicht noch wissen, habe ich vor meinem Leben in Hannesford eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Das war mein Glück, die ungelernten Pflegerinnen hatten im Lazarett einen schweren Stand. Werden Sie abgeholt?«
»Der Wagen dürfte wie üblich draußen auf der Straße stehen. Ich habe Lady Stansbury die Ankunftszeit telegrafiert.«
»Gut«, erwiderte sie fröhlich. »Das spart mir den Fußweg. Sie können mich am Pfarrhaus absetzen.«
Das war nun eine Überraschung.
»Am Pfarrhaus? Wohnen Sie nicht mehr in Hannesford Court?«
»Die Zeiten haben sich geändert.« Sie lächelte zu mir auf. »Ich bin jetzt im Pfarrhaus und kümmere mich um Mrs Uttley. Der Ärmsten geht es leider gar nicht gut.«
Das beantwortete meine Frage nur halb.
»Aber wie ist es dazu gekommen? Ich hätte gedacht, dass Lady Stansbury Sie um jeden Preis zurückhaben wollte.«
Ich war aufrichtig verwundert. Hannesford Court ohne die stille Anne Gregory im Hintergrund konnte ich mir gar nicht vorstellen.
»Sie hat mir in der Tat einen sehr netten Brief geschrieben. Aber ich wollte nicht zurück. Kommen Sie, der Fahrer wartet.«
Nachdem ein Chauffeur, den wir beide nicht kannten, das Gepäck in dem vertrauten Wagen verstaut hatte, hörte ich mir einen präzisen, aber blutleeren Bericht über Annes Lazarettdienst an, eine Reihe von Daten und Ortsnamen, London, Folkestone, Belgien, Frankreich. Mir wurde klar, dass sie diese Rede schon öfter gehalten hatte, eingeübte Worte, steril geworden durch die ständige Wiederholung. Sie sagten alles und nichts. Und waren in dieser Hinsicht seltsam vertraut. Denn ich hatte meine eigene abgenutzte Litanei von Ereignissen und Daten. In Annes gesprächiger Zurückhaltung spiegelte sich etwas, das uns beide verband.
Als ihr Bericht zu Ende war, fragte sie nicht, wie es mir ergangen war. Stattdessen redeten wir über London und unsere Reise. Ich erzählte, wie schmutzig der Zug gewesen war, in dem ich von der Küste gekommen war, und sie beklagte sich, dass es zu wenig Autobusse in London gab, die überdies unzuverlässig waren. Ich kam gar nicht auf die Idee zu fragen, weshalb sie in der Stadt gewesen war, und erst als wir das Pfarrhaus fast erreicht hatten, kamen wir auf Hannesford Court zu sprechen. Als die Schornsteine über den Hecken auftauchten, schwiegen wir beide kurz.
»Wissen Sie noch?«, fragte ich. »Als ich das letzte Mal hier war, habe ich Ihnen gesagt, ich würde nie mehr zurückkommen.«
»Ja, das weiß ich noch.« Sie sah zu, wie die dunklen Hecken draußen am Fenster vorbeizogen. »Und als ich mich zum Lazarettdienst gemeldet habe, habe ich das Gleiche gedacht. Und doch sind wir beide wieder hier.«
»Aber wieso das Pfarrhaus, Anne? Das haben Sie mir immer noch nicht erklärt.«
Wir fuhren ins Dorf und auf die Kirche zu, die sich schattenhaft vor dem noch nicht ganz dunklen Himmel abzeichnete. Einen Moment schaute Anne schweigend in den Abend hinein.
»Es ist komisch, nicht? Als Lady Stansbury mich damals nach Hannesford holte, wollte sie mich vor einem Dasein als Krankenschwester bewahren. Sie hielt es für skandalös, dass die Tochter ihrer ältesten Freundin so tief gesunken war. Also kam ich her und machte mich nützlich. Gehörte beinahe zur Familie, kam aber immer als Letzte zu Tisch. Dann wurden irgendwo weit weg ein paar Schüsse abgefeuert, und plötzlich rissen sich all diese perfekten, eleganten jungen Damen förmlich darum, Krankenschwester zu werden. Eine seltsame Welt!«
Sie schaute mich an. »Lady Stansbury war ehrlich überzeugt, es sei das größte Geschenk, jemanden hierherzuholen. Doch als ich in Frankreich im Lazarett gearbeitet habe, wurde mir klar, dass ich nicht mehr zurück konnte.«
Sie sprach mit einer so ruhigen Gewissheit, dass ich sie fast beneidete.
»Aber was wollen Sie stattdessen machen?«
In ihrem Lächeln schwebten Geister.
»Krankenschwestern sind sehr gefragt, Tom. Es gibt immer noch viele junge Männer, die Pflege brauchen. Falls nicht hier, dann in Übersee. Zunächst aber kümmere ich mich um Mrs Uttley. Sie war immer sehr gut zu mir, während ich in Hannesford gelebt habe. Und es ging ihr so schlecht, als sie mir schrieb. Ich glaube, ich habe zugesagt, weil ich wusste … dass es nicht auf Dauer sein würde.« Der Wagen hielt an. »Haben Sie noch Zeit, kurz mit hereinzukommen? Die beiden würden sich so freuen, Sie zu sehen.«
Ich versprach, den Pfarrer und seine Frau am nächsten Tag zu besuchen. In mancher Hinsicht waren Anne und ich zwei unabhängige Planeten gewesen, die den feurigen Stern der Stansburys umkreisten. Als ich sie an diesem Abend im Schatten des Pfarrhauses verschwinden sah, fragte ich mich, wie viele Veränderungen mich sonst noch in Hannesford erwarteten.
Vom Dorf aus gibt es keine direkte Straße nach Hannesford Court. Ein Pfad durch den Wald ist die kürzeste Verbindung, doch Autos müssen den Umweg über die neue Brücke nehmen, die bei den Uferauen über den River Hanna führt. Der Professor und ich waren oft dort spazieren gegangen; er hatte gern nach Schmetterlingen gesucht. Doch als die Scheinwerfer des Daimler an diesem Abend die vertraute Auffahrt erhellten, dachte ich nicht an den Professor, sondern nur an das, was vor mir lag.
Als ich das erste Mal nach Hannesford kam, lag ein Gewitter in der Luft. Ich spürte die unangenehme Hitze, die sich schwer auf mich niedersenkte, als ich den Zug verließ. Außer mir stieg niemand aus. Man hatte einen Chauffeur geschickt, um mich abzuholen, und der Gepäckträger beeilte sich mit den Koffern. Während die beiden zum Auto eilten, blieb ich allein auf dem Bahnsteig, der ein Stück vom Dorf entfernt liegt, und betrachtete die sanft geschwungenen Felder und das blaue Moor in der Ferne.
An diesem Tag veränderten sich die Farben. Ich hatte eine Welt der tristen, grauen Wohnstuben und der feuchtkalten Vorgärten hinter mir gelassen, in der selbst die strahlendste Hoffnung rasch zu Vorsicht, Vernunft und Sparsamkeit verblasste. Doch in Hannesford war nichts grau oder trist. Die Welt dort war in strahlende Farben getaucht. Selbst die Gewitterwolken, tintenschwarz und schwindelerregend, mit klaffenden Rissen in Indigo und Violett, hatten etwas Dramatisches an sich. Die Felder waren schwefelgelb, der Weizen glomm vor sich hin.
Als der Wagen in die lange Einfahrt von Hannesford Court bog, hatte sich das Glimmen schon zu einem rebellischen Bernsteinton verdunkelt, und das Gewitter brach los. Mein erster Blick auf das alte Haus war verblüffend. Hinter den hoch aufragenden Schornsteinen blitzten grellweiß die Hänge des Moors auf. Und mit jedem neuen Aufbranden des Gewitters hob sich meine Stimmung. Das hier war Naturgewalt und Farbe und Weite, das Leben in einem Ausmaß, wie ich es noch nie gesehen hatte. Das war meine Zukunft, hier fing mein Leben an, hier würde ich Abenteuer erleben.
Als man mich ins Haus führte – geduckt unter dem Regenschirm des Butlers, der Rock schon nass vom Regen –, überwältigte mich beinahe der Duft der Blumen. Von irgendwoher wehte ein Hauch von Orangenblüten, und überall, auf jeder freien Fläche, standen Schalen mit Rosen.
2
Tom! Wie elegant Sie aussehen! Willkommen zurück in Hannesford. Es ist unverzeihlich, dass Sie so lange weg waren.«
Lady Stansbury empfing mich in der Großen Halle, dem ältesten und eindrucksvollsten Teil von Hannesford Court. Der weitläufige Raum hatte eine gewölbte Decke mit freiliegenden Dachbalken und war mit einem gewaltigen Kamin ausgestattet. In einer dunklen Ecke führte eine Treppe aus der Tudorzeit auf die Galerie empor. Dort stand bereits, wie es die Tradition verlangte, ein angemessen dunkler und geheimnisvoller Weihnachtsbaum, der darauf wartete, geschmückt zu werden.
Die Stimme meiner Gastgeberin klang genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte, hell und melodisch. Es war eine Stimme, die erregte Gemüter besänftigen und gelangweilte Gäste bezaubern konnte. Doch ich bemerkte sofort, dass sich Lady Stansbury in anderer Hinsicht sehr verändert hatte. Ich hatte ihr seit meinem letzten Besuch mehrmals geschrieben, zunächst höfliche Briefe, in denen ich von meinen Beförderungen berichtete, später dann, um beim Tod gemeinsamer Freunde zu kondolieren, worin wir alle im Lauf der Jahre so geübt geworden waren. Ihre Antworten hatten mich nicht auf irgendeine Veränderung an ihr vorbereitet. Sie hatte stets einen Ton wohlwollender Herablassung bewahrt, als könnte nichts auch nur einen Moment lang die Festung ihrer Selbstbeherrschung erschüttern.
Doch als ich ihr gegenüberstand, sah ich das Leid, das sich in ihr Gesicht gegraben hatte. Sie wirkte viel älter als früher, schmal und zerbrechlich, als wäre sie urplötzlich gealtert, ein jäher Vorgang, der sie wie eine Strafe getroffen hatte. Die Knochen hatten die Rundung der Wangen verdrängt, und ihr Haar wirkte dünner, so dass sich die Form des Schädels deutlicher abzeichnete. Der Eindruck verwöhnter Zeitlosigkeit, der früher ihr Äußeres geprägt hatte, war völlig verschwunden.
Und noch etwas anderes hatte sich verändert. Seit ich sie kannte, war Lady Stansbury strahlend und elegant über die alltäglichen Mühen, die ihre Existenz sicherten, erhaben gewesen, als nähme sie sie gar nicht wahr. Die Frau, die mich an diesem Abend empfing, wirkte sehr viel zielstrebiger. Es schien, als hätte sie unter den Schicksalsschlägen nicht gewankt, sondern irgendwie die Kraft gefunden, ihnen zu trotzen. Das kannte ich aus den Schützengräben. Es kamen immer neue Offiziere dazu, und man wusste vorher nie, wer zerbrechen und wer wachsen würde.
»Sie müssen versprechen, uns nicht noch einmal zu verlassen, Tom«, fuhr sie fort. »Vor allem nicht, nachdem so viel geschehen ist. Wir sind so glücklich, Sie wieder bei uns zu haben.«
Sie entließ das Hausmädchen mit einer Handbewegung und führte mich zum Kamin.
»Die anderen ziehen sich gerade um, sie kommen gleich herunter. Wir haben das Haus voll, genau wie früher.« Sie zögerte. »Ich wollte Sie etwas fragen, Tom. Hoffentlich sind Sie nicht gekränkt. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich umziehen könnten, bevor Sir Robert Sie in Uniform sieht. Ich weiß, es ist nicht richtig, aber der Anblick junger Männer in Uniform regt ihn furchtbar auf. Es führt ihm vor Augen, dass sie durchgekommen sind. Ich bin mir sicher, Sie verstehen das … Wir haben Sie nicht in Ihrem alten Zimmer untergebracht – wir dachten, da es gleich neben Harrys liegt … Aber das Blaue Zimmer ist sehr hübsch, und Evans wird sich um Sie kümmern. Sie erinnern sich doch an ihn? Er war bereit, zurückzukommen und uns zu unterstützen. Er ist noch von der alten Schule und ein wunderbares Vorbild für die anderen …«
Natürlich war Lady Stansbury immer bezaubernd gewesen, doch war ich nie richtig warm mit ihr geworden. Daher überraschte es mich selbst, dass ich an diesem Abend einen Stich des Mitleids verspürte, als ich kurz darauf von der Galerie in die Große Halle hinunterschaute, wo sie ein Blumengesteck zurechtrückte. Mir wurde unvermittelt bewusst, wie klein sie inmitten der prachtvollen Umgebung wirkte.
Oben im Haus war es kühler. Das Blaue Zimmer war geräumiger, aber auch nichtssagender als mein altes, so als hätten die Schritte ständig wechselnder Gäste seine Eigenart zertreten und nur eine farblose Hülle zurückgelassen, die darauf wartete, gefüllt zu werden. Dennoch war ich froh, dass man mir ein anderes Schlafzimmer zugewiesen hatte. In dem alten hatte ich zu viele ruhelose Nächte verbracht, hatte zu viele Stunden sinnlos an die Decke gestarrt und mich wegen meiner eigenen Torheit gescholten. Das Blaue Zimmer passte mir sehr gut. Ich hatte gebadet, mich umgezogen und die Fürsorge des alten Evans erfolgreich abgewehrt, als es klopfte.
Ich hatte mich oft gefragt, wie es sein würde, Margot Stansbury wieder zu begegnen. Auch wenn ich mir geschworen hatte, nicht mehr herzukommen, konnte ich ihr nicht ewig ausweichen. Die Welt war klein, und unsere Wege würden sich unweigerlich kreuzen. Ich hatte mir oft eine Begegnung mit ihr ausgemalt, war aber dabei stets ein völlig anderer Mann als der, den sie gekannt hatte: klüger oder weltgewandter oder durch irgendetwas berühmt und erfolgreich geworden. Später stellte ich mir dann vor, ich wäre entstellt, verstümmelt oder blind. Margot hingegen sah immer aus wie bei unserer letzten Begegnung: frisch und makellos, ihr goldener Schimmer unverfälscht und ungetrübt. Der Gedanke, dass auch sie sich verändern könnte, kam mir nie. Margot würde immer Margot sein.
Doch die Frau, die an diesem Abend vor mir stand, hatte sich durchaus verändert, genau wie Anne Gregory, und auf eine Weise, die sowohl auffallend als auch schwer zu beschreiben war.
»Was ist los, Tom? Hast du ein Gespenst gesehen?« Sie schloss die Tür hinter sich und musterte mich belustigt. Blaue Augen, dunkle Wimpern, die Mundwinkel in ihrem so typischen angedeuteten Lächeln aufreizend gekräuselt.
»Margot …«
»Ja, Tom, ich weiß. Es ist lange her. Aber bitte keine langweiligen Floskeln. Es zählt nur, dass du hier bist.« Sie betrachtete mich mit unverhohlener Neugier. »Mama hat recht, du bist tatsächlich dünner als früher. Warte nur, bis die Köchin dich sieht. Sie wird es als persönliche Herausforderung auffassen.«
»Mrs Adkins? Ist sie noch hier?«
»Oh, ja. Mrs Adkins macht tapfer weiter. Sie ist ein Schatz. Leider weigert sie sich inzwischen, eine ganze Liste von Speisen zu kochen, seit ihr jemand erzählt hat, es seien die Lieblingsgerichte des Kaisers gewesen. Mutter sagt, es mache die Menüplanung ausgesprochen schwierig.«
Wir lachten beide, und die Spannung verflog. Margot trat auf mich zu.
»Weißt du, Tom, ich kann es gar nicht fassen, dass du wieder da bist. Wir hatten schon gedacht, dass niemand, den wir gern haben, es überstehen würde. Harry, Julian, Oliver … Selbst die, von denen man dachte, dass ihnen niemals etwas Dramatisches zustoßen könnte, so wie die Everson-Brüder oder Tippy Hibbert. All diese schrecklichen, schrecklichen Telegramme. Aber jetzt bist du hier. Ich kann es wirklich kaum glauben.«
Nun stand sie vor mir und drückte ihre Wange an meine, die vertraute Begrüßung, die mich immer aus der Fassung gebracht hatte, obwohl sie es bei kleinen Jungen und ältlichen Colonel genauso machte.
»Und was ist mit mir, Tom? Habe ich mich verändert?«
»Natürlich nicht.« Ich hatte meine Lektion gelernt und war mir auch wirklich nicht sicher. So vieles an ihr war genau so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ihre Gesichtszüge waren noch immer erlesen, ihre Haut makellos, das Blau ihrer Augen leuchtend wie eh und je. Wann immer ich Margot länger nicht gesehen hatte, erlebte ich, wie meine Vorstellung mit der Wirklichkeit kollidierte und mir plötzlich blass und mangelhaft erschien. Nichts konnte mich je auf die wirkliche Margot vorbereiten.
Und doch hatte sie sich verändert. Nicht äußerlich, es war eher ihre Haltung, die Ungezwungenheit, mit der sie sich bewegte, als wäre etwas verschwunden, das sie früher eingeengt und zurückgehalten hatte. Was immer es gewesen sein mochte, der Unterschied war irritierend. Er erinnerte mich daran, dass sich die Welt in den vergangenen fünf Jahren ohne mich weitergedreht hatte. Ein leiser Schreck durchfuhr mich bei diesem Gedanken – der Schock des Schwimmers, der nach dem Boden tastet und nur tiefes Wasser unter sich findet.
»Schau doch nicht so finster, Tom.« Margot beobachtete mich noch immer, ein Lächeln auf den Lippen. »Das ist nicht gerade schmeichelhaft. Du könntest wenigstens so tun, als ob du dich freust, mich zu sehen.«
»Oh, aber …« Ich riss mich zusammen. »Und wie ich mich freue, Margot. Ganz ehrlich. Es ist wunderbar, dich zu sehen. Aber auch seltsam. Ich kann kaum glauben, dass ich wieder in Hannesford bin.«
Sie nickte und trat näher, um meine Krawatte zurechtzurücken. »Natürlich. Alles ist ein bisschen seltsam, nicht wahr? Wir alle waren so damit beschäftigt, das Ende des Krieges herbeizusehnen, dass wir keinen Gedanken an die Zeit danach verschwendet haben.«
Sie trat zurück, um ihr Werk zu bewundern.
»Das mit Julian tut mir leid.«
Da. Ich hatte das, was gesagt werden musste, ausgesprochen.
Sie nickte und trat wieder vor, machte sich erneut an meiner Krawatte zu schaffen.
»Ja. Es war furchtbar für ihn. Er war der Letzte, dem das hätte zustoßen dürfen. So hilflos zu werden. Es wäre besser gewesen, wenn er sofort gestorben wäre. Das ganze Gerede vom Sterben für König und Vaterland. Aber das Sterben ist nicht immer das Schlimmste, oder? Das letzte Jahr war schrecklich für ihn.«
»Und für dich.« Ich sagte es so sanft wie möglich, doch sie schüttelte den Kopf.
»Nicht so schlimm wie für ihn, glaube ich. Und jetzt kommst du mit und begrüßt die anderen. Mama hat leider ein paar furchtbare Langweiler eingeladen …«
Ich hatte Julian Trevelyan nie gemocht. Zuerst war er nur einer der vielen neuen Bekannten, die ich in Hannesford traf, da fiel es mir nicht so auf. Doch im Laufe der Zeit gewann ich ein klareres Bild von Harry Stansburys Freunden. Oliver Eastwell beispielsweise war derb und herzlich und geistig nicht der Schnellste. Freddie Masters war der Witzbold. Tippy Hibbert war der geborene Landjunker, wie aus einem Roman von Thackeray.
An Julian hingegen entdeckte ich einen Hochmut, den auch gute Manieren nicht gänzlich verdecken konnten, und manchmal erschienen mir seine Neckereien grausam. Er trat auf, als stünden ihm von Rechts wegen nur die besten Dinge im Leben zu und als wäre Margot, sogar Margot, nur eines dieser Dinge.
Er galt jedoch als gut aussehend, was nicht ganz unverständlich war. Er war kräftig gebaut und verfügte über eine ruppige, kantige Attraktivität. Ich sah ihn selten tanzen, folgte aber dann und wann seinem Blick, wenn die Musik spielte, und bemerkte, wie er die eine oder andere Dame beobachtete. Ein ziemlich hungriger Blick, dachte ich bei mir. Julian Trevelyan hegte zweifellos gewisse Leidenschaften, und es hätte ihm nicht an weiblicher Gesellschaft gemangelt, um sie auszuleben.
In jenem letzten Sommer, als Margots Vorliebe für Julian immer deutlicher wurde, genoss er sichtlich ihre Gesellschaft. Für mich schien er eher der Sammler zu sein als der Liebhaber, und das sagte ich ihr auch. Es war am Abend des Rosenballs, und ich hatte Margot seither nicht mehr gesehen. Es war bemerkenswert, dass dies unsere letzten Worte gewesen waren.
In der Großen Halle drängten sich bereits die Gäste, als Margot mich hinunterführte. Es war ein schönes Bild. Die Lampen tauchten den alten Raum in ein anheimelndes Licht, und das riesige Kaminfeuer zischte und knackte mit gottloser Wildheit. Vor diesem Hintergrund nahmen sich die tadellos zurechtgemachten Gäste seltsam tröstlich aus. Die strengen schwarzen Umrisse der Männer wirkten durch die fließenden pastellfarbenen Frauenkleider weicher. Erst der Krieg hatte mich die beruhigende Gewissheit, die Menschen in Abendgarderobe verströmten, schätzen gelehrt.
Die Gesellschaft war in etwa so groß wie früher, nur hätte ich damals jeden einzelnen Gast gekannt. Nun ließ ich Margot ziehen und blieb zurück, um die Szene zu betrachten und den Gesichtern Namen zu geben.
Den Londoner Bankier und seine Frau, die sich mit dem alten Colonel Rolleston unterhielten, hatte ich schon in Hannesford gesehen, wenn auch nur selten und nie vor Weihnachten. Vermutlich zwei von Margots Langweilern. Daneben standen die Finch-Taylors, die regelmäßig eingeladen wurden. Laura Finch-Taylor war in meinem Alter, ihr Ehemann deutlich älter, etwa wie Sir Robert, und er schien sich seit unserer letzten Begegnung im Umfang verdoppelt zu haben. Die beiden unterhielten sich mit einem gut aussehenden Mann von etwa vierzig, den ich nicht kannte.
Als Margot auf sie zuging, drehten sich alle drei um. Diese Wirkung hatte sie immer. Daran hatte sich zumindest nichts geändert.
In der Mitte des Raums hielt Lady Stansbury neben einem hochgewachsenen jungen Mann von achtzehn oder neunzehn Jahren Hof. Als er mich entdeckte, löste er sich aus der Gruppe und kam zu mir herüber.
»Hallo, Tom«, begrüßte er mich freundlich. »Erinnerst du dich an mich?«
»Bill!« Das jüngste Kind der Stansburys war bei meinem letzten Besuch dreizehn gewesen. »Meine Güte, bist du gewachsen. Ich hätte dich nie und nimmer erkannt.«
Was auch stimmte. Bill Stansbury war ein unauffälliges Kind gewesen, ein bisschen ehrfürchtig gegenüber seinen älteren Geschwistern und etwas blass, als hätten sie ihm das ganze Licht genommen. Ich erinnerte mich an seine stille Bewunderung für Harry.
»Wir sind alle so froh, dass du es einrichten konntest. Freddie Masters sagt, es sei dein letzter Urlaub. Stimmt das?«
»Sieht so aus.« Ich hatte mir schon lange abgewöhnt, definitive Aussagen über meine Zukunft zu machen.
Der junge Mann lächelte warmherzig. »Wenn Freddie das sagt, wird es wohl stimmen. Er hat meistens recht. Ich wage zu behaupten, dass dir die Armee sehr fehlen wird, wenn es erst vorbei ist. Ich sollte dich warnen, das Zivilleben ist ganz schön öde.«
Erst da dämmerte mir, dass Bill Stansbury alt genug war, um selbst Uniform getragen zu haben. Der Gedanke war ziemlich schockierend.
»Das kann schon sein«, erwiderte ich ernst. »In welchem Regiment hast du gedient?«
»Bei den Devonshires, genau wie Harry. Natürlich habe ich es erst rübergeschafft, als alles vorbei war, was ich ziemlich ärgerlich fand. Denny Houghton da drüben ist es ähnlich gegangen. Er hat den Krieg auch verpasst. Es ist schrecklich, dass wir unseren Beitrag nicht leisten konnten.« Er senkte die Stimme und beugte sich zu mir. »Aber nach dem, was mit Harry und Reggie passiert ist, war Mutter natürlich außer sich bei dem Gedanken, dass ich auch gehe. Und Vater … Du weißt ja, wie sehr er Harry geliebt hat. So wie wir alle. Es hat den alten Herrn ganz schön mitgenommen.«
»Und Reggie?« Ich schaute mich um. »Jemand hat mir erzählt, er erhole sich gut.«
»Oh, ja, ganz hervorragend! Du weißt ja, Reggie war immer ein Kämpfer.« Er wirkte etwas verlegen, als er das sagte. »Er ist heute Abend nicht hier. Ihm ist noch nicht nach Gesellschaft zumute. Er will noch ein bisschen im Sanatorium in Cullingford bleiben. Die Einrichtung ist ausgesprochen gut, es sind viele Offiziere da. Die Ärzte und Schwestern arbeiten ausgezeichnet.« Er beugte sich noch weiter vor. »Tom, ganz unter uns, Mutter möchte mit dir über Reggie sprechen …«
Dann richtete er sich auf und trat einen Schritt zurück, als hätte er ein schwieriges Thema angemessen bewältigt und könnte jetzt zu angenehmeren Dingen übergehen. »Sag mal, hast du das mit Freddie gehört? Sie verleihen ihm den Verdienstorden. Ist das nicht großartig?«
Freddie Masters, der Kriegsheld. Die Welt war schon sonderbar.
»Ja, das habe ich gehört. Ist er hier? Er wollte etwas mit mir besprechen.«
»Er musste nach Crowmarsh, um seine Tante zu besuchen«, meinte Bill grinsend. »Er sagt, sie sei die reichste unverheiratete Tante Europas, und ihr Wunsch sei ihm Befehl. Mutter hat ihm freigegeben. Er kommt zur Schlafenszeit zurück.«
Bill Stansbury schien es zu genießen, mit mir durch den Raum zu schlendern, mich Leuten vorzustellen und gelegentlich kleine Kommentare hinzuzufügen, die nur für mich bestimmt waren. Wenngleich ich seine Bewunderung etwas befremdlich fand, lag in seiner Begeisterung doch etwas von der Fröhlichkeit und Aufregung, die ich so schmerzlich vermisst hatte.
»Mal sehen, Tom, wen haben wir als Nächstes … Mit Denny Houghton verschone ich dich fürs Erste – prachtvoller Bursche – wir waren zusammen in der Schule –, aber er ist eigentlich nur zur Jagd hergekommen. Mama hat darauf bestanden, weil sie so knapp an jungen Männern ist … Die Finch-Taylors kennst du natürlich. Es heißt, durch den Krieg sei der alte Horatio noch reicher geworden. Und sieht Laura nicht prächtig aus?« Bill wurde ein bisschen rot. »Sie sagt, ich wäre Harry sehr ähnlich, das ist doch verdammt anständig von ihr.«
In ebendiesem Moment schaute Laura Finch-Taylor zu uns herüber, und ihre Augen schossen von mir zu Bill und wieder zurück, wobei ein katzenhaftes Lächeln über ihr Gesicht huschte. Dann, bevor einer von uns etwas sagen konnte, wandte sie sich wieder ihrem Mann zu, ruhig und distanziert wie zuvor. In einem Land voller Witwen erschien ihre Gattenwahl auf einmal nicht mehr exzentrisch, sondern erstaunlich weitsichtig. Ihr Lächeln blieb unergründlich wie das der Sphinx; ich hatte nie wirklich begriffen, was hinter ihren dunklen Augen vorging.
»Dort drüben bei meiner Mutter steht Violet Eccleston«, fuhr Bill fort. »Sie ist die Tochter eines alten Freundes von Vater. Vater hatte sich vor einigen Jahren mit ihm zerstritten, doch sie haben sich versöhnt, als Harry starb. Eccleston hat ihm einen äußerst anständigen Brief geschrieben. Leider ist Violet ziemlich anstrengend. Sehr modern. Sie lebt allein in einer Wohnung und studiert in der British Library Wirtschaft.« Er sprach das Wort aus, als litte sie unter einer leicht unappetitlichen Krankheit. »Vater kann sie nicht ertragen, musste sie aber einladen, um keine alten Gräben aufzureißen. Und Mama sagt, wir hätten beim Neujahrsball ohnehin zu viele junge Frauen. Sie macht sich schreckliche Sorgen wegen der Tanzerei.«
»Was ist mit Susan? Ich habe sie noch gar nicht gesehen.« Sie war Margots jüngere Schwester.
»Sie kommt morgen her«, erwiderte Bill fröhlich. »In letzter Zeit ging es ihr nicht so gut. Nur übermüdet, wie die Ärzte sagen. Es war natürlich scheußlich für sie, Oliver so rasch zu verlieren. Mutter meint, sie solle besser wieder bei uns einziehen, aber Susan will nichts davon hören. Sie wohnt in Olivers Haus am Huntingdon Square …«
Susan Stansbury war nur wenige Monate mit Oliver Eastwell verheiratet gewesen, als er starb. Er hatte zu Harrys engstem Kreis gehört, ein gutmütiger Bursche, reich und beflissen, der den geistreichen Stansburys immer ein wenig hinterherhinkte. Seine Verlobung mit Susan hatte mich überrascht, und ich hatte mich gefragt, wie um Himmels willen sie Oliver für den Rest ihres Lebens ertragen sollte. Nun, da sich diese Frage erübrigt hatte, bekam ich ein äußerst schlechtes Gewissen.
»Und Margot?«, fragte ich beiläufig und fuhr fort, die versammelten Gäste zu betrachten. »Wie ist es ihr ergangen?«
»Du kennst ja Margot!«, sagte Bill mit einer lässigen Handbewegung. »Wie immer. Natürlich war es schlimm, Julian auf diese Weise zu verlieren. Es hieß immer, sie seien füreinander bestimmt. Und es war sicher schrecklich, ihn all die Monate so zu erleben. Letztlich war es ein Schock, als er plötzlich starb, aber auch ein Segen, für ihn und Margot. Sie war furchtbar durcheinander wegen der ganzen Sache, aber sehr tapfer.«
Vom anderen Ende des Raums her erklang leises Gelächter, als wollte sie ihre Widerstandskraft betonen. Margot Stansbury hielt stand, auch wenn sie ihren Verlobten verloren hatte.