
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sonne, Meer und jede Menge Romantik - das neue Buch von Jenn Bennett, der Autorin des Bestsellers »Unter dem Zelt der Sterne« Josie (17) hat einen Plan, als sie mit ihrer Mutter an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt: Während Mom die Buchhandlung der Familie führt, wird sie ihren Abschluss machen, mit der Kamera die Stadt erkunden und am Ende des Sommers zu ihrem Vater, einem berühmten Fotografen, an die Westküste ziehen. Und dann steht plötzlich Lucky Karras vor ihr – groß, gut aussehend und verdammt wütend. Ganz anders als der Junge, der 5 Jahre zuvor ihr bester Freund war. Alle warnen Josie, doch als Lucky ihr aus einer Notlage hilft, ist es um sie geschehen. Könnte er der eine gute Grund sein, um doch zu bleiben? Witzige Dialoge, sympathische Figuren, tolles Setting und perfekt fürs Herz!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jenn Bennett: Wiedersehen mit Lucky
Aus dem Englischen von Claudia Max
Josie hat einen festen Plan, als sie mit ihrer Mutter an den Ort ihrer Kindheit zurückkehrt: Während Mom die Buchhandlung der Familie führt, wird sie ihren Abschluss machen, mit der Kamera die Stadt erkunden und am Ende des Sommers zu ihrem Vater, einem bekannten Fotografen, an die Westküste ziehen. Und dann steht plötzlich Lucky Karras vor ihr – groß, gut aussehend und verdammt wütend. Ganz anders als der Junge, der fünf Jahre zuvor ihr bester Freund war. Alle warnen Josie vor ihm, doch als Lucky ihr aus einer Notlage hilft, ist es um sie geschehen. Könnte er der eine gute Grund sein, um doch zu bleiben?
Neuanfang in Sachen Liebe: romantisch, atmosphärisch und einfach perfekt
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
Für alle Buchhändlerinnen und Buchhändler,die ich früher schon geliebt habe.
WILLKOMMEN IN BEAUTY: Das auf kolonial gemachte Schild begrüßt Reisende am Eingang der kleinen Küstenstadt Beauty, Rhode Island. Dank des historischen Hafens mit Verbindung zur Narragansett Bay ist die Stadt im Sommer ein beliebter Ferienort in New England, der betuchte Urlauber anzieht. (Foto privat/Josephine Saint-Martin)
1
Februar
In meiner Familie wird hartnäckig an dem Glauben festgehalten, auf den Saint-Martin-Frauen laste ein Fluch in Liebesangelegenheiten. Sie hätten Pech in der Liebe und seien dazu verdammt, elend und einsam zu enden. Angeblich hat eine meiner frühen Vorfahrinnen in New England einen Nachbarn gegen sich aufgebracht – wie überraschend –, woraufhin der die weise Frau des Dorfs dafür bezahlt hat, uns mit einem Fluch zu belegen. Und zwar absolut jede von uns. Generation um Generation. Im Sinne von für keine von euch wird es je ein »Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende« geben, Amen, so soll es sein, genießt euren Liebeskummer.
Ich bin siebzehn und hatte noch nie eine Beziehung. Genau genommen gab es in meinem Leben sogar nur eine richtige Freundschaft, aber das ist schon lange her. Insoweit hatte ich noch keine Gelegenheit, den Fluch in Aktion zu erleben. Trotz des krassen Aberglaubens in meiner Familie weiß ich sehr wohl, dass es sich bei unserem Pech die letzten Jahre bloß um eine Anhäufung unglücklicher Zufälle handelt. Und dass in die Stadt zu ziehen, wo der Fluch seinen Anfang genommen hat, nicht gleich das Ende der Welt bedeutet, da kann meine Mutter behaupten, was sie will.
Ich stehe gerade vor dem Ortsschild von Beauty und schieße das Standard-Foto von jedem unserer Umzüge. Die absurden Wehe!-Ausrufe meiner Mutter zum Thema Liebe überhöre ich geflissentlich und konzentriere mich stattdessen auf das, was das Schild für mich darstellt – meine Zukunft.
Ihr müsst wissen, meine Mutter und ich ziehen oft um. Und mit oft meine ich sieben Umzüge in den letzten fünf Jahren … die Ostküste hoch und runter, sieben verschiedene Städte. Wir sind Profis. Und hauen schneller aus einer Stadt ab als ein Mafioso, dem jemand gesteckt hat, dass gleich die Cops vor seiner Tür stehen.
Ein Ort ist wie der andere, nach einer Weile fühlen sich alle gleich an.
Außer Beauty.
Hier haben sämtliche wichtigen Ereignisse meines Lebens stattgefunden. Hier wurde ich geboren – wie alle Saint-Martin-Frauen bis zurück zu diesem albernen Liebesfluch. Hier haben Mom und ich bis zu meinem zwölften Lebensjahr gewohnt. Und hier will ich – wenn alles klappt – nächstes Jahr meinen Highschool-Abschluss machen.
Aber am allerwichtigsten – hier wird sich auch mein Leben ändern, wenn alles wie erhofft läuft. Und zwar gewaltig. Ich habe große Pläne für die Zukunft und jeder einzelne fängt mit diesem Schild hier an. Alle anderen mögen nur »Willkommen in Beauty« sehen, ich nicht.
Ich sehe: Hallo, Josie Saint-Martin. Willkommen! Hier fängt dein neues Leben an.
»Es ist eiskalt da draußen, Shutterbug«, ruft mir meine Mutter aus dem kleinen U-Haul-Umzugslaster zu, der hinter mir am Straßenrand parkt. Unser Auto, auch der Rosarote Panther genannt, ein zuckerwattefarbener 1980er-Käfer mit viel zu vielen Meilen auf dem Tacho, ist hinten angehängt. »Hast du das nicht eh schon mal fotografiert? Pfeif auf die Tradition. Das Schild haut dir ja nicht ab. Knips es später, du Fotoverrückte.«
»Hetz mich nicht, Frau.« Ich schraube den Deckel auf das Objektiv meiner alten Nikon F3 und verstaue sie in der braunledernen Kameratasche um meinen Hals. Das Foto vom Ortseingangsschild ist eine Tradition, aber Schilder abzulichten ist auch mein künstlerischer Ansatz als Fotografin. Manche Leute bevorzugen Landschaften oder Menschen oder Tiere, ich nicht. Ich mag Reklametafeln, Plakatwände mit bissigen Slogans, penetrante Neonschriftzüge an Restaurants, von Kugeln durchsiebte Straßenschilder. Sie erzählen alle eine Geschichte und das mit wenigen Worten.
Und mit einer Sache hat meine Mutter recht. Im Gegensatz zu Menschen rühren sich Schilder nicht von der Stelle. Sie warten darauf – vierundzwanzig Stunden, sieben Tage die Woche –, dass man sie fotografiert. Man braucht ihnen keine Nachricht zu schreiben, ob sie zum Abendessen nach Hause kommen. Man braucht sich nicht zu ärgern, wenn man enttäuscht ist, weil die Antwortet lautet: Bestell dir doch was beim Lieferdienst und iss ohne mich. Schilder sind verlässlich.
Ich klettere wieder in den U-Haul und während ich den Gurt umlege, verrät der Blick meiner Mutter ein Gefühl, das sie nur selten zeigt. Was immer das Gegenteil von begeistert sein mag, so sieht sie gerade aus. Ihre Nervosität wegen unseres Umzugs nach Beauty begann mit »leicht gestresst« und steigerte sich auf der Fahrt hierher zu »Riesenangst«, doch jetzt sind wir vermutlich bei »kurz vorm Einscheißen« angelangt.
Und da Winona Saint-Martin normalerweise keine Angst hat, muss ich davon ausgehen, dass uns etwas Großes hier erwartet – etwas, wovon meine Mutter mir nichts erzählt hat. Wie so oft.
Worum es sich auch handeln mag, es muss übel sein. Mehr als eine alte Familienlegende von gescheiterter Liebe.
»Echt jetzt, allmählich mach ich mir wirklich Sorgen«, erkläre ich ihr. »Warum bist du so nervös, dass wir wieder hierher ziehen?« Der Grund, weshalb wir vor fünf Jahren weggegangen sind, ist bis auf Weiteres nicht anwesend: die Matriarchin der Saint-Martin-Sippe, Grandma Diedre. Die Mutter meiner Mutter. Die beiden hatten einen Riesenkrach. Geschrei. Tränen. Die Polizei wurde gerufen. Megadrama, teilweise ging es um mich. Mittlerweile haben sie sich versöhnt … zumindest einigermaßen? Aber unsere Besuche dauern nie länger als ein, zwei Tage, und alle sind immer sehr angespannt.
Unsere Familie ist ziemlich chaotisch.
Meine Mutter ist in Gedanken woanders und hört mir wie üblich nicht zu. »Mist. Ich glaube, das war eine Freundin von deiner Großmutter, die da gerade an uns vorbeigefahren ist«, erklärt sie mir, die Augen auf den Rückspiegel gerichtet. »Vermutlich hängt sie schon am Telefon und warnt das halbe Nest, dass Diedres liederliche Tochter gerade die Stadtgrenze passiert.«
»Du bist paranoid. So würde Grandma dich nie nennen.« Vermutlich. Die Chancen stehen fifty-fifty.
Meine Mutter schnaubt. »Hach, so gutgläubig wäre ich auch gern noch mal. Sei froh, dass ich dich die letzten Jahre vor dem alten Drachen bewahrt habe. Der Mongolei sei Dank.«
»Nepal. Du weißt genau, dass Grandma in Nepal ist.«
Meine Großmutter und Moms ältere Schwester Franny haben sich dem Peace Corps angeschlossen und sind letzte Woche abgereist, um in Nepal Englisch zu unterrichten. Ohne lange zu fackeln, hat sich Grandma für eine Weile aus dem Buchladen ausgeklinkt, der unserer Familie seit Generationen gehört, und meiner Mutter für die Zeit ihrer Abwesenheit die Schlüssel übergeben – also der Person, der sie nicht mal zutraut, einen Brief zur Post zu bringen, geschweige denn, den ganzen Laden zu schmeißen. Und unter uns gesagt ist meine Mutter auch nicht gerade die vertrauenswürdigste Person der Welt.
Darum war es auch ein Schock für uns, dass Grandma und Tante Franny nach Nepal abgehauen sind und uns als Hüterinnen der Familienbuchhandlung zurückgelassen haben. Im Moment passt Frannys Tochter, meine neunzehnjährige Cousine Evie, auf den Laden auf. Sie wird mit uns in der Wohnung meiner Großmutter über dem Laden leben, während sie aufs Community College geht und meiner Mutter weiter mit den Büchern hilft.
»Es gibt keinen Anlass, nervös zu sein. Grandma ist weg. Franny ist weg. Du kannst hier in Beauty von vorn anfangen –«
»Träum weiter, Süße.« Meine Mutter kramt in ihrer Handtasche herum und holt einen Lippenstift namens Ruby Kick hervor. Der rubinrote Kitzel – noch Fragen? Knallrote Lippen und spitz zulaufende Cateye-Brille sind Moms Markenzeichen, ohne die sie niemals das Haus verlassen würde. »Du hast ja keine Ahnung, worauf wir uns hier einlassen. Du warst zwölf, als wir dieses elende Nest der Verdammten verlassen haben. Du kannst dich nicht erinnern, wie es ist. Für Leute wie uns ist Beauty eine Schlangengrube, Josie.«
»Dann gib ihnen keinen Anlass, sich das Maul zu zerreißen.«
»Was soll das denn heißen?«
Ich presse meine Kameratasche an mich. »Das weißt du genau.« Vielleicht liegt es ja an dem dämlichen Saint-Martin-Liebesfluch, aber die Beziehungen meiner Mutter – jung und Single – halten nie lange. Sie bringt keine Männer nach Hause, aber sie wischt nach rechts und trifft sich heimlich mit Typen … vielen Typen. Früher habe ich noch mitgezählt, aber irgendwann war es nur noch deprimierend. Also, hey. Wir leben nicht im feudalen Frankreich des elften Jahrhunderts: Ich weiß, dass Frauen Sex haben können und sollen, wie es ihnen passt. Aber es geht hier um meine Mutter, und ich weiß, dass sie nicht glücklich ist. Und dann noch die Lügen. Wenn es keine große Sache ist, warum rumeiern?
Wenn ich irgendwann Vertrauensprobleme haben sollte, dann deshalb.
Sie hat jedenfalls durchblicken lassen, dass sie nicht mehr ständig online Typen aufreißen würde, wenn wir nach Beauty ziehen. Wir haben es nicht direkt ausdiskutiert, schließlich reden wir nie über irgendetwas Unangenehmes, insoweit war es kein festes Versprechen. Aber sie hat mir stumm zugenickt, was bedeutete: Ich werde in unserer kleinen Heimatstadt, wo man uns und unsere Familie kennt und Klatsch eine Währung ist, nicht mit jedem ins Bett gehen. Ich habe mit einem Nicken geantwortet, das sagte: Okay, cool, aber ich habe es vor allem satt, dass du mich anlügst.
Wie sie jetzt an ihrem Nagel herumkaut, zeigt mir, dass ich sie verletzt habe, weil ich das verbotene Thema – Dates, die sie ja gar nicht hat – angesprochen habe. Und da ich immer die Erwachsene sein muss, beschließe ich, die Sache zu entspannen und das Thema zu wechseln, damit wir uns nicht schon krachen, bevor wir überhaupt in der Stadt sind.
»Und jetzt hast du mir Angst gemacht vor Schlangen und Gruben und schwarzen Löchern.« Ich versuche, es fröhlich klingen zu lassen. »Wird es echt so schlimm hier werden?«
»Schlimmer, Shutterbug. Viel schlimmer. Noch ist es nicht zu spät. Wir können sofort kehrtmachen und zu Thrifty Books in Pennsylvania zurückfahren.«
Mom war schon in ungefähr jeder Filiale der großen Buchhandlungen entlang der Ostküste Geschäftsführerin, außerdem in ein paar tollen unabhängigen Buchläden … und ein paar echten Drecklöchern. Der Laden in Pennsylvania, den sie gerade verlassen hat, gehörte zur Dreckloch-Kategorie.
»Du hast deinem Bezirksleiter diesen Take This Job and Shove It-Song gemailt und deine Leute mitten in der Schicht sitzen lassen«, erinnere ich sie. Seinem Boss zu sagen, er solle sich den Job in den Arsch schieben, ist nicht unbedingt die cleverste Empfehlung.
Einer ihrer Mundwinkel wandert nach oben. »Ja, stimmt schon. Faktisch gesehen habe ich in Pennsylvania vermutlich das getan, was man gemeinhin die Brücken hinter sich abbrechen nennt. Dann fahren wir eben einmal quer durch die Stadt und stattdessen an die Küste von Connecticut. Hartford hat dir gefallen, weißt du noch?«
»Zu viele Morde, zu teuer. Und nach fünf Monaten wurden wir zwangsgeräumt.«
»Wir könnten weiter nach Süden fahren. Maryland?«
»Oder wir könnten hier in Rhode Island bleiben und tun, was wir uns vorgenommen haben. Nämlich ein Jahr lang umsonst in Grandmas Apartment wohnen und Geld für Florida sparen. Das ist schließlich dein Traum, du erinnerst dich? Palmen und weiße Sandstrände? Nie wieder Autos aus dem Schnee schaufeln?«
»Palmen und weiße Sandstrände …«, murmelt sie.
»Und du hast mir versprochen, dass ich hier meinen Highschool-Abschluss machen kann. Henry hat gesagt –«
»Mein Gott, Josie. Echt jetzt? Komm mir nicht mit deinem Vater, wenn ich gerade eine Panikattacke habe.«
»Wie du meinst.« Ich verschränke schützend die Arme über dem weichen Leder meiner Kameratasche. Die Nikon ist eines der wenigen Geschenke, die er mir je gemacht hat, und mein kostbarster Besitz … Sie ist außerdem ein Streitpunkt zwischen meiner Mutter und mir. Meine Eltern hatten was miteinander, als meine Mutter für ein paar Semester an der renommierten Kunsthochschule hier studiert hat. Er war damals ein Fotografie-Professor um die dreißig, sie eine rebellische neunzehnjährige Studentin, die ein paarmal für ihn Akt stand, was sich zu einer Eins-führt-zum-anderen-Situation entwickelte.
Ich bin nicht sicher, was ich davon halten soll, aber ich versuche, nicht zu oft daran zu denken.
Jedenfalls haben sie nie zusammengelebt und waren auch nie verheiratet. Und jetzt ist Henry Zabka ein berühmter Modefotograf in Los Angeles, den ich ungefähr einmal im Jahr sehe. Ich glaube, Mom wäre es lieber, ich würde vergessen, dass er überhaupt existiert. »Hör zu«, erkläre ich ihr diplomatisch. »Es gibt keinen Grund zur Panik. Das hier ist ganz einfach. Die Stadt ist keine Schlangengrube. Und selbst wenn sie sich als solche herausstellt, Evie verlässt sich auf uns. Sie ist allein. Sei für Evie da. Spar Geld. Lass mich die Highschool beenden. Danach kannst du nach Florida runterfahren, wie du es dir immer erträumt hast.«
»Ich werde nicht allein gehen.«
Ich lache nervös und hoffe, dass sie es nicht bemerkt. »Wir beide … Florida … klar. Das meinte ich.« Puh, das war knapp.
»Okay, du hast recht. Wir schaffen das«, sagt sie. Als Giebelhäuser und Lattenzäune vor uns auftauchen, wird sie ruhiger. »Und schließlich ist Beauty einfach nur eine Stadt, oder?«
»Wie jede andere.«
Nur stimmt das leider nicht. Nicht mal annähernd.
Beauty ist ein seltsamer Ort mit einer langen dramatischen Geschichte, die bis in die Kolonialzeit zurückreicht. Die Stadt wurde im späten 17. Jahrhundert von einem Mann namens Zebadiah Summers gegründet, der König Charles III. von England dabei half, zwei zerstrittenen New-England-Stämmen – den Narragansetts und den Pequots – das »schöne« Ufergelände »abzukaufen«. Ein riesiger Steinbruch mit erstklassigem Marmor am Stadtrand machte die englischen Siedler stinkreich. Und der postkartenblaue Hafen, der an unserer Windschutzscheibe vorbeizieht, als meine Mutter die gewundene Küstenstraße hinunterfährt, lockte später weitere Vertreter der High Society New Englands an. Sie bauten im neunzehnten Jahrhundert hier ihre Sommerhäuser und halfen so, die Stadt zu einer der reichsten Gemeinden in Rhode Island zu machen.
Da es eine Hafenstadt ist, dreht sich fast alles um Boote. Ein privater Jachtclub. Regatten. Bootsfestivals … Ein öffentlicher Spazierweg, Hafenpromenade genannt, verläuft etliche Meilen am Wasser und falls ihr Sandstrände und Saltwater Taffy mögt – das findet ihr hier auch.
Ich mag eher das Schräge an Beauty. Zum Beispiel, dass die Stadt seit den Neunzehnzwanzigern den zweideutigen Spitznamen »Clam Town« trägt – offiziell, weil es hier pro Kopf mehr Imbissbuden mit frittierten Muscheln gibt als in jeder anderen Stadt in New England. (Dumm gelaufen, Providence!) Allerdings ist »clam« auch Slang für das weibliche Geschlechtsorgan, so viel dazu. Des Weiteren hat im neunzehnten Jahrhundert ein mäßig berühmter amerikanischer Dichter der Romantik hier gelebt und liegt nun auf dem Eternal Beauty Burial Grounds, einem historischen Friedhof. Und jetzt kommt der schräge Part: Er liegt im Grab einer der ersten weiblichen Kolonistinnen, die bei so einem »Bleibt sie über Wasser, ist sie eine Hexe«-Test der paranoiden Bürger von Beauty ertrank. Sie war also doch keine Hexe gewesen.
Von Friedhöfen und Muschelbuden einmal abgesehen, schlägt das Herz von Beauty im historischen Hafenviertel. Als Mom im Sonnenuntergang ein Pferdegespann überholt, das unter den Gaslaternen entlangtrottet, kommen verschwommene Erinnerungen aus meiner Kindheit hoch. Ich lasse das Fenster herunter und atme die vertraute salzige Luft ein. Am Goodly Pier schaukeln Segelboote an ihren Winterliegeplätzen, die Souvenirläden an der Uferpromenade machen für heute dicht. Auf der einen Straßenseite haben Glasbläser und Kerzenzieher ihre Geschäfte, gegenüber reihen sich historische Stadtresidenzen aneinander. Sie gehören Familien, deren Kinder Elite-Unis besuchen.
Es ist eine andere Welt hier. Ein seltsamer Mix aus reich und skurril.
Wir fahren zur Südseite des Hafens, dann eine Einbahnstraße hinunter, die noch immer mit Granitsteinen aus dem achtzehnten Jahrhundert gepflastert ist. South Harbor ist das Viertel der Arbeiter- und Mittelschicht. Es ist hübsch hier. Ruhig. Ein paar Läden. Lagerhäuser am Ufer. Doch meine Mutter parkt den U-Haul-Umzugswagen vor South Harbors Schmuckstück.
Dem Familienunternehmen der Saint-Martins.
SIREN’S BOOK NOOK – Die Bücherecke der Sirene.
ÄLTESTE UNABHÄNGIGE BUCHHANDLUNG IM KLEINSTEN BUNDESSTAAT.
Unser Buchladen, von den Einheimischen kurz »Nook« genannt, ist im Erdgeschoss eines weißen Erkerhauses untergebracht, das wegen seiner Rolle im Unabhängigkeitskrieg einen Eintrag im staatlichen Register historischer Stätten der USA hat. Im zweiten Stock befindet sich eine kleine Wohnung. Sie ist über eine wackelige Holztreppe auf der Rückseite des Gebäudes zu erreichen, die von der dreihundert Jahre alten Pflastergasse nach oben führt. Dort haben Mom und ich mit Grandma gewohnt, bis ich in der sechsten Klasse war. Aber da sich Grandma Diedre und meine Mutter ständig in die Haare kriegen, sobald sie aufeinandertreffen, wohnen wir bei unseren Besuchen hier normalerweise bei meiner Tante Franny.
Nun denn. Der malerische Buchladen sieht unverändert aus.
Generationen von Saint-Martins haben in diesem Haus gelebt.
Hinter dem großen Sprossenfenster sind Bücher über Schiffe ausgestellt und über dem Eingang hält eine schmiedeeiserne Meerjungfrau auf einer Stange ein aufgeschlagenes Buch über den Gehweg.
»Salty Sally«, begrüßt meine Mutter sie fröhlich, ihre Panik ist verflogen. »Die Meerjungfrauenbrüste wie immer selbstbewusst vorgereckt. Haben wir uns mal wieder gegenseitig am Hals. Zumindest eine Zeit lang.«
Als ich die Tür aufstoße, umhüllt mich der Geruch von altem und neuem Papier. Modrigen Stockflecken auf Pergament. Tinte. Abgewetztem Leder. Orangen-Möbelpolitur. Es riecht einladend, und die New-England-Folkmusik aus den Lautsprechern klingt vertraut und schwermütig. Meine Großmutter sammelt Aufnahmen traditioneller Seemanns- und Bänkellieder aus der Gegend.
Während des Unabhängigkeitskrieges befanden sich in diesem Gebäude das Postamt von Beauty und eine Druckerei – schon meine Vorfahren haben das gedruckte Wort verehrt. Hier wurde damals nicht nur die Lokalzeitung herausgebracht, sondern auch aufwieglerische Flugblätter, die die Rebellen in unserer Stadt – unserer der englischen Krone treuen Stadt – drängten, »sich gegen die Rotrock-Lehnsherren zu erheben«. Mehrere dieser Flugblätter hängen gerahmt an der Wand und die originale Druckerpresse aus dem achtzehnten Jahrhundert dient nun in der Mitte des Ladens als Präsentationsfläche für Geschichtsbücher über Rhode Island.
Es scheint keine Kundschaft da zu sein. Mom und ich laufen um die alte Presse herum zum Verkaufstresen. Hinter der Kasse lümmelt eine neunzehnjährige Studentin (Community College, keine Elite-Uni) auf einem Hocker, der bei jeder ihrer Bewegungen laut knarrt. Sie hat die langen Beine ihrer Mutter und die braune Haut ihres verstorbenen afroamerikanischen Vaters. Ihre Nase – mit den fleckigen Sommersprossen aller Saint-Martin-Frauen – steckt in einer historischen Liebesschnulze mit einem Piraten auf dem Cover.
Evie Saint-Martin.
»Nur Kreditkarten. Kein Bargeld. Wir schließen in zwei Minuten«, leiert Evie gelangweilt hinter ihrem Buch hervor, wie einer dieser gruseligen Butler, die in Horrorfilmen die Tür des Spukhauses öffnen. Neben ihrem Ellbogen dampft Tee in einem Keramikbecher – ihre ganz persönliche Nebelmaschine.
»Ich muss aber die eine Hälfte mit Pennys aus dem Sparstrumpf bezahlen, die andere mit einem Scheck, der nach Mülltonne aussieht«, antworte ich.
Sie lässt das Taschenbuch sinken und sieht mich mit großen, dramatisch geschminkten Kleopatra-Augen an, die unter dichten und mit viel Chemie geglätteten Ponyfransen hervorspähen.
»Cousine«, grüßt sie mit einem trägen Grinsen. Als sie sich über den Tresen beugt und mich umarmt, stoßen wir beinahe die Meerjungfrauenstifte neben der Kasse um. Dann fasst sie mich an den Schultern und lehnt sich zurück, um mich zu begutachten. »Du musst wirklich mehr Selfies posten! Ich wusste gar nicht, dass deine Haare mittlerweile länger sind als meine. Lass sie mich bitte zu irgendwas schön Schrägem schnippeln.« Sie zwinkert wie eine durchgeknallte Wissenschaftlerin.
Evie schneidet sich die Haare selbst. Sie ist auf eine echt tolle Art schräg und tausendmal cooler als ich. Da ihre Eltern zeitweise im einige Stunden entfernten Boston gewohnt haben, sind wir nicht durchgehend zusammen aufgewachsen, aber über die Jahre hat sich zwischen uns eine Fern-Freundschaft entwickelt.
Sie rempelt mich leicht an. »Krass, dass ihr schon hier seid. Ich dachte ihr kämt erst, wenn es dunkel ist?«
»Wir haben eine App heruntergeladen, die vor Radarfallen warnt«, erklärt meine Mutter. Sie geht hinter den Tresen und schlingt die Arme um Evie. »Man hat erst richtig gelebt, wenn man in einem U-Haul mit achtzig durch eine 55er-Zone gebrettert ist.«
»Es war voll der Horror«, informiere ich meine Cousine. »Ich dachte echt, der Rosarote Panther hebt ab und fliegt davon.«
»Dass du und meine Mutter Schwestern seid, versteht echt kein Mensch, Winona.« Evie späht über Moms Schulter durch das Ladenfenster. »Du weißt aber, dass du einen Strafzettel kriegst, wenn du hier ohne Anwohnerausweis parkst? Und zwar einen saftigen.«
Meine Mutter stöhnt. »Verdammt. Alles beim Alten in Beauty – selbst der Hocker in der Nook knarrt noch. Was zum Teufel will ich hier?«
»Für Palmen und weiße Sandstrände sparen«, erinnere ich sie.
»Und mich retten«, sagt Evie. »Grandma Diedre hat seitenlange Anweisungen dagelassen – das Schaufenster muss jeden Monat neu dekoriert werden, und zwar genau nach ihrer Liste langweiliger Bücher, sonst könnte sich hier ja – Gott bewahre – was ändern. Außerdem sind seit zwei Tagen hartnäckig 6,66 Dollar zu wenig im Safe, obwohl ich schon hundertmal nachgezählt habe. Das ist bestimmt die Strafe des rachsüchtigen Stadtgeists, weil wir obszöne Romane verkaufen. Und das an einem Ort, der von Puritanern und Jachtfanatikern gegründet wurde.«
»Ah! Wusst ich’s doch!«, ruft meine Mutter. »Ich habe Josie gerade eben daran erinnert, dass dieser Ort auf einer wahrhaftigen Pforte zur Hölle gebaut ist und jeder hier dem finsteren Lord dient.«
Eine knarrende Diele neben der alten Druckerpresse lässt uns alle gleichzeitig den Kopf drehen. Ein Junge in meinem Alter starrt uns – mich – an.
Groß, schwarze Doc Martens, schwarze Lederjacke. Die dunklen Haare locken sich um sein Gesicht, fallen über Narben, die sich auf einer Seite bis zur Stirn ziehen. Von der Augenbraue fehlt ein Stück. Zwischen Daumen und Zeigefinger ist eine kleine schwarze Katze eintätowiert.
Er hält ein Buch in der Hand und den Kinnriemen eines Jethelms, auf dem in einer coolen Schrift LUCKY 13 steht. Er mustert mich durch einen Fächer schwarzer Wimpern – zuerst die Kameratasche um meinen Hals, dann mein Gesicht.
Er starrt mich an, als sei ich ein Gespenst. Als traue er seinen Augen nicht.
Als seien wir alte Freunde … oder Feinde.
Es fühlt sich an, als hätte man mir gerade in einer fremden Sprache eine Frage gestellt und ich müsste mich durch ein Wirrwarr von Worten kämpfen und Silbe für Silbe nach der Bedeutung suchen. Wer bist du, und was willst du von mir?
In meinem Bauch macht sich ein komisches Gefühl breit. Mit einem Mal ist ein Silbenrätsel in meinem Kopf, dessen Leerstellen sich langsam füllen, und es dämmert-dämmert-dämmert mir, wie die Antwort lauten könnte. Auch wenn ich die letzten Jahre nur selten in Beauty war, hier hat meine Kindheit stattgefunden. Und während dieser Kindheit hatte ich einen besten Freund. Das letzte Mal habe ich ihn mit zwölf gesehen, und er war auch zwölf, und …
Oh. Mein. Gott.
Lucky Karras.
Er ist ganz schön groß geworden. Und ganz schön attraktiv. Seit wann hat er so breite Schultern? Er sieht einschüchternd aus … und irgendwie wütend. Hey, alter Freund! Wie wär’s mit einer Umarmung?, ist hier wohl nicht die angebrachte Reaktion.
Er war ziemlich sauer auf mich, als ich die Stadt verlassen habe. Das ist fünf Jahre her. Und es war nicht meine Schuld. Sein Groll hat sich doch bestimmt gelegt. Hätte ich bloß Zeit gehabt, mir die Haare zu bürsten. Aber ich wusste ja nicht, dass ich aus einem Umzugswagen steigen und … Lucky 2.0 sehen würde.
Meiner subtilen Mutter entgeht der spannungsgeladene Blickwechsel, der sich gerade vor ihren Augen abspielt. Sie erkennt auch Lucky nicht und reagiert mit einer witzigen Entschuldigung. »Oh, sorry. Du natürlich nicht«, ruft sie ihm fröhlich entgegen. »Du bist bestimmt kein Dämonenlakai.«
»Dann kennen Sie mich ganz offensichtlich nicht«, sagt er mit rauchiger Reibeisenstimme. Sie hat sich ebenso verändert wie sein Körper.
»Würde ich aber gern. Winona Saint-Martin.« Sie streckt ihm die Hand entgegen, doch er ergreift sie nicht.
»Ich weiß, wer Sie sind.« Er wirft ihr einen kurzen kühlen Blick zu.
Dann geht er langsam genug an mir vorbei, um mir zuzuflüstern: »Hallo, Josie. Willkommen zurück in der Pforte zur Hölle.«
Anschließend wirft er das Buch auf die Druckerpresse und stapft mit großen Schritten durch die Ladentür.
Ich atme lange und ein bisschen zittrig aus.
»Huh«, sagt Mom. »Und schon habe ich den ersten Kunden vertrieben. Meine Mutter wird echt stolz auf mich sein.«
Evie winkt ab. »Ist doch bloß Phantom.«
»Wer?«, fragt Mom.
»Lucky Karras. Erinnerst du dich noch an die Karras-Familie? Seinen Eltern hat früher die kleine Bootswerkstatt einen Block weiter gehört. Sie haben die große Werft gegenüber gekauft. Der Vater ist Bootsmechaniker. Die Mutter schmeißt den Laden.«
»Das ist der Sohn von Nick und Kat Karras?« Mom klingt überrascht. »Josies Lucky?«
Wärme breitet sich in meiner Brust aus. »Er hat mir nicht ›gehört‹. Wir waren bloß Freunde.« Gute Freunde.
»Hast du ihn erkannt?«, fragt Mom, ohne mir Gelegenheit zu geben, ihr zu antworten. »Ich glaube nicht, dass er dich erkannt hat.«
»Hat er«, murmle ich leicht benommen.
»Er hat hier sein Lager aufgeschlagen und durchs Fenster nach eurem U-Haul Ausschau gehalten«, flüstert Evie und lächelt mir hinter dem Rücken meiner Mutter vielsagend zu.
»Wäre nett gewesen, wenn du mich vorgewarnt hättest«, presse ich durch zusammengekniffene Lippen.
»Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe«, sinniert meine Mutter, die Evies Bemerkung nicht mitbekommen hat, »war er ein rotznasiger kleiner Rabauke mit schwarzem Wuschelkopf. Wann hat er sich in einen düsteren Holden Caulfield verwandelt?«
Evie kichert. »Zwei Jahre nachdem ihr die Stadt verlassen habt? Ich nenne ihn Phantom, weil er ständig hier rumhängt und hinten im Laden vor sich hin brütet.«
»Ich dachte, seine Familie ist umgezogen?« Ich bin immer noch sprachlos.
»Sind sie auch«, antwortet Evie. »Wie ich gesagt habe, ihre Firma ist jetzt auf der anderen Straßenseite.«
Das hatte ich nicht gemeint. Ich hatte geglaubt, sie seien aus der Stadt weggezogen – fort. Ich hatte keine Ahnung, dass er immer noch hier wohnt. Die paar Mal, die wir in den letzten Jahren übers Wochenende in Beauty waren, habe ich ihn nie gesehen oder irgendwas von der Familie mitgekriegt.
»Da war dieses Feuer kurz vor unserem Umzug«, erinnert sich meine Mutter. »In diesem Haus am See.«
»Die Narben …«, murmle ich. Eine Woche nach dem Feuer hatte ich ihn das letzte Mal gesehen, im Krankenhaus. Er hatte überall Verbände und wartete darauf, operiert zu werden. Ich erinnere mich noch, wie besorgt seine Eltern waren, wie sie ständig mit den Ärzten flüsterten, wenn ich ihn nachmittags im Beauty Memorial besuchte. Doch sie meinten, er würde wieder gesund.
Meine Mutter und ich haben die Stadt damals so überstürzt verlassen, dass ich mich nicht mehr von ihm verabschieden konnte.
»Er hatte mehrere Hauttransplantationen«, erklärt Evie. »Keine Ahnung … Vermutlich hat ihn das verändert, danach hat er sich irgendwie zurückgezogen. Seitdem hat er immer mal wieder Ärger, aber –«
»Warte. Was für Ärger denn?«, unterbricht Mom sie.
»Dies und das. Du kennst ja Beauty«, antwortet Evie achselzuckend. »Schwer zu sagen, was Tratsch und was Tatsache ist.«
»Diese Stadt verschlingt einen so oder so bei lebendigem Leib«, sagt meine Mutter. »Ich hoffe, er trägt seinen Ärger nicht in diesen Laden.«
»Keine Sorge«, versichert ihr Evie. »Er liest bloß und schmollt vor sich hin.«
Ich beobachte durchs Ladenfenster, wie Lucky auf ein altes rotes Motorrad steigt, das vor einem Gebäude mit dem Schild NICK’S BOATYARD. REPARATUREN UND WARTUNG parkt. Passend zu Luckys Tattoo sitzt im Bürofenster der Werft eine echte schwarze Katze in einem Fleck Sonnenlicht.
Wie kann das der Junge sein, den ich mal gekannt habe? Unmöglich.
Als er seinen Lucky-13-Helm festzieht, räuspert sich meine Mutter und reißt mich aus meinen Gedanken.
»Nein. Denk nicht mal dran«, warnt sie mich.
»Gott, ich hab bloß aus dem Fenster geschaut.« Mir ist warm. Ob mein Hals gerötet ist? Grandma Diedre sollte mal in eine Klimaanlage für diesen alten Muffelladen investieren.
»Der Liebesfluch der Saint-Martins wirkt hier noch stärker.« Meine Mutter lässt sich nicht abbringen. »Du brauchst dir nur unsere Statistik in Beauty anzusehen. Mein Großvater hatte drei Geliebte in einem Hotel auf der anderen Seite der Stadt. Mein Vater hat meine Mutter für irgendwelche dubiosen Geschäfte in Kalifornien verlassen. Meine Schwester Franny … na ja« – sie dreht sich zu Evie – »du weißt ja, was deiner Mutter passiert ist.«
»Mom«, sage ich scharf. Puh. Wenn jemand taktlos sein kann, dann meine Mutter.
»Schon gut«, sagt Evie.
Aber ist es das wirklich? Evies Vater ist letztes Jahr an einem Schlaganfall gestorben. Er lag ein paar Tage im Krankenhaus, hat es aber nicht geschafft. Die Beerdigung war schrecklich, es war unser letzter Besuch in der Stadt. Bloß für ein paar Tage. Evie hat es verkraftet, aber ihre Mutter hatte einen Nervenzusammenbruch und ist nie wirklich über seinen Tod hinweggekommen. Mom vermutet, dass Grandma sie deshalb überredet hat, ihr Haus zu vermieten und nach Nepal abzuhauen, während Evie zu uns in die Wohnung über dem Laden ziehen würde. Mom behauptet, Franny sei schon immer der Liebling meiner Großmutter gewesen. Man sollte meinen, dass zwei erwachsene Schwestern mit eigenen Kindern solche kleinlichen Eifersüchteleien längst überwunden hätten, aber offenbar entwächst man dem nicht.
»Wie dem auch sei«, sagt meine Mutter leicht verlegen. »Jeder in Beauty weiß, dass auch mich der Saint-Martin-Fluch getroffen hat. Ich habe versucht, die Stadt zu verlassen, um ihm zu entgehen, und nun bin ich die sechsunddreißigjährige alleinerziehende Mutter einer Siebzehnjährigen. Da kannst du dir ja vorstellen, was der Fluch bei dir anrichten würde, Josie. Jede Menge Liebeskummer, ganz klar.«
Bevor ich protestieren kann, schwenkt Evie die Piratenschmonzette. Die Silberringe an ihrem Daumen und Zeigefinger klirren gegeneinander. Sie liest ausschließlich historische Liebesgeschichten. Grafen und Gouvernanten. Prinzen und Gouvernanten. Gouvernanten und Gouvernanten. Kommen noch Moore und ein Spukschloss hinzu, umso besser. Sie hat vor Kurzem beschlossen, die Liebe im richtigen Leben gegen Ersatzliebe auf dem Papier einzutauschen. »Beziehungslos und voll zufrieden.« Behauptet sie zumindest.
»Ich bin nicht hier, um mit irgendjemandem eine Beziehung anzufangen«, informiere ich die beiden.
Hatte nie eine, wollte auch nie eine.
Ganz ehrlich, momentan will ich nur meine Mappe zusammenstellen, damit mich mein Vater, wenn ich nächstes Jahr meinen Highschool-Abschluss habe, in seinem Studio in L. A. eine Ausbildung machen lässt. Aber das sage ich nicht. Es ist mein ganz persönliches Geheimnis. Wenn es etwas gibt, das meiner Mutter das Herz brechen wird, dann ist das keine Liebesgeschichte – sondern die Vorstellung, dass ich sie verlasse. Der ultimative Verrat.
Ich weiß, das macht mich zu einem Ungeheuer. Ich weiß. Aber die Sache ist die: Auf der einen Hälfte der Sippe mag ein Fluch liegen, aber es gibt eben auch noch die andere Hälfte, über die ich gar nichts weiß. Großeltern, die ich nie kennengelernt habe. Tanten. Onkel. Cousinen und Cousins. Mein Vater hat sogar eine neue Frau, eine Malerin. Und sobald ich achtzehn bin, wird mich meine Mutter nicht mehr davon abhalten, meinen Vater zu besuchen. Ich habe nur ganz unverbindlich mit ihm darüber geredet, aber ich glaube, ich kann ihn davon überzeugen, dass ich bei ihm in die Lehre gehen darf. Das wäre mein Lebenstraum – Fotografie von einem echten Profi zu lernen.
Zu lernen, eine richtige Tochter in einer richtigen Familie zu sein.
In einer Familie, die vielleicht besser miteinander kommuniziert als diese hier.
Das ist meine Ausstiegsstrategie. Beauty ist mein letzter Zwischenstopp, danach werde ich möglichst weit nach Westen gehen und mir Leute suchen, bei denen Nähe möglich ist. Menschen, die zusammen zu Abend essen und über ihre Probleme reden. Menschen, die normale Familiensachen miteinander tun – im Garten grillen und in den Zoo gehen. Eltern, die ihren Kindern Schwimmen und Radfahren beibringen. All das will ich.
Und ich habe einen konkreten Drei-Stufen-Plan, wie ich das erreiche:
Schritt 1: Meinem Vater beweisen, dass ich motiviert bin und Talent habe.
Schritt 2: Genug Geld für die Reise nach L. A. sparen.
Schritt 3: Die Highschool abschließen, bevor meine Großmutter aus Nepal zurückkommt.
Dieser letzte Punkt … das wird schwierig. Nächsten Sommer ist Grandma Diedres Zeit in Nepal vorbei, dann wird Beauty von Zwischenstopp-Stadt zur Familienkampfzone. Mom und ich wissen das beide: Das hier ist nur eine Übergangslösung.
Beauty ist eine tickende Zeitbombe. Ich sichere mir bloß einen Weg nach vorne, bevor sie hochgeht.
»Ich bin nicht hier, um mit irgendjemandem eine Beziehung anzufangen«, wiederhole ich. Deshalb ist es mir auch egal, wie heiß Lucky Karras inzwischen aussieht, soll er doch in irgendeinem anderen Buchladen rumschmollen. »Ich will es nur unbeschadet bis zu meinem Highschool-Abschluss schaffen.«
Doch als ich den mitleidigen Blick wahrnehme, den Evie mir zuwirft, als lägen sowohl mein Drei-Stufen-Plan als auch die Zukunft wie ungünstige Tarotkarten vor ihr, beginne ich mich zu fragen, ob ich diese Stadt auch nur bis nächsten Sommer überlebe.
BEAUTY HIGH, GO BREAKERS!: Dieses typische 1980er-Plastik-Schild in Form einer Welle steht vor dem Eingang der öffentlichen Highschool. Das Gebäude wurde zuletzt 1985 renoviert und befindet sich in der Nähe der noblen privaten Golden Academy, wo reiche Erben auf die Elite-Uni vorbereitet werden. (Foto privat/Josephine Saint-Martin)
2
Juni
Erste Eindrücke können trügerisch sein. Vielleicht hätte ich wegen der Rückkehr nach Beauty nicht so viel Begeisterung aufbringen sollen. Es hat gerade mal vier Monate gedauert, um meine anfängliche Hoffnung schwinden zu lassen, und nun funktioniere ich mehr oder weniger bloß noch im Sparmodus und bete, dass meine Batterie nicht komplett aufgibt.
Am letzten Tag vor den Sommerferien schleppe ich mich zwischen der dritten und vierten Stunde mit einem Rest an Energie den Westkorridor der Beauty High hinunter. Ich mache mich so klein wie möglich, die Musik aus meinen Ohrstöpseln dämpft den Krach in den Gängen – die knallenden Spinde und die Football-Spieler, die ihren Bros irgendwas zubrüllen. Das Gelächter und aufgeregte Geplapper wegen der Abschlusspartys. Den heulenden Neuntklässler auf der Toilette. Sommerpläne, die Gestalt annehmen. Den blühenden Drogenhandel.
Ich halte mich so weit wie möglich von diesen Typen fern. Ein paar von ihnen kannte ich, als wir Kinder waren, und einige sind wahrscheinlich ganz okay, aber ich bin voll im Überlebensmodus und darf kein Risiko eingehen. Bei einem Umzug in eine neue Stadt bleibe ich normalerweise für mich und schließe nur mit wenigen Freundschaft. Menschen sind nicht austauschbar. Es tut weh, wenn man jemanden ins Herz schließt und ihn wenige Monate später wieder verlassen muss – meine Mutter scheint das allerdings nicht zu verstehen.
Im Gegensatz zu anderen Orten, an denen wir gelebt haben, lassen mich meine Mitschüler in Beauty nicht in Ruhe. Sie haben mich herumgeschubst wie einen preisgekrönten Pudel, der versehentlich in einem Züchterwettbewerb um den Titel des Hunde-Super-Flops gelandet ist. Seit dem Tag meiner Anmeldung gab es ununterbrochen aufdringliche Fragen. Hast du echt zwei Monate lang in einem Billigmotel gewohnt? Musstet ihr von Lebensmittelmarken leben? Ist deine Mutter sexsüchtig? Kennt dein Vater wirklich Prinz Harry? Was ist der wahre Grund, warum deine Großmutter nach Nepal zu den Sherpas gegangen ist? Hat sie irgendwas mit einer Sekte zu tun?
Anzügliche Blicke, die ständigen Gerüchte, die von Handy zu Handy durch die Schule wandern … manchmal fühlt sich der bloße Klassenzimmerwechsel wie ein Marsch durch Kriegsgebiet an. Ich könnte auf eine Landmine treten und einen Fuß verlieren – oder ein uneheliches Kind bekommen, man weiß nie. Bei jedem Klingeln riskiere ich sowohl mein Leben als auch meinen eh schon gefährdeten Ruf.
An den anderen Orten, an denen meine Mutter und ich gewohnt haben, kannte uns keiner. Doch hier wissen die Leute gerade genug. Intime Details aus unserem Leben dienen der allgemeinen Unterhaltung. Nicht alles, was gesagt wird, stimmt, einiges allerdings schon. Und manches tut weh.
Allmählich denke ich, dass die Chance, ein Jahr lang Geld für meinen Ausstiegsplan zu sparen, damit ich zu meinem Vater nach L. A. ziehen kann, diese ganze Quälerei hier vielleicht doch nicht wert ist. Wenigstens habe ich den Sommer, um wieder Kraft zu tanken, mich im Buchladen zu verkriechen und in meine Fotografie zu vertiefen.
»Josephine?«
Und vielleicht habe ich noch etwas anderes, gleich hier.
Bitte lass es klappen.
Vor dem Raum, in dem die Journalismus-Kurse stattfinden, steht ein Lehrer um die vierzig mit Brille und glänzender Halbglatze. Mr Philipps. Er ist für das Jahrbuch und die Schülerzeitung verantwortlich. Noch wichtiger ist allerdings, dass seine Frau für ein Regionalmagazin arbeitet, das hier in Beauty erscheint: Coast Life. Reisen, Essen und Lifestyle in New England … so in die Richtung. Und es war der Job seiner Frau, der mich vor allem interessiert hat, denn wo ein Magazin ist, da ist auch Fotografie. Und wo Fotografie ist, da gibt es Praktika.
Und das Sommerpraktikum bei Coast Life ist toll.
»Miss Saint-Martin. Wie ich sehe, haben Sie die Elfte überlebt.« Mr Philipps lächelt und rückt seine Brille mit den runden, goldgefassten Gläsern zurecht, die sich stilmäßig irgendwo zwischen John Lennon und Harry Potter bewegt. »Und haben Sie große Pläne für den Sommer?«
Ich habe immer Pläne.
»Ich werde halbtags in der Nook arbeiten«, erkläre ich ihm und warte begierig darauf, dass er mich auf den neuesten Stand bringt.
»Klingt gut. Und was ist mit Ihrer Fotografie? Werden Sie für Ihre Mappe noch weitere Bilder von Schildern hier in der Umgebung schießen?«
»Ich halte immer Ausschau nach guten Schildern. Sie sind die Kommunikation der Menschheit, ich bin mit meiner Kamera bloß die Überbringerin.«
»Schön gesagt«, lächelt er.
Macht er Small Talk mit mir, um mich rücksichtsvoller abzuservieren, oder will er die gute Nachricht auf diese Art noch ein wenig herauszögern? Ich kann es nicht einschätzen, und das macht mich nervös. Mr Philipps ist nett und einer der wenigen Lehrer, die ich hier in Ordnung finde. Doch die schnöde Wahrheit lautet, ich brauche seine Hilfe, wenn ich es nächstes Jahr nach Los Angeles schaffen will.
Das Problem ist nämlich, dass mein berühmter Vater aus gutem Grund berühmt und außerdem berüchtigt dafür ist, extrem kritisch zu sein. Ich muss ihm beweisen, dass ich es draufhabe. Also, ich weiß, dass ich Fotos machen kann. Das meiste habe ich mir selbst beigebracht – mein Vater hat mir Tipps gegeben –, aber ich habe ein gutes Auge und über die Jahre Tausende von Fotos geschossen. Meine Filme entwickle ich selbst, und zwar ganz altmodisch in der Dunkelkammer. Ich habe sogar ein Online-Konto bei Photo Funder eingerichtet, einer Fanseite für Fotografie, auf der ich exklusiv für zahlende anonyme Abonnenten Fotos poste. Allerdings bringt mir das in den meisten Monaten nur ungefähr hundert Dollar ein und der Großteil meiner Abonnenten dürften Freunde meiner Mutter sein und vielleicht noch meine Großmutter. Es genügt nicht, um mich in den Augen meines Vaters zu qualifizieren.
Dafür muss ich schon mehr vorweisen. So was wie ein Fotografie-Praktikum. Ich muss ihm zeigen, dass mich andere für talentiert genug halten, um mich unter ihre Fittiche zu nehmen. Zum Ende des Sommers stellt Coast Life ein Nachwuchstalent ein, um während der Regatta Week bei Modeaufnahmen zu assistieren. Reiche Menschen, die auf ihren Booten Partys feiern. Es klingt, ehrlich gesagt, wie der totale Albtraum – und ist das krasse Gegenteil dessen, was mich künstlerisch interessiert. Aber es macht sich bestimmt fantastisch im Lebenslauf, und der Fotograf, der für das Shooting engagiert wurde, ist ein semi-großer Name unter den Modefotografen. Jemand, den mein Vater respektiert.
»Und wie lautet die endgültige Entscheidung?«, platze ich heraus. Ich halte es nicht mehr aus, mit diesem beklemmenden Gefühl in der Brust Small Talk zu machen.
Mr Philipps zögert. »Es tut mir leid, Josie.«
Mir rutscht das Herz in die Hose.
Tiefer und tiefer …
»Es hat nichts mit deinen eingereichten Fotos zu tun«, versichert er mir, »von denen waren alle begeistert. Aber das Praktikum wird normalerweise an College-Studenten vergeben – sie halten dich für zu jung.«
»Aber ich bin fast achtzehn«, wende ich ein. »Und sie wissen, wer mein Vater ist, oder?
Ich hasse es, mit seinem Namen hausieren zu gehen, aber das hier ist ein Notfall.
»Der Name deines Vaters schadet natürlich nicht. Aber …«
Aber.
»Ich sollte dir das eigentlich nicht sagen«, setzt er leise an. »Aber wenn du die Wahrheit wissen möchtest, sie wollten dir das Praktikum geben. Doch dann tauchte der Big Boss, dem das Magazin gehört, in der Vorstandssitzung auf. Mr Summers ist ein Verfechter von Regeln, und du bist noch nicht volljährig.«
»Mr Summers?«
»Levi Summers, Big Boss«, erklärt er.
Oh. Richtig. Summers. Sein Name steht auf jedem Gebäude der Stadt. Nachfahre des Gründers von Beauty. Superprivilegiert. Ich hatte keine Ahnung, dass ihm das Magazin gehört. Anfängerfehler.
Mr Philipps streckt hilflos die Hände aus. »Aus diesem Grund hat Levi Summers deine Bewerbung rausgenommen. Ich befürchte, diesen Sommer wirst du das Praktikum nicht kriegen. Es tut mir leid.«
Rausgenommen. Einfach so. Puff! Noch etwas, das in den letzten Monaten in Beauty schiefgelaufen ist.
Mr Philipps erzählt mir noch ein paar andere Sachen, die ich kaum mitbekomme, von wegen dass das Praktikum nur vier Tage im August umfasst, bevor die Schule wieder losgeht; dass der Job hart ist, vom frühen Morgen bis Mitternacht, und es deswegen sowieso Probleme in Sachen Jugendschutz und Arbeitsrecht gegeben hätte.
»Außerdem ist es vielleicht besser so, sonst würdest du nämlich die Victory-Day-Flottille verpassen.«
»Wie?«
»Am Ende der Regatta Week – die große Feier anlässlich des Victory Day. Du warst doch als Kind bestimmt schon bei der nächtlichen Flottille?«
Oh ja, war ich. Rhode Island ist der einzige Bundesstaat in den USA, der noch immer einen offiziellen Feiertag einhält, um des Endes des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. In Beauty bedeutet das eine bizarre patriotische Flottille. Sobald es zu dämmern beginnt, leuchten auf jedem Boot weiße Lichterketten und im Hafen werden die großen Fackeln angezündet. Es ist, als hätten sich die Bewohner von Beauty zusammengesetzt und beraten: Wie können wir den Unabhängigkeitstag toppen und den Arschlöchern in Boston eins auswischen, indem wir ihnen die letzten Sommertouristen abspenstig machen?
»Würdest du das Praktikum machen, entginge dir das Vergnügen der Flottille«, erklärt Mr Philipps feierlich, als sei das mein Lebenstraum.
Aber Jachten mit Lichterketten sind mir eigentlich ziemlich egal. Das Praktikum sollte mein Ticket nach Los Angeles sein, aber nun scheint mein Schiff mitsamt meinen Träumen im Hafen zu versinken. Ich kann Mr Philipps nicht erklären, dass die Rückkehr meiner Großmutter aus Nepal wie eine tickende Zeitbombe über mir schwebt und wie chaotisch das Verhältnis zwischen ihr und meiner Mutter ist. Und jetzt ist es schon Sommer und ich bin L. A. kein Stück näher gekommen.
Ein paar Typen aus der Zwölften gehen an uns vorbei, sie strahlen Arroganz aus und lachen auf diese machomäßige Art. Ich versuche zwar, den Kopf wegzudrehen, doch ihr Anführer entdeckt mich – ein Idiot aus dem Footballteam, den alle Big Dave nennen.
»Josie Saint-Martin.« Er lässt sich meinen Namen auf der Zunge zergehen, zu vertraulich. Er kennt mich überhaupt nicht, weder aus der Kindheit noch seit meiner Rückkehr. »Kommst du heute Abend zu meiner Party? Du darfst auch Fotos von mir machen«, sagt er und haucht mir einen Luftkuss zu. »Private Fotosession.«
Seine Jungs wiehern.
»Vergiss es.« Hoffentlich klinge ich abgebrühter, als ich mich fühle.
»Damit wäre das ja geklärt, Mr Danvers. Gehen Sie weiter«, sagt Mr Philipps und deutet den Gang entlang.
Die Jungs schlendern davon. Big Dave tut, als würde er fotografieren, während einer seiner Kumpels hinter Mr Philipps eine anzügliche Handbewegung macht. Ich hasse sie. Ich hasse Mr Philipps, dass er sich leise für ihr unverschämtes Gehabe entschuldigt, als habe er mich gerade gerettet. Na klar, so sind Jungs eben. Ich hasse es, dass er keine Ahnung hat, dass ich diesen Dreck schon seit Monaten Tag für Tag ertragen muss, wenn es kein Lehrer mitbekommt. Ich hasse es, ständig wütend zu sein.
Doch am meisten hasse ich, dass ich nach dem Abgang von Big Dave und seinen Vollpfosten eine schlanke Gestalt in schwarzer Lederjacke am Ende des Flurs entdecke, die gerade ihren Spind abschließt.
Lucky Karras.
Egal, wo ich hingehe, er ist auch da. Im Buchladen. Am Straßenrand davor, wo er sein altes rotes Motorrad parkt. Als Silhouette im Fenster des Werftbüros gegenüber. In der Schlange vor dem Donut-Laden am Ende der Straße. Und hier in der Schule.
Wir reden nie. Nicht richtig jedenfalls. Er hat nie gesagt: Erzähl mal, was du die letzten Jahre gemacht hast! Oder: Wie lief es so? Nichts in die Richtung. Wir zeigen auf keine Weise, dass wir mal beste Freunde waren und uns jeden Tag nach der Schule gesehen haben. Dass ich sonntags immer bei ihm zum Abendessen war. Dass wir uns nach dem Unterricht heimlich am Ende der Hafenpromenade in einem verlassenen Bootsschuppen getroffen haben – Geheimcode: Treffpunkt North Star –, um Musik zu hören oder für ziemlich schreckliche Harry-Potter-D&D-Abenteuer.
Nein. Er ist einfach … da. So wie jetzt. Dunkle Augen starren mich über den Flur hinweg an.
Hat er Big Dave gerade eben gehört? Lucky wird in der Schule ständig Zeuge meiner kleinen Demütigungen, und ich bin unentschieden, ob ich wütend oder dankbar sein soll, dass er nie einen Versuch macht, dazwischenzugehen. Ich weiß bloß, dass ich es satthabe, die ganze Zeit über ihn nachzudenken. Dass ich es satthabe, darüber zu brüten, warum er nicht mit mir redet. Und dass ich es satthabe, wie er mich mit Blicken verfolgt.
Ich bin wirklich froh, dass die Elfte vorbei ist.
Wie Ameisen, die ihren Haufen verlassen, strömen beim letzten Klingeln alle aus dem hundert Jahre alten Backsteingebäude. Ich stiefle allein die fünf Blocks nach South Harbour und versuche, wegen des abgelehnten Praktikums nicht deprimiert zu sein. Schließlich habe ich schon heftigere Stürme überstanden. Ich brauche bloß einen neuen Ansatz. Einen anderen Ansprechpartner. Dann zeige ich meine Arbeiten der richtigen Person, die sich für mich einsetzen und Levi Summers und seinen dämlichen Altersregeln die Stirn bieten wird. Irgendwas. Mir wird schon was einfallen.
Hartnäckig. Listig wie ein Fuchs. Pläneschmiederin. Intrigantin. Das bin ich.
Bei der Nook angekommen, spähe ich in den Laden, wo sich meine Mutter gerade mit einem Kunden unterhält. Dann gehe ich ums Haus und die wackelige Treppe hinauf, die grundsätzlich voller Möwenschiss ist. Hier oben im alten Apartment meiner Großmutter habe ich als Kind gewohnt. Die Tür hat ein eigenwilliges altes Schloss und ein neues Sicherheitssystem, nachdem ich den Code eingetippt habe, schließe ich sie mit einem Fußtritt.
Wenn man hereinkommt, besteht die Wohnung im Wesentlichen aus einem großen Wohnzimmer mit Kamin und einer kleinen offenen Küche. Die Einrichtung ist ein Mischmasch aus den Möbeln meiner Großmutter – Antiquitäten aus New England, abgetretene Teppiche auf Holzdielen und ihre Meerjungfrauen-Sammlung – und den wenigen Dingen, die wir von einem Bundesstaat zum anderen mitgeschleppt haben: eine Pin-up-Girl-Lampe aus den 1950er-Jahren, die ich in einem Trödelladen gefunden habe und die meiner Mutter beängstigend ähnlich sieht; gerahmte Fotos, die ich geschossen habe, von allen Städten, in denen wir in den letzten Jahren gelebt haben; Mr Ugly, eine Decke, die meine Mutter in einer ihrer Handarbeitsphasen gehäkelt hat. Egal, wo wir hinziehen, diese Sachen folgen uns. Sie signalisieren zu Hause.
Sollen sie zumindest. Im Moment fechten sie gerade einen Kampf mit Grandmas Sachen aus. Es erinnert mich ständig daran, dass wir nur vorübergehend im Zuhause von jemand anderem leben.
Ich laufe den schmalen Flur hinunter, vorbei an Evies Zimmer – schräge und unheimliche Tierpräparate, stangenweise umgearbeitete Secondhand-Klamotten, stapelweise zerfledderte historische Liebesromane – und verziehe mich in mein Zimmer mit hundert Prozent weniger ausgestopften Eichhörnchen-Kobra-Kombinationen.
Genau genommen könnte mein ehemaliges Kinderzimmer auch ein Hotelzimmer sein, außer meinen Kleidern und der Fotoausrüstung gibt es so gut wie nichts Persönliches dort. Auf dem einzigen Bücherregal stehen Standardwerke zur Fotografie, darunter auch der Bildband mit Modefotos meines Vaters, außerdem meine Sammlung von Vintage-Kameras. Meine älteste ist eine Kodak Nr. 2 Brownie von 1924 (nicht funktionstüchtig), die seltenste ist eine Rolleiflex Automat von 1951 (funktionstüchtig) und natürlich meine Nikon F3, die Kamera, die ich am häufigsten benutze. Meine digitalen Fotos speichere ich wie alle anderen zusätzlich in der Cloud, die meisten der entwickelten Filme bewahre ich in Boxen auf, die sich in einer Ecke stapeln. Aber über meinem an die Wand geschobenen Bett habe ich an einer Schnur ein paar ausgewählte Fotos mit Holzwäscheklammern befestigt. Sie lassen sich in weniger als einer Minute abnehmen und zusammenpacken. Ich habe die Zeit gestoppt.
Die Zimmer hier oben sind allesamt winzig, doch meines hat das Erkerfenster mit Blick über die Giebeldächer und Türmchen zum Stadtpark. Ich stolpere aus meinen Schuhen und steuere auf den Fensterplatz mit dem Nest aus Kissen zu – in dieser Ecke habe ich einen Großteil der letzten Monate mit Lesen und Möwen beobachten verbracht.
Hier lässt sich auch gut eine Weile in Selbstmitleid schwelgen.
Ich richte mich eigentlich darauf ein, den Abend schmollend zu Hause zu verbringen, doch eine Stunde später kommt Evie herein und hat ganz andere Pläne für uns beide. Sie zerrt mich aus meinem Zimmer und wir essen übrig gebliebene kalte Take-out-Nudeln, während meine Mutter unten im Laden in irgendwelches Buchhaltungschaos vertieft ist.
Evie hält einen Finger an die Schläfe. »Madame Evie die Große hat gerade eine Vision aus dem Jenseits. Die Geister zeigen mir … warte. Ich sehe dich und mich bei einer ›First Night‹.«
»Ist das eine biblische Version der Apokalypse?«
»First-Night-Hauspartys haben Tradition hier – im Sinne von die erste Nacht des Sommers. Die Schule ist vorbei, die Studis kommen aus dem College nach Hause und bald geht die Touristensaison los.«
»Also sozusagen eine Ausrede, es krachen zu lassen und eine wilde Party zu feiern?«
»So ungefähr«, stimmt sie zu.
Nachdem sie mir monatelang dabei zugesehen hat, wie ich mich mit dem Klatsch an der Beauty High herumgequält habe, interpretiert Evie meinen deprimierten Zustand wegen des abgelehnten Praktikums entsprechend falsch und glaubt, dass eine First-Night-Party – die richtige Party – mein soziales Leben in Gang bringen wird. Ein Sozialleben, das es bewusst nicht gibt. Doch Evie geht davon aus, dass der Tratsch nachlässt, wenn ich auf Leute zugehe.
Gut gemeint, aber ich kann ihr auf keinen Fall erklären, dass ich aufgrund meines Ausstiegsplans mit Los Angeles gar nicht lange genug in Beauty sein werde, um mich mit Leuten anzufreunden. Ich liebe Evie, aber sie wird mir wie alle anderen erklären, dass ich noch zu jung bin und wie sehr es meine Mutter verletzen würde. Sie versteht nicht, wie es ist, mit Winona Saint-Martin zusammenzuleben. Sie sieht bloß die Spaß-Winona. Oder die Engagierte-Geschäftsführerin-Winona, die klug und entschlossen den Buchladen schmeißt und sich wirklich die größte Mühe gibt, nicht genau in dieser Minute in irgendeiner Bar auf der anderen Seite der Stadt mit irgendwelchen namenlosen Kerlen in der Kiste zu landen.
Evie kennt die Immer-auf-der-Piste-Winona nicht.
Oder meine Favoritin, die Darüber-reden-wir-nicht-Winona.
»Also, Josie, ich habe eine Einladung zu einer super Party. Keine Beauty-High-Party. Wir gehen zusammen hin. Du wirst ein paar neue Leute kennenlernen. Ich vielleicht auch. Nicht alle hier sind schrecklich, ob du es glaubst oder nicht.«
Evie hat sich nach einer kurzen Beziehung gerade von irgendeinem Harvard-Typen namens Adrian getrennt, der sie seither unauffällig stalkt und sich insgesamt als totales Arschloch entpuppt hat. Sie hat nicht viel darüber geredet, aber ich glaube, es setzt ihr ganz schön zu.
»Ich dachte, Buchbeziehungen seien besser als welche im realen Leben?«, erinnere ich sie.
»Ich lerne aus ihnen, wie ich bessere Beziehungen im realen Leben haben kann«, erwidert sie.
»Weil du ja auch ständig dunkle Herzöge und schaurige Witwen in Beauty triffst?«
»Die Welt ist ein Spukschloss im Moor«, erklärt sie. »Dein Herzog kann überall warten. Vielleicht sogar bei der First-Night-Party heute Abend. Du musst nur empfänglich sein und ihn in dein Leben lassen.«
»Bis der Saint-Martin-Fluch zuschlägt und mein Herzog in einem See ertrinkt oder mich mit drei Geliebten betrügt.«
»Ich bin mir nicht mehr so sicher, was den Saint-Martin-Fluch angeht.«
»Du bist eine Abtrünnige?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Ja und nein? Ich glaube, die Frauen in unserer Familie sind alle ein bisschen schräg, aber das ist ein anderes Thema.« Sie grinst. »Und jetzt komm. Lass uns aus dieser Wohnung abhauen. Frische Luft und neue Gesichter werden uns beiden guttun. Wir sehen das locker und machen uns einen coolen Abend, okay?«
Von mir aus.
Zu besagter Hausparty ist es nicht sehr weit, fünfzehn bis zwanzig Minuten. Wir wagen uns die Lamplighter Lane hinunter – eine enge Gasse zwischen unserem Viertel und dem historischen Stadtkern mit seinen alten Läden und einem Wachsmuseum. Außerdem ist sie – laut meiner abergläubischen Mutter – Beautys Pforte zur Hölle.
»Ich bin nicht sicher, ob sie es dir gegenüber erwähnt hat«, sage ich zu Evie, »aber Mom behauptet, wenn man um Mitternacht an dieser Ecke stehen bleibt, begegnet man dem Teufel, der einem die Seele abkaufen will.«
»Muss man dazu an einem Fiedelwettbewerb teilnehmen?«, fragt meine Cousine amüsiert und macht einen Schritt zur Seite, um nicht in eine Spalte zu treten. Dabei summt sie ein paar Takte des Bluegrass-Songs The Devil Went Down to Georgia, in dem es darum geht, dass der Teufel mit einem jungen Mann um die Wette fiedelt.
»Gut möglich«, sage ich. »Weißt du, dass sie zwei Blocks Umweg in Kauf nimmt, wenn sie zur Bank muss, nur um nicht durch diese Straße fahren zu müssen? Und zwar schon seit meiner Kindheit.«
»An Halloween gibt es hier Grusel-Touren. Vielleicht hat sie sich dabei als Kind erschreckt. Ich frage mal meine Mutter, wenn wir das nächste Mal skypen. Bis dahin warne mich einfach, wenn du irgendwelche teuflischen Gestalten mit Fiedeln siehst. Komm – hier lang.«
Die Party findet im weitläufigen Garten einer der historischen Stadtresidenzen im Zentrum statt. Ich habe keine Ahnung, welcher Familie sie gehört, auf jeden Fall einer von denen mit altem Geld. Am Tor der mit Luxuslimousinen zugeparkten Auffahrt übergibt Evie die Einladung und wir dürfen passieren. Wie angewiesen folgen wir einem Pfad Richtung Pool und Poolhaus – das größer scheint als unsere Wohnung über dem Buchladen.
»Boah, Evie. Wer sind diese Leute?«, frage ich, als wir auf das blaue Wasser des Pools zugehen, an dem Dutzende von Teenagern lachen und trinken und zu lauter Musik tanzen.
»Größtenteils Goldens«, antwortet sie. Golden Academy, die Privatschule in Beauty. Vorbereitung auf die Elite-Unis. Unerreichbar. »Und Collegestudenten, die den Sommer zu Hause verbringen. Harvard ist nur ein paar Stunden entfernt. Wenn ich mir das bloß auch leisten könnte.«
Meine Goth-Cousine an einer Elite-Uni? Ob es mit dem Harvard-Typen zu tun hat, mit dem sie zusammen war? Sie belegt seit einigen Jahren am Community College hier Grundkurse in Biologie, aber eigentlich möchte sie forensische Anthropologin werden. Oder Historikerin. Oder Schriftstellerin. Wie alle Saint-Martins ändert sie ständig ihre Meinung. Selbst ihre Mutter, Franny – im Vergleich zu meiner Mutter die sittenstrenge Schwester –, hat Dutzende Male den Beruf gewechselt, bevor sie ihr Haus untervermietet hat und mit Grandma nach Nepal abgedampft ist.
Als wir auf den Pool zugehen, wo sich alle versammelt haben, werde ich ein bisschen nervös. Diese Jugendlichen sehen nicht nur reich aus, sondern auch älter. Hübscher. Größer. Schneller … Besser. Ich sehe sie sonst großspurig durch die Stadt flanieren, aber ihnen in ihrer privaten Umgebung zu begegnen fühlt sich komisch an. Ich komme mir wie ein Eindringling vor. »He, Evie? Woher kennst du diese Leute noch mal? Weil du mit diesem Typen zusammen warst?«
»Adrian. Ja, so ungefähr.«
»Aber warum sind wir hier, wenn du dich von ihm getrennt hast?«
»Er ist eine Person. Aber es schwimmen ja noch mehr Fische im Meer. Außerdem hat man mir versichert, dass er nicht eingeladen wurde, wir werden ihm also nicht über den Weg laufen. Eine Stunde, okay? Wenn du dann gehen willst, hauen wir ab.«
Eine Stunde? Träum weiter. Nach zwanzig Minuten zwischen Bikinioberteilen und Bootsschuhen, mit Gesprächsfetzen über das Ruderteam in Harvard und wie sie den Sommer an den Stränden nördlich von Beauty und in Europa verbringen werden … ist es alles. Zu. Viel.
Aber dann entdeckt Evie ihre Leute. Ein freundliches braunäugiges Mädchen aus Barcelona namens Vanessa, das mit Evie aufs College geht und genug über mich weiß, um mich zu überrumpeln. »Es kommt mir vor, als würde ich dich schon kennen«, sagt sie mit hübschem spanischem Akzent.
Was komisch ist, denn Evie hat diese Vanessa noch nie erwähnt. Aber sie scheinen gut befreundet zu sein, sie haken sich unter und Evie ist in ihrer Nähe sichtlich entspannter. Es ist noch ein anderes Mädchen bei ihnen, das nächstes Jahr nach Princeton gehen wird, aber ich bekomme ihren Namen nicht mit. Sie versuchen mich in ihr Gespräch einzubeziehen, doch es wirkt angestrengt. Sie sind älter als ich und wie sie mir die kalte Schulter zeigen, um mich auszuschließen, macht ziemlich klar, dass ich das fünfte Rad am Wagen bin.
Während Evie sich mit Vanessa in ein intensives Gespräch über Umweltaktivismus und die steigenden Temperaturen im Hafen vertieft, schlendere ich um den Pool und tue, als wüsste ich, wohin ich gehe. Meine Füße bewegen sich im Takt der wummernden Musik, die aus unsichtbaren Lautsprechern dröhnt. Das Poolhaus stellt sich als Fehler heraus – Drinks und eine Toilette, klar, aber zu viele fremde Augen, die mich anstarren –, also verdrücke ich mich durch Flügeltüren auf eine lauschige Terrasse auf der Rückseite.
Hier draußen ist es düster, nur ein paar Glühlampen spenden Licht, ein Labyrinth aus Büschen schirmt die Terrasse vom Pool ab. Sie ist in mehrere Sitzgruppen unterteilt. Ein Glastisch neben einem Liegestuhl ist mit Plastikbechern und Zigarettenkippen zugemüllt – es scheint die inoffizielle Raucherecke zu sein. Mit einem tiefen Seufzer lasse ich mich in den Liegestuhl fallen. Die Ecke ist gut zum Brüten, hier kann ich meine Wunden wegen des Praktikums lecken. Vielleicht fällt mir ein Plan B ein. Vielleicht sogar Plan B bis D.
Fast sofort spüre ich ein Prickeln im Nacken und mir wird bewusst, dass meine abgeschiedene Oase nicht so verlassen ist, wie ich anfangs dachte.
Ich bin nicht allein.
SUMMERS & CO: Schild über dem Art-déco-Eingang eines der letzten florierenden amerikanischen Kaufhäuser in Familienbesitz. Das mehrstöckige, in den 1920er-Jahren eröffnete Geschäft ist für seine Maßschneiderei und die üppig dekorierten Schaufenster an Feiertagen bekannt. (Foto privat/Josephine Saint-Martin)
3
»Sieh mal einer an«, sagt eine raue Stimme.
Ich zucke erschrocken zusammen und spähe in die Dunkelheit. Hinter einer bewachsenen Spalierwand sitzt jemand mit lässig ausgestreckten Beinen auf einem sofaähnlichen Teil. Als er sich vorbeugt und die Ellbogen auf die Knie stützt, bewegen sich die markanten Flächen seines vernarbten Gesichts vom Schatten ins Licht.
Lucky Karras.
Warum ist er in diesem gottverlassenen Nest immer dort, wo ich bin?
»Josie Saint-Martin, wie sie leibt und lebt«, sagt er.
»Ich habe dich da hinten nicht gesehen«, antworte ich schnell. »Ich bin …« Dir nicht gefolgt? Habe dich nicht gestalkt? Versuche nicht, dir jedes Mal über den Weg zu laufen, sobald ich vor die Tür trete? »Ich habe nicht mitbekommen, dass du hier draußen bist. Oder hier. Auf dieser Party. Überhaupt hier.« Mein Gott, ich klinge, als hätte ich sie nicht alle.
»Ja, ich bin hier, genau«, bemerkt er sarkastisch und hebt leicht die Hände, lässt sie dann aber wieder sinken. Sein Blick wandert über meinen langen Zopf, der mir über die Schulter fällt. »Die Frage ist eher, warum bist du hier? Hätte dich nicht für eine Partygängerin gehalten. Noch dazu auf einer Golden-Veranstaltung.«
»Evie hat mich mitgeschleppt.« Ich deute in die Richtung der Lichter und Geräusche vom Pool, die durch die dichten Zweige der Büsche dringen. Ich versuche mich an die Namen von Evies Freundinnen zu erinnern. »Vanessa? Aus Barcelona? Ich glaube, Evie und sie sind am Community College im gleichen Kurs. Sie scheinen Freundinnen zu sein oder Kommilitoninnen oder so.«
Lucky lacht leise. Als er den Blick senkt, werfen schwarze Wimpern Schatten auf hohe Wangenknochen.
»Was ist?« Ich habe das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.
Er schüttelt den Kopf. »Nichts.«
»Weißt du«, erkläre ich ihm sachlich. »Ich warte hier bloß auf meine Cousine, okay?« Das kann er gern als Signal betrachten. So nach dem Motto, Hey, zieh weiter und feiere mit, ich will hier meine Ruhe haben. Warum sitzt er im Dunkeln, weit weg von allen andern? Es passt mir überhaupt nicht, dass er sich meines Einzelgängerinnen-Throns bemächtigt hat.
Lucky und ich hatten dieses Halbjahr einen einzigen gemeinsamen Kurs an der Beauty High: AP Englisch auf College-Niveau. Da unser Lehrer alles tat, um möglichst keinen Unterricht halten zu müssen, haben wir uns eine Menge alter Filme angesehen – lauter Adaptionen von Büchern, die auf dem Lehrplan standen. Sobald die Lichter ausgingen, legte Lucky den Kopf auf den Tisch und schlief. Ich habe ihm einmal meine Notizen ausgeliehen, die er mir im Anschluss mit ein paar roten Klugscheißer-Kommentaren versehen in den Buchladen gebracht hat. Es war der persönlichste Austausch, den wir seit meiner Rückkehr hatten. Es sei denn, man zählt das ganze schweigende Starren mit. Von der anderen Straßenseite starren. Aus dem Buchladen starren. Durch die Schulcafeteria starren.
Zählt man das Starren dazu, dann haben wir verdammt regelmäßig miteinander kommuniziert.

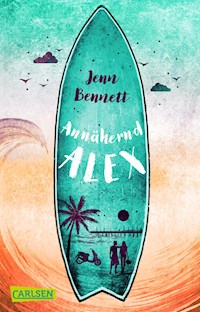













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













