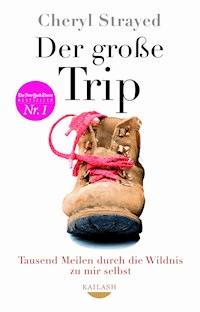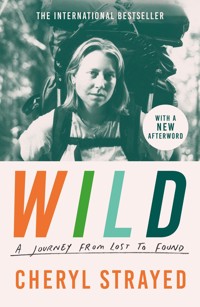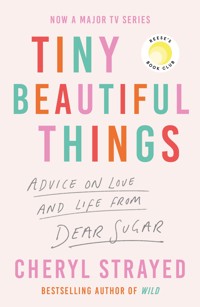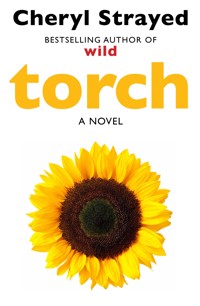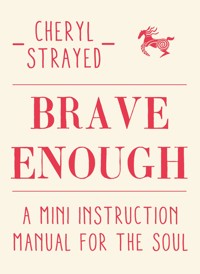4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch wenn das Verhältnis zu ihrer Mutter nicht immer einfach war, so freut sich die 20-jährige College-Studentin Claire Wood auf den Besuch bei ihrer Familie, die in einer ländlichen Gegend Minnesotas wohnt. Was Claire dann aber zu Hause erfährt, zieht ihr den Boden unter den Füßen weg: Ihre Mom Teresa ist unheilbar an Krebs erkrankt – mit nur 38 Jahren. Für die Woods beginnt eine Zeit der Angst und Verzweiflung. Während ihr Stiefvater Bruce beinahe am Leid seiner Frau zerbricht und ihr jüngerer Bruder Josh sich ganz zurückzieht, versucht Claire, die Familie zusammenzuhalten. Denn sie erkennt: Auch im größten Kummer entsteht Hoffnung, wenn man füreinander da ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 645
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
»Wir müssen reden.« Collegestudentin Claire Wood ist nervös, als sie auf Bitte ihrer Mom Teresa die Familie zu Hause im ländlichen Norden Minnesotas besucht. Was sie dann aber dort erfährt, zieht ihr den Boden unter den Füßen weg: Ihre Mutter ist unheilbar an Krebs erkrankt – mit nur 38 Jahren. Für die Woods beginnt eine Zeit der Angst und Verzweiflung, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint und die sie auseinanderzureißen droht. Trotz der niederschmetternden Diagnose unterzieht Teresa sich einer schmerzhaften Behandlung und kämpft gegen den Krebs an, doch irgendwann verlassen sie ihre Kräfte. Teresas Mann Bruce zerbricht beinahe am Leid seiner Frau, und Claires jüngerer Bruder Joshua entfremdet sich immer mehr von ihr. Doch Claire gibt nicht auf und versucht mit aller Kraft, die Familie zusammenzuhalten. Denn auch im größten Kummer entsteht Hoffnung, wenn man füreinander da ist …
Weitere Informationen zu Cheryl Strayed
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
CHERYL STRAYED
Wildblumen
im Schnee
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Reiner Pfleiderer
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2005
unter dem Titel »Torch« bei Houghton Mifflin, Inc., New York
und 2012 in Neuausgabe bei Vintage Books,
a division of Random House, Inc., New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text
enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt
der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten.
Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss.
Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2016
Copyright © der Originalausgabe 2005, 2012 by Cheryl Strayed
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by special arrangement
with Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Alexander Behrmann
KS · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-18503-9V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Brian Jay Lindstrom
und
Zum Gedenken an meine Mutter,
Bobbi Anne Lambrecht,
in Liebe
Vorwort
Als ich neun war, schenkte mir jemand ein Tagebuch. Ich weiß nicht mehr, wer. Es war ganz weiß und hatte ein kleines goldenes Schloss mit einem kleinen goldenen Schlüssel, der zum Verschließen des Buches gedacht war, diesen Zweck aber nie erfüllte. Ich liebte dieses Tagebuch. Ich erinnere mich noch genau, dass es für mich das schönste Geschenk war, das ich je bekommen hatte. Ich füllte es mit Geschichten über Prinzessinnen und Könige, über Pferde, die von Mädchen geritten wurden, deren Väter in schicken Autos herumfuhren. Ich schrieb über Dinge, die mit mir nichts zu tun hatten.
Als ich elf war, kam eine Dichterin an meine Schule und unterrichtete uns mehrere Tage. Gastpoeten waren in Schulen eine große Seltenheit. Jede Minute, die sie zu uns sprach, war, als hielte jemand ein brennendes Streichholz an die entflammbarsten, verborgensten Teile meines Ichs. Einmal erklärte sie uns, was eine Metapher war, und forderte uns dann auf, ein ganzes Gedicht zu schreiben, das aus Metaphern bestand. Ich war ein Löwe. Ich war ein Eiszapfen. Ich war ein Kaleidoskop. Ich war eine zerrissene Buchseite. Ich war Glas, das andere Menschen für Stein hielten. Ein andermal erklärte sie uns, dass wir auch Gedichte über unsere Erinnerungen schreiben könnten. Sie forderte uns auf, die Augen zu schließen und eine Weile daran zu denken, wie wir noch jünger gewesen waren, dann die Augen wieder zu öffnen und zu schreiben. Ich schrieb, wie ich als Fünfjährige in farbbeklecksten Turnschuhen in dem »schönen schmutzigen Pittsburgh«, wie ich es nannte, einen Bürgersteig entlangrannte.
Eine Woche später bestellte mich der Direktor in sein Büro und teilte mir hinter seinem großen Schreibtisch hervor mit, dass die Gastpoetin ihm mein Gedicht gezeigt habe. »Du kannst gut schreiben!«, rief er aus. Er hieß Menzel und war der erste Mensch, der so etwas zu mir sagte. Er reichte mir eine Kopie des Gedichts und bat mich, es ihm laut vorzulesen, was ich verlegen, aber auch glücklich tat. Als ich fertig war, sagte er, es sei ungewöhnlich, dass ich Pittsburgh als schön und als schmutzig beschrieben hätte, da die meisten Menschen meinen würden, es könne nicht beides gleichzeitig sein. »Schreib weiter, Cheryl«, sagte er.
Ich schrieb weiter.
Ich ahnte nicht, dass ich dadurch zur Schriftstellerin wurde. Ich kannte Menschen, die Bücher schrieben, aber mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass ich eine von ihnen werden könnte, bis ich mich als zwanzigjährige Studentin an der University of Minnesota in Minneapolis für ein Einführungsseminar »Lyrik« bei Michael Dennis Browne anmeldete. In diesem Seminar lernte ich eine Menge. Ich begann, Sprache mit neuen Augen zu sehen. Ich schrieb meine ersten ernsthaften (allerdings miserablen) Gedichte. Doch am wichtigsten war, dass ich mehrmals pro Woche in einem Raum mit einem Schriftsteller saß, der nicht nur ein, sondern viele Bücher geschrieben hatte, denn erst da dämmerte mir, dass ich die Kluft, die uns trennte und die mir gewaltig erschien, vielleicht – nur vielleicht – eines Tages würde überbrücken können, indem ich ebenfalls ein Buch schrieb.
Ich bin häufig gefragt worden, wie lange ich für die Arbeit an Wildblumen im Schnee gebraucht habe. Darauf gibt es drei Antworten, und alle sind richtig: vier Jahre, sieben Jahre und vierunddreißig Jahre. Doch die letzte Antwort ist die zutreffendste. Denn am Entstehen dieses Buches haben sie alle ihren Anteil: das kleine weiße Tagebuch mit dem Schloss, das nicht funktionierte, die Gastpoetin an der Schule, die mir beibrachte, was eine Metapher ist, der Direktor, der mich zum Weiterschreiben ermunterte, der Schriftsteller, dessen Existenz mir den Weg wies. Sie sind in der Danksagung dieses Buches nicht aufgeführt, aber sie haben es mitgeprägt. Wildblumen im Schnee ist die Geschichte, die ich in den ersten vierunddreißig Jahren meines Lebens in mir ausgebrütet habe. Ich hatte das Gefühl, nicht leben zu können, ohne sie zu erzählen. Und das Gefühl, sterben zu können, wenn ich sie zu Papier gebracht hätte (was ich nicht kann und nicht will). Vielleicht hat jeder Schriftsteller zu seinem ersten Buch eine solche Beziehung. Bei der Arbeit an meinen anderen Büchern Der große Trip und Der große Trip zu dir selbst habe ich mich abgerackert, aber Wildblumen im Schnee hat mich das Schreiben gelehrt und war deshalb das Buch, das mir das Höchstmaß an Glauben, Anstrengung und Hingabe abverlangte.
Wildblumen im Schnee ist ein Roman über eine Familie im ländlichen Norden Minnesotas, die einen großen Verlust erleidet. Da ich an einem Ort aufgewachsen bin, der dem im Roman geschilderten Ort nicht unähnlich ist, und meine Familie einen schweren Verlust erlitten hat, der dem der Familie Wood/Gunther im Buch nicht unähnlich ist, lesen viele Menschen Wildblumen im Schnee wie einen Tatsachenroman, aber das ist er nicht. Wie viele Romanautoren habe auch ich aus meinen Erfahrungen geschöpft – wer meine anderen Bücher gelesen hat, wird zweifellos einige Details wiedererkennen, die an meine Mutter und ihren Tod oder an die Landschaft und Kultur des ländlichen Aitkin County, Minnesota, erinnern, in dem ich aufgewachsen bin –, aber die autobiografischen Elemente waren nur der Samen, aus dem ich eine fiktionale Welt erschaffen habe.
Es stimmt zwar, dass meine Familie und ich bei dem sehr realen Lokalsender KAXE Radiosendungen gehört haben wie die, die Teresa Wood in Wildblumen im Schnee moderiert, aber meine Mutter war keine Radiomoderatorin, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie eine hätte werden wollen, wenn sie Gelegenheit dazu gehabt hätte. Mein Bruder musste nicht wegen Dealens ins Gefängnis wie Joshua Wood. Mein Stiefvater war kein Einzelkind und hörte in seiner Trauer nicht obsessiv die Musik von Kenny G, wie Bruce Gunther es tut. Ich hatte keine Affäre, während meine Mutter im Sterben lag wie Claire Wood in einem Krankenhaus in Duluth.
Mit Wildblumen im Schnee wollte ich keine Geschichte erzählen, die auf wahren Begebenheiten beruht, aber natürlich lässt sich mein Bedürfnis, Wildblumen im Schnee zu schreiben, nicht davon trennen, was geschehen ist. Es gehört zu den größten Widersprüchen fiktionaler Literatur, dass der Autor häufig nur kraft seiner Fantasie zu den tiefsten Wahrheiten vordringt. Ich jedenfalls habe es bei der Arbeit an Wildblumen im Schnee so empfunden. Ich weiß nicht genau, was es für meinen Stiefvater bedeutete, seine Frau zu verlieren, oder für meine Geschwister, ihre Mutter zu verlieren, aber in Wildblumen im Schnee habe ich mich bemüht, es zu verstehen. Als Autorin eines Romans durfte ich suchen. Ich durfte die einzige Geschichte erzählen, die ich zu der Zeit erzählen konnte, eine, die über die Grenzen meiner eigenen persönlichen Trauer hinausging – einer Trauer, die so groß war, dass ich allein sie nicht fassen konnte. Ich musste sie auf andere Menschen verteilen und dabei auch diesen anderen gerecht werden. Auch sie hatten meine Mutter verloren. Ich stellte die Geschichte der Trauer meiner Familie auf eine größere, größtenteils fiktionale Bühne, damit ich mir ein Bild davon machen konnte, wie jeder von uns daraus hervorgegangen war. Dabei fühlte ich mich nicht der Faktentreue, sondern der emotionalen Wahrheit verpflichtet.
Das meine ich damit, wenn ich sage, dass ich Wildblumen im Schnee in mir ausgebrütet habe. Es ist die Geschichte meines Lebens, und doch habe ich alles erfunden. Ich erschuf Figuren, auch wenn ich in jedem Wort, das ich schrieb, die Menschen spürte, die ich kannte und liebte. Ich siedelte die Geschichte an einem Ort an, der mein Zuhause war und doch auch wieder nicht. Ich gab der Stadt in Wildblumen im Schnee den Namen Midden – das mittelalterliche Wort für Müllgrube –, aber nicht, weil ich damit andeuten wollte, meine geliebte Heimatstadt McGregor sei ein trostloses Kaff, sondern weil ein Midden eine wertvolle Fundstätte für archäologische Ausgrabungen ist. Wir bergen dort verborgene Schätze, großartige und profane. In einem Midden können wir die Geschichte eines Volkes und eines Ortes auffinden, aber nur wenn wir graben.
Wildblumen im Schnee ist das Resultat meines ersten nachdrücklichen Grabungsversuchs. Als ich beim Schreiben unter der Oberfläche kratzte, wurde mir klar, dass ich nicht wusste, worauf ich beim Freilegen der Schichten stoßen würde. Erst als ich fertig war, konnte ich sehen, was ich getan hatte: Ich hatte nicht nur einen Roman über Trauer und Verlust geschrieben, sondern auch einen über die Liebe in ihren vielen Formen und darüber, wie wir mitten in der tiefsten Finsternis ein Licht finden, wie wir überleben, was wir nicht überleben zu können glauben. Erst aus diesem Blickwinkel – Jahre nach der Veröffentlichung von Wildblumen im Schnee – kann ich erkennen, wovon all meine Bücher handeln. Davon, dass Dinge gleichzeitig schön und schmutzig sein können.
TEIL 1
Die Woods aus Coltrap County
»Und doch müsstest du es aushalten, wenn du es nicht verhindern kannst. Es ist schwach und dumm, zu sagen, man kann nicht ertragen, was das Schicksal einem auferlegt.«
Charlotte Brontë, Jane Eyre
1
Sie hatte Schmerzen. Als wäre ihr Rückgrat ein Reißverschluss und jemand wäre hinter sie getreten, hätte ihn aufgezogen, hineingegriffen und ihre Organe zusammengedrückt, als wären sie Butter oder Teig oder Weintrauben, die ausgepresst werden sollten. Bei anderen Gelegenheiten war es, als ob etwas Scharfkantiges wie Diamanten oder Glasscherben ihre Knochen ritzte. Teresa beschrieb, was sie empfand – das mit dem Reißverschluss, den Weintrauben, den Diamanten und Glasscherben –, dem Arzt, der auf einem kleinen Rollhocker saß und in ein Notizbuch schrieb. Er schrieb noch, als sie bereits verstummt war, und lauschte weiter mit schiefem Kopf wie ein Hund, der in der Ferne ein Geräusch gehört hatte. Es war später Nachmittag, das Ende eines langen Untersuchungstages, und er war der letzte Arzt, der richtige Arzt, derjenige, der ihr endlich sagen würde, was ihr fehlte.
Teresa hielt ihre Ohrringe – zwischen zwei Glasplatten gepresste und getrocknete Veilchen – in einer Hand und legte sie an, noch beim Anziehen, nachdem sie stundenlang in einem Krankenhauskittel von Zimmer zu Zimmer gewandert war. Sie untersuchte ihre Bluse auf Fussel, Katzenhaare und verirrte Fadenreste und zupfte pedantisch ab, was sie fand. Sie blickte zu Bruce, der aus dem Fenster schaute und ein Schiff im Hafen beobachtete, das ruhig und elegant über den See glitt, als wäre nicht Januar, als wäre hier nicht Minnesota, als gäbe es kein Eis.
Im Moment hatte sie keine Schmerzen und sagte dies dem Arzt, während er schrieb. »Es gibt lange Phasen, in denen ich mich richtig gut fühle«, sagte sie und lachte, wie sie bei Fremden immer lachte. Es würde sie nicht wundern, fuhr sie fort, wenn sie langsam den Verstand verlöre oder schon in die Wechseljahre käme. Oder wenn sie eine atypische Lungenentzündung hätte. Atypische Lungenentzündung war ihre neueste Theorie und die, die ihr am besten gefiel. Denn sie konnte den Husten und die Schmerzen erklären. Und warum sich ihr Rückgrat wie ein Reißverschluss anfühlte.
»Ich würde gern noch eine Untersuchung vornehmen«, sagte der Arzt und schaute zu ihr auf, als wäre er aus einer Trance erwacht. Er war jung. Jünger. Ob er dreißig war?, fragte sie sich. Er bat sie, sich wieder zu entkleiden, gab ihr einen frischen Kittel und verließ den Raum.
Sie zog sich langsam aus, zögernd zunächst, dann rasch, sich duckend, als hätte Bruce sie noch nie nackt gesehen. Die Sonne schien ins Zimmer und färbte alles zartlila.
»Wie schön das Licht ist«, sagte sie, ging zum Untersuchungstisch und setzte sich darauf. Der Kittel klaffte über ihrem Bauch, sodass rosige Haut hervorschaute, und sie drückte den Spalt mit den Händen zu. Sie war durstig, durfte aber keinen Tropfen trinken. Und hungrig, denn sie hatte seit gestern Abend nichts mehr gegessen. »Ich sterbe vor Hunger.«
»Das ist gut«, sagte Bruce. »Appetit bedeutet, dass du gesund bist.« Sein Gesicht sah rot und trocken aus, seine Haut rissig, als hätte er gerade in der Auffahrt Schnee geschippt, obwohl er sie den ganzen Tag von einer Abteilung des Krankenhauses zur nächsten begleitet und alles gelesen hatte, was er in den Wartezimmern fand. Zeitschriften wie Reader’s Digest, Newsweek und Self, die er nur widerwillig in die Hand nahm und trotzdem von vorn bis hinten gierig verschlang. Den ganzen Tag über hatte er ihr in den kurzen Spannen, in denen auch sie warten musste, von den Artikeln erzählt. Von einer alten Frau, die von einem Jungen, der ihr eine Hundehütte bauen sollte, zu Tode geprügelt worden war. Von einem Filmstar, der scheidungsbedingt seine Jacht verkaufen musste. Von einem Mann aus Kentucky, der einen Marathon gelaufen war, obwohl er nur einen Fuß hatte und anstelle des anderen eine komplizierte, robuste Metallfeder, die in einen Schuh montiert war.
Der Arzt klopfte an und stürmte herein, ohne eine Antwort abzuwarten. Er wusch sich die Hände, zückte sein kleines schwarzes Instrument, das mit der kleinen Lampe, und leuchtete ihr in Augen, Ohren und Mund. Sie roch das Zimtkaugummi, das er kaute, und die Seife, die er benutzt hatte, bevor er sie anfasste. Ohne zu blinzeln, starrte sie in den Lichtstrahl und folgte, als er sie dazu aufforderte, mit den Augen mühelos dem Stift, den er vor ihr hin und her bewegte.
»Ich bin keine kranke Frau«, erklärte sie.
Niemand stimmte zu. Niemand widersprach. Aber Bruce trat hinter sie und rieb ihr den Rücken.
Seine Hände erzeugten ein kratzendes Geräusch auf dem Stoff des Kittels, so rau und rissig waren sie, wie Baumrinde. Abends schnitt er sich immer mit einem Taschenmesser die Schwielen ab.
Der Arzt sprach das Wort Krebs nicht aus – zumindest hörte sie es ihn nicht sagen. Er sprach von Orangen, Erbsen und Radieschen, von Eierstöcken, Lunge und Leber. Er sagte, dass entlang ihrer Wirbelsäule Tumore wucherten.
»Was ist mit meinem Gehirn?«, fragte sie, die Tränen zurückhaltend.
Er antwortete, er habe auf eine Untersuchung des Gehirns verzichtet, da es in Anbetracht ihrer Eierstöcke, Lunge und Leber irrelevant sei. »Ihre Brüste sind in Ordnung«, sagte er, an das Waschbecken gelehnt.
Sie errötete, als sie das hörte. Ihre Brüste sind in Ordnung.
»Danke«, sagte sie und beugte sich im Stuhl etwas vor. Einmal war sie aus Solidarität mit Frauen, deren Brüste nicht in Ordnung waren, sechs Meilen durch die Straßen von Duluth marschiert und hatte dafür ein rosa T-Shirt und einen Teller Spaghetti bekommen.
»Was bedeutet das genau?« Ihre Stimme klang vernünftig jenseits der Vernunft. Sie spürte jeden Muskel in ihrem Gesicht. Manche waren wie gelähmt, andere zuckten. Sie drückte sich die kalten Hände gegen die Wangen.
»Ich möchte Ihnen keine Angst machen«, sagte der Arzt und erklärte ihr dann sehr ruhig, dass sie nicht erwarten könne, in einem Jahr noch zu leben. Er sprach lange und in einfachen Worten, aber sie verstand nicht, was er sagte. Als sie Bruce kennengelernt hatte, hatte sie ihn einmal gebeten, ihr zu erklären, wie ein Automotor funktionierte. Sie tat es, weil sie ihn liebte, und wollte ihre Liebe dadurch beweisen, dass sie Interesse an seinem Wissen zeigte. Er zeichnete die Bauteile eines Motors auf eine Serviette und erklärte ihr, was wie zusammengehörte und welche Teile andere antrieben, wobei er mehrmals abschweifte und schilderte, was voraussichtlich passierte, wenn bestimmte Dinge nicht funktionierten, und sie lächelte und setzte ein intelligentes Gesicht auf, als hätte sie verstanden, doch am Ende hatte sie überhaupt nichts begriffen. So wie jetzt.
Sie sah Bruce nicht an, sie brachte es nicht über sich. Sie vernahm ein kurzes Aufstöhnen aus seiner Richtung, dann ein langes grässliches Husten.
»Danke«, sagte sie, als der Arzt ausgeredet hatte. »Ich meine dafür, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun.« Und dann fügte sie kraftlos hinzu: »Nur eins noch – Sie sind sich sicher? Denn … eigentlich … fühle ich mich gar nicht so krank.« Sie glaubte, sie würde es spüren, wenn Orangen in ihr wuchsen. Sie hatte beide Male sofort gewusst, dass sie schwanger war.
»Das kommt noch. Ich würde sehr bald damit rechnen«, erwiderte der Arzt. Er hatte ein Grübchenkinn, ein Milchgesicht. »Es kommt selten vor, dass man ihn so spät entdeckt. Tatsächlich spricht der Umstand, dass wir ihn so spät entdeckt haben, für Ihren guten Allgemeinzustand. Ansonsten sind Sie nämlich in blendender gesundheitlicher Verfassung.«
Er stemmte sich hoch, setzte sich auf den Tisch und ließ die Beine baumeln.
»Danke«, sagte sie noch einmal und griff nach ihrem Mantel.
Langsam und wortlos gingen sie zum Aufzug, drückten den durchscheinenden Knopf und warteten, bis er kam. Taumelnd stiegen sie ein und atmeten erleichtert auf. Endlich allein.
»Teresa«, sagte Bruce und sah ihr in die Augen. Er roch nach den Mandarinen und Trauben, die sie für ihn in ihrer famosen großen Strohtasche mitgebracht und von denen er den ganzen Tag genascht hatte.
Sie strich behutsam über sein Gesicht, und dann packte er sie und zog sie an sich. Er befühlte ihre Wirbelsäule, einen Wirbel, dann einen anderen, als wollte er sie zählen und Bestandsaufnahme machen. Sie schob eine Hand in eine Gürtelschlaufe hinten an seiner Jeans, und mit der anderen griff sie nach der Muschel, die sie an einem Lederband um den Hals trug. Ein Geschenk ihrer Kinder. Die Schale glänzte bei jeder Bewegung in wechselnden Farben, schillerte wie ein tropischer Fisch im Aquarium und war so dünn, dass sie sie mit Leichtigkeit zerbrechen könnte. Sie spielte mit dem Gedanken, es zu tun. Als Teenager hatte sie einmal in einem Anfall stiller Wut eine ganze Flasche Kokoslotion über ihren Schenkeln ausgedrückt, weil ihr etwas verwehrt worden war: der Besuch einer Party, eine Schallplatte oder ein Paar Stiefel. Daran dachte sie jetzt. Sie dachte: Ausgerechnet daran denke ich jetzt. Sie versuchte, an nichts zu denken, aber dann dachte sie an Krebs. Krebs, sagte sie zu sich. Krebs, Krebs, Krebs. Das Wort fauchte in ihr wie ein anfahrender Zug. Und dann schloss sie die Augen, und es verwandelte sich in etwas anderes, das sich schlingernd entfernte, eine Quecksilberperle oder ein Mädchen auf Rollerskates.
Sie gingen in ein China-Restaurant. Essen konnten sie noch. Sie bestellten grüne Bohnen in Knoblauchsauce und kalte Sesamnudeln, dann lasen sie sich gegenseitig die Horoskope auf ihren Tischsets vor. Sie waren beide Tierkreiszeichen Pferd, achtunddreißig Jahre alt. Sie waren viel in Bewegung, standen ständig unter Strom, ließen sich nie unterkriegen. Außerdem waren sie impulsiv und dickköpfig und ließen Umsicht vermissen. Sie passten perfekt zusammen.
Goldfische schwammen in einem Bassin in der Nähe ihres Tisches. Alte Goldfische. Beunruhigend große Goldfische. »Hallo, Goldfische«, gurrte sie sanft und neigte sich auf dem Stuhl in ihre Richtung. Sie kamen an die Oberfläche, öffneten die großen Mäuler zu perfekten Kreisen und erzeugten leise Knallgeräusche.
»Seid ihr hungrig?«, fragte sie. »Sie sind hungrig«, sagte sie zu Bruce und sah sich suchend im Restaurant um, als wollte sie feststellen, wo das Fischfutter aufbewahrt wurde.
An einem Nebentisch wurde Geburtstag gefeiert, und Bruce und Teresa waren genötigt, das Geburtstagsständchen mitzusingen. Das Geburtstagskind, eine Frau, bekam eine Crème brûlée, lobte sie überschwänglich und aß dann ohne großen Appetit.
Bruce hielt über den Tisch hinweg Teresas Hand. »Jetzt, wo ich sterbe, gehen wir wieder zusammen aus«, sagte sie im Scherz, aber sie lachten nicht. Trauer durchströmte sie mit einer Sinnlichkeit, als würden sie sich trennen. Ihr Unterleib war eine Faust, dann ein Sumpf. »Ich möchte mit dir schlafen«, sagte sie, und er blinzelte mit seinen blauen Augen, die sich so mit Tränen füllten, dass er die Brille abnehmen musste. Im Lauf der Jahre hatten sie immer seltener miteinander geschlafen. Vielleicht ein-, zweimal im Monat.
Das Essen kam in großen Schalen, und sie aßen, als wäre alles beim Alten. Sie waren so hungrig, dass sie nicht sprechen konnten, und so lauschten sie der Unterhaltung der fröhlichen Geburtstagsrunde. Die Dame mit der Crème brûlée beharrte darauf, dass ihr Tierkreiszeichen Drache und nicht Hase sei, obwohl das Tischset etwas anderes sagte. Nach einer Weile standen alle auf, schlüpften in ihre dicken Mäntel und schlenderten, die Goldfische im Teich bewundernd, an Teresa und Bruce vorbei.
»Ich hatte auch mal einen Goldfisch«, sagte ein Mann, der das Geburtstagskind am Arm hielt. »Er hieß Charlie.« Und alle brüllten vor Lachen.
Später, nachdem Bruce die Rechnung bezahlt hatte, gingen sie über einen Steg, von dem man einen Penny in den Teich werfen konnte.
Sie warfen Pennys.
Auf der Heimfahrt überkam es sie, und sie weinten. Es war gut, dass sie fuhren, denn so mussten sie einander nicht ansehen. Sie sprachen das Wort aus, aber als wären es zwei. Kre-ebs. Sie konnten es nur langsam, zergliedert aussprechen oder gar nicht. Sie schworen einander, den Kindern nichts zu sagen. Wie konnten sie das den Kindern sagen?
»Wie könnten wir nicht?«, fragte Teresa nach einer Weile bitter. Sie dachte daran, wie sie die Hände ihrer Kinder, als sie noch Babys waren, in den Mund genommen und so getan hatte, als wollte sie sie essen, bis sie lachten. Sie erinnerte sich noch ganz genau, wie ihre Finger gegen ihre Zunge drückten, und sie sank mit dem Oberkörper vornüber und brach in Schluchzen aus.
Bruce ging vom Gas, steuerte den Pick-up an die Seite und hielt an. Sie waren mittlerweile aus Duluth heraus, von der Autobahn herunter und auf der Landstraße nach Hause. Er beugte sich über sie, umschlang ihren Rücken und drückte sie, so gut es ging.
Sie holte mehrmals tief Luft, um sich zu beruhigen, wischte sich mit den Handschuhen das Gesicht ab, hob den Kopf und blickte durch die Windschutzscheibe hinaus in den Schnee, der festgebacken am Straßenrand lag. Zu Hause erschien ihr unerreichbar fern.
»Fahren wir weiter«, sagte sie.
Sie fuhren schweigend unter einem eisklaren schwarzen Himmel und kamen alle paar Meilen an einer Truthahnfarm oder einem Milchviehbetrieb oder einem Haus mit beleuchtetem Schuppen vorbei. Wieder in Coltrap County, stellte Bruce das Radio an, und sie erschraken, als sie Teresas Stimme vernahmen, obwohl heute Donnerstag war. Sie interviewte gerade eine Wünschelrutengängerin aus Blue River namens Patty Peterson, die Nachfahrin einer langen Reihe von Petersons, die alle nach Wasseradern gesucht hatten.
Teresa hörte sich sagen: »Die Kunst – und eine Kunst könnte man es wohl nennen – oder auch Gabe, den richtigen Weidenzweig auszuwählen, hat mich schon immer fasziniert.« Und schaltete das Radio sofort wieder aus. Sie verschränkte die Hände im Schoß. Draußen waren es zehn Grad unter null. Der Pick-up dröhnte, denn er benötigte einen neuen Auspufftopf.
»Vielleicht wird er auf dieselbe rätselhafte Weise wieder verschwinden, wie er gekommen ist«, sagte sie und blickte zu Bruce. Sein hageres Gesicht war schön im matten Schein der Armaturenbeleuchtung.
»Darauf werden wir setzen«, sagte er und legte ihr eine Hand aufs Knie. Sie erwog, dichter zu ihm rüberzurutschen und das linke Bein über die Mittelkonsole zu schwingen, fühlte sich aber an ihren Platz an der dunklen Scheibe gefesselt.
»Ich könnte aber auch sterben«, sagte sie ruhig, als hätte sie bereits mit allem ihren Frieden gemacht. »Ich könnte ohne weiteres sterben.«
»Nein.«
»Bruce.«
»Wir werden alle sterben«, sagte er leise. »Jeder wird sterben, aber du wirst nicht jetzt sterben.«
Sie drückte die bloße Hand flach an die vereiste Scheibe und hinterließ einen Abdruck. »Ich glaube nicht, dass ich auf diese Weise sterben werde.«
»Du musst optimistisch bleiben, Ter. Warten wir die Bestrahlung ab, dann sehen wir weiter. Wie der Doktor gesagt hat.«
»Er hat gesagt, dass wir dann über eine Chemo nachdenken. Ob ich kräftig genug bin für eine Chemo, wenn ich mit der Bestrahlung fertig bin, und nicht, ob ich dann geheilt bin, Bruce. Du hörst nie richtig zu.« Zum ersten Mal an diesem Tag ärgerte sie sich über ihn, und ihr Ärger war eine Wohltat, als würde ihr warmes Wasser sanft über die Füße gegossen.
»Na schön.«
»Was na schön?«
»Warten wir ab. Okay?«
Sie starrte aus dem Fenster.
»Okay?«, wiederholte er, aber sie antwortete nicht.
Sie fuhren an einer Farm vorbei, auf der mehrere Kühe im hellen Lichtschein der offenen Stalltür standen, die Köpfe dem dunklen Wald dahinter zugewandt, als hätten sie dort etwas Schlimmes bemerkt, was kein Mensch wahrnehmen konnte.
2
Die Stimme seiner Mutter erfüllte Joshua mit Scham.
»Sie hören Moderne Pioniere!«, rief sie aus allen vier Lautsprecherboxen im Speiseraum des Midden Café und aus der einen Box hinten in der Küche, die mit Ruß überzogen und mit Fett und Ketchup bespritzt war. Joshua lauschte der in der Küche, während er, die Arme bis zu den Ellbogen in brühend heißem Seifenwasser, mit einem Knäuel Stahlwolle Töpfe scheuerte. Die Stimme seiner Mutter bereitete ihm Kopfschmerzen, als würde ihm ein spitzer Gegenstand ins Trommelfell getrieben. Ihre Radiostimme klang, wie sie selbst war: beharrlich, resolut, heiter, wissbegierig. Von ihren Interviewpartnern wollte sie alles wissen. »Und können Sie uns sagen, wie genau Sie den Honig der Bienen einsammeln?«, fragte sie beispielsweise. Oder sie bestritt die ganze Stunde allein, redete übers Biogärtnern oder Selbstbauen einer Mostpresse, übers Quilten oder die medizinischen Vorzüge von Ginseng. Einmal hatte sie auf ihrem Dulcimer »Turkey in the Straw« gespielt, sodass es ganz Nord-Minnesota hören konnte, und hinterher aus einem Buch über amerikanische Folkmusik vorgelesen. Neulich hatte sie kundgetan, wie viel Geld sie in einem halben Jahr für Tampons ausgegeben habe, und dann weniger kostspielige Alternativen vorgestellt: Naturschwämme und Baumwollbinden, die sie sich aus Joshuas und Claires alten Hemden genäht hatte. Das hatte sie wortwörtlich gesagt: aus Joshuas und Claires alten Hemden. Claire war inzwischen aufs College gewechselt, und so hatte Joshua in der ersten Woche seines letzten Highschooljahrs ganz allein mit dieser Schmach leben müssen.
Marcy schob sich durch die Schwingtür in die Küche zurück, in den Händen einen Stapel schmutziger Teller mit Speiseresten und zusammengeknüllten Servietten. Sie stellte sie auf die Arbeitsplatte, die Joshua eben abgeräumt hatte, und fischte eine Zigarette aus ihrer Schürze. Joshua beobachtete sie verstohlen, während er die Teller abkratzte. Sie war Ende zwanzig und klein, verheiratet, Mutter zweier Kinder und mit einem großen Busen ausgestattet, der sie dicker machte, als sie war. Joshua sinnierte bei der Arbeit viel darüber, ob er sie hübsch fand oder nicht. Er war siebzehn, schlaksig und blond, ruhig, aber nicht schüchtern.
Seine Mutter sprach gerade mit einer Wünschelrutengängerin namens Patty Peterson. Ihre Stimme klang angeregt, Pattys Stimme zittrig. Marcy stand da und hörte zu, während sie ihr Schürzenband löste und fester knüpfte. »Eh wirs uns versehen, geht deine Mutter nach Afrika und erzählt uns, wie es dort so zugeht. Zum Beispiel, wie sie dort aufs Klo gehen.«
»Sie würde gern nach Afrika gehen«, entgegnete Joshua mit einfältigem Ernst, sich standhaft weigernd, auch nur den kleinsten Scherz über seine Mutter zu würdigen. Sie würde nach Afrika gehen, das wusste er. Sie würde überallhin gehen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte.
»Drüben in Blue River haben sie jetzt einen Afrikaner, ein adoptiertes Kind«, rief Vern von der Hintertür. Trotz der Kälte hatte er einen Eimer in die Tür gestellt, damit sie offen blieb. Marcy war die Tochter des Besitzers, Vern der Abendkoch.
»Keinen Afrikaner, Vern«, sagte Marcy. »Einen Schwarzen. Er stammt aus den ›Cities‹. Das ist nicht Afrika.« Sie rückte die Haarspange zurecht, die ihre Locken am Hinterkopf zusammenhielt. »Willst du, dass wir hier drin erfrieren?«
Vern schloss die Tür. »Vielleicht wird deine Mom den Afrikaner interviewen«, sagte er. »Uns erzählen, was er zu sagen hat.«
»Sei lieb«, sagte Marcy, stellte sich auf die Zehenspitzen und zog, die Zigarette in den Mund geklemmt, einen Stapel Styroporbehälter vom obersten Regal. »Nichts gegen deine Mutter, Josh«, fuhr sie fort. »Sie ist eine supernette Frau. Eine interessante Frau. Nicht alle können gleich sein.« Sie drückte die Glut der Zigarette sorgfältig in einem Teller aus, pustete den Stummel an, steckte ihn in die Schürzentasche zurück und schwirrte zur Tür hinaus.
Vor sechs Jahren, als seine Mutter mit der Sendung angefangen hatte, hatte sich Joshua nicht geschämt. Er war stolz gewesen, als wäre er auf ein Podest gehoben worden und würde von innen heraus strahlen. Er hielt seine Mutter für berühmt und folglich sie alle – Claire, Bruce und sich selbst. Teresa hatte sie zu einem Teil ihrer Sendung gemacht, ihr Leben lieferte ihr den Stoff. Sie ließ sie zur Vorbeugung gegen Erkältungen und Herzkrankheiten rohen Knoblauch essen, sich zum Schutz vor Stechmücken die Haut mit Flohkraut einreiben, Tee aus gekochten Dreiblatt-Feuerkolben trinken, wenn sie Husten hatten. Fleisch durften sie nicht essen, und wenn doch, dann mussten sie die Tiere selbst töten, was sie eines Winters taten, als sie fünf Hähne schlachteten, die sie als Küken für Hennen gehalten hatten. Sie schüttelten frische Sahne in Gläsern, bis sie zu Butter verklumpte. Ihre Mutter besorgte sich Schafwolle von einem Nachbarn, kämmte und spann sie auf einem Spinnrad, das Bruce ihr gebaut hatte. Sie hob Brokkoliblätter auf, sammelte Löwenzahn und die inneren Rindenschichten bestimmter Bäume und gewann daraus Farbstoff für das Garn. Dabei kamen die unglaublichsten Farben heraus: Rot, Lila und Gelb, wo man eigentlich nur Schlammgrün oder Matschbraun erwartet hätte. Und dann erzählte ihre Mutter aller Welt von ihrer Familie. Von ihren Erfolgen und Niederlagen, ihren Entdeckungen und Überraschungen. »Wir sind alle moderne Pioniere!«, sagte sie immer. Hörer riefen während der Sendung an und stellten Fragen oder auch später zu Hause und baten sie um Rat. Langsam zunächst und dann über Nacht, wie es schien, wollte Joshua kein moderner Pionier mehr sein. Er wollte so sein wie alle anderen und nichts weiter. Claire hatte schon viel früher kein moderner Pionier mehr sein wollen. Sie hatte darauf bestanden, Make-up zu tragen, und mit ihrer Mutter und Bruce heftig darüber gestritten, warum sie keinen Fernseher haben durften, warum sie nicht normal sein konnten. Dieselben Streitereien lieferte sich jetzt Joshua mit ihnen.
»Du musst auch noch die Fritteuse putzen«, sagte Vern. »Versuch ja nicht, das auf Angie abzuwälzen.«
Joshua machte sich wieder ans Scheuern und drehte das heiße Wasser voll auf. Der Dampf tat seinem Gesicht gut und öffnete die Poren. Pickel sprossen auf dem rosigen Teil seiner Wangen und auf der breiten Fläche seiner Stirn. Nachts im Bett kratzte er daran, bis sie bluteten, und dann stand er immer auf und tat Wasserstoffperoxid drauf. Er mochte das Gefühl, dass die Blasen alles wegfraßen.
»Hörst du, was ich dir sage?«, fragte Vern, als Joshua das Wasser wieder abdrehte.
»Ja.«
»Was?«
»Ich sagte, ja«, erwiderte er schroffer und richtete seine blauen Augen auf Vern: einen hageren alten Mann mit Wampe und roter Knollennase, der an einem Arm mit einer Hula-Tänzerin und am anderen mit einem tauumwundenen Anker tätowiert war.
»Dann antworte gefälligst. Zeig etwas Respekt vor Älteren.« Vern stand an der Tür. Seine Schürze und sein T-Shirt waren dort, wo er sich die Hände abgewischt hatte, voller Flecken in Grillsaucenfarbe. Er öffnete die Tür erneut und schnipste seine Zigarettenkippe in die Dunkelheit hinaus. In der Gasse hinter dem vereisten Treppenabsatz parkten sein Van und Joshuas Pick-up an der Rückwand von Ed’s Feed.
Joshua klappte die Spülmaschine auf, und Dampf quoll heraus. Er zog einen Korb mit sauberem Besteck heraus und begann, die Teile in runde weiße Halter zu räumen, wobei er jedes mit einem Geschirrtuch kurz abwischte.
»Du kommst heute wohl nicht hinterher, oder?«
»Nö.« Seine Mutter lachte aus dem Radio, und auch die Wünschelrutengängerin lachte, ehe die beiden ihr Gespräch bierernst fortsetzten.
»Oder?«
»Ich sagte, nein.«
»Vielleicht musst du noch lernen, dass man pünktlich erscheinen muss, wenn man einen Job hat, oder?«
»Ja.«
»Mir ist nicht entgangen, dass du gestern Abend Angie die Lasagneform überlassen hast. Glaub bloß nicht, ich merke so was nicht. Ich merke es sehr wohl. Ich merke alles, was ihr Blödmänner ausheckt, zwei Wochen bevor ihr selbst drauf kommt. Und ich weiß, dass du ständig was ausheckst. Und darüber nachdenkst, wie du damit durchkommst. Hab ich recht?«
»Nein.«
Vern musterte Joshua, den Oberkörper leicht vorgebeugt, eine qualmende Zigarette zwischen den Lippen, als wollte er noch etwas sagen, als ginge er im Kopf die Liste der Dinge durch, die ihn nervten. Joshua hatte Vern fast sein ganzes Leben lang gekannt, ohne seinen Namen zu wissen. Erst als sie im Café Arbeitskollegen wurden, hatte er erfahren, dass er Vern hieß, Vern Milkkinen. Davor hatte er ihn nur als den Hühnermann gekannt, so wie die meisten Leute in Midden, denn im Sommer verkaufte er auf dem Parkplatz des Dairy Queen Küken, Eier und ein ständig wechselndes Sortiment von Hausmacherkonserven, Seifen, Bienenwachskerzen und Traubenkirschenmarmelade, seine Spezialität. Joshua war nie auf die Idee gekommen, sich zu fragen, was der Hühnermann – was Vern – in den Monaten tat, in denen er nicht verkaufte, bis er dann eines Tages in die Küche des Cafés marschierte und Vern dort stehen sah, ein Fleischermesser in der Hand.
An ihrem ersten gemeinsamen Arbeitstag ließ Vern nicht erkennen, dass er sich an Joshua erinnerte, als wäre ihm nicht bewusst, dass er ihn praktisch hatte aufwachsen sehen und in den dreizehn Sommern zwischen seinem vierten und siebzehnten Lebensjahr mindestens einmal pro Woche zu Gesicht bekommen hatte, zunächst als Kind, wenn Joshua seine Mutter zum Hühnermann begleitete, und später, wenn er allein zu ihm geschickt wurde. Der Parkplatz des Dairy Queen war der einzige Platz in Midden, der eine markttaugliche Größe hatte, denn er diente auch der Kwik-Mart-Tanke und Bonnie’s Burger Chalet als Parkplatz. Jede Woche hatten der Hühnermann und er sich mit einem Nicken oder leichten Heben von Kinn oder Hand begrüßt. Einmal, als er zehn war, fragte ihn der Hühnermann, ob er Mädchen möge, ob er schon eine Freundin habe, ob er schon mal ein Mädchen geküsst habe, welche er vorziehe, Brünette oder Blonde.
»Oder Rothaarige. Auf die musst du ein Auge haben. Das sind die mit den engsten Muschis«, sagte Vern und brüllte vor Lachen.
Dann zeigte er Joshua sein Anker-Tattoo und fragte ihn, ob er Popeye den Seemann kenne, die Comicfigur.
»Ja«, antwortete Joshua ernst und hielt ihm das Geld hin, das ihm seine Mutter mitgegeben hatte.
»Das bin ich. Ich bin Popeye«, sagte Vern mit wildem, geheimnisvollem Blick, als hätte ihn die Erinnerung in eine Zeit zurückversetzt, in der er ein heimlicher Held gewesen war. »Nur ich bin das Original, nicht die Comicfigur.« Und dann lachte er wieder lauthals, und Joshua täuschte ein Lächeln vor.
Joshua hatte mehrere Jahre gebraucht, um die Vorstellung, dass Vern Popeye sei, ganz abzuschütteln, obwohl Verns wahres Leben ein offenes Buch war. Er hatte einen Sohn namens Andrew, der zwanzig Jahre älter als Joshua war. Wenn Vern gute Laune hatte, erzählte er bei der Arbeit Anekdoten aus Andrews Jugend. Wie Andrew seinen ersten Hirsch erlegt hatte, von seinen legendären Basketballkünsten, wie er Andrew einmal den Arm gebrochen hatte, als er ihn in der achten Klasse beim Kiffen erwischte. »Ich habe den Lauser einfach am Arm gepackt und gedreht, bis es knackte«, sagte Vern. »Ich hätte ihn glatt abgerissen, wenn ich gekonnt hätte. Das war ihm eine Lehre. Ich lass mir nicht auf der Nase herumtanzen. So erzieht man kein Kind. Wenn du dir von ihnen auf der Nase herumtanzen lässt, werden sie nie hart.«
Joshua kannte seinen eigenen Vater kaum. Er lebte jetzt in Texas. Zusammen mit Claire hatte er ihn dort einmal besucht, als er zehn war, aber seit seinem vierten Lebensjahr waren sie nicht mehr mit ihm zusammen. Damals hatten sie nicht in Midden gelebt, sondern in Pennsylvania, wo sein Vater in einem Kohlebergwerk arbeitete. Sie zogen nach Midden, ohne jemals von der Stadt gehört zu haben, bis sie mit einer Reihe von Greyhound-Bussen hinfuhren, weil ihre Mutter durch die Cousine einer Freundin dort einen Job als Putzfrau in einem Altersheim namens Rest-A-While Villa bekommen hatte.
Marcy kam in die Küche zurück und setzte sich auf den umgedrehten Eimer, der ihnen als Stuhl diente. »Ich nehme heute Abend das Schweinefilet, Vern. Mit einer Ofenkartoffel. Die Erbsen kannst du behalten. Du hast doch noch eine Ofenkartoffel für mich?«
Vern nickte und schloss wieder die Tür, die er geöffnet hatte.
»Ob es wohl schneien wird?«, fragte sie und inspizierte ihre Fingernägel.
»Zu kalt für Schnee«, antwortete er.
Alle drei hörten zu, als Teresa Patty Peterson fragte, wie sie die Zukunft des Wünschelrutengehens einschätze, und Patty antwortete, dass es eine aussterbende Kunst sei. Die Radiosendung war nicht Teresas richtiger Job, sie arbeitete ehrenamtlich wie fast alle Mitarbeiter des Senders. Im Brotberuf war sie Kellnerin in Len’s Lookout am Highway 32, wo sie vor zehn Jahren, nach der Schließung der Rest-A-While Villa, angefangen hatte.
Marcy riss Joshua die Baseballmütze vom Kopf und setzte sie ihm schief wieder auf. »Sag Vern, was du zum Abendessen willst, damit wir beizeiten verschwinden können. Ich muss noch ausfegen.«
»Zwiebelringe bitte«, sagte er und belud einen weiteren Spülkorb mit schmutzigem Geschirr. Im Radio fragte seine Mutter, in welchem Jahr der Königin-Frauenschuh zur Staatsblume von Minnesota gekürt worden sei.
»1892«, sagte Vern, öffnete die Ofenklappe, nahm mit der bloßen Hand eine in Alufolie eingewickelte Kartoffel heraus und ließ sie auf einen Teller fallen.
Am Schluss jeder Sendung stellte seine Mutter eine Frage, und während sie darauf wartete, dass Hörer anriefen und die richtige Antwort errieten, gab sie eine Vorschau auf die Sendung in der nächsten Woche. Die Fragen testete sie vorher an Joshua, Claire und Bruce. So sollten sie ihr die Namen aller sieben Zwerge nennen, die Definition von pulchritudinous oder die einwohnerreichste Stadt Indiens. Die Anrufer jubelten, wenn ihre Antwort stimmte, als hätten sie etwas gewonnen, obwohl es gar nichts zu gewinnen gab. Die ganze Belohnung bestand darin, dass Teresa die Leute fragte, von wo aus sie anriefen, und die Ortsnamen dann freudig überrascht wiederholte. Die Namen kalter ländlicher Gemeinden mit indianischen Namen oder den Namen von Tieren, Flüssen oder Seen wie Keewatin, Atumba, Beaver oder Deer Lake.
»1910?«, fragte eine Stimme im Radio unsicher.
»Nein«, gurrte Teresa. »Aber gut geraten.«
Vern trat, mit zwei Zangen einen Frittierkorb haltend, vor Joshua hin und ließ ihn ins leere Spülbecken fallen. »Das wird heiß sein.«
»1892«, sagte eine Stimme, und Teresa stieß einen Freudenschrei aus.
Vern schaltete das Radio aus, und ein Gefühl der Dankbarkeit durchströmte Joshua. Sie brauchten nicht zu hören, von wo diese Woche die richtige Antwort kam, brauchten nicht zu hören, was Teresa wie jede Woche am Schluss der Sendung sagte: »Und damit, Leute, wären wir wieder am Ende der Stunde angelangt. Arbeitet fleißig. Tut Gutes. Macht das Unmögliche möglich. Und seid nächste Woche wieder dabei, wenn es Neues von den Modernen Pionieren gibt.«
»Dein Kumpel ist draußen«, sagte Marcy zu Joshua, als sie in die Küche zurückkam, und zog ihren Mantel an. »Ich habe vorn abgeschlossen, wer als Letzter geht, muss also hinten raus.«
»Das ist der Bursche da«, sagte Vern, während er sich die Schürze auszog. »Denn ich bin es mit Sicherheit nicht.«
Joshua schlüpfte in der Küche aus seinen nassen Kleidern, als Vern gegangen war, und trug seinen Teller mit Zwiebelringen ins Lokal, wo R. J. gerade Ms. Pac Man spielte.
»Ich weiß jetzt, wie man ihn bearbeiten muss, damit man umsonst spielen kann«, sagte er zu R. J., als dessen Spieler alle tot waren.
»Ich möchte jetzt nicht mehr spielen. Kann ich eine Limo haben?«
Joshua zapfte jedem ein Mountain Dew. Im Café herrschte jetzt Stille. Die Deckenbeleuchtung war aus, und außer ihm und R. J. war niemand mehr da. Alle Tische waren aufgestuhlt. R. J. trug Jeans und ein weites Sporttrikot, das über die Hose hing, sodass sein Oberkörper wie ein Fass aussah. Sein Vater war ein Ojibwe, seine Mutter eine Weiße. Wie alle Ojibwes, die in Midden lebten, bekam er jeden Herbst von der Firma Reebok ein Paar Turnschuhe geschenkt, was zur Folge hatte, dass die Jungs in der Schule ihn manchmal auf die Toilette schleppten, seinen Kopf in die Kloschüssel drückten und spülten. Trotzdem waren er und Joshua seit der fünften Klasse eng befreundet.
»Ich hab da was, falls du mal die Nacht durchmachen willst.« R. J. zog eine Pergamintüte, wie sie für die Aufbewahrung von Briefmarken benutzt wird, aus der Tasche. »Bender hat es mir gegeben.« Bender war der Freund seiner Mutter.
»Was ist das?«
R. J. öffnete die Tüte behutsam und schüttelte den Inhalt in seine kleine weiche Hand. Graue salzkorngroße Kristalle rieselten heraus. »Crystal Meth. Bender hat es gemacht«, antwortete R. J. und errötete. »Sag es nicht weiter. Bender und meine Mom haben es gemacht. Nur so.« Er hatte dunkle wulstige Augen. Er ähnelte seinem Vater, einem Mann, den er nur selten sah.
»Probieren wir es aus«, sagte Joshua, der häufig Gras rauchte, aber nie etwas anderes genommen hatte. R. J.’s Mutter und Bender versorgten ganz Midden mit Marihuana. Sie bauten es in einem Keller unter der Veranda an, von dessen Existenz sonst niemand wusste.
»Jetzt gleich?« R. J. schob das Meth mit einem Finger herum.
»Wie wirkt es?«
»Macht wach und aufgedreht.«
Joshua leckte sich einen Finger an, tupfte ihn in die Kristalle und steckte ihn dann in den Mund.
»Was tust du da?«
»Ich reibe es in mein Zahnfleisch«, antwortete Joshua. »Man muss es ins Zahnfleisch reiben, damit es in die Blutbahn gelangt.« Er wusste das nicht mit Bestimmtheit, sondern erinnerte sich nur dunkel, so was mal gehört oder in einem Film gesehen zu haben.
»Man muss es schnupfen«, erklärte R. J. »Hat Bender mir gesagt.«
Joshua hörte nicht hin, setzte sich in eine Nische und schloss die Augen, als meditiere er.
»Spinnst du jetzt total?«, fragte R. J.
»Wenn hier einer spinnt, dann du«, sagte Joshua und behielt die Augen zu. »Ich lasse es in meine Blutbahn eindringen, du Blödmann.«
»Wie schmeckt es?«
»Wie Medizin.«
»Was für ein Gefühl ist es?«
Joshua antwortete nicht. Er spürte ein leichtes Kribbeln, konnte aber nicht sagen, ob er es wirklich spürte oder nur deshalb, weil er es spüren wollte. Er öffnete die Augen, und das Gefühl verflog. »Lass uns durch die Gegend fahren«, sagte er.
R. J. kratzte die Kristalle sorgfältig in die Tüte zurück und leckte den Rest vom Handteller.
Joshua fuhr. In der Stadt war sonst kein Fahrzeug unterwegs. Zehn Uhr abends war wie mitten in der Nacht. Sie passierten dunkle Ladenfronten – Ina’s Drug, das Lebensmittelgeschäft Red Owl, das Video- und Sonnenstudio, dann die Skating-Bahn, das Dairy Queen, die Schule und die Midden Clinic, ein umgebautes Wohnmobil von doppelter Breite, das auf dem Schulparkplatz stand – und schließlich die beiden einzigen Läden, die noch offen hatten, den Kwik Mart und das Punk’s Hideaway, in dem Vern jetzt wahrscheinlich war, weil er, wie Joshua wusste, jeden Abend dort hinging. Auf dem Weg stadtauswärts kamen sie am Treetops Motel vorbei, wo sie Anita sahen, die im Empfangsraum, der auch ihr Wohnzimmer war, auf einem geblümten Sofa saß und sich die Nachrichten ansah.
Sie fuhren zum Highway 32 hinaus, vorbei an Len’s Lookout, wo Joshuas Mutter arbeitete, dann weitere fünfzehn Meilen nach Osten, damit R. J. sehen konnte, ob Melissa Lloyds Auto in ihrer Einfahrt stand, und anschließend die fünfzehn Meilen wieder zurück in die Stadt. Joshua setzte R. J. daheim ab und nahm dann die sechsundzwanzig Meilen bis zu sich nach Hause in Angriff. Als er allein im Wagen saß, merkte er, dass ihn der Unterkiefer schmerzte, weil er, ohne sich dessen bewusst zu sein, die Zähne aufeinandergebissen hatte. Er versuchte, die Kinnlade locker zu lassen, als baumele sie nur lose am übrigen Gesicht. Er fühlte sich weniger high als vielmehr intensiv der Ecken und Kanten um ihn und in ihm bewusst. Er mochte dieses Gefühl und wusste, dass er es wieder spüren wollte.
Als er in der Zufahrt parkte und aus dem Pick-up stieg, hörte er Tanner und Spy im Haus ihr Begrüßungsgebell anstimmen und gegen die Haustür springen. Er eilte hinein und versuchte, sie zum Schweigen zu bringen, damit sie seine Mutter und Bruce nicht weckten. Ohne Licht zu machen, schlich er in die Küche, öffnete den Kühlschrank und spähte hinein, obwohl er gar keinen Hunger hatte. Er nahm einen Apfel, biss hinein und bereute es sofort, aß aber weiter.
»Josh«, rief seine Mutter.
Er hörte sie aus dem Bett steigen. »Ich bin zu Hause«, antwortete er gereizt, denn er wollte nicht, dass sie aufstand. Er spielte mit dem Gedanken, nach oben zu flüchten. Er liebte sein Zimmer.
»Du kommst spät«, sagte sie, als sie in ihrem Morgenmantel, ihrem langen Fleecenachthemd und ihren Schlappen aus Pelzimitat in der Küche erschien. Die Hunde liefen zu ihr und drückten ihre Schnauzen an ihre Hände, sodass sie sie streicheln musste.
»Wir haben spät geschlossen. Ganz am Schluss kamen noch drei Tische.« Er warf den Apfelbutzen in Richtung Mülleimer und hörte am Geräusch, dass er danebengetroffen hatte, ging aber nicht hin, um ihn aufzuheben. »Aber morgen ist sowieso keine Schule. Die Lehrer haben einen Workshop.«
»Du sollst mich doch anrufen, wenn es später als zehn wird. Das war unsere Abmachung, als du den Job angenommen hast.«
»Es ist erst elf.«
Er füllte sich am Hahn ein Glas Wasser und trank es in einem Zug aus, sich bewusst, dass ihn seine Mutter beobachtete. »Was ist denn?«, fragte er und füllte das Glas unter dem voll aufgedrehten Hahn nach.
»Ich bin eh nicht müde«, sagte sie, als hätte er sich dafür entschuldigt, sie geweckt zu haben. »Möchtest du einen Tee?«, fragte sie und setzte bereits den Kessel auf.
»Hast du auf der Heimfahrt den Mond gesehen?«, fragte sie.
»Ja.«
Sie nahm zwei Becher von den Haken über der Spüle und hängte, ohne Licht zu machen, die Teebeutel hinein.
»Die Kamille wird uns beim Einschlafen helfen.«
Der Kessel begann zu pfeifen. Sie nahm ihn vom Herd, goss Wasser in die Becher und setzte sich an den Tisch.
Er nahm ebenfalls Platz und zog seinen heißen Becher zu sich her.
»Ich mache mir eben Sorgen, wenn du so spät kommst. Jetzt, wo die Straßen vereist sind«, sagte sie und musterte ihn im schwachen Mondlicht, das durch die Fenster drang. »Aber jetzt bist du ja wohlbehalten da, und das ist die Hauptsache.«
Sie pustete über ihren Tee, ohne einen Schluck zu trinken, und er tat dasselbe. Er hatte seine Kopfhörer um den Hals hängen. Wie gern hätte er sie jetzt aufgesetzt und sich eine CD reingezogen. Stattdessen stellte er sich die Musik vor und spielte im Kopf einen Song ab, wobei der bloße Gedanke daran ihn befeuerte.
»Dann hast du heute Abend viel zu tun gehabt?«
»Eigentlich nicht«, antwortete er und erinnerte sich dann seiner Lüge von vorhin. »Bis kurz vor dem Schließen, dann hat sich der Laden gefüllt.«
»Das ist typisch.« Sie lachte leise. »Jedes Mal, wenn ich im Len’s Feierabend machen will, taucht eine ganze Busladung auf.«
Einmal hatte sie versucht, den Job dort aufzugeben, und sich selbstständig gemacht mit dem Ziel, auf Flohmärkten und in Trödelläden ihre Gemälde zu verkaufen. Landschaftsbilder von Nord-Minnesota. Enten und Gänseblümchen, Bäche und Bäume, Wiesen und Goldruten. Die meisten hingen jetzt in ihrem Haus, sehr zu Joshuas Verdruss. Einmal hatte seine Mutter mit R. J. unaufgefordert eine Führung gemacht und ihm erzählt, was sie zu den einzelnen Bildern inspiriert hatte und wie ihre Titel lauteten. Die Titel fand Joshua noch peinlicher als die Bilder selbst. Sie waren exemplarisch für alles, was ihn an seiner Mutter nervte: schwülstig und großtuerisch, mädchenhaft und überdreht – Wilder Stachelbeerstrauch in Sommermoor, Das sanfte Wiegen des Ahornbaumes, Das Geburtsland von Vater Mississippi –, als verweise jedes einzelne direkt auf seine eigene Größe.
Joshua trank probeweise einen Schluck Tee und musste an ein Spiel namens »Was trinkt ihr?« denken, das Claire und er immer mit ihrer Mutter gespielt hatten. Sie hatte Lebensmittelfarbe in Zuckerwasser gerührt, wenn sie nicht mehr genug Geld für Kool-Aid hatte, und sie dann mit einem erwartungsvollen Lächeln gefragt, was sie gerade tranken, und sie hatten geantwortet, wonach ihnen gerade der Sinn stand, was ihnen gerade einfiel. Zum Beispiel sagten sie Martini, obwohl sie überhaupt nicht wussten, was ein Martini war, und ihre Mutter gab dann unter viel Aufhebens eine imaginäre Olive dazu. Oder sie antworteten Schoko-Milchshake oder Sarsaparilla oder nannten die Namen von Getränken, die sie selbst erfunden hatten, und ihre Mutter mixte etwas dazu und machte es besser, als es war, sodass selbst Wasser für sie anders schmeckte. Das war, bevor sie Bruce kennenlernten, kurz nachdem sie nach Midden gezogen waren, in eine Wohnung über Len’s Lookout. Die Wohnung war eigentlich keine richtige Wohnung, und auch die Stadt kam ihnen nicht wie eine richtige Stadt vor, weil sie in diesem ersten Jahr weit draußen wohnten und Fremde waren in diesem Ort, in dem sonst jeder jeden kannte. Die Wohnung bestand aus einem einzigen großen Zimmer mit einer Kochecke, die Len für sie eingebaut hatte, Dusche, Sauna und Toilette befanden sich hinten im Garten. Sie hatten eine Bettcouch zum Ausklappen, auf der sie alle schliefen und die sie meistens ausgeklappt ließen, sodass die Wohnung im Grunde ein riesiges Bett war, eine Insel mitten in ihrem neuen Leben in Minnesota.
Nachmittags, wenn Claire und Joshua aus der Schule zurück waren und ihre Mutter von der Arbeit kam, legten sie sich auf das Bett, redeten und spielten Spiele, die sie sich selbst ausgedacht hatten. Zum Beispiel sagten sie, dass sie nicht mehr aus dem Bett steigen könnten, weil der Fußboden in Wirklichkeit ein haifischverseuchtes Meer sei. Oder ihre Mutter schloss die Augen und fragte mit einer hochnäsigen Stimme, die sie nur bei dieser Gelegenheit benutzte: »Wer bin ich jetzt?« Und Joshua und Claire kreischten: »Miss Bettina von Soundso.« Und dann verwandelten sie sie. Sacht strichen sie ihr über die Augenlider und Lippen, die Wangen und das übrige Gesicht und schilderten dabei die ganze Zeit, wo sie welche Farben auftrugen, und ihre Mutter öffnete von Zeit zu Zeit die Augen und sagte: »Ich glaube, Miss Bettina von Soundso würde mehr Rouge auflegen, meint ihr nicht auch?« Also rieben sie ihr Gesicht noch etwas länger, und dann fragte sie: »Was um alles in der Welt machen wir nur mit Miss Bettina von Soundsos Haar?« Worauf sie ihr mit den Fingern durchs Haar fuhren und so taten, als würden sie es mit Haarspray in Form bringen oder zu einem richtigen Knoten binden. Wenn sie fertig waren, setzte sich ihre Mutter auf und sagte mit ihrer versnobtesten Stimme: »Meine Lieben! Miss Bettina von Soundso ist hocherfreut, eure Bekanntschaft zu machen.« Claire und er hatten sich dann immer vor Lachen gekugelt.
An diese Dinge erinnerte sich Joshua jetzt mit einer an Wut grenzenden Beschämung. Was war er damals nur für ein Kindskopf gewesen. Jetzt wollte er keiner mehr sein.
»Woran denkst du?«, fragte seine Mutter, plötzlich argwöhnisch, als ahne sie, was ihm durch den Kopf ging.
»An nichts.«
»Hast du eine Freundin?«
Er konnte hören, dass sie lächelte, und am liebsten hätte er dieses Lächeln ausgelöscht – warum, wusste er selbst nicht.
»Wieso?«, fragte er giftig.
»Ich frage mich, ob du deshalb so spät gekommen bist.«
»Das hab ich dir doch gesagt. Weil noch ein ganzer Schwung Leute gekommen ist.«
Die Hunde hockten zwischen ihnen, legten ihnen von Zeit zu Zeit eine Pfote auf den Schoß und zogen sie wieder weg, wenn sie gestreichelt wurden.
»Und außerdem: Wenn ich eine Freundin hätte, wäre ich mehr als eine Stunde zu spät gekommen.«
»Vermutlich«, sagte sie, sann einen Augenblick darüber nach und brach in ein langes inniges Lachen aus. Gegen seinen Willen lachte er mit, aber weniger herzlich.
Sie zog ihren Ehering ab und legte ihn auf den Tisch, ging zur Spüle, drückte sich Creme in die Hände und verrieb sie im Stehen. Im Dunkeln konnte er nur ihre Silhouette erkennen. Sie sah aus wie eine freundliche Hexe, und ihre Haare waren auf der Seite, mit der sie auf dem Kopfkissen gelegen hatte, schrecklich zerdrückt.
»Hier«, sagte sie, nahm wieder Platz und streckte ihm die Hände hin. »Ich habe zu viel erwischt.« Sie kratzte sich die überschüssige Creme ab und massierte sie in seine Hände ein, bis hinauf zu den Unterarmen. Das erinnerte ihn daran, wie sie ihm, wenn er als Kind erkältet war, immer die Brust mit Eukalyptusöl eingerieben und dazu gesungen hatte: »Die Krankheit fließt aus dir heraus in meine Hände. Die Krankheit weicht ganz aus Joshuas Körper und wird jetzt und immerdar in den Händen seiner armen alten Mutter wohnen.« Er hatte das Gefühl, dass auch sie in diesem Moment daran dachte. Mit einem Mal fühlte er sich ihr nahe, als wären sie die ganze Nacht zusammen durch die Gegend gefahren und hätten geredet.
ENDE DER LESEPROBE
Nachweise
TEIL 1
Charlotte Brontë, Jane Eyre. Aus dem Englischen übersetzt von Andrea Ott, Nachwort von Elfi Bettinger. Copyright © 2016 by Manesse Verlag, Zürich, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
TEIL 2
Das Zitat aus Mary Lee Settle, Charley Bland, wurde für diese Ausgabe von Reiner Pfleiderer übersetzt.
TEIL 3
Down by the Riverby Edna O’Brien © 1996
Reprinted by kind permission of Edna O’Brien
Das Zitat aus Edna O‘Brien, Down by the River, wurde für diese Ausgabe von Reiner Pfleiderer übersetzt.
TEIL 4
»September 1, 1939« Copyright © 1939 by W. H. Auden, veröffentlicht mit Genehmigung Nr. 71 075 der Paul & Peter Fritz AG in Zürich.
»1. September 1939«, aus: W. H. Auden, Liebesgedichte. Aus dem Englischen von Rüdiger Görner. © der deutschen Übersetzung Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2008.
TEIL 5
Quotation from »Late Fragment« by Raymond Carver: Copyright © Tess Gallagher 1996, used by permission of The Wylie Agency (UK) Limited.
Raymond Carver, »Spätes Fragment«. Aus: ders., Ein neuer Pfad zum Wasserfall. Aus dem Amerikanischen von Helmut Frielinghaus. © S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013.