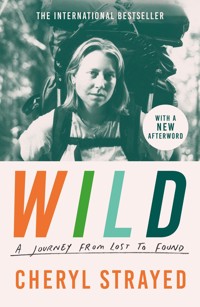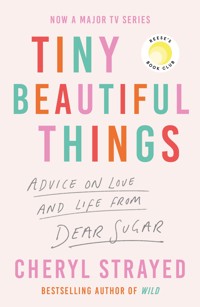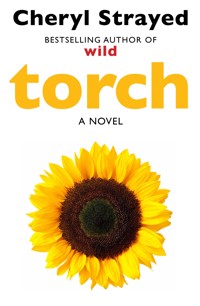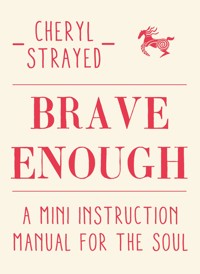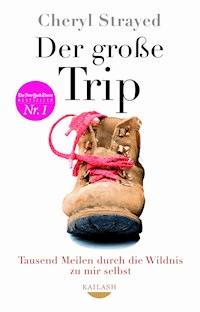
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kailash
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
EAT, PRAY, LOVE meets Hape Kerkeling
Gerade 26 geworden, hat Cheryl Strayed das Gefühl, alles verloren zu haben. Drogen und Männer trösten sie über den Tod ihrer Mutter und das Scheitern ihrer Ehe hinweg. Als ihr ein Outdoor-Führer über den Pacific Crest Trail in die Hände fällt, trifft sie die folgenreichste Entscheidung ihres Lebens: mehr als tausend Meilen zu wandern. Die berührende Geschichte einer Selbstfindung – voller Witz, Weisheit und Intensität, mit einer respektlosen Heldin, die man lieben muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Cheryl Strayed
Der große Trip
Tausend Meilen durch die Wildnis zu mir selbst
Aus dem Amerikanischen von
Reiner Pfleiderer
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Wild« bei Alfred A. Knopf, Random House, Inc., New York.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe
© 2013 der deutschsprachigen Ausgabe
Kailash Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
© 2012 Cheryl Strayed
Lektorat: Claudia Alt
Umschlaggestaltung: WEISS WERKSTATT MÜNCHEN
unter Verwendung eines Motivs von © Scuddy Waggoner – istockphoto
Karte: Mapping Specialists
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-04602-6
www.kailash-verlag.de
Für Brian Lindstrom.
Und für unsere Kinder, Carver und Bobbi.
Vorbemerkung der Autorin
Bei der Niederschrift dieses Buches habe ich mich auf meine Tagebücher und, sofern möglich, auf recherchierte Fakten gestützt. Ich habe mehrere Personen, die im Buch auftauchen, zurate gezogen und im Übrigen auf meine Erinnerungen an die darin geschilderten Ereignisse und diese Zeit meines Lebens zurückgegriffen. Die Namen der meisten, aber nicht aller Personen in diesem Buch habe ich geändert, und in einigen Fällen habe ich zudem Details, die ihrer Identifizierung dienen könnten, modifiziert, um Anonymität zu gewährleisten. Keine Person und kein Ereignis in diesem Buch sind erfunden. Da und dort habe ich Personen und Ereignisse weggelassen, allerdings nur, wenn Wahrheitsgehalt und Substanz der Geschichte davon nicht beeinträchtigt wurden.
Prolog
Die Bäume waren groß, aber ich war größer, denn ich stand auf einem steilen Berghang in Nordkalifornien. Vor wenigen Augenblicken hatte ich meine Wanderstiefel ausgezogen, und einer war in ebendiese Bäume gefallen, war zuerst in die Luft katapultiert worden, als mein großer Rucksack daraufkippte, dann über den Schotterpfad gerutscht und über den Rand geflogen. Mehrere Meter unter mir prallte er an einem Felsvorsprung ab, bevor er auf Nimmerwiedersehen zwischen den Baumkronen des Waldes darunter verschwand. Mir blieb vor Schreck die Luft weg, obwohl ich seit achtunddreißig Tagen in der Wildnis unterwegs war und mittlerweile gelernt hatte, dass alles passieren konnte und tatsächlich auch passierte. Trotzdem war ich geschockt, als es passierte.
Mein Stiefel war weg. Tatsächlich weg.
Ich drückte mir seinen Gefährten an die Brust wie ein Baby, obwohl das natürlich zwecklos war. Was ist ein Stiefel ohne den anderen? Nichts. Er ist nutzlos, eine Waise für immer und ewig, und ich konnte kein Mitleid mit ihm haben. Es war ein richtig großer und schwerer Latschen, ein brauner Raichle-Stiefel mit rotem Schnürband und silbernen Metallschließen. Ich hob ihn hoch, warf ihn mit aller Kraft fort und sah zu, wie er zwischen den sattgrünen Bäumen und aus meinem Leben verschwand.
Ich war allein. Ich war barfuß. Ich war sechsundzwanzig Jahre alt und ebenfalls eine Waise. Eine richtige Rumtreiberin, wie mich ein Fremder ein paar Wochen zuvor genannt hatte, als ich ihm meinen Namen nannte und erklärte, wie verlassen ich auf der Welt war. Mein Vater verschwand aus meinem Leben, als ich sechs war. Meine Mutter starb, als ich zweiundzwanzig war. Nach ihrem Tod verwandelte sich mein Stiefvater von einem Menschen, in dem ich meinen Dad sah, in einen Mann, den ich nur noch zeitweise wiedererkannte. Meine beiden Geschwister gingen in ihrer Trauer eigene Wege, obwohl ich mich bemühte, uns zusammenzuhalten. Bis ich aufgab und ebenfalls meiner Wege ging.
In den Jahren, bevor ich meinen Stiefel über diese Bergkante warf, hatte ich beinahe auch mein Leben weggeworfen. Ich war durch die Lande gezogen – von Minnesota über New York nach Oregon und durch den gesamten Westen –, bis ich schließlich im Sommer 1995 ohne Stiefel dastand, mehr an die Welt gebunden als frei, zu gehen, wohin ich wollte.
Es war eine Welt, in der ich nie gewesen war, von der ich aber die ganze Zeit gewusst hatte, dass sie da war, eine Welt, in die ich traurig und verstört, voller Furcht und Hoffnung getaumelt war. Eine Welt, von der ich hoffte, sie würde mich zu der Frau machen, die ich werden zu können glaubte, und zugleich in das Mädchen zurückverwandeln, das ich einmal gewesen war. Eine Welt, die gut einen halben Meter breit und 4284 Kilometer lang war.
Eine Welt namens Pacific Crest Trail.
Ich hatte erst sieben Monate zuvor zum ersten Mal davon gehört, als ich in Minneapolis lebte, traurig und kurz vor der Scheidung von einem Mann, den ich immer noch liebte. Ich stand an der Kasse eines Outdoor-Ladens an, um einen Klappspaten zu bezahlen, als ich ein Buch mit dem Titel The Pacific Crest Trail, Volume I: California aus dem Regal neben mir nahm und den Text auf dem Rückendeckel las. Der PCT, stand dort, sei ein durchgehender Wildnispfad, der von der mexikanischen Grenze in Kalifornien bis kurz hinter die kanadische Grenze führte und auf den Kämmen von sieben Gebirgszügen verlief: Laguna, San Jacinto, San Bernardino, San Gabriel, Liebre, Tehachapi, Sierra Nevada, Klamath und Cascades. Eine Strecke von rund tausend Meilen– 1600 Kilometer – Luftlinie. Aber der Pfad war mehr als doppelt so lang. Er durchquerte die drei Bundesstaaten Kalifornien, Oregon und Washington in voller Länge und passierte Nationalparks und ausgewiesene Wildnisareale, Stammesgebiete, staatliche und private Ländereien, Wüsten, Gebirge und Regenwälder, Flüsse und Highways. Ich drehte das Buch um und sah mir das Foto auf dem Cover an – ein mit Felsbrocken übersäter See, umringt von Bergspitzen, die gegen einen blauen Himmel abstachen –, dann stellte ich das Buch ins Regal zurück, bezahlte meinen Spaten und ging.
Aber ich kam später wieder und kaufte das Buch. Damals war der Pacific Crest Trail für mich noch keine Welt. Er war eine vage, ausgefallene Idee, fremdartig, verheißungsvoll. Etwas regte sich in mir, wenn ich mit dem Finger seine gezackte Linie auf der Landkarte abfuhr.
Ich beschloss, an dieser Linie entlangzuwandern – jedenfalls so weit, wie ich in hundert Tagen kam. Ich lebte damals getrennt von meinem Mann in einer Einzimmerwohnung in Minneapolis und jobbte als Kellnerin, so tief gesunken und durcheinander wie nie zuvor in meinem Leben. Jeden Tag hatte ich das Gefühl, in einem tiefen Brunnen zu sitzen und nach oben zu blicken. Aber auf dem Grund dieses Brunnens machte ich mich daran, eine Solo-Wildnis-Trekkerin zu werden. Und warum auch nicht? Ich war schon so vieles gewesen. Eine liebende Frau und Ehebrecherin. Eine geliebte Tochter, die ihre Feiertage allein verbrachte. Eine ehrgeizige Streberin und ambitionierte Autorin, die sich von einem Verlegenheitsjob zum nächsten hangelte, gefährlich mit Drogen experimentierte und mit zu vielen Männern schlief. Ich war die Enkelin eines Bergmanns aus Pennsylvania, die Tochter eines Stahlarbeiters, der auf Vertreter umgesattelt hatte. Nach der Trennung meiner Eltern lebte ich mit meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester in Wohnsiedlungen, die allein erziehende Mütter und ihre Kinder bevölkerten. Als Teenager lebte ichim Norden Minnesotas weit draußen auf dem Landin einem Haus ohne Innentoilette, Strom und fließend Wasser. Dennoch wurde ich an der Highschool Cheerleader und Homecoming Queen, ging anschließend aufs College und wurde auf dem Campus eine radikale, linke Feministin.
Aber eine Frau, die tausendsechshundert Kilometer allein durch die Wildnis wandert? Ich hatte nie etwas Vergleichbares getan. Aber einen Versuch war es wert. Ich hatte nichts zu verlieren.
Als ich jetzt barfuß auf diesem Berg in Kalifornien stand, kam es mir so vor, als wäre es Jahre her, dass ich die wohl unsinnige Entscheidung getroffen hatte, mich allein zu einer langen Wanderung auf dem PCT aufzumachen, um mich zu retten. Als wäre es in einem anderen Leben gewesen, dass ich glaubte, alles, was ich davor gewesen war, hätte mich auf diese Wanderung vorbereitet. Aber nichts hatte mich darauf vorbereitet, und nichts hätte mich darauf vorbereiten können. Jeder Tag auf dem Pfad war die einzig mögliche Vorbereitung auf den nächsten. Und manchmal bereitete mich nicht einmal der darauf vor, was am nächsten geschehen würde.
Wie zum Beispiel darauf, dass meine Stiefel unwiederbringlich von einer Bergflanke segelten.
In Wahrheit sah ich den Verlust mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sechs Wochen lang war ich in diesen Stiefeln durch Wüsten und Schnee gewandert, vorbei an Bäumen, Sträuchern, Gräsern und Blumen aller Formen, Farben und Größen, bergauf und bergab, über Wiesen und Waldlichtungen und durch Landstriche, über die ich nichts Näheres sagen konnte, nur, dass ich dort gewesen war, dass ich sie durchquert hatte und gut durchgekommen war. Und in diesen Wochen hatte ich mir in diesen Stiefeln die Füße wund gelaufen, mir Blasen und blaue Zehennägel geholt, von denen sich vier ablösten, was mit großen Schmerzen verbunden war. An dem Tag, als ich die Stiefel verlor, war ich fertig mit ihnen und sie mit mir, obwohl ich zugeben muss, dass sie mir ans Herz gewachsen waren. Sie waren für mich keine leblosen Objekte mehr, sondern ein Teil von mir, wie so ziemlich alles, was ich in diesem Sommer schleppte – Rucksack, Zelt, Schlafsack, Wasserfilter, Kocher und die kleine orangerote Pfeife, die ich anstelle einer Schusswaffe dabeihatte. Alle diese Gegenstände waren mir vertraut. Ich konnte mich auf sie verlassen, sie halfen mir durchzukommen.
Ich spähte hinab auf die Bäume, deren hohe Wipfel sich im heißen Wind wiegten. Sollen sie meine Stiefel ruhig behalten, dachte ich und blickte über das herrliche weite Grün. Dieser Aussicht wegen hatte ich beschlossen, hier zu rasten. Es war ein Spätnachmittag Mitte Juli, und ich war kilometerweit von jeder Zivilisation entfernt, Tage von der einsamen Poststelle, wo das nächste Versorgungspaket auf mich wartete. Es war durchaus möglich, dass mir jemand auf dem Pfad entgegenkommen würde, aber nicht sehr wahrscheinlich. Gewöhnlich wanderte ich tagelang, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Aber es spielte ohnehin keine Rolle, ob jemand vorbeikam. Mit dieser Sache musste ich allein fertigwerden.
Ich blickte auf meine nackten, geschundenen Füße mit dem traurigen Rest meiner Zehennägel. Sie waren gespenstisch blass bis zu den Linien ein paar Zentimeter über den Knöcheln, wo die Wollsocken, die ich normalerweise trug, endeten. Die Waden darüber waren muskulös, goldbraun und behaart, schmutzverkrustet und voller blauer Flecken und Schrammen. Ich war in der Mojave-Wüste losgelaufen und fest entschlossen, nicht aufzugeben, bevor ich an der Grenze zwischen Oregon und Washington die Hand auf die Brücke legte, die sich dort über den Columbia River spannt und den grandiosen Namen »Brücke der Götter« trägt.
Ich blickte nach Norden, in ihre Richtung – der bloße Gedanke an die Brücke war mir ein Ansporn. Ich blickte nach Süden, wo ich herkam, in das wilde Land, das mich vieles gelehrt und mich demütig gemacht hatte, und erwog meine Möglichkeiten. Mir war klar, dass es nur eine gab. Es gab immer nur eine.
Weitergehen.
Teil Eins – Die zehntausend Dinge
Dass nicht den Einsturz solcher Macht verkündet ein stärkres Krachen!
William ShakespeareAntonius und Cleopatra
1 – Die zehntausend Dinge
Meine dreimonatige Solowanderung auf dem Pacific Crest Trail hatte viele Anfänge. Da war zunächst der leichtfertige Entschluss, es zu tun, gefolgt von einem zweiten, ernsthafteren Entschluss, es wirklich zu tun, und dann der lange dritte Anfang, bestehend aus den Wochen, in denen ich einkaufte, packte und mich vorbereitete. Ich kündigte meinen Job als Kellnerin, verkaufte fast meine gesamte Habe, brachte meine Scheidung vollends über die Bühne, nahm Abschied von meinen Freunden und besuchte ein letztes Mal das Grab meiner Mutter. Ich fuhr quer durchs Land von Minneapolis nach Portland in Oregon, und ein paar Tage später flog ich nach Los Angeles. Von dort ließ ich mich in die Stadt Mojave chauffieren und weiter zu der Stelle, wo der PCT einen Highway kreuzte.
Dann schließlich die tatsächliche Ausführung meines Vorhabens, rasch gefolgt von der bitteren Erkenntnis, was das bedeutete, und dem Entschluss aufzugeben, weil es lächerlich und idiotisch war und wahnsinnig schwierig, viel schwieriger, als ich erwartet hatte, und weil ich in keiner Weise darauf vorbereitet war.
Und endlich diewirkliche und wahrhaftige Ausführung.
Bleiben und weitermachen, trotz allem. Trotz der Bären, trotz der Klapperschlangen, trotz der Pumas, die ich selbst nie zu Gesicht bekam, nur ihre Exkremente. Trotz der Blasen und Schürfwunden, Kratzer und Schrammen. Trotz der Erschöpfung und der Entbehrungen. Trotz Hitze und Kälte, Eintönigkeit und Schmerzen, Hunger und Durst, trotz der Gespenster der Vergangenheit, die mich auf den tausendsechshundert Kilometern verfolgten, die ich im Alleingang von der Mojave-Wüste bis zum Bundesstaat Washington zurücklegte.
Und schließlich, als ich es tatsächlich getan hatte, als ich losmarschiert war und Tag für Tag Kilometer um Kilometer zurücklegte, die Erkenntnis, dass das, was ich für den Anfang gehalten hatte, eigentlich gar nicht der Anfang gewesen war. Die Erkenntnis, dass meine Wanderung auf dem Pacific Crest Trail in Wahrheit nicht erst begonnen hatte, als ich mich spontan dazu entschloss. Sie hatte früher begonnen, noch bevor ich überhaupt daran dachte, nämlich genau vier Jahre, sieben Monate und drei Tage früher, als ich in einem kleinen Raum in der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, stand und erfuhr, dass meine Mutter sterben würde.
Ich trug Grün. Grüne Hosen, grüne Bluse, grünes Band im Haar. Alles von meiner Mutter genäht – sie hatte mein Leben lang Sachen für mich geschneidert. Einige waren genau so, wie ich sie mir erträumt hatte, andere weniger. Ich war nicht allzu sehr versessen auf diesen grünen Hosenanzug, trug ihn aber trotzdem, als Buße, als Opfer, als Glücksbringer.
In dem grünen Hosenanzug begleitete ich meine Mutter und meinen Stiefvater Eddie den ganzen Tag in der Mayo Clinic von Etage zu Etage, von einer Untersuchung zur nächsten. Und die ganze Zeit ging mir ein Gebet durch den Kopf, obwohl Gebet nicht ganz das richtige Wort ist. Ich war nicht gottesfürchtig. Ich glaubte nicht einmal an Gott. Mein Gebet lautete nicht: Bitte, lieber Gott, erbarme dich unser.
Ich wollte nicht um Gnade bitten. Das hatte ich nicht nötig. Meine Mutter war fünfundvierzig. Sie sah gut aus, ernährte sich seit vielen Jahren vorwiegend vegetarisch. Sie hatte überall in ihrem Garten Ringelblumen gesät, um Schädlinge zu vertreiben, statt ihnen mit Insektiziden zu Leibe zu rücken. Meine Geschwister und ich mussten rohe Knoblauchzehen essen, wenn eine Erkältung im Anmarsch war. Menschen wie meine Mutter bekamen keinen Krebs. Die Untersuchungen in der Mayo Clinic würden das beweisen und die Diagnose der Ärzte in Duluth widerlegen. Davon war ich überzeugt. Wer waren diese Ärzte in Duluth denn schon? Was war Duluth? Duluth war ein kaltes Provinznest, in dem Ärzte, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, behaupteten, fünfundvierzigjährige Nichtraucherinnen, die sich vegetarisch ernährten, rohen Knoblauch aßen und Naturkosmetik verwendeten, litten an Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium.
Zum Teufel mit ihnen.
Das war mein Gebet: Zum Teufel mit ihnen, zum Teufel mit ihnen.
Und doch war meine Mutter in der Mayo Clinic jedes Mal völlig erschöpft, wenn sie länger als drei Minuten stehen musste.
»Willst du einen Rollstuhl?«, fragte Eddie sie, als wir auf einem mit Teppichboden ausgelegten Flur an mehreren vorbeikamen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!