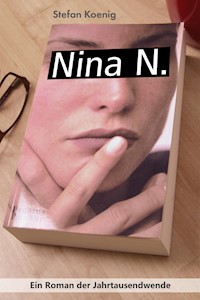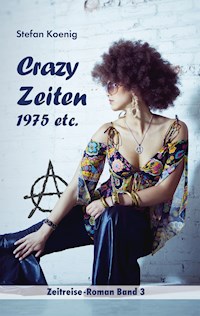Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Band 2
- Sprache: Deutsch
Was war das für eine Zeit, damals, Anfang der 1970er Jahre, als der graue Schleier aufbrach? Uns Jungen gingen die alten Autoritäten gewaltig auf den Sack. Hatten sie aus dem Kriegsdesaster gelernt? Wir wollten leben, einfach nur leben: Liebe, Freiheit, Musik hören, auf Festivals feiern, Reisen, andere Kulturen kennen lernen. Noch immer wurde Schreckliches aus Vietnam berichtet. Noch immer regnete es Bomben unserer US-Freunde über dieses geschundene Land. Waren das überhaupt Freunde? Alles im Namen der Demokratie? Wir hatten das Gefühl, von allen belogen zu werden. Eine heuchlerische, verkorkste Gesellschaft. Eine lieblose, noch immer viel zu prüde Gesellschaft – mit endlosem Konsumzwang. Dem wollten wir uns entziehen. Für uns wurde der Aufbruch eine Frage des inneren Überlebens. Wir wurden rebellisch und hofften auf die Befreiung durch die Macht der Liebe. Wer liebte, konnte nicht Krieg spielen – dachten wir. Und so hieß unser Motto "Make Love – Not War!" Die Organisation in politischen Gruppen, Vereinigungen und Parteien folgte auf dem Fuß – bald schon würde die Revolution alles Alte und Verkommene beseitigen. Unsere Hoffnung hielt uns aufrecht. Sich anpassen und beugen war nicht unsere Sache. Noch nicht. Unsere Visionen erreichten Blüten. Unsere Illusionen kämpften mit der Realität. Wir hofften und bangten. Vieles geriet durcheinander: Wertvorstellungen, Arbeitsmoral, Kulturelle Ansprüche. Es änderten sich Sprache, Musik und die gesellschaftliche Atmosphäre als es hieß, man wolle mehr Demokratie wagen. Konnte die Verheißung erfüllt werden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Wilde Zeiten - 1970 etc.
Zeitreise-Roman Band 2
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Wilde Zeiten - 1970 etc.
1970 - Aufbruch & Liebe & Musik & Terror
Zeit für Wohngemeinschaften
Die »konkret« &Ulrike Meinhof
Der Homo méditerranée & Krupp & Krause
Torremolinos & Verschwörung à la Dregger
Rio Reiser & Ton Steine Scherben
Herzberg Festival & Volontariat & unser Torre-Trip
Miss Wahlen & Big Eden & Marokko
Lauscher vom Teufelsberg & Schlepper
Feldpost & Glaube & Gewissen
Woodstock auf Fehmarn & Jimi Hendrix
Joschka & Häuserkampf & die »Bravo«
Weihnachten & Silvester 1970
1971 - Love & Peace & Fotzenneid
Rache für Che Guevara
Orwell & das Tagebuch & der Abschied
Gib auf, Ulrike!
Neue Perspektiven & zurück nach Ffm.
1972 - Umbrüche & Einbrüche & Siege & Macht
Gott & die Welt & der neue Schatz
Beuys & Kunst & Heroin & Willy
Schlafende Feldjäger & Captain Kirk
Entführungen & Verführungen
Weltjugend & ein Interview
Auf dem Weg zu neuen Ufern
Komparserie & das ewig Weibliche zieht uns hinan
1974 - Frust & Freude & die Bulli-Route
Lizenzen & Krautrock & My Bonnie
Rio Reiser & die Linken
Runder Fußball & rund herum durch Marokko
Svea auf Abwegen & Fasten Seat Belt
Dank und Nachbetrachtung
Roman-Thematik nach Jahren
Folgeromane zu „Wilde Zeiten – 1970 etc.“
Bisher erschienen von Stefan Koenig
Impressum neobooks
Wilde Zeiten - 1970 etc.
Stefan Koenig
Wilde Zeiten
1970 etc.
Zeitreise-Roman
Band 2
Aus dem Deutschen
ins Deutsche übersetzt
von Jürgen Bodelle
Jugend ist Wahrheit
***
„Bitte benehmen Sie sich,
wie es wohlerzogenen
jungen Damen und Herren ansteht:
keine Selbstmorde,
keine Sprengkörper,
keine Fehlgeburten.“
(Hinweis auf dem Schwarzen Brett
des Hotels Isabel in Torremolinos)
© 2019 by Stefan Koenig
Lektorat:
Herbert Bauch, Frankfurt am Main
Peter Döring, Ebbertshausen
Alexandra Pfeifer, Laubach
Christa Thiemann, Laubach
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mail-Kontakt
zu Verlag und Autor:
Postadresse:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Ja, alles ist im Fluss. Und einiges geht den Bach runter: Hoffnungen, Wünsche, Illusionen, Visionen – gewissermaßen die soziale Software. Was bisher trotz aller 68er-Rebellion blieb, ist die Hardware. Das harte Kerngeschäft des ein-prozentigen Establishments: Die Welt der Waren und des Geldes. Wir Jungen von damals, wir Politfreaks und Blumenkinder, wir versuchten die wahre Welt zu erkunden und der jugendlichen Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen. In stolzem und berechtigtem Eigeninteresse traten wir ein für Frieden, Gleichberechtigung von Frau und Mann, soziale Gerechtigkeit, Brüderlichkeit, Freiheit – für all die guten alten Ideale der französischen Revolution, auch wenn wir von dieser Historie noch nicht wirklich etwas verstanden.
Im ersten Band der Zeitreise-Serie, »Sexy Zeiten – 1968 etc.«, habe ich unser jugendliches Aufbegehren in seinen Anfängen geschildert, zum Teil eine individuelle, teils eine Familien- und im Ganzen eine gesellschaftliche Geschichte. Geschichte in Form eines Romans. Ich hoffe, Sie hatten Freude an diesem Einsteiger. Nun reisen wir von den Sechzigern weiter in die erste Hälfte der Siebziger Jahre. Auch hier erleben wir den Protest in all seinen Variationen. Und wir verspüren bereits erste gesellschaftliche Veränderungen – einige von uns gingen auf den großen Hippie-Trail, andere versanken im Studium von Marx und Engels, engagierten sich in Kirchen, Kinderläden, Verbänden und Parteien. Einige standen, however, abseits. Die Politik trieb Wandel durch Handel und wurde etwas weniger aggressiv. In diesem Moment wurde die alte Bundesrepublik bunter. Das allgegenwärtige Grau blätterte ab und eine andere Fassade kam zum Vorschein. Was bewegte uns damals?
1970 - Aufbruch & Liebe & Musik & Terror
Karin feuerte mich an. „Ich liebe dich.“ Ich war kurz vorm Kommen. Raketen zischten am Europacenter hoch. Eine knallte ein paar Fenster weiter gegen die von uns frisch eroberte Chefetage. Ein sexy Sternenregen ergoss sich, während auch ich fast am Explodieren war und Karin die Situation stöhnend untermalte. Ein tolles Schauspiel.
Sie liebt mich. Sind solcher Art Liebesgeständnisse eigentlich immer der speziellen Situation geschuldet? Ist es Schauspielerei? Ich weigerte mich, den Gedanken zu vertiefen. Einen Moment hielt ich inne und sagte: „Ich dich auch. Für immer und ewig.“
Draußen böllerte es ununterbrochen. Vor etwa zehn Minuten war das neue Jahrzehnt angebrochen. Wir hatten die Siebziger Jahre mit unserer ungeplanten wilden Liebesnacht rasant eingeläutet. Mitten in Westberlin. Hoch über den Dächern der Stadt. Drei Etagen unter uns würden unsere gleichaltrigen Partygäste der Center-Disco bis in den frühen Morgen tanzen – wir hörten sie nicht, aber wir wussten es. Alle Pärchen würden jetzt noch weitere Male anstoßen, sich umarmen, gegenseitige Versprechungen ins Ohr flüstern und Mumm trinken.
Mumm war in. Was würde ihnen und uns das neue Jahrzehnt bringen? Hätten wir Jungen den Mumm, weiterhin für eine neue Gesellschaft Rabatz zu machen und unsere Freizeit für die große Freiheits-Revolution und gegen das Geld-Establishment zu opfern? Was würde aus der Hippie-Kultur werden? Was aus der Friedenssehnsucht der Blumenkinder in California, einer hoffnungsvollen Sehnsucht, die auch in unserem noch immer viel zu grauen Land um sich griff?
Es war eine Stunde vor Mitternacht, als wir von der Uni-Silvester-Fete abgehauen waren. Sie fand unter dem Motto „Sieg dem Vietcong!“ statt. Das war ehrenhaft und politisch korrekt. Aber es war uns zu voll, zu viel Gedränge. Und zu qualmig, denn Rauchen war eine übliche Form der wortlosen Kommunikation – so „in“ wie die Räucherstäbchen und der bekannte süßliche Duft aus den gedrehten Joints. Uns war es an diesem Silvesterabend zu viel des Guten. Wir husteten beim Abtanzen um die Wette – und wir sehnten uns nach Zweisamkeit. So hatten wir zufällig auf dem Nachhauseweg statt in die Wohngemeinschaft in die geheime 21. Etage des Europacenters – in die verlassene Chefetage – gefunden.
Jetzt schossen sprühende Leuchtraketen aus Ost und West in Berlins kalte Winternacht. Das bunte Feuerwerk erreichte uns scheinbar mühelos in Westberlins höchstem Stockwerk. Gerade ging ein Lichterregen über der benachbarten Gedächtniskirche nieder. Was für ein Anblick!
Ich musste meine Aufmerksamkeit wieder auf Karin lenken, unbedingt. Das gebot nicht nur die ritterliche Höflichkeit, die man uns allerdings in Sachen Sex in der Tanzstunde nicht beigebracht hatte. Auch da war das Thema galant umgangen worden. Den ersten entsprechenden Hinweis hatte mein Schulfreund Pit ein Jahr zuvor von seiner Gaby erhalten, wie er damals entrüstet berichtet hatte.
„Mach ein bissi langsamer. Noch nicht! Noch nicht kommen! Konzentrier‘ dich mal ein bissi mehr auf mich!“, hatte Gaby ausgerufen. Und er sagte, das hätte leider etwas abtörnend gewirkt. Musste man beim Sex nicht auch Egoist sein, wenn alles klappen sollte?
Nun galt es. Ich war hochkonzentriert und versuchte den Feuerwerksreigen zu ignorieren. Gleich musste die Erlösung kommen, und auch ich sollte endlich meine Rakete abschießen. Wir kamen gleichzeitig – ich und eine anonyme Silvesterrakete, die ihren silbernen Sprühregen im Moment meiner Erlösung genau in Richtung des großen Panoramafensters, vor dem Karin und ich uns liebten, ergoss. Karin stöhnte, ich stöhnte.
Puh, welch einen Kraftakt uns die Natur abnötigte, um – wenn es darauf ankam – Nachwuchs zu zeugen. Aber das sollte noch Zeit haben, hofften wir, viel Zeit. Karin nahm die Pille. Ich vertraute Karin; aber konnte man der Pille vertrauen? Hin und wieder sollte es zu TroPi-Kindern gekommen sein, Kindern, die sich trotz Pille auf den Weg durch diese enge Öffnung in die weite Welt machten.
Ich schnaufte und küsste Karin erschöpft. Leidenschaftlich erwiderte sie den Kuss.
„Bist du auch ge …?“
„Ja klar“, sagte Karin. „Ich bin etwas vor dir gekommen.“
Konnte ich das überprüfen? Ach, die Sache mit dem weiblichen Orgasmus musste noch näher erforscht werden. Irgendwann. Von irgendwelchen Forschern.
So lagen wir halbnackt, vor Erregung glühend, auf dem dicken Florteppich jener einsam und verlassen daliegenden Chefetage, die wohl erstmals solch einen menschelnden Jahreswechsel erlebt hatte. Auf diesem einladenden Teppich hatten es die hohen Herren des Establishments gewiss noch nie getrieben – höchstens in Gedanken. Aber konnten wir es wirklich wissen? Wie viele Male hatte vielleicht einer der hier residierenden Manager seine Sekretärin verführt und machtbesessen geknallt? Macht und Sex. Männliche Skrupellosigkeit und weibliche Sehnsucht. Gegenseitige Ausnutzung oder Missbrauch von Lohnabhängigen? Ich wollte nicht daran denken, nicht jetzt.
„Es ist gut, dass auch Chefetagen keine Tagebücher schreiben“, sagte ich. Karin hatte mir gestern erzählt, dass sie kein Tagebuch mehr schreibe. Das sei kindisch. Ihre politische Arbeit erfordere ihre ganze Kraft und man dürfe sich nicht in belangloser Privatheit verzetteln. Ich war mir sicher, dass diese Chefetage unser Geheimnis bewahren würde – bis in alle Ewigkeit, unvergessen.
„Tagebücher schreiben nur völlig unterbeschäftigte Kindsköpfe“, sagte Karin. Da wusste ich noch nicht, dass sie mich gerade anlog.
Wir schmiegten uns aneinander und schauten hinaus in die hell erleuchtete geteilte Stadt, deren Himmel in diesen Minuten im Feuerwerksreigen vereint war. Wir drückten uns noch enger aneinander, glücklich, überglücklich. Ohne Sekt, ohne formelles Prost Neujahr, ohne unsere WG-Freunde; das war schon merkwürdig. Hätten wir wenigstens einen kleinen Transistorradio, wie er gerade trendy war. Ein paar Melodien. Abseits der Gedanken zum Jahreswechsel und all den guten Vorsätzen, die jetzt langsam mein Hirn zu fluten begannen. Nur ein paar Songs. Vielleicht unsere Liebeshymne „Je t’aime … moi non plus“. Oder „Love is love“ von Barry Ryan. Oder „Hey Jude“ von den Beatles aus 1968.
Und jedes Mal, wenn's weh tut/Hey Jude, dann halt ein/Trag' nicht die Welt auf deinen Schultern/Du weißt ganz genau, es ist ein Narrenspiel/Sich seine Welt unnötig kälter zu machen/Na na na, na na, na na na/Hey Jude, enttäusch' mich nicht/Du hast sie gefunden, nun geh' und hol sie dir/Denk' dran, lass sie hinein in dein Herz/Dann kann's los geh'n - mach's jetzt besser.
So genossen wir auch ohne Mucke unsere Zweisamkeit und unser kleines Abenteuer auf diesem hohen Turm der Konsumgesellschaft. Nur das Böllern von draußen war unsere Begleitmusik.
Wir streichelten uns und knutschten. Im Vergleich zur winterlichen Außentemperatur war es hier warm, doch im Vergleich mit unserer nachlassenden Energie –zusehends geschmälert von unserem nicht weniger energiezehrenden Nachspiel – wurde es langsam kühler und wir begannen zu frösteln.
„Cheri“, flüsterte ich Karin ins Ohr, „bevor wir frieren, sollten wir gehen.“
„Ja, ich freue mich jetzt auf ein Schlückchen Sekt zuhause.“
Ob sich Tommi und Rosi, Rolf und Quiny, und mein treuer Freund Richy noch immer auf der TU-Party rumtrieben?
„Wenn wir es schaffen, bleiben wir noch wach, bis die ganze Mannschaft kommt, um mit ihnen anzustoßen, ansonsten ...“
„Fortsetzung, Coco?“ Karin sah mich schelmisch-keck an.
Ich musste lachen. „Wenn ich bis dahin zaubern kann, gerne.“
Ich nannte sie seit unserer gemeinsamen „Je t‘aime“-Liebeshymne einfach nur „Cheri“. Und Karin sagte nur noch gelegentlich Kara zu mir, lieber nannte sie mich seit Kurzem „Coco“.
„Kara haben dich die Girls von deiner Bier- und Badeclique genannt. Hieß dein Lieblingsbier damals nicht Karamalz?“
Ich nickte.
„Coco, die Zeit ist passé. Kara ist Vergangenheit.“
„Die meisten nennen mich aber immer noch so. Ist ja auch okay, denn Coco können sie ja wohl kaum sagen, ohne dass du ihnen auf die Finger klopfst!“
Der 90er Bus kam und wir stiegen am Kudamm, Busstation Gedächtniskirche, gegenüber vom neonbeleuchteten KaDeWe, ein. Der Bus war leer. „Prost Neujahr!“, sagte ein ziemlich junger Busfahrer, was wir erstaunt erwiderten. Für so viel Freundlichkeit waren Westberlins Busfahrer eigentlich nicht bekannt. Der Mann trug eine bunt gecheckte Weste und an seinem rechten Handgelenk baumelten die kurzen Strippen eines farbigen Handreifes, wie man ihn in Jamaika trug.
Völlig untypisch, dieser Busfahrer. Das musste jene berühmte Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Oben im Doppeldeckerbus saßen wir ganz vorn und schauten uns die kurfürstliche Prachtstraße mit ihren glitzernden Schaufenstern an.
Karin stupste mich an. „Weißt du, was mir gerade einfällt? Ab heute steht dir beim Solidaritätsverband im Krankheitsfall Lohnfortzahlung zu. Wenn du mal krank wirst, kriegst du trotzdem Kohle. Wusstest du das?“
„Ja, hab‘ ich auch vor ein paar Tagen gelesen.“ Da gab es im Tagesspiegel eine Neujahrsrubrik: Was sich 1970 ändert. „Du weißt aber schon, dass ich kein Angestellter bin. Ich sammle die Altkleider als Kleinunternehmer für einen gemeinnützigen Verein und bin weder sozialversichert, noch habe ich auf irgendwas einen Anspruch. Hier geht es ganz allein um Unterstützung des vietnamesischen Befreiungskampfes“, antwortete ich mit hochpolitischem Unterton. „Aber gut, dass sich was ändert!“
Es stimmte, allmählich tat sich was in Grauland. In diesem Fall konnte man es als arbeitnehmerfreundliches Zugeständnis bezeichnen. Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für Arbeiter war eine neue, von den Gewerkschaften erkämpfte soziale Errungenschaft. Nun standen zumindest sie und die Angestellten nicht mehr im Regen, sondern erhielten sechs Wochen lang ihren Lohn weiter ausbezahlt.
„Willst du unter so ungesicherten Umständen weiter für den Solidaritätsverband arbeiten?“
„Cheri, ich baue den Verband hier in Westberlin gerade erst auf, bin noch ganz am Anfang. Ich kann doch nicht gleich etwas fordern, wenn noch nicht einmal der erste Eisenbahnwaggon mit Klamotten beladen ist!“
*
Während wir unsere Busgespräche führten, zofften sich Rolf und Quiny auf der Uni-Fete. Das reihte sich wohl ein in jenes derzeit recht bekannte Neujahrs-Szenario – auch oder gerade für uns Freigeister: Jahreswechsel hieß allzu oft auch Partnerwechsel. Quiny hatte eine Stunde vor Mitternacht im studentischen wie im nichtstudentischen Gewimmel Rolf aus den Augen verloren. Zum Abhotten zog es sie auf die Tanzfläche. Da traf sie auf Wolle, einen lange begehrten Jugendfreund, der sie antanzte und gestand, dass er froh sei, nun endlich für sie frei zu sein. Den Neujahrstrunk gönnten sich die Zwei einsam aber gemeinsam. Als Rolf die beiden auf der Suche nach Quiny in einer dunklen Ecke entdeckte, knutschend und fummelnd, war das Ding gelaufen.
„Was soll das denn? Sieht so die freie Liebe aus?“
Quiny sah ihn kühl an und sagte: „Genauso ist es. Ich liebe Wolle.“
Wolle lächelte mild und meinte, sie hätten gerade etwas beschlossen. „Wir ziehen zusammen und bleiben bis März in Berlin.“ Danach wollten sie mit seinem Bulli nach Torremolinos und für ein Jahr als Hippies leben.
„Ich wünsche dir Frieden und eine reine Seele!“, sagte er zu Rolf, der sich samt reiner Seele umdrehte und wortlos im Dunst aus Räucherstäbchen und Zigarettenqualm verschwand.
Karin und ich erfuhren hiervon erst am nächsten Mittag, dem Neujahrstag. Aber im Moment saßen wir noch ahnungslos im Bus und sprachen über unsere eigene Jahresplanung. Karin wollte statt Urlaub zu machen lieber die proletarische Weltrevolution im Sinne Mao Tse-tungs in Westberlin vorantreiben. Vielleicht mit Claudia Roth oder Rio Reiser.
Ich wollte im Sommer eher einen VW-Bus anschaffen und vier volle Wochen lang durch Südfrankreich und Nordspanien düsen. Natürlich hatte mich zudem der Ehrgeiz in finanzieller und politischer Hinsicht gepackt. Mit Altkleidersammlungen konnte unser Verein in wenigen Monaten immerhin einige hunderttausend Mark zusammenkriegen und sie in Form von Medizintechnik an die vietnamesische Botschaft in Ostberlin übergeben. Wir ließen unsere Planungen erstmal offen.
Draußen verstummte die Knallerei; es wurde zusehends ruhiger. Plötzlich hörten wir die Stimme des Busfahrers über den Lautsprecher. „Ich wünsche uns allen ein glückliches und friedvolles Neues Jahr und jetzt schalte ich mal meinen Privatsender ein, verehrte Fahrgäste!“ Es knackste und dann hörten wir einen Radio-Moderator mit der Teilansage: „… und hier eine Aufnahme vom Simon & Garfunkel-Konzert im Central Park“. Und wir hörten »The Sound of Silence«.
Dann rief der Fahrer unsere Haltestelle aus: „Olivaer Platz!“
Beim Aussteigen winkten wir ihm zu und er winkte zurück. Ob das ein verkappter Hippie war?
Der nächste Morgen begann spät mittags. Rolf hatte kein Auge zugemacht und schäumte vor Unverständnis und Wut und sah zum Heulen aus. Er fluchte über seine noch vor wenigen Stunden hochgeliebte Quiny und entdeckte plötzlich all jene Eigenschaften an ihr, die ihn eigentlich schon immer gestört hatten – alles unwichtige Kleinigkeiten, die ihm plötzlich einfielen, um sich den Abschied von ihr leichtzureden. Nach einer weinerlichen Dauerschleife von rund sechzig Minuten, versuchte ich Rolf mit einer Grundsatzdiskussion auf eine andere Spur zu bringen.
Wir fragten uns, ob wir eine Wohngemeinschaft oder schon eine Kommune waren. „Kommune“ war „in“. Kommunarden geisterten durch Presse, Funk und Fernsehen. Tommi, der manchmal einen auf christlich machte, stand der Sache skeptisch gegenüber. Ich erklärte ihm, dass genau das die Form des Zusammenlebens der Ur-Christen gewesen sei.
„Ach so. Alles teilen, egal wer was verdient.“
„So in etwa“, antwortete Karin.
Wir lebten jetzt alle zusammen, Tommi und Rosi, Rolf, Richy, Karin und ich – Quiny fiel wohl ab sofort weg und musste nur noch ihre Sachen abholen. Beppo, unser LKW-Fahrer, noch aus Frankfurter Zeiten, war im Herbst ausgezogen, weil frisch verliebt, und hatte Richy Platz gemacht. Richy, schlank und schlau, war weit entfernt von jedweder Liebelei; wir vermuteten, er würde in seinem jungen Leben ausschließlich einer Liebesheirat Raum geben. Das aber dann mit sofortiger Wirkung.
Tommi stand gut im Futter, war aber nicht dick; noch trug er seine Haare relativ kurz und sah aus wie eben ein typischer Postgewerkschaftler aussah. Seine Freundin, die achtzehnjährige Rosi, ein hellhäutiges, schlankes Blondinchen, trug ihre Haare schulterlang.
Rolfs wochenlange Bemühungen, sich eine Mähne stehen zu lassen, scheiterten merkwürdiger Weise bei jedem neuen Frisörbesuch, was eine lange, ebenso merkwürdige Entschuldigung des Gescheiterten, hinter sich herzog.
Darüber machte sich mit intellektuellem Humor mein alter Schulkamerad Richy regelmäßig lustig, der als Einziger von uns wallend lange Christushaare trug; dazu hatte er die passenden Jesus-Gesichtszüge, was ihm eine dauerhaft lächelnde Milde und eine gewisse Würde verlieh. Er konnte so schön leise und immer überzeugend reden. Auch wenn er sich über etwas belustigte, klang es nie gemein oder gar gehässig. Im Gegenteil, es klang wie ein zarter göttlich-köstlicher Hinweis.
Meinen 181 Zentimetern standen Karins zierliche 164 Zentimeter gegenüber. Meine gelegentlich mit Wasserstoffperoxyd aufgeplusterten dunklen Haare wurden von einem Schnauzer und manchmal von einem Vollbartversuch ergänzt und umrandeten meine allzu scharf geratene Nase, unter der – dem Herrgott sei’s gedankt – kein typisch männliches schmallippiges Plappermaul zugange war. Mit meinen Lippen war ich sehr zufrieden und Karin auch. Karin trug ihre volle, brünette Haarpracht halblang und hatte verführerische Kurven, die sie ohne Gewissensbisse einsetzte, um irgendwelche abstrusen Sympathisanten für ihren Großen Vorsitzenden Mao Tse-tung zu gewinnen.
Zeit für Wohngemeinschaften
Eine Woche vor Jahreswechsel war Jean-Francois, genannt Frankholz, zu Besuch gekommen. Ich ahnte bereits, dass er bleiben würde. Und so war es auch. Er war ein typischer Franzose, trug Cordhose und stets Hemd, manchmal ein Jackett, und er war wirklich nett und konnte gut kochen. Seine Brille und seine etwas gelockten wirren Haare machten aus ihm einen ausgeflippten Akademiker, der stets auf Durchreise und auf der Suche nach der Weltformel schien. Nun also waren wir eine Siebener-WG, und wenn wir alles teilen würden, wären wir eine Siebener-Kommune. Darüber mussten aber erst noch einige klärende Diskussionen geführt werden. Wir hatten Zeit und wir ließen uns zur Klärung Zeit.
Jeder hatte eine Arbeit und wir beschlossen, vorerst zu gleichen Teilen in eine Gemeinschaftskasse einzuzahlen. Der Betrag für die Miete war nach Zimmergröße gestaffelt. Die Gemeinschaftsräume wurden zu gleichen Teilen aufgeteilt. Blieben noch Strom, Telefon und Lebensmittel.
Die Zimmeraufteilung ging problemlos. Wir hatten ja bereits spontan bei Einzug entschieden, und jeder war zufrieden gewesen. Wenn nun jemand neu in die WG aufgenommen wurde, stand natürlich nicht jeder Raum zur Disposition sondern nur der frei gewordene. Tommis Freundin Rosi stellte dieses „Naturprinzip“, wie Rolf es einmal getauft hatte, in Frage. Tommi und ich hatten ihr Paroli geboten, aber jetzt – bei sieben Personen – sahen wir ein, dass wir neu aufteilen mussten, und es kam uns beiden gar nicht so ungelegen. Tommi und Rosi zogen gemeinsam in eines der großen Zimmer, Karin und ich in das andere.
So kamen wir alle problemlos in der Fünf-Zimmer-Wohnung unter. Als Gemeinschaftsraum mit Fernseher und sauteurer Blaupunkt-Stereoanlage diente uns der riesig große Flur, der mit unserer Gemeinschaftsküche eine räumliche Einheit bildete und gar nicht wie ein Flur wirkte.
Während wir heiß über Rolfs gescheiterte Beziehung, über Besitzansprüche, Egoismus, Neid und Eifersuchtsprobleme diskutierten, bereitete der oberbayrischen Stadt Laufen, der Quiny entstammte, eine Anti-Kriegsparole Kopfzerbrechen. Ein Unbekannter – oder war es gar ein heimliches und heimisches Revoluzzerweib? – hatte mittels gut haftender Farbe einen Kampfspruch aufs alte Stadttor gesprüht. Nachdem der Bürgermeister Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt und die Polizei ergebnislos nach dem Täter gefahndet hatte, beschäftigten sich jetzt auch die Stadträte mit dem Spruch auf der geschichtsträchtigen Pforte:
„Vietnam 150.000 Tote – Amis raus!“
In einem Antrag an den Rat hatte der evangelische Ortspfarrer Dr. Hohenberger, 47 Jahre alt, gefordert, die Parole nachträglich zu genehmigen und als improvisiertes Mahnmal „gegen einen der schmutzigsten Kriege der Menschheit“ zu erhalten. Pfarrer Hohenberger: „Ein solches Mahnmal fehlte leider bisher in Laufen. Jetzt haben wir eins. Noch dazu kostenlos!“ Davon jedoch wollten die ehrenwerten konservativen Stadtväter nichts wissen. Der Antrag wurde einstimmig abgeschmettert. Quiny hätte den Stadträten gewiss literweise Bier über die Seppelhosen gekippt … hätte, hätte, Fahrradkette.
*
„Hier werden Sie von Willy Brandt gefahren!“ Mit diesem Slogan an der Windschutzscheibe sollte auf Vorschlage eines stern-Reporters der Namensvetter des Bundeskanzlers, Taxifahrer Willy Brandt aus Bonn, für sein Unternehmen werben. Um die Wettbewerbsgleichheit nicht ins Schleudern zu bringen, verzichtete der Droschkenbesitzer jedoch auf diese Art von Public Relation. Nachher würde vielleicht der Kanzler mit der Parole „Hier regiert Sie ein Taxifahrer“ werben; wir Ex-Frankfurter lachten uns schepp, wie man in unserer Heimatstadt so schön sagte – aber wie konnten wir damals wissen, dass Jahre später tatsächlich ein Taxifahrer als Außenminister regierte?
Dass der im vergangenen Oktober neu gewählte Bundeskanzler Gas gab und die als „Zone“ verpönte DDR anerkennen wollte, machte uns Mut. Entspannungspolitik konnte die Kriegshetzer entwaffnen. Entwaffnend freundliche Ostpolitik konnte dem inneren wie äußeren Frieden nur nützlich sein. Für viele Erzkonservative war das aber zunächst verwunderlich. Doch große Teile der Bevölkerung waren des langen Wartens auf ein Zeichen der überfälligen Grenzöffnungen müde und wollten endlich eine realistische Politik.
Mein guter altsozialdemokratischer Vater Otto schrieb in einem Brief Anfang Januar: „Mein lieber Sohn, es wird Zeit, dass man verhandelt. Das finde ich gut an unserer neuen Regierung. Jedem Vernünftigen muss klar sein, dass man die Existenz eines zweiten deutschen Staates nicht wegwischen und übersehen kann …“
Ich hätte ja gerne gewusst, welcher Partei meine Eltern im September letzten Jahres bei der Bundestagswahl ihre Stimme gegeben hatten. Ob sie Willy Brandts SPD gewählt hatten? Als ich Vater gefragt hatte, berief er sich auf das Wahlgeheimnis: „Das nehme ich ernst!“
Mutter sagte, dass sie nach dem Wahlgang traditionsgemäß ins Wirtshaus gegangen seien. „Weißt du, was ich da gewählt habe? Rippchen mit Sauerkraut!“
Otto schrieb noch etwas zur neuen Ostpolitik, was ich gut fand: „Brandt macht eine Politik des Realismus. Das ist längst überfällig. Auch die Aussöhnung mit den Russen. Wir haben denen viel Leid zugefügt. Und der ostdeutsche Staat ist ein Produkt des Nazi-Krieges. Man muss das anerkennen, man muss den Tatsachen ins Auge sehen.“
Tja, den verdammten Tatsachen ins Auge sehen. Das fällt manchmal schwer. Insbesondere, wenn es um die Liebe geht. Irgendwann später rief Quiny an. Erst war Rolf am Apparat. Ein Gedöns machte der! „Blöde Schlampe! – Wortbrüchiges Luder! – Untreues Weib! – Bleib wo der Pfeffer wächst!“, brüllte er in den Hörer. Ich befürchtete, dass er unseren teuren neuen Telefonapparat auf den Boden pfeffern könnte und machte ihm ein Handzeichen, mich ran zu lassen und sich zu beruhigen.
„Mach mal auf Entspannungspolitik!“, rief ich ihm zu. Er zog eine Fratze, gab mir den Hörer und verzog sich in sein Zimmer, ließ aber die Tür einen Spalt offen.
„Kannst du Rolf bitten, dass er meine Sachen zusammenstellt, damit ich sie morgen abholen kann?“, fragte Quiny. Ihre Stimme zitterte ein wenig. „Weißt du, im Moment kann ich nicht vernünftig mit ihm reden.“
„Ich versuch‘ mein Bestes“, beruhigte ich sie. „Ich bin jedenfalls da. Vielleicht hat Rolf morgen eine Verabredung …“. Das sagte ich besonders laut in Richtung der angelehnten Tür. „Dann braucht ihr euch nämlich nicht zu begegnen und eure emotionalen Tretminen werden nicht scharf gemacht.“
Apropos Minen: Willy Brandt würde der DDR-Regierung Verhandlungen über eine Entschärfung der sogenannten Todesgrenze und über beidseitige Gewaltverzichts-Erklärungen vorschlagen, berichtete entrüstet ein CDU-INTERN-Pamphlet; das war so etwas wie eine stille Post für konservative Scharfmacher. Das wäre doch Verrat. Purer Verrat!
Wie konnte Gewaltverzicht Verrat bedeuten, fragte ich mich. Was ging in diesen schwarzen Hirnen alles schief? Waren da irgendwelche Minen im Oberstübchen explodiert?
Als Quiny kam, um ihre Sachen abzuholen, war Rolf tatsächlich unterwegs. Wolle wartete diskret unten in seinem VW-Bulli. Ich half Quiny beim Runtertragen und setzte mich noch eine Weile zu den beiden in den Bus, nachdem Wolle um die Ecke gefahren war, falls Rolf vorzeitig zurückkommen würde. Aus Wolles Transistorradio lief „Goodbye Ruby Tuesday“ von den Rolling Stones:
Es ist keine Zeit zu verlieren,/ hörte ich sie sagen./Erfülle deine Träume, bevor sie entschwinden./ Die ganze Zeit sterben./Deine Träume verlieren./Und du wirst den Verstand verlieren./Ist das Leben nicht lieblos?/Lebwohl, Ruby Tuesday,/wer könnte dir einen Namen geben,/ wenn du dich veränderst mit jedem neuen Tag?/ Ich vermisse dich immer noch.
Gerade in diesem Moment sahen wir Rolf weit vorn zum Hauseingang unserer WG schleichen. Man sah ihm an, dass er etwas vermisste, was ihn sichtlich bedrückte. Kurz vor ihm schlich in seiner etwas schäbigen Hochwasser-Hose ein anderer Schleicher, der unscheinbare Eigentümer der Clausewitzstraße 2, unser Vermieter, Herr Brat. Erst kurz vor Weihnachten hatte er mir im Zusammenhang mit dem Selbstmord meines früheren Grundschulkameraden Joschi, der wie er Mitglied der Jüdischen Gemeinde von Westberlin war, seine eigene Leidensgeschichte erzählt. Und dass sein millionenschweres Immobilien-Erbe all das nicht wettmachen könne, was sich nachts in seinen Albträumen abspiele.
Er schien sehr großes Vertrauen in mich zu setzen, weil er mir sein hartes, grobes Äußeres im Kern als Ausdruck seiner inneren Zerbrechlichkeit offenbarte. Ohne es bei ihm auszusprechen und ohne es jemals bei meinen Mitbewohnern anzusprechen, interpretierte ich es so: Ich hatte eine Art Nervenzusammenbruch dieses alten Mannes miterlebt. Seine harte Hand, seine dauernde juristische Peitsche gegen seine Mieter waren Ausdruck einer völligen Zerrissenheit und Projektion all seiner Ängste, vielleicht auch seines Eigenhasses.
Sein karges einsames Leben erhielt für ihn offenbar nur Sinn durch ein gnadenloses Regiment gegenüber den von ihm Abhängigen. Denn wann immer ich zu ihm kam, klagte er darüber, gegen wen und warum er schon wieder Klage einreichen müsse. Klagen bestimmten sein Leben. Später erinnerte es mich ein wenig an die Aggressionspolitik der verschiedenen israelischen Regierungen gegenüber den von ihr abhängigen Palästinensern. Es mochte ein schiefer Vergleich sein – aber so dachte ich eben.
Ich tippte Wolle auf die Schulter. „Wollt ihr wirklich nach Spanien abzwitschern und ein Hippieleben führen? Job aufgeben und so?“
„Wir waren eben im Reisebüro am Kudamm, Ecke Olivaer Platz, und haben uns erkundigt. Das wird toll, glaub mir. Aber wir brauchen kein Reisebüro, um unseren Traum zu verwirklichen. Wir brauchten nur den Prospekt. Wir reisen selbst“, sagte Wolle.
„Wie kamt ihr darauf?“
Quiny sah mich verschmitzt an. „Das war meine Idee. Weißt du, Kara, im November hatte ich mit Rolf einen Streit, der sich über eine Woche lang hinzog. Eines Tages ging ich bummeln, um etwas Abstand zu gewinnen. Da stand ich plötzlich vor dem Schaufenster dieses Reisebüros. Ein übergroßes Plakat sprang mir ins Auge. Es zeigte vor einer uralten steinernen Windmühle ein lebensgroßes blondes Hippiemädchen im Bikini mit einem durchsichtigen Wickelröckchen, Blumenkränzchen im Haar, bunte Arm- und Fußbänder und im Hintergrund das blaugrüne Mittelmeer. Da standen nur drei Worte: Komm nach Torremolinos!“
Sie war weiter gegangen und ahnte nicht, dass diese erste Begegnung mit Torremolinos das Besondere jenes düsteren November-Bummels war. Doch wieder bei Rolf und seinem Gezeter wegen irgendwelcher Nichtigkeiten angekommen, flüchtete sie sich in ihre Phantasie und sah sich im Sonnenlicht neben einer Windmühle in Spanien stehen. „Anfangs erweckte dieses Traumbild noch keine starke Sehnsucht in mir, lediglich ein paar Überlegungen: Wie sah es dort wohl genau aus? Wie groß war die Stadt? Wo lag sie genau und gab es da viele Hippies?“
Als Quiny in unserem Gemeinschaftsraum den Weltatlas aus dem Regal nahm, fand sie jedoch kein Torremolinos auf der Spanienkarte.
„Rolf wollte ich nicht fragen, denn ich hatte vor, mal ohne ihn für eine Weile wegzufahren. Das wusste er aber damals noch nicht. Torremolinos wird sehr klein sein, dachte ich! Nachdem mich der Gedanke an Spanien auch noch in der darauffolgenden Woche verfolgte, nahm ich mir vor, mich näher zu erkundigen.“
Am Montag nach dem dritten Advent hatte sie dann das Reisebüro betreten und ging auf die Mittdreißigerin hinter dem Beratungstresen zu. Sie war drahtig, brünett, ziemlich klein und schien keine Berlinerin zu sein, denn beim Sprechen stolperte sie eher über einen spitzen Stein.
„Das Plakat mit Torremolinos … also, das …, also ist das was?“
„Ich kann ihnen Spanien wärmstens empfehlen“, sagte die Brünette. „Ich war selbst schon dort. Torremolinos ist ein Paradies für jugendliche Paradiesvögel.“ Quiny hatte sich auch die vielen anderen Plakate hinter dem Tresen angeschaut, wo es hieß: Neckermann fliegt Sie ins sonnige Italien. Daneben lockte ein türkisfarbenes Plakat mit der Aufschrift: Griechenland – ein sonniger Traum geht in Erfüllung. In den Reisebüros Westberlins, das ein abgeschiedenes Inseldasein führte, war der unkomplizierte Flug in die Sonne die gängigste und beliebteste Ware, auch wenn das Fliegen noch teuer war. Berliner traf man überall, wo auch immer man Urlaub machte.
„Sagt mir rechtzeitig, wann ihr losfahrt. Lasst uns Kontakt halten; vielleicht besuchen Karin und ich euch in Torremolinos.“
„Klaro“, sagte Wolle.
Quiny drückte mich. „Ich halte dich auf dem Laufenden. Nur sag bitte Rolf nichts von unseren Plänen. Man muss ihm ja nicht unnötig Schmerz zufügen.“
*
Zu all den neunmalklugen Neuparteien gesellte sich Ende Januar eine superneue Partei mit dem Kürzel DSP, das war die Deutsche Sex-Partei. Sie konstituierte sich sinniger Weise in der Hamburger Gaststätte Justizhof. Deutschlands meistpropagierter Industriezweig sollte endlich seine parlamentarische Lobby bekommen. Ihr Ziel war es, „die geschäftsmäßigen Interessen derjenigen Leute zu vertreten, die sich für die Lust einsetzen.“ Mit dem für Vereins-, Partei- und ähnlichen Gründungen nötigen Bierernst lieferte der sechsunddreißigjährige Parteiboss Joachim Driessen einen historischen Abriss jener Bewegung, als deren vorläufigen Höhepunkt die DSP sich gern begriff.
„Ich sag nur: Trau keinem über Dreißig!“, rief Karin in die abendliche Essensrunde.
Unter dem Parteisymbol – einem goldenen Tropfen auf schwarz-rotem Grund – lieferte der Polit-Neuling mit dem Erscheinungsbild eines arbeitslosen Pastors ein Parteiprogramm der Öffnung nach rechts und links: Mehr Porno-Importe aus Skandinavien, Abbruch der diplomatischen Beziehungen zum Vatikanstaat und Schaffung einer „befriedigten Gesellschaft“.
Richy war mit Kochen dran, und so gab es heute Abend eines seiner Standardgerichte, wahrscheinlich weil es so einfach und billig war: Bauchfleisch mit Sauerkraut und Salzkartoffeln. Nebenbei musste ich von meinem ersten journalistischen Honorar-Auftrag für die politische Kulturzeitschrift „konkret“ berichten, den ich Mitte Oktober des Vorjahres vom Chefredakteur Klaus Rainer Röhl erhalten hatte. Das hatte wohl auch etwas mit Bauchfleisch zu tun. Ich sollte nämlich von der ersten in Europa stattfindenden Pornomesse berichten.
Damals im Oktober hatte ich nach zahlreichen telefonischen Vorkontakten die Redaktion in der Hamburger Gerhofstraße 40 besucht. Ich war dort schon einmal im Februar bei Ulrike Meinhof, der Chefkolumnistin, vorstellig geworden, erfolglos. Jetzt hoffte ich auf einen Durchbruch. Röhl war für mich, den antiautoritären Revoluzzer, eine unbestreitbare journalistische Autorität. Aber als ich ihn so in seinem Büro sitzen sah, mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem großen Eichen-Schreibtisch, freundlich lächelnd, in der Rechten eine dicke Zigarre à la Che, da atmete ich erleichtert auf. Er ist zwar eine absolute Respektperson, aber er ist auch locker drauf, dachte ich. Hier konnte ich wohl offen sein und angstfrei meine Bewerbung als zukünftiger Journalist loswerden.
„Na, junger Mann, dann schießen Sie mal los. Was haben Sie denn bisher so gemacht außer Schule?“
Er schien nichts von meinem damaligen Besuch bei Ulrike Meinhof mitbekommen zu haben und so wollte ich nichts verkomplizieren und sparte es aus.
Was ich bisher gemacht hatte außer Schule? Ich berichtete ihm natürlich dennoch als erstes von meinen damaligen Schulaktivitäten als Chefredakteur zweier Schülerzeitungen, erst in der Realschule und nach mittlerer Reife und dem Wechsel ins Gymnasium als Mitarbeiter der Oberstufenzeitung.
„Und wie ging es nach dem Abitur weiter?“
Ich weiß nicht, ob Röhl bemerkte, wie mir das Blut aus dem Kopf wich, aber mit dieser Fragestellung, in der das Abitur versteckt war, hatte ich dummerweise überhaupt nicht gerechnet.
Sollte meine journalistische Karriere so jämmerlich am Anfang scheitern? Nur weil ich drei Monate vor dem Abi aus politischen Gründen (Kein Mensch muss zertifiziert werden!) hingeschmissen hatte? Nur weil ich im Solidaritätsverband zur Unterstützung des vietnamesischen Freiheitskampfes praktische Solidarität und nicht nur hohle Abitur-Worte zu meiner politischen Daseinsdevise gemacht hatte? Ich ging auf die Sache mit dem Abi nicht ein, berichtete aber ausgiebig über all die Solidaritätsaktionen für Vietnam und legte ihm meine mitgebrachten Schülerzeitungs-Artikel vor. Das war zwar ein Ausweichmanöver und nicht gelogen, aber auch nicht ganz aufrichtig.
„Wenn Sie finanziell durch Ihre Arbeit beim Solidaritätsverband abgesichert sind, dann können wir es ja mit einem ersten Honorarauftrag versuchen. Ob es später mehr wird, werden wir sehen. Trauen Sie sich zu, über die erste Pornomesse in Kopenhagen zu berichten. Wir zahlen Ihnen die Reisekosten und wenn der Artikel gelungen ist, dann landet eine Pauschale von 350 Mark auf Ihrem Konto.“
Ich schaute in die lachende Runde meiner WG-Mitbewohner. „Was lacht ihr da so hämisch?“, wollte ich wissen. Natürlich wusste ich, weshalb sie lachten. Statt knallharter solider politisch-kultureller Berichterstattung sollte ich von einem Nebenfeld der gesellschaftlichen Umwälzung berichten. Das war wahrlich kein heldenhafter Erstauftrag. Aber war das überhaupt ein Nebenfeld? Das war gegenwärtig doch schon sehr prägend.
„Ich habe das angenommen, weil es immerhin ein Einstieg war“, sagte ich. „Und außerdem gehört das Thema in einen Zusammenhang mit der sexuellen Revolution, die Bestandteil unseres Befreiungskampfes im eigenen Land ist.“
„Schon gut“, sagte Tommi und lächelte ein klein wenig zu mild und viel zu süffisant. „Brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Kam denn was dabei heraus?“
„Ja. Ein halbseitiger Artikel mit Foto einer Pornodarstellerin, die Reisekosten und die Knete.“
Karin meinte mich in Schutz nehmen zu müssen und sagte: „Es ist ja echt unter aller Sau, dass man heutzutage in unserem immer noch sexuell verklemmten Land offiziell keine Pornohefte erwerben darf. Wer Bedarf an solchen Dingen hat, kann sich das nur illegal als Schubladenware besorgen. Das ist doch einer mündigen Gesellschaft unwürdig. Und ist man schließlich irgendwie an ein Heftchen gekommen, dann hält man womöglich ein Pornoheft in der Hand, das mit einem Tiefkühlfleisch-Transporter aus Dänemark eingeschmuggelt wurde.“
„Genau das habe ich in meinem Artikel auch beschrieben. Das war eine beliebte Schmuggelmethode. In Dänemark waren Pornos nämlich schon seit 1967 frei erhältlich, auch für Jugendliche ab sechzehn Jahren. Und die Kopenhagener Messe war halt Ausdruck dieser sexuellen Freizügigkeit.“
Rolf ging in seine Bude und legte den neuesten Hit „Down On The Corner“ von Creedence Clearwater Revivival auf, und wir klopften unterm Abendbrottisch mit den Füßen im Takt:
„Früh am Abend/ Gerade um die Essenszeit/ Drüben beim Gerichtsgebäude/ Fangen sie schon an aufzubauen/ Vier Kinder an der Ecke/ Versuchen, dich aufzuheitern/ Willy sucht 'ne Melodie raus und spielt sie auf der Harfe/ Unten an der Ecke/ Draußen auf der Straße/ Spielen Willy and the poorboys/ Spende fünf Cent und klopf mit den Füßen im Takt.
Ein paar Tage später gab mir Rolf einen ausgeschnittenen Artikel von Springers Berliner Morgenpost zu lesen. Da stand etwas zur Neugründung der Deutschen Sex-Partei: „Nationalen und anderen Rechts-Gläubigen biederten sich die Sexualdemokraten mit dem Rückgriff auf ein gängiges Wahlkampfthema an: »Wir wollen keine Langmähnigen als Mitglieder, unsere Leute sind Typen in guten Anzügen«. Innenpolitisch hielt sich die Gründungsversammlung an bewährte Vorbilder; die Journalistenfrage: »Was sagt Ihre Partei zur Wiedervereinigung?« blieb unbeantwortet.“
Im Gegensatz zu den anderen parlamentarischen Parteien legte der DSP-Parteigründer die Zusammenhänge von Politik und Geschäft recht offen dar. Im Nebenberuf Herausgeber und Redakteur des Lust-Blättchens St.-Pauli-Zeitung, ließ Driessen die Parteiversammlung recht bald zu einer PR-Veranstaltung für sein erotisierendes Periodikum geraten. Den Fotografen der konkurrierenden St-Pauli-Nachrichten warf er hinaus, noch bevor er tiefsinnige Reflexionen über den Sinngehalt seines selbst entworfenen Parteisymbols absonderte: „Der Betrachter mag darin ein Fruchtbarkeitssymbol sehen oder eine Träne als Zeichen der Trauer über unsere lustfeindliche Umwelt. Sache der Sex-Partei wird es sein, eine Freudenträne daraus zu machen!“
In unserem Gemeinschaftsbad hatte sich Rosi mit ihren Make-up-Utensilien ganz gut ausgebreitet. Jetzt fiel mir auf unserem Schmökertisch neben dem Stapel unserer Kloliteratur, den Micky-Maus-Heften, dem stern, der Satirezeitschrift Pardon, der konkret und dem bürgerlich-kritischen Spiegel, eine ausgeschnittene Anzeige ins Auge.
„Jeder kennt dieses Problem: Besonders bei körperlicher und nervlicher Anspannung entstehen in intimen Körperbereichen Sekrete, die das Gefühl der Frische beeinträchtigen.“
Mann oh Mann, war das vornehm ausgedrückt. Andere würden sagen, man schwitzt und stinkt!
Und worin lag nun die Lösung dieses schier kopfzerbrechenden Problems?
Na klar, diese „natürliche, aber lästige Begleiterscheinung beseitigt Camelia-Spray nachhaltig und auf angenehme Weise. Mit Camelia-Spray fühlen Sie sich frisch und unbekümmert – jeden Tag …“
Und wer war wieder mal auf so’ne Werbung reingefallen, statt sich zu waschen? Unsere Rosi. Sie hatte gleich sieben Spraydosen gekauft, für jeden von uns eine, und alles aus unserer Gemeinschaftskasse. Richy war der erste, der es monierte, dann beschwerten sich auch noch Rolf, Frankholz und ich – nur unsere zwei hübschen Vorzeigefrauen hielten zusammen und lobten das Spray in höchstkapitalistischen Werbetönen. Tommi hielt sich diplomatisch zurück, als Rosi das Wort ergriff: „Gerade euch Typen tut das Spray gut, ihr schwitzt viel mehr als wir und ihr riecht dann ziemlich schnell ziemlich streng.“ Rosi sah uns mitleidig an.
Karin, eingepfercht in einen extra für sie angefertigten Mao-Anzug, nickte zustimmend, als hätte auch der Große Vorsitzende uns das Spray in der Vierten Direktive des Fünften Parteitags zum Dreißigsten Jubiläum der glorreichen Volksbefreiungsarmee empfohlen. Na ja, was hatten die Studenten noch vor wenigen Monaten auf Westberlins Straßen außer Ho-Ho-Ho-Chi-Minh gerufen? Genau das: Kapitalismus führt zum Faschismus – Kapitalismus muss weg! Und jetzt dieses Camelia-Spray!
Was dringend einer Lösung bedurfte, war der Zigarettengestank in der WG. Rolf, der werktags im Steuerbüro eines Herrn Elmar Tanner arbeitete, rauchte Gauloises; auch sein Chef, ein offensichtlich wichtiger CDU-Mann, war Gauloises-Raucher – und dass ihm einige Jahre später im Zuge eines Westberliner CDU- und Regierungsskandals der Kopf rauchen und er in monatelanger Untersuchungshaft sitzen würde, ahnten wir damals natürlich nicht. Aber suspekt war mir schon, was Rolf hin und wieder von seinem Chef, vom Steuerbüro und allerlei merkwürdigen Besuchen berichtete.
Tommi und Rosi waren typische Gelegenheitsraucher und rauchten dann das, was ihnen eben in die Finger kam; Frankholz, der Originalfranzose, rauchte Pfeife mit dem gallischen Gauloises-Tabak, „weil das Tabak ist so schön stark, weißt du, weil gute Sorte und schmeckt so schön intensiv, weil durch das Maispapier. Ist nämlich Tabak in Maispapier gedreht, weißt du.“
An jeder Ecke hingen Zigaretten- und Kaugummiautomaten. Und rund um den Kudamm gab es eine Menge Tabakgeschäfte, in denen Jean-Francois seinen Stopftabak kaufte. Wie er mir einmal erklärte, hatte die Maispapiervariante die Eigenschaft, dass die Gauloises ausging, wenn nicht regelmäßig an ihr gezogen wurde. Sie kam damit der lange Zeit in Frankreich üblichen Angewohnheit, die Zigarette einfach im Mundwinkel hängen zu lassen, entgegen. Sie prägte den Typ vom Bilderbuchfranzosen mit der Zigarette im Mundwinkel. Aber in diesem Punkt scherte sich Frankholz nicht ums Stereotyp. Er rauchte Pfeife.
Die Nichtraucherfront bestand aus Karin, Richy und mir. Wir schrieben einen großen Zettel und hängten ihn an die Pinnwand neben die Einkaufsliste: „§ 1 Ich nehme Rücksicht auf die Nichtraucher. § 2 Nach jeder Zigarette und nach jedem Pfeifchen lüfte ich kräftig den Raum, in dem geraucht wurde. § 3 Mehr ist nicht zu tun. § 4 Daaaanke !!!
Roland rief an und fragte, wie es mit den Sammlungen stehe. Meine angeheuerten studentischen Helfer, Andy, Britta und Ingo, hatten gute Arbeit geleistet und bis zur zweiten Januarwoche die Türen und Hauseingänge samt Hinterhöfen in halb Charlottenburg mit unseren Info-Zetteln zugeklebt. Am Donnerstag, dem ersten Einsammeltag, merkten wir, dass die Kleidersammlung in Westberlin wesentlich ergiebiger war als im Rhein-Main-Gebiet, und so konnte ich unserem großen kleinen Vereinsvorsitzenden, er maß zirka 160 Zentimeter, eine enorme Einnahme prognostizieren. Wenn das so weiterging, hatten wir bereits im Januar rund 45.000 DM an Spendengelder zusammen, wenn man die LKW- und Personalkosten abzog.
Wir fuhren jetzt mit zwei Großlastwagen, Richy und Beppo jeweils am Steuer, und als Einsammelhelfer die drei studentischen „Heinzelmännchen“ wie der ASTA als Jobvermittler seine studentischen Hilfskräfte bezeichnete. Sie waren natürlich sozialversichert und wir bezahlten sehr gut: das Doppelte, was sie als Babysitter, Aushilfsgärtner oder in einer Putzkolonne verdient hätten.
Die größere Tour fuhren Richy mit Andy und Britta, aus denen schon bald ein Pärchen wurde. Sie wollten, wie sie mir sagten, mit ihren hier verdienten Penunzen in den Semesterferien über Spanien bis nach Marokko trampen. Dort sei es preiswert und es gäbe tolle Hippietreffs und gutes Kraut. Unterwegs würden sie in Torremolinos Halt machen. Ich musste gleich an Wolle und Quiny denken. Von ihr hatte ich gehört, dass sie sich bereits im Kinderladen, wo sie als Kindergärtnerin arbeitete, ab April für sechs Monate hatte beurlauben lassen. „Kein Aprilscherz, Kara, aber am 1. April geht’s ab Richtung Torremolinos!“ Ich freute mich für Quiny.
Die kleinere Einsammel-Tour fuhren Beppo und Ingo, zwei Pragmatiker, die ihren Verdienst lieber hier vor Ort in Autos und Frauen investierten.
Tommi, unser angehender Postbeamter und Telefonspezialist, liebte Telefonstreiche. Manchmal war ich unfreiwilliger Mithörer. Manchmal Mitmacher, wie heute. Ich schlug eine x-beliebige Seite im Telefonbuch auf und fuhr blind mit dem Finger über die Namen und Nummern bis Tommi „Stopp!“ rief.
Dann wählte er. „Hier ist die Störstelle der Deutschen Bundespost. Ihr Telefon hat eine Störung. Können Sie mich verstehen? Nein? Ich kann Sie nur mit Unterbrechungen verstehen. Würden Sie bitte meinen Anweisungen folgen!“
„Wer ist da?“, fragte eine arglose Frauenstimme.
„Die Post. Die Entstörungsstelle. Ihr Telefon muss dringend gereinigt werden. Bitte holen Sie zuerst ein Staubtuch. Haben Sie das zur Hand?“
„Ja, einen Moment“, sagte die Frau am anderen Ende und man hört sie rumkruscheln. „Ich hab’s.“
Tommi zwinkerte mir zu und sagte: „Dann drehen Sie bitte die Sprechmuschel auf und reinigen Sie den Tonkopf vorsichtig mit dem trockenen Tuch.“
Zum Schluss bedankte sich Tommi höflich, legte auf und wir lachten uns kaputt. Da waren wir Kindsköpfe zwanzig Jahre alt.
Die »konkret« &Ulrike Meinhof
Bisschen kindsköpfig war ich mir auch vorgekommen, als ich mit Neunzehn im Februar 1969 bei meinem allerersten Kontaktversuch in der Hamburger konkret-Redaktion Ulrike Meinhof begegnet war. Sie war mit dem Chefredakteur Röhl verheiratet und führte mich in ihr Büro, da Röhl in München auf CSU-Recherche-Tour war. Er wollte christsoziale Insider treffen, die ihm mehr über die Beziehungen von Franz Josef Strauß zur Rüstungsmafia berichten konnten. Das wollte er keinem anderen überlassen und gerne selbst in die Hand nehmen, weil zu brisant.
Ulrike Meinhof war für mich bis dahin eine völlig unbekannte Person, nur aus ihren konkret-Kolumnen konnte ich mir ein Bild über sie machen. Noch stand sie ja nicht im Kreuzfeuer des gewaltbereiten Terrors. Wie sie mir so gegenüber saß, sah sie sehr bürgerlich solide aus, halblanges, gepflegtes dunkles Haar, eine leicht bräunlich getönte Brille, ein dunkler Rollkragenpullover, dazu eine dunkle Hose und schwarze halbhohe Schuhe. Sie war zirka Mitte Dreißig, vielleicht ein, zwei Jahre jünger oder älter – sehr schwer zu schätzen für mich, da mir alle über Dreißig schon ziemlich alt erschienen.
„Wie sieht denn Ihr politischer Lebenslauf aus?“, fragte sie mich. „Sie wissen ja, dass wir eine politische, gesellschaftskritische Kulturzeitschrift sind. Da erwarten wir von unseren Mitarbeitern freilich eine solide Kenntnis der gesellschaftlichen Zusammenhänge.“
Ich berichtete ihr von meiner frühen Politisierung bei der Jungen Union, von der ich mich ebenso wie von den christlichen Pfadfindern rechtzeitig abnabeln konnte, um mein eigenes Köpfchen zu entwickeln, bevor ich bei den Provos landete. Genau das war der Zeitpunkt, an dem ich mir dann doch sehr kindisch vorkam, als sich die Chefkolumnistin und Ehefrau des Chefredakteurs und Herausgebers für meinen mickrigen politischen Lebenslauf interessierte. Ich lief rot an und bereute noch in diesem Augenblick, ihr von meiner halbherzigen Gammler- und Provo-Zeit etwas vorgeschwärmt zu haben.
Es schien aber nichts auszumachen, denn sie machte einen interessiert-höflichen Eindruck und sagte abschließend nur noch, ich würde von ihr hören. Das war vor ziemlich genau einem Jahr gewesen. Aber ich hörte von ihr nichts mehr, kein einziges Wort. Wie ich sehr viel später erfuhr, lag sie zu dieser Zeit bereits schwer im Clinch mit ihrem Mann und seinem redaktionellen Marketingkonzept. Der konkret standen bewegte Zeiten bevor.
Ende des Monats las ich in der Tageszeitung, dass konkret-Chefredakteur Röhl wegen Lästerung der deutschen Flagge von der Kriminalpolizei vernommen worden war. Anlass war ein Lolly lutschender Nackedei mit erdbeerfarbenem Schmollmund auf einem der konkret-Titel. Die Farbe des Lutschers: Schwarz-Rot-Gold.
Dazu fiel Frankholz bei unserem atheistischen Abendmahl ein Gedicht seines mittelalterlichen Landsmannes Francois Villon ein, das er mit seinem Französischakzent in fast einwandfreiem Deutsch zum Besten gab.
„Ich bin so wilde nach deinem Erdbeermund,
ich schrie mir schon das Lungen wund
nach deinem weißen … äh …“
„Leib, du Weib!“, ergänzte Richy.
Unser französischer Freund („Ah ja“) fuhr fort:
„Im Klee, da hat der Mai eine Bett gemacht,
da blühte einem schöner Zeitvertreib
mit deinem Leib die lange Nacht.
Da wille ich sein im tiefen Tal
Deine Nachtgebet und auch dein Sterngemahl.“
Wir klatschten. Jean-Francois stand auf und verbeugte sich tief. „Ich liebe dieses Dichter.“
„Was ist das, ein Sterngemahl?“, fragte Rosi.
Tommi räusperte sich.
„Ach so“, sagte Rosi. „Du bist so was. Aber erst dann, wenn du mich heiratest.“
Wir diskutierten über den Sinn von Heirat noch eine ganze Stunde lang und kamen zu dem Ergebnis, dass die Heirat ein typischer Kunstharzkleister aus dem Hause des Kapitalismus ist. Das brauchten wir nicht – vielleicht aber auch nur „noch nicht“, wie Karin unter Verweis auf die chinesische Revolutionspraxis und die Haltung des Großen Vorsitzenden einwendete.
*
Anfang Februar 1970 kam es zum bisher größten Ost-West-Geschäft zwischen der BRD und der UdSSR, nämlich zur Lieferung von Erdgas gegen Großröhren. Geboren war die politische Maxime „Wandel durch Handel“.
„Das kann nicht falsch sein“, meinte Richy.
„Was kann nicht falsch sein? Dass wir jetzt vom Gas der Russen abhängig werden?“, fragte Karin.
„Wandel durch Annäherung kann nicht falsch sein“, sagte Richy. „Du schürst Ängste, die sonst nur von Konservativen bedient werden! Aber da sieht man wieder mal die Übereinstimmung zwischen Maoisten und antisowjetischen Reaktionären.“
„Revisionisten-Geschwafel!“, sagte Karin und wedelte mit der neuesten Ausgabe der Peking Rundschau herum. „Hier steht schwarz auf weiß, was der Große Vorsitzende Mao dazu sagt: Den Marxismus und nicht den Revisionismus praktizieren; sich zusammenschließen und nicht Spaltertätigkeit betreiben; offen und ehrlich sein und sich nicht mit Verschwörungen und Ränken befassen!“
„Na, dann merk dir das mal, Genossin Karin: Nicht Spaltertätigkeit betreiben!“, sagte Richy und verschwand schmunzelnd in seinem kleinen, anspruchslosen Zimmer, das kein Plakat und nur eine Stechpalme schmückte.
Ich mischte mich in solche Zoffereien ungern ein; mich belustigte es eher. Irgendwie nahm ich meiner Liebsten sowieso nicht ab, was da an blumig-chinesischen Worten über ihre wundervollen Lippen purzelte. Für mich war das eine aufgesetzte Show. Sie wollte sich behaupten, wollte sich einen besonderen Stellenwert im Kreis von uns politisierten Männern erkämpfen, wollte sich Achtung durch eine ausgefallene Politposition verschaffen.
Zeitweise hatte sie sich in Frankfurt für den Weiberrat interessiert. Das waren die weiblichen SDS-Mitglieder; wenn nicht Mitglieder, so waren es doch zumindest SDS-affine Mädels, die den publicitygeilen SDS-Jungs nicht nachstehen wollten. Auch bemängelten sie das noch tief verwurzelte Mackertum im jungen Blut der Jungrevolutionäre. Die Frankfurter Machos im Sozialistischen Deutschen Studentenbund rund um Hans-Jürgen Krahl, Cohn-Bendit, die Brüder Wolff und Günter Amendt dominierten tatsächlich das politische Geschehen und die Presse. Und sie gaben vor, auch im Namen der Frauen zu sprechen, denn eine eigenständige Frauenbewegung existierte noch nicht so recht.
Aber Karin war total eigensinnig und ließ nur ihren eigenen Weg gelten; alles, was nach deutscher Normalität roch, war ihr suspekt. Dazu gehörten die organisierten Studenten, die gewerkschaftlich engagierten Sozialisten und alle SPDler, DKPler und alle K-Gruppen außer natürlich der maoistischen KPD/ML. Aber auch dort mochte sie sich nicht organisieren, sondern sprach nur unablässig davon, wie wichtig eine revolutionäre Organisation sei. „Die Arbeiterklasse braucht eine revolutionäre Vorhut“, war eine ihrer Standardaussagen.
„Aber wofür braucht der revolutionäre Mann überhaupt eine Vorhaut?“, fragt Tommi. Wenn Tommi ihr mit solchen Scherzen in die maoistische Parade fuhr, konnte sie lächelnd über seinen Einwand hinweggehen. Bei mir aber konnte sie in solchen Situationen höllisch explodieren. Dem konnte ich nur Einhalt gebieten, indem ich mich entwaffnend auszog und mich ergab. Ab da wurde das explosive Spiel erst interessant und ich spürte, wie sich Karins Verbissenheit im Liebesspiel in kleinen Liebesbissen auflöste.
*
Ohjessesmaria, der für seine außerirdischen Liebeleien und Geheimwissenschaften bekannte schweizerische Erfolgsautor Erich von Däniken wurde vom Kantonsgericht in Chur wegen Betrugs und Urkundenfälschung zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Meine Mutter konnte es nicht glauben, sie liebte zwar vornehmlich die Romane von Johannes Mario Simmel, hatte jedoch seit Ottos letztem Weihnachtsgeschenk neu zu Dänikens Geheimwissenschaften gefunden. Erinnerungen an die Zukunft hieß sein Buch. Da fragte er zum Beispiel, ob Gott von der Zeit abhängig und ob die Bundeslade von Moses elektrisch geladen war. Seiner Meinung nach war die Sintflut vorausgeplant, außerdem paarten sich die Götter und die Menschen sehr gerne. Das war für ihn klar wie Kloßbrühe.
Ein paar Tage später, Mitte Februar, gab es eine weitere Gerichtsmeldung. Eine im Jahr 1896 geborene Anna Anderson, verheiratete Anastasia Manahan, verlor vor dem Bundesgerichtshof in letzter Instanz ihren Prozess um Anerkennung als Zarentochter Anastasia, der jüngsten Tochter des letzten russischen Zaren.
Und noch einen Tag später legte US-Präsident Richard Nixon dem Kongress seine außenpolitische Doktrin für die 1970er Jahre vor. Danach sollten die USA ihre Rolle als Weltpolizei aufgeben. „Da lachen ja die Hühner“, meinte Rolf. „Wenn das so kommt, dann fress‘ ich einen Besen!“
„Das kommt so!“, sagte Karin. „Hier steht schon mal der Besen.“ Sie deutete in die Flur-Ecke hinter der Garderobe, wobei wir alle sofort ein schlechtes Gewissen bekamen, weil wir immer noch nicht geklärt hatten, wer als nächstes mit dem Kehren von Küche, Bad und Flur dran war. „Ich sag euch: Das kommt wirklich so! Der US-Imperialismus geht seinem Ende entgegen.“
„Wenn das nicht mal wieder eine dieser maoistischen Fehleinschätzungen ist“, antwortete Rolf.
„Das ist keine Fehleinschätzung, weil Nixon sonst seine NATO-Verbündeten nicht auffordern würde, mehr eigene Verantwortung zu übernehmen. Das ist das Eingeständnis, dass Amerika am Ende ist!“
„Quatsch mit Soße“, sagte ich. „Das heißt nur, dass wir und die anderen US-Vasallen mehr in die NATO-Aufrüstung stecken sollen. Denk doch mal nach! Wir sollen bei den Amis mehr Panzer und Bomber kaufen. Darum geht es Nixon, schön verklausuliert als »mehr eigene Verantwortung übernehmen!« Klingt gut und lässt bei Amerikas Rüstungsindustrie die Kassen klingeln.“ Mir war klar, dass Nixon den Krieg im Fernen Osten mit europäischem fresh money ausweiten wollte.
Fast hätte mir Karin die Augen ausgekratzt. Sie saß da wie ein Panther auf dem Sprung. Aber sie hielt die Klappe. Zehn Minuten später legte sie mich im Bett flach und machte mich auf diese Weise mundtot.
Am nächsten Morgen plauderte Frankholz aus seinem historischen Nähstübchen und legte uns die originalfranzösische Sicht der Dinge zum Maiaufstand 1968 in Paris dar. Im Speziellen ging es um Daniel Cohn-Bendit, den Roten Dany. Das interessierte zwar keinen mehr, da es aus unserer Sicht schon eine Ewigkeit, nämlich zwei Jahre, her war. Doch Jean-Francois plauderte munter drauflos.
„Ich glaube, Dany le Rouge, also glaube ich, war deutscher Anarchist in unser Lande, um die Sozialismus zu stoppen. Hat so viel Wirrzeug gemacht, alles durcheinander und nix auf die Beine gebracht, was könnte bleiben. Nur kaputt machen ist doch kein … wie sagt man … Concepion …“
„Konzept“, sagte ich und goss mir die warme Milch über die Haferflocken. Die mussten erst zirka drei Minuten aufquellen, aber nicht zu viel, dann kam das kleingeschnippelte Obst obendrauf. Das war das Konzept für mein Rezept.
„Hoch die internationale Solidarität!“, rief Rolf.
Richy und ich mussten lachen. Frankholz grinste und reckte die Faust hoch. Auch Karins Mao-Fäustchen mit den lila lackierten Fingernägeln flog hoch; sie musste sich beeilen, die Schule rief, und sie verließ uns hastig, wie immer etwas zu spät für den pünktlichen Unterrichtsbeginn. Aber als revolutionäre Abiturientin mit Plateau-Schuhen konnte man sich das offenbar irgendwie leisten.
Und was kam nach dem Frühstück? Das obligatorische »Rettchen«. Es war wirklich so, auch an diesem Morgen; Rauchen war wie ein stilles Übereinkommen, eine Geheimsprache, die signalisierte: Ich bin gelassen und bin so frei, so zu sein, wie ich bin.
„Brav macht ihr das; ihr verhaltet euch so, genau wie es sich die Zigarettenindustrie wünscht“, sagte Richy.
„Was wünscht die sich denn?“, fragte Rolf zurück.
„Na, genau solch eine Haltung, wie ihr sie an den Tag legt: Wir sind immer entspannt. Hippie happy. Uns regt nichts auf. Wir sind so cool. Wir sind die Cowboys, die ohne zu schwitzen die Rinder einfangen.“
Da hatte er Recht; diese Haltung wurde von der Tabakindustrie, wenn nicht initiiert, so doch kultiviert. Die Zigarettenwerbung verknüpfte Rauchen mit unbändiger Freiheit, mit Cowboys und Abenteuer. Ich, als geborener Nichtraucher, hatte mich oft einem rauchigen Gruppenzwang ausgesetzt gefühlt. Aber wie beim Saufen und Kiffen hatte ich heldenhaft widerstanden, einsam, aber zufrieden.
In unserer WG stand ich nun nicht mehr einsam auf verlorenem Posten, wenn sich alle anderen der Lässigkeit des qualmenden Abenteuers auslieferten. Raucher und Nichtraucher respektierten sich. Es gab keine Eklats, weil ausreichend gelüftet wurde und sich die Raucher an die Paragraphen an der Pinnwand hielten. Es tat niemandem einen Abbruch.
Beim Kiffen allerdings tat sich was. Die ausgestoßenen Inhalationsdünste schienen noch genug THC zu enthalten, um mich lockerer und wesentlich lustiger werden zu lassen, als die Direktkonsumenten selbst je wurden. Offenbar war ich sehr empfänglich für diese Gaben. Ohne wirklich Gras geraucht zu haben, war ich oftmals high bis über die Ohren.
In diesem Zustand führten wir grundsätzlich ernsthafte Grundsatzdiskussionen, die man nur bekifft-amüsiert überstehen konnte, darunter die bedeutendste Grundsatzfrage aller Zeiten: Was ist eigentlich unser Ziel?
Im Athener Grill saßen wir beisammen, Karin, Rosi, Tommi, Richy und ich. Rolf musste noch im Steuerbüro an einer Schummelbilanz für seinen stramm CDU-treuen Bürochef arbeiten. Auch unsere guten Kumpels und Solidaritätsverband-Helfer Andy, Britta und Ingo waren dabei. Alle hatten vorm Essen einen Joint gezogen, außer Karin, Richy und ich.
„Unsere Vision ist – ganz einfach gesagt – die freie Persönlichkeitsentfaltung, frei, das heißt ohne Fremdbestimmung“, sagte Karin nach dem zweiten Bier und schwadronierte weiter: „Ohne Manipulation durch die Presse der herrschenden Wirtschaftsmächtigen. Nicht der Profit, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen!“
Rosi schaute aus ihren etwas roten Augen, was dem Gras geschuldet war, und fragte in ihrer leidenschaftslosen Naivität: „Und wo bleibt die Natur?“
Ihr Liebster streichelte ihr die Hand, die gerade nach dem Tsatsiki-Teller griff. „Die sorgt für sich selbst. Mach dir keine Sorgen, die regeneriert sich, ist doch intakt, was willst du mehr?“
Ich sah, wie Richy nach Luft schnappte und Tommi ins Visier nahm. „Die Luft ist verpestet bis dorthinaus. Wie soll die sich von selbst regenerieren?“
Rosi stocherte in ihrem Zaziki herum und fragte, ob da Knoblauch drin sei. Tommi meinte, er hätte gehört, drüben der Sozialismus könne noch nicht auf Industrie verzichten, während der Kapitalismus industriell und militärisch ununterbrochen aufrüste, das sei doch wohl logisch. Erst im Kommunismus sei die Industrie überflüssig – was natürlich nur seinem derzeit arg benebelten Kopf entsprang. Der sozialistische Braunkohlegeruch über Berlin habe ein besonderes Flair oder so. Und so verlief sich die Diskussion im griechischen Nirwana zwischen Feta aus dem Ofen, gebratenen Zucchini und leckerem Braunkohl-Düftchen; oder war es vielleicht doch das Düftchen des Kohlsüppchens? Auf dem kurzen Nachhauseweg sangen wir auf dem Kudamm in einheitlicher Geschlossenheit.
„Das ist die Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem holden Duft, Duft, Duft, wo nur selten was verpufft, pufft, pufft, in dem Duft, Duft, Duft, dieser Luft, Luft, Luft!“
Weit vor uns an der Ecke Joachimstaler Straße – außer Konkurrenz von uns Neuberliner-Luftikussen –lieferten sich die Hare-Krishna-Jünger mit der Heilsarmee ihre eigene singende Präsenzschlacht: Wer war öfter präsent, wer sang lauter, wer konnte mehr Passanten zum Stehenbleiben und zum Nicht-schlecht-Staunen animieren?
*
Wir fühlten uns so schrecklich gut, so frei. Vorbei war es mit Mutters Sprüchen von wegen: „Was sollen denn die Nachbarn denken!“ Hier in der Millionenstadt kannte uns niemand; hier konnten wir alte Autoritäten lächerlich machen, ohne es unseren Alten umständlich erklären zu müssen. Wir waren unter uns und im Grundsatz einer Meinung, wenn es um die Modernisierung der Gesellschaft ging, sprich: um Demokratisierung.
Die begann mit radikaler Systemkritik und Verhohnepipelung überholter oder überstrapazierter Symbole und Verhaltensweisen. Letzteres hatte am besten Teufels Kommune 1 auf dem Schirm. Als der angeklagte Fritz Teufel vom Richter aufgefordert worden war, sich zu erheben, hatte er geantwortet: „Nun denn, wenn es der Wahrheitsfindung dient!“ Im grauen Gerichtssaal herrschte schallendes Gelächter. Der Richter schaute betreten drein. Und heute befand sich die Kommune, wie man hörte, in einer Krise oder sogar in Auflösung. Da würde ich mich demnächst, wenn ich mehr Zeit hätte, mal erkundigen.
Am Nachmittag rief Lollo an. „Wie geht es meinem Sohn? Wir haben lange nichts von dir gehört!“
„Stimmt nicht, Mama, ich habe erst vor zwei Wochen angerufen.“
„Ja schon. Aber du wolltest das darauf folgende Wochenende Bescheid sagen, wie es beruflich aussieht. Weil …“ Sie stockte.
„Weil ich vorhabe, als Berufsjournalist zu arbeiten, meinst du. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ich muss mich erstmal neben meinem durchaus gut auskömmlichen Solidaritätsverbands-Engagement als Honorarjournalist bewähren; das ist halt so. Es gibt ja keine überbetriebliche Vollzeit-Ausbildung zum Journalisten, so mit Berufsschule oder gar mit Studium, was ja momentan sowieso nicht in Frage kommt, weil …“ Jetzt kam ich ins Stocken.
„Weil du kein Abitur hast“, ergänzte Lollo mehr traurig als vorwurfsvoll.
„Wer weiß, wie sich das alles entwickelt, mein Muttchen. Lass mir einfach noch Zeit. Ich krieg das alles hin.“
„Hauptsache du bist glücklich und verdienst dein eigenes Geld.“
„Und es dient einem guten Zweck!“, fügte ich selbstbewusst hinzu.
„Wer weiß!“, wandte sie ein. „Vielleicht verlängern eure Spenden an den Vietcong nur den Krieg.“
„Also Mutter!“, rief ich entrüstet in die Sprechmuschel. „Ganz sicher nicht! Unsere deutsche Regierung hilft den Amis, den Krieg aufrechtzuerhalten: Mit der Zwischenstationierung von Waffen und Soldaten, mit der Finanzierung all der damit zusammenhängenden immensen Kosten und so weiter.“
„Auch die Regierung von Willy Brandt?“, fragte Lollo ungläubig zurück.
„Auch die. Da hat sich leider nichts geändert. Es scheint so, als existierten da Geheimverträge, die unserer Regierung in bestimmten Dingen die Hände fesseln.“
Dann wurde mir plötzlich bewusst, dass es mitten am Tag war. „Lollo, weißt du, dass du zur teuersten Zeit anrufst. Jetzt kostet eine Minute 60 Pfennig, abends nur zwanzig. Ich rufe dich heute Abend zurück.“
„Aber mach das auch. Ich wollte dir noch einiges berichten.“
„Na klar. Ich rufe gegen 19:00 Uhr an.“
„Lieber eine halbe Stunde später; du weißt doch – Papa sieht da die Nachrichten im Zweiten. Und er will dich ja auch mal wieder an der Strippe haben.“
Was Otto wohl von mir wollte? Von seinen Sporterfolgen berichten? Oder dezent nachfragen, was ich sportlich so treibe? Oder ob ich es mir mit dem Abi nicht doch mal überlegen wolle?
Wenn wir vom Großeinkauf für die Wohngemeinschaft zurück waren, wuschen wir uns jetzt immer als erstes gründlich die Hände. Aus der BRD war eine heftige Grippewelle nach Westberlin importiert worden. Dadurch waren im Westen bereits mehr als zweitausend Menschen gestorben. Die epidemische Infektionskrankheit hatte sich seit Anfang des Jahres in Nord-, West- und Mitteleuropa ausgebreitet.