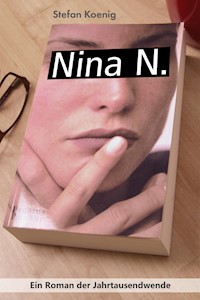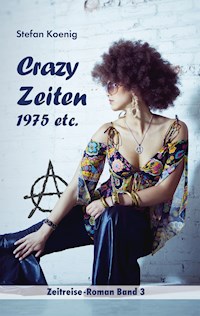Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitreise-Roman
- Sprache: Deutsch
Die 1980er Jahre. Wir Spät-68er wurden erwachsen. Peter Maffay und die DDR-Band Karat ließen uns über sieben Brücken gehen. Udo Jürgens sang "Adler sterben" und Rio Reiser hielt dagegen mit "Alles Lüge". Madonna und Michael Jackson starteten sexy durch. Trendy und überlebenswichtig wurde das Thema Umweltschutz. Uwe Barschel überlebte seine Beziehungen zum organisierten Waffenhandel nicht. In Genf, dem Drehpunkt der Politmafiosi, lag er tot in der Badewanne. Die CIA trieb ihr Unwesen, aber die Stasi geriet in Verdacht. Die Coronar-Krise von damals war die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Wir kauften säckeweise Milchpulver. Verstrahlte Frischmilch, Cäsiumbelastetes Gemüse und Obst waren tabu. Nie wieder wollten wir eine solch schlimme Krise erleben. Aber wir tanzten trotzdem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stefan Koenig
Rasante Zeiten - 1985 etc.
Zeitreise-Roman Band 5
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Rasante Zeiten - 1985 etc.
George Orwell & das Jahr 1984
Gib mir mal ‘ne Bottle Bier
Traumreise nach London
Umweltchaos, Spionage & Fluchthelfer
Über sieben Brücken …
1985 & die Generation Golf
AKW tut weh
Uschi Obermaier lässt grüßen
Rotationsprinzip & Formaldehyd
Neue Väter, Glasnost & Radio Eriwan
Rock am Ring & Träumereien
Nina & die Scientologen
Fußball-Drama & Live Aid Konzert
Die Infektion & die Idee
Arbeitsamt, Lindenstraße & Flick
Über den Wolken - grenzenlos
1986 Poona in den USA et cetera
Trimm Dich & Kaffeegeplauder
Ein Mordkomplott
Glykol & das Atomdesaster
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist
Sag mir, wo die Blumen sind
Schuldlos schuldig
1987 Völlig losgelöst von der Erde
Dead Kennedys & Massenphänomene
Rio Reiser & Alles Lüge
Udo Jürgens & Peter Maffay
Mord in Genf & Waffenschieber
1988 Tod & Teufel & 1000 Tricks
Tagebuch, Gartenlaube & Sina
Ein Fehlurteil & die Verzweiflung
Drohende Invasion & Treuhand-Ideen
Inhaltsverzeichnis des Buches
Dank & Nachbetrachtung
Impressum neobooks
Rasante Zeiten - 1985 etc.
Stefan Koenig
Rasante Zeiten
1985 etc.
Zeitreise-Roman
Band 5
Aus dem Deutschen
ins Deutsche übersetzt
von Jürgen Bodelle
Ein altes Foto in meiner Hand
Als wir kaum wussten, wer wir sind
Fünf Sommer und wir waren endlos
Bis jeder seine Wege ging
Tim ist jetzt in Freiburg
Tobi in Berlin
Phillip wurde Anwalt
Nur Hannah ist geblieben
Manu wollte Tänzer werden
Jetzt macht er BWL
Die Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell
So laufen die Jahre weiter ins Land
So fängt das Neue nach dem Alten an
Wir sind auf der Reise und irgendwann
Kommen wir an, kommen wir an
Wir starten von vorne, geben fast auf
Wir stolpern und fallen
und ziehen uns wieder rauf
So laufen die Jahre und irgendwann
Kommen wir an, kommen wir an
War kurz zu Hause, war lang nicht hier
Wo Stein auf Stein wie früher steht
Die alte Straße ist fast wie damals
Und doch hat sich so viel gedreht
Kathi hat jetzt Kinder
Wir ham' kaum noch Kontakt
Kolja macht Sozialarbeit
Und Marc hat's nicht gepackt
Clemens reist durch Frankreich
Sucht immer noch sein Glück
Und ich spiel meine Lieder
Und denk an euch zurück
Und jeder hat Geschichten,
von denen er gern erzähltDie Zeit vergeht im Rückspiegel so schnell
So laufen die Jahre weiter ins Land
So fängt das Neue nach dem Alten an
Wir sind auf der Reise und irgendwann
Kommen wir an, kommen wir an
Wir starten von vorne, geben fast auf
Wir stolpern und fallen
und ziehen uns wieder rauf
So laufen die Jahre und irgendwann
Kommen wir an, kommen wir an
Ein altes Foto in meiner Hand
Als wir kaum wussten, wer wir sind
(»Die Reise«, Max Giesinger)
Stefan Koenig
Rasante Zeiten
1985 etc.
Pegasus Bücher
© 2020 by Stefan Koenig
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Mail-Kontakt
zu Verlag und Autor:
Postadresse:
Pegasus Bücher
Postfach 1111
D-35321 Laubach
Rasante Zeiten – wenn man noch jung, noch sehr jung ist, scheint die Zeit still zu stehen. Man schaut nach vorne und wartet darauf, schnell vorwärts zu kommen. Wann werde ich endlich fünfzehn, wann endlich zwanzig? Dann scheint die Zeit einen Moment zu zögern – soll es schneller oder langsamer gehen? Und irgendwann beginnt die Zeit ohne Rücksicht auf Verluste am Rad zu drehen. Sie wird schneller, die Zeitabstände werden kürzer. Die Zeit rennt und rennt, und alles wird turbulenter und plötzlich heißt es: „Sorry, ich hab‘ keine Zeit.“
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, möchte ich meine Leserschaft bitten, sich Zeit zu nehmen. Sie ist so kostbar. Lassen Sie sich nicht dieses Juwels berauben. Es ist Ihr ganz persönlicher Schatz – viel wertvoller als der Staatsschatz des Dresdner Grünen Gewölbes, der gerade einem dreisten Kunstraub zum Opfer fiel. Wenn Sie es zulassen, dass man Ihnen die Zeit stiehlt, dann sind Sie selbst Täter und Opfer in Einem. Wenn Sie gar sich selbst der Zeit berauben, indem Sie sie nicht wertschätzen, dann … dann tun Sie mir leid.
Mitte der Achtziger bis Ende der Achtziger Jahre war unverkennbar eine Umbruchzeit. Heute leben wir in Corona-Zeiten, auch eine Umbruchzeit. Mit Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregelung, Maskenpflicht, mit temporärem, ganz schlimmem, ja existentiell bedrohlichem Klopapier- und Dosenfutter-Mangel, vergleichbar mit dem DDR-Bananen-Mangel – schlichte Mangelwirtschaft, ganz planlos, als hätte der Begriff Planwirtschaft keinerlei Bedeutung. Und das Virus hat uns alle in der Mangel. Wer das wohl alles plant? Verschwörung vorn, Verschwörung hinten.
Natürlich gibt es das – Verschwörungen. Es ist das Normalste auf der Welt. Die Weltgeschichte strotzt vor Verschwörungen. Denken Sie bitte an den 15. März des Jahres 44 vor Christus, als Brutus und seine Mitverschörer Cäsar in die tödliche Falle lockten. Manchmal ist es für uns alle wahrlich schwer zu unterscheiden, was wahr, was hingegen unwahr ist, was sein könnte und was uns als absoluter Quatsch präsentiert wird.
In diesem Zeitreise-Band geht es selbstverständlich auch um Verschwörungen. Um Uwe Barschel, Monika Weimar, Alexander Schalk-Golodkowski, am Rande um Silvio Berlusconi, Toni Schumacher und meine liebevoll gehassten Beamten des Offenbacher Arbeitsamtes – sie alle sind verbandelt mit diesem verschwörerischen Verschwörungsbegriff.
Noch einmal zur Corona-Krise – lassen Sie mich zurückkommen auf ein historisches Parallelereignis. Damals, als der Reaktor in Tschernobyl explodierte und die Atomwolke Europa verseuchte, wurden die Warnungen der Kernkraftkritiker erst in den Wind geschlagen. Dann aber gab es plötzlich Panik, Lebensmittel- und Ausgehbeschränkungen, Frischmilchverbote. Gemüse und Obst wurden Millionentonnenfach vernichtet, es herrschte eine grenzübergreifende grenzenlose Ratlosigkeit der Regierungen, eine große Verunsicherung der Bevölkerung. Aber lesen Sie selbst. Ich zeige Ihnen hier die Parallelen zu unseren heutigen Zuständen.
Es gibt zu den achtziger Jahren eine Menge Fragen. Stehen sie für den Zusammenbruch der sozialistischen Idee? Oder lediglich für das Scheitern eines realsozialistischen Versuchs, eine andere Gesellschaftsform zu etablieren? Stehen sie für das Ende christlicher Werte, weil in Europa die Kirchen immer leerer wurden? Stehen sie für den Triumph der kapitalistischen Ellenbogengesellschaft? Für die Vernichtung der Regenwälder und den Beginn dessen, was wir heute als Klimakatastrophe realkapitalistisch erleben?
Ich gebe ihnen darauf keine politikwissenschaftliche oder soziologische Antwort. Ich habe einen hoffentlich lesbaren und spannenden Roman geschrieben. Die Antworten geben Sie sich am besten selbst. Denn Sie sind ebenso kompetent wie ich.
Die Erlebniswelt, durch die ich Sie romanhaft führe, war meine Welt. So entspricht das Buch in vielerlei Hinsicht meiner Weltsicht und meinen Erlebnissen. Es erhebt weiß Gott – wenn er denn existiert und überhaupt etwas wissen kann – nicht den Anspruch der Allwissenheit. Die Gläubigen unter meinen Leserinnen und Lesern wissen es zu schätzen, dass es nur einen Allmächtigen und Allwissenden geben kann. Jedenfalls bin ich es nicht.
Was ich trotz all meiner Ohnmacht und Unwissenheit versucht habe zu erfassen, ist der Zeitgeist. Jener besagte heilige Zeitgeist. Es gibt ihn tatsächlich. Denn sehr oft wird von ihm geredet – was nicht heißt, dass alles, worüber viel geredet wird, auch tatsächlich existiert. Denken Sie etwa an den Weihnachtsmann oder den Osterhasen. Bei Engeln könnte ich mit einigen von Ihnen gewiss in Streit geraten. Aber lassen wir das. Die Achtziger waren streitbar genug.
Das herrschende Lebensgefühl war wohl die Umweltangst, die Sorge vor der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Was aber war noch das bestimmende Lebensgefühl? War es die Sucht nach Luxus und Überfluss, war es die Radikalisierung oder aber die Verflachung der Musik? War es die Ermüdung des jugendlichen Elans bei gleichzeitigem Ruf nach traditionellen Werten?
Es gab Schlagzeilen, die uns faszinierten, entsetzten, interessierten, schockierten. Da landete ein junger Husar aus Hamburg mit seiner Cessna auf dem Roten Platz. Da kam Aids auf, es gab Hungersnöte in Afrika, in Fußballstadien starben Fans. Und da war Krieg, wohin man sah. Man konnte es nicht mehr sehen … Aber da sangen auch die Vögelein, und Rio Reiser sang sich zum König von Deutschland hoch, und Madonna donnerte sexy ins Musikgeschäft hinein. Es waren wirklich rasante Zeiten.
Dieses Buch ist den Helden unserer Zeit gewidmet, die auch unter größter Gefahr für die eigene Existenz
der Wahrheit verpflichtet bleiben:
Julian Assange
Barret Brown
Glenn Greenwald
Chelsea Manning
Edward Snowden
sowie den vielen Frauen und Männern, die weltweit
der Korruption und dem Opportunismus widerstehen,
den hunderten hier nicht Genannten,
den weniger Berühmten und
tausenden mutigen Unbekannten.
Sie kämpfen gegen die abgrundtiefe Bösartigkeit und Ignoranz der Herrschaftseliten, welche die westlichen Demokratien zu Fassadendemokratien umgebaut haben.
* Auch dem kleinen Maxim Joris gewidmet *
George Orwell & das Jahr 1984
Ich war im ersten Moment sprachlos. Noch eben hatte ich unsere Nachbarn für den verabredeten Sauna-Abend an diesem trüb-kalten Novembertag erwartet. Jetzt standen vor unserer Haustür zwei Herren mit dem zweifelhaften Charme grauer Eminenzen und hielten mir ihre Blechmarken unter die Nase.
„Staatsschutz. Dürfen wir reinkommen?“
Ich war gerade von meiner Arbeit an der Frankfurter Uni nach Hause gekommen und hatte meine Frau Emma, unsere eineinhalb-jährige Karola und den sechs Wochen alten Luca mit einem Küsschen begrüßt. Es war schön, endlich einmal zeitig zu Hause zu sein. So schön, Ruhe zu haben, bevor die Saunarunde angetanzt kam. So schön, Emma mit den beiden Süßen im Arm auf dem Sofa liegen zu sehen. Ich war entspannt und wollte gerade in die Küche gehen, um meiner Frau und mir einen Tee zu machen, als es geklingelt hatte. Erst einmal, dann ein zweites, und schließlich ein drittes, aufdringliches Mal.
„Schon die ersten Nachbarn?“, hatte ich Emma gefragt und auf die Uhr geschaut.
„Na, die wären aber mehr als eine Stunde zu früh.“
Es war Viertel nach Fünf, und erst um halb Sieben war die Saunarunde angesagt. Ich hätte mich am Liebsten tot gestellt und wäre nicht zur Tür gegangen, aber da klingelte es schon wieder, diesmal lange, sehr lange. Der kleine Luca hatte zu schreien begonnen.
Ich war zur Wohnungstür gegangen, hatte den Hausflur durchquert, die Haustür erwartungsvoll geöffnet und starrte nun auf diese beiden ovalen Blechmarken, auf denen „Zentrale Kriminaldirektion Land Hessen ZK 10“ eingraviert stand.
Mir ging blitzschnell so viel durch den Kopf, dass ich selbst nicht wusste, wie mir geschah. Ich dachte an meine Zeit in den USA, wo ich auf Kosten der IBM schwarz telefoniert hatte – konnte das vielleicht ein Grund sein? Aber ausgerechnet der Staatsschutz? Die IBM-Telefonate waren reines Privatrecht – da sah ich wahrhaftig keinen Zusammenhang.
Ich dachte an meine Verbindungen zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ACLU, der American Civil Liberties Union – was konnte daran verboten sein? Meine Blitzerinnerung führte mich aber auch zurück in die noch frühere Zeit der 1970er Jahre, als ich für den Verfassungsschutz zum Vorwand für eine kleine klassische Verschwörung wurde. Nur weil er mich kannte, sollte ein Schulkamerad Berufsverbot und damit keine Assistenzprofessur erhalten – offensichtlich war ich für unsere Staatsschützer ein Staatsfeind. Und der Bekannte eines Staatsfeindes war ebenfalls ein Staatsfeind. In jenen frühen Zeiten hatte ich Altkleidersammlungen für den Befreiungskampf der Vietnamesen gegen das völkerrechtswidrige, jahrelange Dauerbombardement der USA organisiert. Spendensammelei für Medizin, die von der vietnamesischen Bevölkerung dringend benötigt wurde. Der christliche Westen hatte die offiziellen Medizinlieferungen boykottiert. Konnte man als humanistischer Spendensammler im Christenland schon zum Staatsfeind werden?
Ich dachte an meinen verschwundenen Koffer, der höchstwahrscheinlich von der CIA noch auf dem International Airport in San Francisco vor meinem Abflug nach good old Germany abgefangen worden war. Stand etwa etwas Staatsgefährdendes in meinen Dokumenten? Vielleicht, dass die Amis ein äußerst progressives Gesetz hatten, den »Freedom of Information Act«, der jedem Bürger die Einsicht in seine von den Behörden geführten Akten unumschränkt erlaubte? Dass es große Hürden für die Administrationen gab, wenn sie dieses Recht ihren Bürgern verweigern sollten – konnte ein solch offen vorliegendes Wissen für die BRD-Behörden Verfolgens wert sein?
Und dann klopfte jenes Literaturglanzstück des laufenden Jahres wie verhext an mein Oberstübchen: »1984«, von George Orwell. Würden mich diese beiden Staatsschützer vielleicht auf unseren Staat einschwören wollen? Würden sie mir Fragen nach Orwellschem Muster stellen? Total verschwörerisch …
„Herr Koenig, sind Sie bereit, für unseren Staat Ihr Leben zu opfern?“
„Ja“, würde ich des Scheins halber antworten, um ihre wahre Absicht in Erfahrung zu bringen.
„Sind Sie bereit, einen Mord zu begehen?“
„Ja.“
„Sabotageakte zu begehen, die vielleicht den Tod von Hunderten von unschuldigen Menschen herbeiführen?“
„Ja.“
„Unser Land an die Vereinigten Staaten von Amerika zu verraten?“
„Ja.“
„Sind Sie bereit, zu betrügen, zu fälschen, zu erpressen, die Gesinnung von Kindern zu verderben, süchtig machende Rauschgifte unter die Leute zu bringen; die Prostitution zu ermutigen, Geschlechtskrankheiten zu verbreiten – alles zu tun, was dazu angetan ist, die linken Genossen in Misskredit zu bringen?“
„Ja.“
„Würden Sie alles tun, um die Macht der Gewerkschaften und der Anti-Atombewegung zu untergraben?“
„Ja.“
„Wenn es zum Beispiel irgendwie unseren Interessen dienlich sein sollte, einem dieser neuen Grünen Schwefelsäure ins Gesicht zu spritzen – sind Sie dazu bereit?“
„Ja.“
„Sind Sie dazu bereit, Ihre bisherige Persönlichkeit aufzugeben und für den Rest Ihres Lebens als Kellner oder Hafenarbeiter durchs Leben zu gehen?“
„Ja.“
„Sie sind bereit, Suizid zu verüben, wenn und wann wir Ihnen das befehlen?“
„Ja. Nun sagen Sie mir aber bitte, was Sie heute von mir wollen?“, würde ich antworten.
„Noch eine letzte Frage: Sind Sie bereit, sich von Ihrer Frau, Ihrer Tochter und Ihrem Sohn zu trennen und sie nie wiederzusehen?“
Wahrscheinlich wäre ich für einen langen Augenblick meiner Sprache beraubt. Meine Zunge würde keinen Laut hervorbringen, während sie immer wieder die Anfangssilben erst des einen, dann des anderen Wortes zu formen versuchte. Ehe ich es nicht gesagt haben würde, würde ich nicht wissen, welches Wort meine Zunge endgültig formen würde, bevor die beiden Staatsschützer endlich ein „Nein!“ aus meinem Mund erreichen würde.
Meine Gedanken stockten.
Einer der beiden Herren vor der Haustür räusperte sich.
Noch immer starrte ich wie gebannt auf die Blechmarken der beiden Beamten.
„Nun“, sagte der größere von beiden, „mein Name ist Hase, sollten wir das Gespräch nicht lieber diskret führen?“
„Wer ist denn da?“, rief Emma aus der nahen Ferne des heimeligen Wohnzimmers.
„Ein Herr Hase und ein Herr …“
„Herrlinger“, sagte der zweite Schlapphut.
„Führen Sie zufällig auch Dienstausweise bei sich?“, fragte ich. „Nicht, dass ich Ihnen nicht traue, aber …“
„Selbstverständlich!“, sagten beide wie aus einem Mund und zückten ihre Ausweise, auf denen dasselbe wie auf den Blechmarken stand, versehen mit ihren Lichtbildern, ihren Namen und der Bezeichnung ihrer Wiesbadener Dienststelle: »Fahndung, OPE Staatsschutz«.
Zwei Stockwerke über uns hörte ich, wie sich eine Tür öffnete. Die Tür der neugierigen, alles sehenden, alles riechenden, alles hörenden Tante Ria.
„Kommen Sie herein“, sagte ich mit einem Seufzer. „Ich bitte Sie jedoch, auf unsere müden Kleinen Rücksicht zu nehmen. Meine Frau wollte sie gerade eben zu Bett bringen.“
„Dem steht nichts entgegen, Herr Koenig“, sagte der kleine Dicke.
Beide betraten unsere Wohnung. Ich schloss die Tür hinter ihnen, bat sie ihre Mäntel abzulegen, was sie tatsächlich taten, während ich in ihren Manteltaschen versteckte Aufnahmegeräte vermutet hatte, und ich stellte sie Emma mit den Worten vor, es gehe wahrscheinlich um ein politisches Interview.
Emma entschuldigte sich, die Kinder müssten ins Bett. Eigentlich sei dies mein Part, denn üblicher Weise würde ich ihnen Gute-Nacht-Geschichten erzählen.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass diese Botschaft die beiden Beamten erreichte, aber sie machten dennoch ein bemüht-freundliches Gesicht zu unserem abendlichen Familienleben. Dann waren wir alleine.
„Ich weiß nicht, welches Anliegen Sie haben, aber ist es in einer halben Stunde zu erledigen?“, fragte ich, „denn dann strömen hier die Nachbarn ein. Wir haben jeden Mittwoch eine gemütliche Nachbarschaftsrunde.“
„Wir hätten unsere Garderobe nicht ablegen müssen, denn es handelt sich lediglich um zwei Fragen zu Ihrem Mercedes“, sagte Herr Hase, dessen Namen ich natürlich äußerst lustig fand.
Innerlich stöhnte ich erleichtert auf. Daran hätte ich eigentlich als Erstes denken können. Aber die Sache, so relativ frisch sie noch war, war doch bereits abgehakt als eine bürokratische Verwechslung des Kraftfahrtbundesamtes. Ein letzter Zweifel war allerdings geblieben, ob nicht irgendwelche kriminellen Elemente sich zufällig ein gleiches Modell auserwählt hatten, um irgendein krummes Ding zu drehen.
„Die erste Frage wäre, wo Ihr Wagen in den Monaten nach ihrem Umzug von Berlin nach Frankfurt war?“, fragte Herrlinger. Ich war davon überzeugt, dass beide Namen reine Tarnnamen waren.
„Hatten Sie das Auto an jemanden verliehen?“, schob sein Häschen-Kollege eine Frage nach.
Ich musste mir den Standardwitz verkneifen: Konnten Sie das nicht mit Hilfe Ihrer allmächtigen Behörde ermitteln? Oder ist Ihr Name wirklich Hase, und Sie wissen von nichts?
„Weder meine Frau, noch ich haben jemals das Auto verliehen“, antwortete ich wahrheitsgemäß. „Und wo es war?“ Ich grübelte.
„War es immer bei Ihnen oder war es in dieser Zeit vielleicht einmal in einer Werkstatt?“, fragte der kleine Dicke.
Na klar, es war erst vor etwas mehr als einem halben Jahr für eine Woche bei meinem ehemaligen Grundschulkameraden Alois zur Reparatur gewesen. „Ja, der Mercedes hatte eine Inspektion, es musste allerhand repariert werden“, sagte ich.
„Können Sie uns bitte sagen, um welche Werkstatt es sich handelt?“
Ich sagte es ihnen, und dann erzählte ich noch einmal das, was ich bereits der harmlosen Bußgeldstelle mitgeteilt hatte: Meine Frau hatte eine Problemschwangerschaft gehabt. Sie war für vier Wochen im Krankenhaus gewesen. Während dieser Zeit war ich von der Uni freigestellt worden, hatte unsere kleine Karola und meine Eltern versorgt und nur das Fahrrad benutzt. Unser Mercedes stand während der gesamten vier Wochen, die meine Frau im Krankenhaus war, in der Garage. In dieser Zeit kaufte ich gegenüber, in der Seckbacher Landstraße, beim Tante Emma Laden, den die Familie Wagenbach liebevoll führte, ein. Ich brauchte kein Auto in diesen vier Wochen. Ganz einfach.
Doch genau in dieser Zeit war eine Dublette unseres alten Mercedes aufgetaucht und mit einer Frau am Steuer geblitzt worden.
„Wir wissen ja, dass nicht Ihr Wagen geblitzt wurde“, sagte Herr Hase. „Es war eine fast perfekte Dublette.“
„Wer hat denn Interesse, unseren Wagen als Dublette zu fahren?“, fragte ich die beiden Beamten.
Beide sahen sich an, dann antwortete der dickere: „Wissen Sie, es gibt tausend Gründe, weshalb, warum, wieso. Wenn wir das wüssten, dann wären wir nicht hier.“
„Sie sind aber doch kein übliches Kriminalkommissariat. Sie haben es doch mit politisch motivierten Straftaten zu tun, oder täusche ich mich?“
„Sie täuschen sich nicht. Aber wir ermitteln natürlich in alle Richtungen. Im Frankfurter Nordend und in Bornheim gibt es viele Unterstützer der sogenannten Roten Zellen“, sagte der Dicke. Beschwichtigend fügte er hinzu: „Wir wissen, dass Sie nicht dazu gehören.“
„Woher wollen Sie das wissen?“ scherzte ich, obwohl mir nicht zum Scherzen zumute war. Schließlich hatte man mich Jahre zuvor ganz offensichtlich postalisch und telefonisch überwacht – vielleicht sogar persönlich über Bekannte oder Freunde bespitzeln lassen. Und der Grund hierzu? Allein deshalb, weil ich der Bundeswehr entflohen war. Hinzu kam wohl auch der schon erwähnte Versuch, meine Vietnam-Sammlungen zur Beendigung des mörderischen US-Krieges zu kriminalisieren.
Der Staatsschützer ging nicht auf meine Frage ein. „Vielleicht brauchen diese RAF-Nachfolger unauffällige Familienautos in der Hoffnung, nicht aufzufallen. Aber der Zufall deckt dann doch immer wieder einmal etwas auf. Die Dame, die am Steuer der Dublette saß, fuhr einfach zehn Stundenkilometer zu schnell – und schon ist die aufwendig hergerichtete Dublette aufgeflogen. Jetzt ist unser Part herauszufinden, wie die gerade auf Ihren Mercedes gestoßen sind. Deshalb unsere Fragen.“
Der Beamte stand auf, auch Herr Hase erhob sich.
„Sie haben keine Idee dazu?“, fragte mich Herr Hase.
„Keine Spur, meine Herren. Ich bin politisch weit entfernt von diesen sogenannten Feierabend-Terroris-ten.“
»Feierabend-Terroristen« hatten die Behörden und Zeitungen jene Politgangster genannt, die meinen Fast-Schwiegervater, den hessischen Wirtschaftsminister Heinz Herbert Karry, und andere hohe Bundesbeamte ermordet hatten – aber es waren allesamt sehr merkwürdige Morde. Ohne echte Bekennerschreiben. Ohne politisch übliche Pamphlete, ohne theoretisches, bombastisches Rechtfertigungsgebrabbel – außer bei Karry, wo in einer sehr ungewöhnlichen und unglaubwürdigen Weise einige Klugscheißereien zum Besten gegeben worden waren. Merkwürdige Umstände. Merkwürdig mangelhafte Ermittlungen. Merkwürdige Morde mit merkwürdigen Hintergründen. Und dann dieser offiziell benutzte Begriff von „Feierabend-Terroristen“ – das klang so mysteriös verschleiernd wie die immer wieder aus der Klamottenkiste gezogene Einzeltäter-These bei rechtsradikalen Anschlägen und Morden.
Ich nahm die Mäntel der beiden vom Kleiderhaken und reichte sie ihnen.
„Danke, Sie sind der perfekte Gastgeber, aber Sie brauchen uns nicht in den Mantel zu helfen“, sagte der kleine Dicke lachend.
„Das hätte ich allein deshalb nicht gemacht, weil sie sportlich ausschauen“, antwortete ich. Tatsächlich sahen sie wie zwei unsportliche, bürokratische Sesselfurzer aus. Dann fügte ich hinzu, weil es mir tatsächlich erst jetzt einfiel: „Und entschuldigen Sie bitte, dass ich vergessen habe, Ihnen etwas zu trinken anzubieten. Aber Ihr Besuch kam so überraschend, dass ich …“
„Keine Sorge“, sagte der Dicke, „das holen wir jetzt nach.“ Und weg waren sie.
Irgendwie hinterließ der Besuch etwas Menschlich-Normales und doch auch etwas Unheimliches. Natürlich musste ich wieder an meinen aktuellen Lesestoff von George Orwell denken: »1984«. Dazu diese trübe Novemberstimmung. Da war jetzt die Sauna genau der richtige Ort.
*
Die ersten Besucher der Saunarunde kamen einfach herein. Die Tür war wie an jedem Saunaabend nur angelehnt. Ich hatte die Klingel abgestellt, damit die Kinder nicht geweckt wurden. Trotz Großstadt-Trallala hatten wir dieses grenzenlose urbane Vertrauen. Es wurde acht Jahre später heftig erschüttert.
Moni brachte ihren traditionellen Nudel-Salat mit, den ich nicht ausstehen konnte, weil sie ihn regelmäßig mit Mayonnaise überfrachtete. Ihr Mann, Logistiker bei REWE, brachte gebratene Hähnchenteile mit. Gunnar war früher ein Liebhaber knuspriger Hähnchenschenkel gewesen. Wenn er sich daran hörbar erinnerte, tätschelte er – Sigmund Freud ließ grüßen – die Oberschenkel seiner Liebsten. Er beschaffte die Hähnchen bei einem Bauernhof im Vogelsberg, wie er immer aufs Neue zu betonen pflegte. Auch unsere ewig gackernde Moni stammte aus dem Vogelsberg, jenem herrlichen Naturfleck zwischen Gießen und Fulda. Was die Hähnchenbeschaffung betraf, glaubte ich ihm auf‘s Wort. Emma glaubte ihm kein Wort. Dennoch wurde Gunnar sechs Jahre später Prokurist unserer Unternehmen, was wir jetzt noch nicht ahnten.
Erstaunlich war, dass er, der Hähnchenbeschaffer, seit Neuestem Fleisch verabscheute. Er war nun einer der ersten männlichen Vegetarier.
Nur Moni konnte er nicht auf den Vegetarier-Kurs zwingen; ganz im Gegenteil. Je mehr er von seinem vegetarischen Leben schwärmte, desto versessener schien sie heimlich Schnitzel und gelegentlich Hähnchenschlegel beim Metzger um die Ecke zu genießen. Wenn Gunnar und ihr gemeinsamer pubertierender Sohn Philip mittags noch nicht zu Hause waren, schlich sie sich davon und täuschte für die beobachtende Nachbarschaft einen Familieneinkauf vor. Per Zufall hatte ich sie einige Male beim Metzger getroffen. Mein Gott, ich wollte sie dort nicht treffen! Und meine Güte, ich gehörte nicht zur beobachtenden Nachbarschaft – was man von Moni nicht behaupten konnte.
Wohl deshalb fragte sie mich jetzt ein wenig aus.
„Wer waren denn die beiden Herren, die da vor eurer Haustür standen?“
Ich wusste sofort, wen sie meinte. Da aber gerade der zweite Schub an Saunagästen zur Tür hereinströmte, sagte ich: „Erzähl‘ ich dir später. Das ist eine längere Geschichte. Was ich dich fragen wollte: Macht Philip eigentlich die Essenspläne seines Vaters mit?“
Philip wuchs nun in seinem sechsten Lebensjahr schon voll vegetarisch auf. Und er war dennoch – wahrscheinlich aber gerade deshalb – sehr gut in der Schule, wie Moni und Gunnar unentwegt betonten. In seiner Klasse, in der die fleischfressenden Freunde noch weit in der Überzahl waren, war er jedoch in jeglicher Hinsicht Einzelgänger.
„Er schreibt schon wie ein Siebtklässler“, sagte Moni stolz. „Und er hat das Mathetalent seines Vaters geerbt, was ich neidlos zugestehen muss.“
„Vegetarisch bedingt?“, fragte ich.
Sie gackerte.
Als Gunnar sich etwas abseits mit dem gerade hinzugestoßenen Ärztepaar Anne und Tobias unterhielt, flüsterte sie mir zu: „Bitte keine Bemerkung über meine Balkonaktivitäten.“
Erst stutzte ich einen Moment, dann musste ich lächeln und antwortete mit einem klaren: „Ehrenwort!“
Auf Monis Balkon, über den wir uns zuwinken konnten, rauchte sie – auch hier heimlich und verschwörerisch – ihre ansonsten auf dem Küchenschrank sorgsam versteckten Zigaretten. Gunnar hatte das Rauchen strikt untersagt, „da man der Jugend kein falsches Vorbild abgeben darf“, wie er, der pädagogisch stets »on top« war, betonte.
„Wenn ich mein Zigarettchen morgens und mittags nicht rauchen kann, werde ich fett. Ich explodiere dann regelrecht und mein Mann wird mich von einer Diät zur anderen jagen“, flüsterte sie weiter. „Ich habe jetzt schon drei Kilo zu viel drauf!“
Die kleine Blondine war gut proportioniert, aber keinesfalls hatte sie eine jener vielen Brigitte-Diäten nötig, die seit einigen Jahren das besondere Geschenk der Unternehmerfamilien Gruner und Jahr an die neue ernährungsbewusste Welt der Feministinnen war. Mit Diäten ließ sich neuerdings gut Umsatz machen.
Inzwischen hatte Gunnar seine Nachbarn Anne und Tobias tief in pädagogische Austauscherfahrungen über ihre beiden gleichaltrigen Söhne verstrickt.
„In Sachen Ordnungssinn bin ich strikt!“ Gunnar hatte drei Wände des Kinderzimmers mit halbhohen Schubladenregalen versehen, und jede Schublade hatte eine große Überschrift mit etlichen kleinen Unterpunkten. Ein perfektes, bis ins Kleinste ausgeklügeltes Ordnungssystem, das einem jungen Menschen das Schubladendenken unheimlich nahe bringen musste.
Anne, die fast-promovierte Arztfrau – sie hatte kurz vor der Heirat die Doktorarbeit abgebrochen –, war jedoch keineswegs so ordnungsbegeistert wie ihr Nachbar und meinte: „Unsere Kinder brauchen Entfaltungsmöglichkeiten und müssen sich ihr Ordnungssystem vielleicht auch selbst erarbeiten, oder wie siehst du das, Gunnar?“
Gunnar sah es natürlich anders, denn sein Philip konnte – „freiwillig“, wie er betonte – noch etliche Schubladenregale aufstocken, was aus seiner Sicht genügend kreative Luft nach oben bot. Ich schwieg dazu und musste lächeln. Wahrscheinlich bewunderte ich insgeheim das Ordnungssystem. Aber gleichzeitig dachte ich: So wehrt sich die tief verinnerlichte alte Ordnungssehnsucht unserer Eltern und Großeltern gegen die erst eineinhalb Jahrzehnte frische Sehnsucht der 68er-Eltern nach mehr flexibler und kreativer Freiheit von genau dieser Ordnung.
Als Annes Mann Tobias, unser promovierter Diabetes-Experte, über verträgliche Menge und Art der Süßigkeiten für unsere Kids zu schwadronieren begann, war es Zeit, die Hüllen fallen zu lassen und zu duschen. Die Sauna war auf 80 Grad aufgeheizt, und so setzten wir unsere Unterhaltung schwitzend fort. Inzwischen waren auch Irmel und Arnd aus der Seitenstraße sowie ihr Untermieter, der 25-jährige Jungschauspieler Christian, eingetrudelt. Auch Doris, die im Nebenhaus wohnte und in Frankfurts Innenstadt einen gutsituierten Optik- und Hörgeräteladen betrieb, kam später dazu. Noch genoss sie ihr Single-Dasein, lag aber bei jeder Festivität auf der Lauer …
„Auf meinem Grabstein wird mal stehen »Sie war stets suchend und bemüht«. Ich werde euch für diese Inschrift jedenfalls von himmlischen Gefilden herab danken!“, sagte sie dann scherzend, wenn jemand versuchte, sie auf einen Mann aufmerksam zu machen.
Gib mir mal ‘ne Bottle Bier
Nach dem ersten Saunagang saßen wir um unseren Esstisch herum und tranken erst einmal aus Emmas Samowar, den sie auf Frankfurts Trödelmarkt am Main erstanden hatte. Tee mit Glühweingeschmack, der aber kein Glühwein war. Nun ja, dem Trend der Zeit entsprechend: mehr Schein als Sein, aber gewiss nicht ungesund, irgendwie, oder so oder vielleicht. Aromatisierte Teesorten waren »in«.
Dann kamen noch Gitti, wie immer stark parfümiert, und Bernd, entsprechend passend zu seiner Herzdame duftend, hinzu. Sie wohnten im selben Dreifamilienhaus wie Moni und Gunnar. Unsere Saunarunde war nun komplett.
Bis auf Doris, die zehn Jahre älter und Christian, der zehn Jahre jünger war, waren wir alle im etwa gleichen Alter zwischen 30 und 35 Jahre alt. Meistens machten wir Jungs gemeinsam einen Saunagang, und danach gingen die Mädels in die verschwitzte Bude. Wir unterhielten uns entweder über unsere Jobs oder über Politik und Wirtschaft. Die Frauen erzählten sich Neuigkeiten aus Kindergärten, Schulen und der Mode. Klassische Rollenaufteilung, klassisches Rollengeschwätz. Aber immer unterhaltsam. Das Revolutionsfieber lag Jahrzehnte hinter uns. Und doch glühte da irgendwo noch irgendetwas sanft in der linken Herzkammer und hielt die Aortenklappe in Bewegung.
Christian, unser Jungschauspieler auf diversen Tingel-Tangel-Bühnen, fand, die Politik sei ein einziges Schauspiel, und CDU und CSU hätten zugestandener Weise die weltallerbesten Darsteller. Gerade vor ein paar Tagen nämlich war CDU-Charmeur Rainer Barzel vom Amt des Bundestagspräsidenten mit Sauerbiermiene zurückgetreten, nachdem der Verdacht aufgekommen war, er stehe im schmierigen Zusammenhang mit der Flick-Parteispendenaffäre. Natürlich spielte er einen auf völlig unbeteiligt und wusste von nichts, auch wenn die sich Sachlage selbst für Otto Normalverbraucher sehr eindeutig darstellte.
„Barzels Sauerbiermiene ist wahrscheinlich auch nur gespielt“, meinte ich und wurde mir sofort bewusst, dass ich hätte schweigen sollen, als Gunnar mit einer ebensolch bierernsten Miene das Wort ergriff.
Schließlich war er selbsternannter Bierfachmann und somit auch Bierhistoriker. „Vorneweg: »Das« Sauerbier gibt es nicht“, sprang er sofort auf Barzels Sauerbiermiene an. „Mit dem Begriff Sauerbier werden eine ganze Vielzahl unterschiedlichster Biere zusammengefasst.“
Höflich und unschuldig, wie er war, fragte Bernd überflüssiger Weise nach: „Welche Vielzahl meinst du? Welche Brauerei-Stile sind das, wo kommen sie her – und vor allem: Warum schmecken manche Biere sauer?“
Jetzt mischte auch noch Doris mit, obwohl sie kaum Bier, stattdessen aber viel Rotwein trank: „Genau! Früher war Bier irgendwie mehr sauer.“ Eine absolute Steilvorlage für Bier-Gunnar, der als Vollkostvegetarier zugleich überzeugter Biertrinker war, wovon sein Bierbäuchlein zeugte.
„Bier ist gesund und besteht zu 100 Prozent aus vegetarischen Bestandteilen“, warf ich opportunistisch dazwischen, um nicht als Spielverderber blöd da zu stehen.
Gunnar sah mich ein klein wenig misstrauisch an, wie ich fand; schließlich wusste er, dass ich kein passionierter Biertrinker war. Dann sah er zu Doris, um ihr in seiner unnachahmlich souveränen Art zu antworten: „Man muss davon ausgehen, dass vor der Einführung des bis heute gängigen Konservierungsverfahrens flüssiger Lebensmittel durch Louis Pasteur – kurz: vor der Pasteurisierung – alle Biere mehr oder weniger säuerlich schmeckten.“
„Hä? Pasteurisiertes Bier?“, sagte Doris. „Klingt auch nicht gerade nach Natur pur!“
Und plötzlich wurde mir bewusst, dass all die spannenden, weltbewegenden WG-Diskussionen der früheren Jahre unwiederbringlich vorüber waren. Sie waren den gesättigten Unterhaltungen bürgerlicher Belanglosigkeit gewichen.
„Infektionen mit Milchsäure- oder anderen Bakterien oder bestimmten Hefen, wie der Brettanomyces, die für einen ganz eigenen Sauer-Touch im Bier sorgen, waren früher kaum zu verhindern“, fuhr Gunnar seinen Vortrag fort. „Je nach Brauerei, Temperatur, Jahreszeit, also je nach Spiel des Schicksals, tat das dem Geschmack des Bieres mehr oder weniger Abbruch. Die Redewendung, etwas verkaufe sich »wie sauer Bier«, hat jedenfalls belegbare, historische Wurzeln.“
»Howgh«. Der Häuptling der Bildungsbürger hatte gesprochen. Emma, Gitti, Irmel und Arndt zollten so etwas wie höflich-verhaltenen Beifall. Und auch ich nickte etwas widerwillig, was man jedoch auch als sachte zustimmend werten konnte. Vom Thema selbst hatte ich keine Ahnung und fand es auch nicht besonders aufregend. Zehn Jahre später sah ich das anders, was ich jetzt von mir selbst nicht wissen konnte. Im Augenblick jedenfalls langweilte mich die Thematik.
Mich beschäftigte im Moment mehr, weshalb die Amis mit großer Mehrheit doof genug waren, den doofen rechtskonservativen Republikaner und hauptberuflichen Wild-West-Schauspieler Ronald Reagan erneut zu ihrem Wildwestpräsidenten zu wählen. Noch einmal vier lange Jahre diesen durchtriebenen Luftikus, diesen Geldverschleuderer, diesen weltweit größten Staatsschuldenmacher, diesen ungenierten Rüstungsfanatiker. Ein Mann, der reiner Statist für die Superreichen war und der seinen zig Millionen armen Mitbürgern noch nicht einmal ein funktionierendes und bezahlbares Gesundheitssystem gönnte.
Meine Gedanken in Ehren, aber Gunnar war im theoretischen Bier-Rausch und nicht zu bremsen. „Als Brauer ab Ende des 19.Jahrhunderts in der Lage waren, die unbeabsichtigte Säuerung zu verhindern, taten sie das in Deutschland auch. Saure Biere waren hierzulande schnell auf dem Rückzug, selbst das letzte seiner Art, die Berliner Weiße, war bis Mitte des 20.Jahrhunderts fast ausgerottet. In anderen Teilen der Welt aber hielten sich Sauerbiere – allen voran in Belgien. In Belgien haben saure Biere Tradition.“
Gunnar sah seine Moni auffordernd an. Und sein Weibchen war bereit zu springen: „Soll ich ein paar Flaschen holen?“
Für Emma und mich war es spannend, noch einmal so ein quicklebendiges Patriarchat in der Epoche der allgemeinen Emanzipation zu erleben. Eine Art Zeitreise in die Ära unserer Großeltern und Eltern. Ich hätte darauf wetten können, dass jede andere Frau aus unserer Saunarunde, statt sich so weiblich beflissen auf den Sprung zu machen, eher ihren Mann zum Bier holen heimgeschickt hätte.
Gunnar aber wies ihr mit einer knappen Kopfbewegung den Weg und fuhr dozierend fort: „Die besten, die edelsten Biere unseres bierkulturell beeindruckenden Nachbarlandes schmecken sauer. Das Lambic etwa gilt als der vielleicht anspruchsvollste und komplexeste Bierstil der Welt. Im Grunde sprechen wir hier von einem spontan vergorenen Weizenbier, wobei aber eine Besonderheit in Abgrenzung zum deutschen Weizenbier darin liegt, dass der belgische Brauer hier »Rohfrucht«, also unvermälzten Weizen, verwendet.“
Arndt, der an Diabetes litt, wandte sich an Tobias: „Sag mal, Tobi, gibt es aus diabetischer Sicht eigentlich Einwände gegen den Bierkonsum?“
Bevor Tobi seine Mediziner-Antwort in die Runde werfen konnte, fuhr Gunnar unbekümmert in seinem Bier-Referat fort, da auch Stefan etwas gefragt hatte, nämlich inwieweit saures Bier mit der Braumethode zusammenhängt.
„Nach dem Brauen werden Lambics traditionell in ein Kühlschiff gegossen, eine große, flache Wanne meist im Dachgeschoss der Brauerei, in der der eben noch kochende Sud möglichst schnell abkühlen sollte, ehe er in den Gär-Tank gefüllt wird.“
Meine Gedanken schweiften wieder einmal ab. Plötzlich drängte sich mir wie aus dem Nichts die Frage auf, wie ich meine kleine Familie ernähren wollte, wenn mein befristeter Arbeitsvertrag an der Uni ausgelaufen war. Ich wehrte den Gedanken krampfhaft ab. Ich wollte daran nicht denken, nicht jetzt, nicht hier, nicht in dieser.
„Früher hatten auch deutsche Brauereien Kühlschiffe, allerdings wurden die durch Plattenkühler ersetzt, weil die Gefahr, dass die Würze sich, wenn sie da so offen herum steht, Infektionen durch Bakterien oder wilde Hefen einfängt, hoch ist“, riss mich Gunnar aus meinen Gedanken.
„Igitt!“, rief Doris aus. „Bakterien! Infektionen!“
„Genau das will der Lambic-Brauer!“, fuhr Gunnar fort. „Der Brauer setzt auf Spontangärung, darauf also, dass seine Würze ohne das menschliche Zutun von Hefe durch ihn anfängt zu gären. Oft stehen dafür in den Kühlschiffen belgischer Traditionsbrauereien die Fenster offen, Moos und Spinnweben an der Decke werden niemals entfernt. Denn überall darin verstecken sich genau jene »wilde Hefen«, die den Geschmack der Biere dieses Hauses prägen. Danach gärt Lambic über Wochen in offenen Gärbottichen, ehe eine teils Jahre dauernde Lagerzeit beginnt.“
Noch einmal stieß Doris ein lautes Igitt aus.
Gunnar hatte den Wettbewerb zwischen unserer männlichen Experten-Spezies vorerst gewonnen, aber schon rüstete Tobi zu einem sanften bildungsbürgerlich-medizinischen Gegenangriff.
„Mal zurück zu deiner Frage, Arndt. Was ich dir als Diabetiker raten kann, ist eine gewisse Zurückhaltung.“
Wir konnten nicht ahnen, dass es gerade jener wunde Punkt war, an dem Arndt schon zwei Jahre später im Alter von nur 37 Jahren versterben würde.
Arndt sah Tobias fragend an, und Tobias, immer der ernste Arzt, sah Arndt mit Ausrufezeichen in den Augen an. „Bereits ab einem Blutalkoholspiegel von 0,45 Promille ist die Zuckerfreisetzung gestört. Weiblichen Diabetikerinnen wird deshalb empfohlen, nicht mehr als 10 g Alkohol täglich zu trinken. Das entspricht etwa einem achtel Liter trockenem Wein oder 250 ml Bier. Bei Männern mit Diabetes liegt diese Menge doppelt so hoch. Auch wenn die Empfehlungen sich auf den Tag beziehen, sollte Alkohol, ganz gleich ob mit Diabetes oder ohne diese Erkrankung, nicht täglich dazugehören.“
„Nicht täglich?“, entrüstete sich Gunnar. „Mir bekommt es außerordentlich gut.“
„Es entwickelt sich leicht ein Gewohnheitseffekt, das Gewicht steigt, die Leber kann geschädigt und der Appetit gesteigert werden. Gerade bei Typ-2-Diabetes, wie es Arndt hat, ist es wichtig, Kalorien im Blick zu halten, damit das Gewicht nicht steigt. Alkohol kann den Fettstoffwechsel stören, den Fettabbau erschweren und somit Übergewicht fördern. Also ein Gläschen sollte am besten wohldosiert und mit Genuss getrunken werden.“
„Was heißt überhaupt Typ-2-Diabetes?“, fragte Doris.
„Diabetes mellitus oder auf gut Deutsch Zuckerkrankheit ist eine chronische Störung des Stoffwechsels, bei der die Blutzuckerkonzentration zeitweise oder ständig erhöht ist.“ Endlich war Tobias in seinem Element.
Seine Frau schaute Emma an: „Gehen wir mal kurz in die Küche?“ Die beiden verschwanden. Ich hatte den Eindruck, dass Anne das medizinische Fachchinesisch nicht mehr hören konnte. Mich interessierte es. Gesund leben, tja, man hatte ja Kinder, die man gesund großziehen wollte. All die neuartigen und sich überstürzenden Umweltprobleme waren schon schlimm genug, sagte ich mir und musste an meinen neuen Aufgabenbereich am Uni-Institut denken. Ich sollte eine Umweltbibliothek aufbauen und dabei insbesondere vergleichende soziologische wie umweltmedizinische Untersuchungen berücksichtigen. Gehörte da nicht Ernährung dazu?
„Im Allgemeinen werden unter dem Begriff Diabetes verschiedene Krankheitsformen zusammengefasst. Am weitesten verbreitet sind Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes. Typ-2-Diabetes wurde früher auch als Altersdiabetes bezeichnet, weil er meist bei älteren Menschen auftrat. Heute sind aber zunehmend Jüngere, zum Teil sogar Kinder und Jugendliche von einem Diabetes mellitus betroffen.“
„Ja, so alt bin ich gar nicht, muss mich aber schon mit einer sogenannten Alterskrankheit rumschlagen“, sagte Arndt lachend.
„Was bei dir, lieber Arndt, gottseidank nicht zutrifft: Übergewicht und Bewegungsmangel. Denn sie erhöhen das Risiko, an Diabetes zu erkranken. In der Regel entwickelt sich Typ-2-Diabetes langsam. Häufig vergehen bis zur Entdeckung fünf bis zehn Jahre, in denen die Erkrankung bereits erhebliche Schäden anrichten kann. Ursache der Diabetes-Erkrankung ist in der Regel sowohl eine zu geringe Produktion des Hormons Insulin als auch ein zu geringes Ansprechen der Körperzellen auf Insulin.“
„Ist unser Arndt in Gefahr?“, fragte Doris.
„Nein, nein, ich spreche hier nur von den allgemeinen Risikofaktoren. Bei Arndt haben wir alles im Griff.“
Aber es war nicht so, wie wir alle dachten und wie Arndt gewiss hoffte.
Wenn es mal nicht um Bier, Gesundheit, Politik und Wirtschaft ging, war Religion im Spiel. Dann lag der unterhaltsame Spielball bei Gott und der Welt. Insbesondere in diesen Tagen, da die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi von zwei Mitgliedern ihrer Leibwache erschossen worden war – ebenso wie ihr vor 36 Jahren von einem Hindu-Nationalisten ermordeter Vater war sie Verfechterin der absoluten Gewaltlosigkeit gewesen.
„Die Täter gehören der Religionsgemeinschaft der Sikhs an“, berichtete Gunnar sein Zeitungswissen aus dem SPIEGEL. „Gandhi hat deren Nationalheiligtum, den Goldenen Tempel in Amritsar, am 5. Juni von Regierungstruppen erstürmen lassen.“
„Na, dann war sie wohl gar nicht so gewaltfrei wie sie getan hat“, sagte Tobias, und Christian meinte: „Alles ziemlich plumpe Schauspieler.“
„Dass du so dein eigenes Berufsnest beschmutzen kannst“, warf Gunnar in gespielter Empörung ein. Und mit der »Nestbeschmutzung« landete der Ball erneut in der Politik, hatten doch gerade wieder einmal einige CSU-Granden den Sozialdemokraten Nestbeschmutzung vorgeworfen, weil diese in der Flick-Affäre auf schonungsloser Aufklärung bestanden.
„Wobei die Sozis mit »schonungslos« gewiss nicht meinen, dass man auch die Zuwendungen von Unternehmen an sie selbst unter die Lupe nehmen solle“, sagte Tobias.
Die politischen Saunaverhältnisse waren in unserer Frankfurter Nachbarschaft durchaus pluralistisch durchmischt. Tobias war den Christdemokraten zugetan, seine Frau schwankte zwischen CDU und FDP. Moni und Gunnar waren „Kleineres-Übel-Wähler“, was im Klartext bedeutete, dass sie treu zur SPD hielten, egal ob diese den Aufrüstungsbefehlen aus Washington gehorchte oder nicht.
Gitti und Bernd waren bekennende Wechselwähler. Was ihnen aber niemand so recht abnahm, außer mir. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass beide keiner dogmatischen Partei-Haltung frönten, sondern sich nach den aktuellen und lokalen Gegebenheiten richteten.
„Nun lasst doch mal die Sau raus“, forderte sie Christian auf, „und macht nicht so ’ne Show. Wer kriegt bei der nächsten Wahl eure Stimmen?“
„Schon mal was vom Wahlgeheimnis gehört?“, konterte Bernd. „Aber im Ernst: Ich weiß nicht, was meine Frau wählt, ich zumindest mache es von den jeweiligen Umständen abhängig. Es kann schon mal sein, dass ich auf kommunaler Ebene CDU oder SPD wähle, je nach Kandidaten, und auf Bundesebene eben GRÜNE, also vielleicht, wer weiß, kommt ganz drauf an!“
Ähnlich äußerte sich Gitti, die demnächst im Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesamt für Sera und Impfstoffe, anfangen würde. Sie war inzwischen unsere Expertin in Sachen AIDS, dem hochaktuellen Gesundheits- und Sex- beziehungsweise Anti-Sex-Thema. Sie informierte uns bereits jetzt über ihr Lieblings- und zukünftiges Arbeitsgebiet, über die neuesten Erkenntnisse aus der Impfindustrie und aus dem staatlichen Zulassungs- und Kontrollapparat.
„Meine Parteipräferenz? Was ich wähle? Was weiß ich!“, sagte sie. „Es kommt ganz auf die aktuellen Angebote der Parteien an. Und was sie gegen AIDS zu tun gedenken.“
Von AIDS, der unheilbaren, unweigerlich tödlich verlaufenden Krankheit, über die Ansteckungs- und Übertragungsgefahren bis hin zur Frage, ob wir eigentlich unsere Kinder schon hatten taufen lassen, bedurfte es keiner großen Gedankensprünge.
„Nein, Karola und Luca sind noch nicht getauft“, sagte Emma. „Wir hätten es euch schon gesagt. Aber wir haben es vor. Wahrscheinlich um die Osterzeit herum. Wenn das Wetter mitspielt, machen wir ein Gartenfest.“
„Seid ihr noch in der Kirche?“, fragte Doris.
„Nein“, antworteten Emma und ich wie aus einem Mund.
Ich war bereits zwei Tage nach meinem achtzehnten Geburtstag zum Amtsgericht gegangen, um mich erleichtert von der obersten Heuchler-Instanz zu verabschieden. Der Eintritt in die Gemeinde erfolgte stets automatisch, doch der Austritt machte einen amtsgerichtlichen Staatsakt – manchmal samt Begründung – nötig. Die Austrittsurkunde hing ich mir damals gerahmt in mein WG-Zimmer. 1968 hatte das ungenügende Engagement der Kirchenhäuptlinge gegen den Vietnamkrieg meine anti-kirchliche Haltung beflügelt. Besonders galt das für dieses eine Bild mit dem Militärpfarrer, der jenen hässlichen Langstreckenbomber mit Weihwasser besprühte. Gleichwohl lernte ich später viele ehrliche Christen in der Friedensbewegung schätzen.
„Man will ja seine Kinder nicht zu Sonderlingen machen“, sagte Emma, und ich stimmte ihr zu.
„Wenn alle zum Religionsunterricht gehen, nur deine Tochter hat eine einsame Freistunde, dann muss sich das Kind ja ausgeschlossen fühlen“, sagte ich. „Die Kinder können ja später entscheiden, ob sie der Kirche angehören wollen oder nicht.“
„Ich wurde stockkatholisch erzogen und kenne die Doppelmoral dieser Brüder und Schwestern in- und auswendig“, sagte Gitti. „Aber ich bin immer noch in diesem Verein, weil ich denke, dass man seinen Kindern später keinen Gefallen tut, wenn bei der Kommunion alle Eltern gläubig neben ihren Kindern auf der Kirchenbank sitzen, aber deine Kids wissen, dass du zu der Sache nicht wirklich stehst.“
„Was willst du damit sagen?“ Anne sah Gitti skeptisch, fast misstrauisch, an.
„Ich will damit sagen, dass ich glaube, dass man die Kirche auch verändern kann. Dass man dabei bleiben sollte, wenn man sie verändern will. Dass es genug Potential in der Kirche gibt, um der Aufrichtigkeit und der Umsetzung christlicher Werte gerecht zu werden.“
Anne schüttelte unmerkbar den Kopf und murmelte vor sich hin: „Na, dann mal viel Erfolg mit all den alten schmierigen Männern.“
„Ja, es sind schwierige Männer. Aber eines Tages werden …“ Gittis Satz brach unvollendet ab und niemand machte sie auf ihren Hörfehler aufmerksam.
Denn jetzt kam Moni mit sechs Botteln belgischem Bier zurück. Doch bevor wir die Flaschen köpften, starteten wir in die zweite Saunarunde, und erst danach aßen wir die Salate und Hähnchenschenkel und ließen uns das belgische Bier schmecken, wobei Doris dieses Mal kein Igitt, sondern einen wirklich undefinierbaren und doch irgendwie zufrieden-glucksenden Sufflaut hervorstieß.
Traumreise nach London
Emma schlief schon. Ich war angenehm erschöpft, aber noch nicht müde. Die beiden Saunagänge hatten gut getan – auch die Gespräche über Gott und die Welt hatten meine Gedanken vom Besuch der Staatsschutzbeamten und dem mysteriösen Hintergrund abgelenkt. Schlafen konnte ich noch nicht. Also knipste ich meine Nachttischlampe an und legte ein buntes Tuch darüber, damit Emma und Luca nicht wach wurden. Karola schlief schon in ihrem eigenen Kinderzimmer.
Ich griff zu meinem Schmöker auf dem Nachttisch, war im Nu in Orwells »1984« versunken und erlebte mit Winston Smith die Welt der allgegenwärtigen Überwachung. Keine Ahnung, wie lange ich gelesen hatte; ich weiß nur, dass mich die Sache mit dem »Neusprech« sehr beschäftigte. Wenn ich nur mehr darüber erfahren könnte … Dann musste ich gerade noch das Licht ausgeknipst haben und mir mussten die Augen zugefallen sein …
Es ist mir völlig schleierhaft, wie ich bei all diesen Kontrollen nach London gelangt war. Es war jedenfalls ein klarer, kalter Tag im November, und die Glocken am Big Ben schlugen gerade dreizehn, als ich den Victory-Block erreichte, in dem Winston Smith wohnte. Ich ging rasch durch die Glastür, nachdem mir ein unbestimmtes Summen anzeigte, dass Mr. Smith auf mein Klingeln hin den Öffner betätigt hatte.
Irgendwie roch es seltsam im Flur. Aber noch seltsamer war das Riesenplakat, von dem mir ein übergroßes weibliches Gesicht streng entgegensah – so, als wollte mich die Eigentümerin dieser Wohnanlage, oder wer immer es war, vor Ungehorsam warnen. Das Gesicht war so aufgenommen, dass mich ihre herrischen Augen überallhin verfolgten. Ich schaute nach, ob die darunter aushängenden Zettel einen Hinweis auf den strengen Blick gaben. Tatsächlich hing dort die Hausordnung, die ich jedoch nicht zu lesen beabsichtigte. Darüber konnte mir Winston gewiss Auskunft erteilen. Unter dem Plakat stand in fetten Lettern: »Sie sieht dich! Sie liebt dich!«
Winstons Wohnung lag sieben Stockwerke hoch, der Aufzug war außer Betrieb, und ich kam schnaufend an. Der Mann, der mir die Tür öffnete, sah verhärmt und grau aus. Seine Augen waren faltenumwölkt, hatten jedoch noch einen seichten Glanz und strahlten einen Rest Hoffnung aus, als sie mich wahrnahmen. Als hätte er mich lange schon erwartet, bat er mit einer einladenden Geste hinein, jedoch ohne ein Wort zu verlieren. Stattdessen legte er den Zeigefinger auf den Mund und bedeutete mir, ihm schweigend zu folgen.
Smith war eine magere, gebrechliche Gestalt, die fast etwas Geisterhaftes an sich hatte. Betont wurde dies durch die graue Tory-Parteiuniform, die er trug, einer Art Trainingsanzug. Über seiner linken Brusttasche, dort, wo das Herz sitzt, war ein roter Punkt aufgenäht. Es bedeutete, dass Winston Smith eine Vertrauensperson innerhalb des Parteiapparates und somit auch im Ministerium war.
Aus einem in die Wand eingelassenen modernen Volksempfänger, vermutlich aus Leichtmetall, der im Flur seitlich der Eingangstür angebracht war, klang eine blecherne Stimme und verlas Zahlen zur aktuellen Rüstungsproduktion. Winston drehte an der rechten Seitenwand an einem Metallrädchen. Er drehte es bis zum Anschlag, so dass die Stimme zwar leiser gestellt, aber nicht abgestellt werden konnte. Kurz hinter der Wohnungstür nahm Winston ein Tuch von der Linse des Volksempfängers, das bisher verhindert hatte, dass ich in ihr Blickfeld geriet. Es war ein Gerät, das sich »Televisor« nannte und das der Durchsage von Nachrichten für die Ministeriumsmitarbeiter, aber auch dem Empfang von Geräuschen und Gesprächen aus den Wohnungen und Büros derselben diente. Das Gleiche erfolgte auf optischem Weg – die Sendung und der Empfang von Bildern. Wir bogen hinter dem Gerät in ein Zimmer ein, das völlig verdunkelt war.
„Zwangshören?“, fragte ich extrem flüsternd. Ich konnte mir das absolute Schweigen nicht antun. Zu sehr war ich die Freiheit der Rede und der Gedanken gewohnt.
Sofort legte Winston seinen Finger wieder auf die Lippen. „Das Friedensministerium! Man kann den Televisor nicht abstellen!“, flüsterte er zurück und verschwand im Dunkel des Zimmers, in das ich ihm schweigend folgte. „Hier können wir uns leise unterhalten.“
„Danke, dass du unter diesen schwierigen Umständen zu einem Interview bereit bist“, sagte ich. „Wir können uns doch duzen, oder?“
„Wenn man mich verrät und beseitigt, ist es gleich, ob wir uns geduzt oder gesiezt haben.“
Ich fand es schade, dass wir uns hier im Dunkeln nicht sehen konnten. Gerne hätte ich seinen Gesichtsausdruck, seine emotionalen Regungen wahrgenommen. Schließlich hatte ich als Journalist gelernt, nicht nur die gesagten Worte, sondern auch die Körpersprache im Zusammenhang mit jenen bloß mit den Lippen geformten Lauten zu deuten.
„Ist es so schlimm?“, fragte ich. Mir war daran gelegen, für meine zukünftige wissenschaftliche Arbeit zum Datenschutz und zur Informationsfreiheit Fakten aus dem Dschungel zivilisatorischer Überwachungsdiktaturen zu sammeln. Und natürlich interessierte mich diese neue Sprache, das Neusprech.
Winston tastete nach meiner Hand und führte mich zu einem Sessel. „Nimm Platz.“ Vorsichtig ließ ich mich nieder. Dann saß ich in einer tiefen, weichen Mulde. Links und rechts mit Armlehnen versehen, fühlte ich mich etwas eingeengt, aber das sollte mich nicht stören, sobald ich nur meine Fragen wahrheitsgemäß beantwortet bekäme. Ich hörte, wie sich Winston räusperte.
„Es ist mehr als schlimm. Einen schlimmen Zustand kann man zumeist wieder ändern. Aber diesen endgültigen Verlauf kannst du nicht korrigieren, nicht rückgängig machen. Sie löschen Stück für Stück die Vergangenheit unwiederbringlich aus. Als Mitarbeiter der Abteilung IV des Wahrheitsministeriums bin ich unablässig mit der Korrektur alter Dokumente beschäftigt. Ich muss frühere Zeitungs- und Wissenschaftsartikel »verdeutlichen«, wie es in Neusprech heißt, also neu deuten. Ich muss ganze Bücher umschreiben, um die Vergangenheit umzudeuten und der Gegenwart anzupassen.“
„Artikel neu deuten, sie »verdeutlichen« – was meinst du damit?“
„Ich? Ich meine überhaupt nichts; es ist nicht mein Begriff. Es ist der Begriff der anderen! Die da oben meinen, man müsse die Erinnerung an alte Zeiten der neuen Zeit anpassen. Das nennt der Wahrheitsminister »verdeutlichen«. Sie wollen die Vergangenheit aus dem Gedächtnis tilgen, um der neuen, der sogenannten »wirklichen Wahrheit« Platz zu schaffen. Aber dies soll schleichend geschehen, durch immer neue, kleinere, fast unmerkliche und stetige Korrekturen, durch permanente Umdeutungen, bis schließlich keine wahre Erinnerung mehr existiert. Nach dem Motto: Steter Tropfen höhlt den Stein.“
„Wie soll das geschehen? Man kann doch nicht die Vergangenheit aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwinden lassen!“
Vom Flur her hörte man weiter die überschwängliche Verlesung der Produktionszahlen zu neuen Pershings und zu atomar bestückten Jagdbombern sowie zu den in Erdbunkern rund um London versteckten Atomminen, die gezündet würden, sobald der Feind sich der Stadt nähern würde. Selbst mir, der ich mich in einem sicheren Land lebend dünkte, wurde Angst und Bange, als ich die endlose und voller Freude vorgetragenen Zahlen zur weiteren Aufrüstung gegen den Ostfeind vernahm.
„Präsident Reagans Idee, dieser Rüstungswahn“, sagte Winston. „Die Eiserne Lady ist seine zweite Hand, seine Vollzieherin in Übersee.“
Jetzt erst erkannte ich das strenge Frauengesicht, dass von allen Plakaten in dieser grauen Stadt auf die Menschen herunterschaute und deren Blicke jedermann unerbittlich verfolgten – es war Margaret Thatcher. Sie hatte den Falklandkrieg geführt und gegen Argentinien gewonnen. Biertrunken hatte ihr das Volk gedankt.
Sie war die Stellvertreterin der USA in Europa und im Rest der Welt. Sie war Reagans Sprachrohr in der NATO und seine Vollstreckerin in den absolut notwendigen Auslandskriegen, um die Macht der imperial Mächtigen zu zementieren. Aber auch nach innen musste ein unbändiger und unablässiger Krieg geführt werden. Sie fuhr einen harten Vernichtungskurs gegen die Gewerkschaften, gegen Arbeitnehmer und Sozialisten. Sie hebelte deren verbürgte Rechte aus. Sie hatte die britische Industrie nach Reagans Vorbild an China versilbert, um dort billig produzieren zu lassen, und um mit dem eingenommenen Silberschatz den Finanzsektor zu füttern.
„China wird unsere Werkbank! Und wir beherrschen die Weltfinanzen“, pflegte Mrs. Thatcher zu sagen.
„Die Konservativen werden eines Tages jammern, dass sie ihre Industrie ins Ausland verscherbelt haben, nur um jetzt kurzfristig Profit zu machen und das Finanzkarussell zu beschleunigen. Sie wollen mit wenig Aufwand schnelle Casinogewinne einfahren“, sagte Winston halblaut.
„Alles für die »Londoner City«? Alles für die »Bank of London«?“
Er antwortete nicht, wahrscheinlich hatte er genickt, wie ich in diesem abgedunkelten Zimmer vermutete.
Thatcher und ihre Tories hatten dem Staat das Recht genommen, die Finanzindustrie zu regulieren. Mit ihren einschneidenden Maßnahmen läuteten sie den Beginn des ungezügelten Casinokapitalismus ein. Sie privatisierten die Staatsunternehmen und reduzierten den Staat auf einen Erfüllungsgehilfen der Finanzoligarchen. Seither waren nur noch vier Ministerien zum Regieren nötig. Ihre Aufgaben waren bescheiden: Krieg führen, Liebe unterminieren, Chaos fördern, die Massen verdummen, sie auf Trab und knapp halten. Mehr war zum Regieren nicht nötig.
Das Wahrheitsministerium, abgekürzt und in der Neusprache »Miniwahr« genannt, befasste sich vornehmlich mit der Neuschreibung der Geschichte sowie mit dem Nachrichtenwesen, der Propaganda, dem Freizeit- und Erziehungswesen und mit allen Kultur- und Kunstangelegenheiten. Winston war in Abteilung IV beschäftigt, die aus mehreren tausend Mitarbeitern bestand und sich der permanenten Geschichtsrevision widmete.
„Was machst du da genau?“, fragte ich.
„Du wirst es am besten begreifen, wenn du mich an meinen Arbeitsplatz begleitest. Aber um nicht aufzufallen, musst du dazu eine Parteiuniform der Tories tragen. Sobald du sie anhast, können wir aus dem dunklen Zimmer heraus. Wenn dich der Televisor dann zufällig erfassen sollte, wirst du zumindest nicht automatisch gemeldet und einbestellt. Bei einer Einbestellung würdest du als NZG identifiziert und wir würden vor Gericht enden. Das wäre für uns beide das Ende.“
„NZG? Was heißt das?“, fragte ich.
„Nichtzugehöriger.“ Winston reichte mir in der Dunkelheit eine Tory-Trainingshose, damit ich sie gegen meine Jeans wechseln konnte. Als ich die Hose wie auch die Trainingsjacke angezogen hatte, fuhr ich mit der Hand über meine linke Brusthälfte und spürte den Aufnäher.
„Welche Farbe hat mein Punkt?“
„Natürlich Rot, damit du im Ministerium nicht auffällst“, sagte Winston.
Ich zog meine neue Trainingsjacke stramm.
„Fertig angezogen?“
„Ich bin bereit“, sagte ich. Wir gingen in die beleuchteten Zimmer hinüber.
Ich wusste es schon, aber Winston warnte mich erneut und eindringlich: Der Televisor war gleichzeitig Empfangs- und Sendegerät, das sämtliche Geräusche und Bewegungen registrierte und an eine zentrale Parteidienststelle meldete, wo die Parameter in einem Rechenzentrum ausgewertet wurden. Auffälligkeiten wurden mit der Einschaltung der Gedankenpolizei quittiert. Ob man auffällig geworden war und gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt überwacht wurde, war gewissermaßen Glücksache. Doch man war instinktiv darauf eingestellt, jederzeit vom Televisor ins Visier genommen und ausgespäht zu werden.
Die Gedankenpolizei bestand aus einer Spezialeinheit von Informatikern, deren besondere Gabe es war, aus dem maschinellen Who-is-Who politische Raster herauszufiltern, um Gedankenabweichler erkennen zu können.
Ein kurzer Blitzgedanke durchzuckte mich. Ich erinnerte mich an Horst Herolds in den 70er-Jahren entwickelte und erstmals 1979 erfolgreich gegen die RAF angewandte Rasterfahndung in der BRD.
Dann kehrten meine Gedanken zurück nach London. Gedankenabweichler in den Reihen des Herrschaftsapparates konnten nicht geduldet werden. Innerhalb der Partei wurde ein Gedankenverbrechen mit der gesellschaftlichen Zurückstufung in das Heer der Masse geahndet. Innerhalb der Ministerien wurden Gedankenverbrechen mit der Vaporisierung der Gedankenverbrecher bestraft. Salzsäure, Verdunstung oder einfache Verdampfung waren die vorherrschenden Mittel der Wahl, um Gedankenverbrecher zu eliminieren.
Von ihnen durfte nichts zurückbleiben, kein Vermächtnis, kein überliefertes Wort, kein Erinnerungsgegenstand, keine Urkunde, weder Gehaltsbescheinigungen noch irgendwelche Kleidungsstücke.
„Wenn wir erwischt werden, werden wir aus der Geschichte der Menschheit für immer verschwinden. Nichts von uns wird übrig bleiben. Niemand wird sich an uns erinnern können. Willst du das Risiko wirklich eingehen?“
Ich schaute Winston an, und dann sah ich auf das einen Kilometer entfernte, wuchtig und weiß aus der düsteren Landschaft emporragende Wahrheitsministerium.
„Bin bereit“, sagte ich und nickte entschieden, wie man nickt, wenn man sich selbst überzeugen und überwinden will.
Das also, dachte ich mit einer Art diffusem Abscheu, ist jenes London, von dem ich als Schüler geschwärmt hatte, weil hier die Beatles im September 1969 über den Zebrastreifen der Abbey Road gegangen waren und ihren Song dabei gesungen hatten:
Something in the way she moves
attracts me like no other lover
Something in the way she woos me
I don't want to leave her now
You know I believe and how
Somewhere in her smile she knows
that I don't need no other lover
Auch Winston Smith war in seinen Kindheitserinnerungen gefangen und versuchte nachzuforschen, ob London immer so ausgesehen hatte. Die ständige Neubearbeitung der Vergangenheit, durchgeführt von tausenden zur strengsten Verschwiegenheit verpflichteten Ministeriumsbeamten, der Austausch von alten gegen neue Fotos in den Dokumenten der staatlichen Archive, die Neubeschreibungen der Zustände in alten Tages- und Wochenzeitungen – das alles hatte in Winstons Gedächtnis bereits einige verunsichernde Lücken hinterlassen.
Manchmal wusste er selbst nicht mehr, ob dem, was er an Vergangenheit korrigierte, nun bereits die brandneue oder schon die mehrfach bearbeitete oder vielleicht noch die ursprüngliche Version der Wirklichkeit zugrunde lag. Er kam zusehends durcheinander.
Hatten da immer diese langen Reihen heruntergekommen aussehender Häuser aus dem neunzehnten Jahrhundert gestanden? Waren die zerbombten Ruinen, auf deren Trümmer Unkraut wucherte, Überbleibsel des Zweiten Weltkriegs oder doch der Beweis neuer Kriegshandlungen, in die Großbritannien auf ewig verstrickt schien, als sei es eine gottgewollte Selbstverständlichkeit?
Wir beeilten uns, um nicht zu spät an Winstons Arbeitsplatz zu kommen. Was bedeuteten die in der Ferne zu hörenden Detonationen? Waren es aktuelle Bombeneinschläge oder kamen die Einschlagsgeräusche bloß aus den Lautsprechern an den viktorianisch verzierten Straßenlaternen? Aber Winston schwieg vor sich hin und erinnerte sich nicht wirklich, während das Wahrheitsministerium in seiner übergroßen Dimension immer näher rückte.
Wir hatten jetzt nur noch eine Strecke von vielleicht zweihundert Metern bis zum Eingang vor uns.
„Wird man mich einlassen?“ Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man ohne irgendeine elektronische Erkennung in das Zentrum der Macht gelangen konnte.
„Der rote Punkt ist fälschungssicher. Er besteht aus einem besonderen, einem geheim gehaltenen Farbspektrum, das nur ein spezielles optisches Spektrometer erkennen kann.“
Ich wunderte mich, wie weit entwickelt dieses heruntergekommene Land war. Im internationalen Vergleich des Bruttoinlandsproduktes rangierte es auf Platz Sieben hinter der DDR.
„Was, wenn man meinen Ausweis sehen will?“, fragte ich.
„Wir kommen ohne persönliche Kontrolle hinein. Bleibe einfach an meiner Seite und frage mich harmlose Dinge, wie zum Beispiel, ob ich dir aktuelle Rüstungszahlen oder die Berichtszahlen über die in der letzten Schlacht gefallenen feindlichen Soldaten nennen kann. Das sind die üblichen Unterhaltungen, und wir fallen nicht auf, wenn wir entschlossen und wie gute alte Kollegen durch marschieren.“
„Was wäre meine Funktion an deinem Arbeitsplatz?“
„Du wirst von mir als mein neuer Kollege angelernt, ganz einfach.“
Die Sonne fiel an diesem Morgen auf die unzähligen Fenster des Wahrheitsministeriums, deren Glas die Strahlen erbarmungslos zurück in die staubdurchsetzte Luft schleuderte. Die von der Sonne abgewandten seitlichen Fensterschlitze sahen aus wie Schießscharten einer Festung an der Atlantikwestfront 1942. Mein Herz schlug wild und ich fühlte Schweißperlen, die sich an meinem Haaransatz bildeten. Diese riesige Pyramide aus Schießscharten war uneinnehmbar; sie war ein Monument der neuen, der momentan absoluten Wahrheit:
Wer die Macht zur Gestaltung der Gegenwart hat, hat die Macht über die Wahrheit. Wer über die Gegenwart verfügt, hat die Macht zur Veränderung der Vergangenheit und damit die Macht zur Gestaltung der Zukunft. Das jedenfalls war das Theorem, das Winston aus dem Parteiprogramm zu verstehen glaubte.
Die Tories sagten, das Inselreich Großbritannien habe schon immer den verbündeten USA als riesiger Flugzeugträger gegen den Ostfeind gedient. Winston Smith aber wusste, dass es früher einmal andere Kräftekonstellationen gegeben hatte. Aber wo war dieses Wissen verankert? Nur in seinem eigenen Bewusstsein, das früher oder später samt seinem Körper unweigerlich in Staub zerfallen und von reflektierten Schießscharten-Sonnenstrahlen durchlöchert würde.
Wenn die Massen die von der Partei verbreiteten Lügen glaubten, wenn alle Schriftdokumente, Lehr- und Tagebücher, Romane, Zeitungen und Zeitschriften, Filme, Bilder und Hörspiele umgeschrieben wären und gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit.
Im Parteiprogramm stand unzweideutig etwas, was Voraussetzung des sogenannten Zwiedenkens war. Es war einfacher formuliert als Winston es je zu formulieren in der Lage gewesen wäre: „Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft; wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.“ Somit war festgelegt, dass das gegenwärtig Wahre wahr blieb bis in alle Ewigkeit. So einfach war das. Es war nichts weiter nötig als eine nicht abreißende Kette von Siegen über das eigene Gedächtnis, eine Art sanfter Gehirnwäsche, indem frühere Erinnerungen von der kriegerischen Macht der Gegenwart verdrängt wurden. »Wirklichkeitskontrolle« nannten sie es; in der Neusprache hieß es »Zwiedenken«.
Ich konnte Winston natürlich nicht an seinem Arbeitsplatz zu diesen mir so interessant erscheinenden Themen »Neusprech« und »Zwiedenken« interviewen. Hinter seinem Schreibtisch hing ein Televisor, der alles beobachten konnte. Ich wäre den Aufpassern mit meiner Fragerei direkt ins Netz gegangen.
„Setzen Sie sich bitte“, sagte Winston und siezte mich, weil wir nun offiziell Kollegen waren und es den Mitarbeitern untereinander verboten war, sich zu duzen. Das Duzen konnte persönliches Vertrauen schaffen und war somit eine Gefahr für die Partei.
„Womit gedenken Sie Ihre Arbeit zu beginnen?“, fragte ich in einem möglichst glaubwürdigen und gestelzten Englisch.
„Ich führe Sie als Erstes in die Systematik unserer Arbeitsweise ein.“ Er deutete an die Seitenwände neben seinem Schreibtisch, wo ich drei mit Klappgittern geschützte Schlitze in unterschiedlicher Größe sah. „Hier sehen Sie unsere wichtigsten Papierkörbe. Wir nennen sie Gedächtnislöcher. Sie existieren überall im gesamten Ministeriumsgebäude, auch auf den Fluren und in den Aufzügen.“
„Was dürfte ich darin entsorgen?“
„Wenn man weiß, dass ein Dokument zur Vernichtung bestimmt ist oder man sieht inoffizielle Papiere, getarnt als Abfallpapiere, herumliegen, ist es unsere Pflicht, das Schutzgitter des nächstbesten Gedächtnisloches hochzuklappen und das Papier dem darin herrschenden Luftsog zu überlassen.“
„Ein Luftsog soll etwas vernichten?“, fragte ich ahnungslos.
„Der Luftstrom wirbelt das Stück Papier fort zu unseren hochmodernen Verbrennungsöfen, die im Tiefgeschoss acht Etagen unter der Erdoberfläche arbeiten und an die Energieversorgung des Gebäudes angebunden sind.“