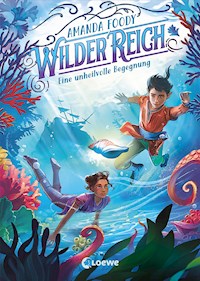
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: WilderReich
- Sprache: Deutsch
Das Abenteuer ruft … Zwischen bunten Fischschwärmen und funkelnden Korallen lauert große Gefahr: Lochmordra, das Legendäre Biest des Weiten Meeres, greift Inseln und deren Bewohner an. Die Lehrlinge Barclay, Viola und Taron helfen den Wilderweisen, das Land zu beschützen. Dabei gerät Barclays Wilderkraft immer wieder außer Kontrolle und richtet noch mehr Verwüstung an. Er zweifelt stark an sich – doch Barclay muss seine Unsicherheit schnell überwinden, denn Lochmordra ist nicht die einzige Bedrohung … Band 2 der mitreißenden Fantasyreihe! Der zweite Band der mitreißenden Kinderbuchreihe ab 10 Jahren, die Abenteuer, Spannung und Wildnis miteinander verbindet. Freundschaft und Identität treffen auf eine coole Unterwasserwelt und Tiere – die packend erzählte Geschichte sorgt mit kreativen Wortfindungen für spannende Unterhaltung. Fantasyfans von Woodwalkers, Seawalkers und Animox werden großen Spaß am Lesen haben! Der Titel ist bei Antolin gelistet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FÜR GOLDIE, MEIN ERSTES HAUSTIER, UND PEACH, EIN JAHRMARKTSGEWINN –IHR WART BEIDE AUSGEZEICHNETE GOLDFISCHE
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 – Barclay Torn rannte …
Kapitel 2 – Die Möwen-Wilderbiester …
Kapitel 3 – Eine Stunde später …
Kapitel 4 – Die Fahrt veränderte …
Kapitel 5 – Edwyn gähnte und …
Kapitel 6 – Etwas knallte und …
Kapitel 7 – Am Abend kehrten …
Kapitel 8 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 9 – Am nächsten Morgen …
Kapitel 10 – Nach einer Woche …
Kapitel 11 – Was ist das …
Kapitel 12 – Barclay war nun …
Kapitel 13 – Ohne das Krächzen …
Kapitel 14 – Ich kapier’s nicht …
Kapitel 15 – Alle zurück zum …
Kapitel 16 – Zehn Tage lang …
Kapitel 17 – Obwohl Barclay immer …
Kapitel 18 – Barclay eilte zurück …
Kapitel 19 – Zitternd taumelten die …
Kapitel 20 – Ich versteh’s immer …
Kapitel 21 – Wir müssen ihm …
Kapitel 22 – Barclay hustete Salzwasser …
Kapitel 23 – Barclay und Taron …
Kapitel 24 – Am nächsten Morgen …
Ein Reisetagbuch gefährlicher Wilderbiester
Kapitel 1
Barclay Torn rannte so schnell, dass er fast über den Rand der Welt sauste.
»Boah!«, schrie er und schwenkte gerade noch rechtzeitig ab, bevor der Boden steil abfiel. Er ruderte mit den Armen, um nicht vornüberzufallen, und plumpste rückwärts in das hohe Gras und den glitschigen Matsch. Dann kroch er an das Ende der Klippe, wo sich ihm der unglaublichste Ausblick bot, den er je gesehen hatte.
Eine einzige graue Weite – graues Wasser breitete sich in alle Richtungen aus, bis es auf den grauen Horizont traf. Barclay war jetzt schon seit dreizehn Wochen unterwegs und obwohl er auf seiner Reise durch viele Orte gekommen war – malerische Dörfer, prächtige Städte und unberührte Wildnis –, hatte er zum ersten Mal wirklich das Gefühl, ein Abenteuer zu erleben.
Sie hatten endlich das Weite Meer erreicht.
»Das ist nicht das Weite Meer«, sagte jemand trocken und Taron Murdock trat neben ihn. Genau wie Barclay war Taron ein Wilderweisen-Lehrling. Und genau wie Barclay hatte er sich dem Legendären Biest des Düsteren Waldes gestellt. Trotzdem waren die beiden nicht gerade die besten Freunde. »Das ist ein Golf. Es sieht kein bisschen wie das Weite Meer aus.«
Barclay schäumte innerlich vor Wut. Wie sollte er das wissen? Er war aus den Anderorten, wie Wilderweisen alle Länder nannten, in denen keine magischen Wilderbiester lebten. Genauer gesagt war Barclay aus Biederford, einer kleinen und spießigen Stadt jenseits des Düsteren Waldes, einem anderen der sechs Wilderlande. Und sehr, sehr weit von hier entfernt.
»Wie sieht das Weite Meer denn dann aus?«, fragte Barclay. Er konnte sich kein Gewässer vorstellen, das noch größer war als dieses hier. Er schluckte nervös, schob sich vorsichtig nach vorn und blickte in die Tiefe. Mehrere hundert Meter unter ihm schlugen Wellen gegen die Felsen.
Taron verdrehte die Augen. »Glaub mir – wenn wir am Weiten Meer ankommen, weißt du’s sofort.«
Ganz gleich, ob das stimmte oder nicht, Barclay würde sich dieses Abenteuer nicht von Taron vermiesen lassen. Er sah hinter sich, um sich zu vergewissern, dass die Luft rein war, und flüsterte: »Krux, du musst dir das ansehen.«
Bei dieser Aufforderung erschien neben Barclay eine riesige wolfsähnliche Kreatur, deren Fell so dunkel und struppig war, dass es den Rauchschwaden eines Waldbrandes ähnelte. Sie hatte dunkle Augen, schwarze Klauen und am Rücken entlang dünner werdendes Fell, das den Blick auf Wirbel und Knochen freilegte.
Barclay hatte anfangs schreckliche Angst vor Krux gehabt, weil alle Bewohner der Anderorte dazu erzogen wurden, sich vor Wilderbiestern und ihrer gefährlichen Magie zu fürchten. Aber jetzt legte er einen Arm um den Lufthund und schmiegte sich an den Körper des Biests.
»Hast du so was schon mal gesehen?«, fragte er.
Krux schüttelte den Kopf und wedelte begeistert mit dem Schwanz.
Neben ihnen verzog Taron das Gesicht.
»Was ist los?«, fragte Barclay, auch wenn Taron nie einen besonderen Grund brauchte, um ein Miesepeter zu sein.
»Ich bin hier zu Hause«, grummelte Taron.
»Was habe ich euch gesagt?«, schimpfte ihre Meisterin Runa Rasgar hinter ihnen. Sie war am Rand des Klippenpfades stehen geblieben. »Schick Krux zurück in sein Mal.«
Runa gehörte nicht zu der Sorte Mensch, von der man zurechtgewiesen werden wollte. Sie trug den Ledermantel und den Kettenpanzer einer Kriegerin. Über die rechte Seite ihres Gesichts zog sich eine schaurige Narbe, die wie eine geriffelte Spur in ihre helle Haut geritzt war. Sie war eine berühmte Wächterin, sechsfacher Dooling-Champion und angsteinflößend genug, um sich den Spitznamen »die Nachtklaue« verdient zu haben.
Wie immer lungerte Viola Dumont, die gemeinsam mit Barclay und Taron in der Lehre war, in Runas Schatten. Sie schnalzte mit der Zunge und spiegelte die Missbilligung ihrer Meisterin wider.
Krux winselte. Da sie auf ihrer Reise größtenteils durch Anderorte gekommen waren, hatten die vier ihre Wilderbiester nicht aus ihren goldenen, tattoo-ähnlichen Malen gelassen, in denen sie verborgen blieben. Barclay hatte auf die harte Tour gelernt, dass Anderlinge schon bei dem kleinsten Verdacht eines Wilderweisen in ihrer Mitte sofort zu Fackeln und Mistgabeln griffen.
»Aber wir sind auf dieser Straße den ganzen Morgen noch keiner Menschenseele begegnet«, protestierte Barclay. »Krux möchte einfach nur rennen. Kann er nicht …«
»Leider nicht.« Runa zeigte auf etwas in der Ferne. »Steh auf, dann verstehst du auch, warum.«
Barclay stellte sich hin und blickte den Hügel hinunter. Ein Dorf mit grauen Feldsteinhäusern schmiegte sich unter ihnen an die Küstenlinie und Rauch quoll aus den schiefen Schornsteinen.
Barclays Brust kribbelte vor Aufregung. Sie waren endlich an ihrem Ziel angekommen.
»Tut mir leid, alter Freund«, sagte Barclay zu Krux und schickte ihn zurück in das Mal auf seinem Oberarm, das weiter über Barclays blasse Haut schlich, als wäre es verärgert. Doch nachdem Krux ein paar Runden gedreht hatte, rollte er sich zusammen, um ein Nickerchen zu machen.
Die Gruppe machte sich wieder auf den Weg und ging den sich windenden Pfad hinunter zum Dorf.
Neben Barclay klirrte und klapperte Viola beim Gehen. Ihr ganzer Mantel war von oben bis unten mit so vielen goldenen Anstecknadeln und Broschen bedeckt, dass Barclay kaum den Wollstoff darunter ausmachen konnte. Sie behauptete, der ganze Schnickschnack würde ihren Drachenwelpen Mitzi davon abhalten, an ihren Ohren und an ihren bauschigen Haarknoten zu knabbern. Trotzdem hatte sie einen winzigen, geschwollenen Bluterguss auf ihrer hellbraunen Wange, wo Mitzi sie kürzlich leicht gebissen hatte.
»Wie schaffst du es bloß immer, so schmutzig zu werden?«, fragte Viola ihn.
Barclays Kleider und seine Hände waren mit getrocknetem Schlamm überzogen. Zu Hause in Biederford hätte ihn das sofort in Panik versetzt, weil es gegen eine der vielen albernen Vorschriften der Stadt verstieß, die alles von Unreinlichkeit bis hin zu Schluckauf verboten.
Aber jetzt zuckte Barclay nur mit den Schultern. »Wie kommt es eigentlich, dass du allem zustimmst, was Runa sagt?«
Viola spielte an ihren Anstecknadeln herum und schaute verlegen. »Tu ich gar nicht.«
»Und ob«, murmelte Taron.
»Sind da nicht irgendwo Blumen, die du zertrampeln könntest?«, schoss sie an Taron gewandt zurück. »Oder Sonnenschein, über den du dich beschweren musst?«
Taron warf ihnen einen sehr typischen bösen Taron-Blick zu und stürmte voraus.
Kurz darauf erreichten sie das Dorf, einen trostlosen und traurigen Ort. Alle Türen und Fensterläden schienen aus verrottetem Treibholz zu bestehen. Schafe liefen auf der Hauptstraße neben dem Strand umher und kauten das spröde Gras, das inmitten des Sandes und der Pflastersteine spross. Die Luft roch nach Salz und Frühling und einer Menge Dung.
»Das ist die Stadt Knunx«, erklärte Runa. »Es ist die dem Weiten Meer am nächsten gelegene Anderorte-Stadt.«
Genau wie Biederford, dachte Barclay.
Viele Dinge in Knunx erinnerten ihn an Biederford. Die Dorfbewohner, an denen er vorbeikam, beäugten ihn und seine Freunde misstrauisch und Barclay wusste, dass die vier auch ohne ihre freilaufenden Wilderbiester ein eigenartiges Bild abgeben mussten. Barclays langes schwarzes Haar war von den Winden oben auf der Klippe wild zerzaust. Viola klapperte mit jedem Schritt. Und bei Runas bedrohlicher Erscheinung wandten alle Ladeninhaber den Blick ab.
Da sie offenbar das Unbehagen spürte, blieb Runa unten am Strand bei den Stegen stehen, auf denen Seeleute und Fischer geschäftig hin und her liefen. Sie ließ den Blick über Barclays ungebändigtes Haar und Violas merkwürdigen Mantel schweifen und ihn dann auf Tarons schlichtem blauen Pulli ruhen.
Sie zeigte auf Taron. »Geh und bitte diese Seeleute um eine Überfahrt zur Insel Munsey.«
Taron blickte noch mürrischer als sonst drein. »Konnte Orla uns kein Schiff schicken? Niemand wird sich bereit erklären, uns überzusetzen.«
»Orla hat viel um die Ohren. Wir müssen selbst sehen, wie wir dorthin kommen.«
Während sie sprachen, rempelte einer der Seeleute – ein stämmiger Mann mit einem aufgerollten Seil um die Schulter geschlungen – Taron an. Taron durchbohrte den Mann mit Blicken, als er davonspazierte.
»Ich begleite dich lieber«, sagte Runa schnell. »Wir werden hier bestimmt nicht lange willkommen sein.«
Als die beiden die Stege entlangmarschierten, fragte Barclay Viola: »Was ist die Insel Munsey? Wer ist Orla?«
Als Tochter des Groß-Wilderweisen, des Oberhaupts vom Wilderreich, wusste sie immer über solche Dinge Bescheid.
»Auf der Insel Munsey befindet sich das Gildehauptquartier des Weiten Meeres«, antwortete sie sachlich, »und Orla Ní Brennan ist die Hohe Wilderweise.« Die Hohen Wilderweisen waren jeweils für einen der sechs Standorte der Gilde verantwortlich und unterstanden dem Groß-Wilderweisen. »Das wüsstest du, wenn du deine Lektüre nicht vernachlässigen würdest, die dir Runa gegeben hat.«
Barclay las gern und kam nur selten nicht mit seinen Hausaufgaben hinterher. Aber weil er ein Anderling war, musste er sehr viel mehr über die Wilderlande lernen als Viola und Taron. Und so hatte ihm Runa die mühsame Aufgabe gegeben, während ihrer Reise seinen Rückstand aufzuholen.
»Ich vernachlässige meine Lektüre nicht«, gab Barclay zurück. »Aber wenn ich noch eine Einzelheit über den Großen Capamoo-Krieg oder die Ekelpocken-Seuche auswendig lernen muss, explodiert mein Kopf.«
Neben ihnen hievte ein Fischer ein Netz mit dem Fang des Tages auf den Landungssteg. Ein übler Gestank erfüllte die Luft – die dort aufgehäuften Fische waren alle tot. Sie ergossen sich über Barclays und Violas Stiefel und hinterließen schmierige Schlieren auf den Holzbrettern.
Viola sprang kreischend zurück. »Igitt«, murrte sie.
Barclay hielt sich die Nase zu. Wie auch immer diese Fische gestorben waren, es musste schon eine Weile her sein. Für den Verzehr waren sie bereits zu verdorben.
Bei der Sauerei murmelte der Fischer etwas in ihre Richtung, das Barclay nicht verstand, aber wohl »Entschuldigung« heißen sollte. Dann musterte der Fischer die beiden und riss ängstlich die Augen auf.
»Wilder-Coimadaí.« Diesmal war seine Stimme barsch, ganz gleich, was er da sagte. Er griff in seine Tasche und holte eine Trompetenmuschel heraus. Dann drückte er sie an sich und stürmte davon.
Weil Barclay die meiste Zeit mit Runa und den beiden anderen Lehrlingen verbrachte, vergaß er oft, dass sie sich alle in Wilderweisen-Sprache hörten. Wilderweisen benutzten sie, sobald sie mit einem Biest verbunden waren. Deshalb konnten sie einander verstehen, obwohl sie aus weit voneinander entfernten Teilen der Welt kamen. Aber der Fischer war ein Anderling.
»Hast du verstanden, was er gesagt hat?«, fragte Barclay. Viola war ein Sprachtalent.
»Die Sprache des Weiten Meeres habe ich nie gelernt, aber wenn ich raten müsste … würde ich sagen, dass das ihr Wort für ›Wilderweise‹ ist. Und seine Muschel hat mich an dein Gestrüpp-Amulett erinnert, das du früher mit dir rumgeschleppt hast. Weißt du noch? Davon hast du immer wie ein Stinktier gemüffelt.«
Barclay lief rot an. Nachdem er sich versehentlich mit Krux verbunden hatte und aus Biederford vertrieben worden war, hatte er sein Amulett mitgenommen. Immerhin sollte es angeblich Biester abwehren und Barclay war kurz davor gewesen, sich in den riesigen und furchterregenden Düsteren Wald zu wagen, in dem es von Wilderbiestern nur so wimmelte. Später hatte er erfahren, dass das Amulett völlig nutzlos war. Es hatte lediglich dazu gedient, ihn wie einen Idioten aussehen zu lassen.
»Die Bewohner von Biederford haben keine Ahnung, dass Wilderweisen sie vor Wilderbiestern beschützen. Sie wissen nur, dass Wilderbiester gefährlich sind«, gab Barclay hitzig zurück. »In Knunx ist es bestimmt nicht anders.«
Viola verschränkte die Arme. »Es ist ja nicht so, als würden wir ein großes Geheimnis darum machen, was wir tun. Anderlinge sind einfach undankbar. Du hast doch gesehen, wie der Seemann Taron angerempelt hat. Das war auf jeden Fall Absicht.«
»Die Bewohner von Knunx wissen, dass Wilderweisen sich mit Biestern verbinden. Sie glauben, dass wir sie in Gefahr bringen könnten.« Die Biederforder gingen mit verdächtigen Reisenden weitaus schlimmer um, wobei eine Ziegenherde auf sie zu hetzen oder sie mit schimmeligem Obst zu bewerfen, noch das Netteste war.
Viola stieß Barclay mit dem Ellbogen an. »Das glaubst du nur, weil du ein Anderling bist.«
Diese Worte hätten ihm nicht so wehtun sollen. Nicht nur, weil Viola ihn damit aufzog, sondern auch, weil die Menschen in Biederford ihn schrecklich behandelt hatten – und das schon vor seiner Verbannung aus der Stadt. Aber manche seiner dortigen Weggefährten würden ihm immer wichtig sein. Wie Meister Fungus, der hiesige Pilzbauer. Oder Bibliothekarin Havener, bei der er sich unzählige Abenteuerbücher ausgeliehen hatte. Und vor allem war Biederford die Heimatstadt seiner Eltern gewesen.
Und dort waren sie auch begraben.
Gravaldor, das Legendäre Biest des Düsteren Waldes, hatte bei seinem Angriff auf die Stadt vor fast acht Jahren Barclays Eltern getötet. Biederford hatte bei vielen Dingen unrecht, vor allem, wenn es um Wilderbiester ging. Aber Barclay verstand, warum sie sich fürchteten, und so konnte er es ihnen nur schwer vorwerfen.
Da er keine Lust verspürte, Viola seine gemischten Gefühle zu erklären, stapfte er stattdessen über den Strand. Bei den Stegen hatten Taron und Runa einen heftigen Streit mit einem anderen Seemann. Obwohl Barclay Taron verstehen konnte (»Ich bin nicht unhöflich, alter Mann!«, schrie er, während er unhöflich mit den Händen gestikulierte), waren ihm die Worte des Seemanns fremd. Seine Stimme hob und senkte sich, als wogten seine Worte wie das Meer. Doch seinem wütenden Tonfall nach zu urteilen, verlief das Gespräch nicht gut.
Eine kühle Brise fegte über den Strand. In der Nähe lag ein Schiff mit gebrochenen Masten und zerfetzten Segeln auf dem Sand und Barclay duckte sich dahinter, um sich vor dem Wind zu schützen. Dann betrachtete er niedergeschlagen seine düstere Umgebung. Wohin er auch sah, überall war nasser Sand und schmutzige Schafswolle und kratzige Leinensäcke lagen herum. Möwen kreisten über ihm und ihre Schatten drehten Schleifen über den Dünen. Dunkle Gewitterwolken ballten sich hinter ihnen zusammen.
In Biederford war letztes Jahr zur gleichen Zeit gerade das einwöchige Frühlingsfest der Stadt zu Ende gegangen. Die Stadtbewohner hatten bunt gefärbte Eier an die Äste voller pink- und orangefarbener Blüten gehängt. Barclay hatte Meister Fungus sogar dazu überredet, das Haus festlich zu schmücken, und so hatten sie die Fenster mit Pilzgirlanden verziert.
Dieses Jahr feierte Biederford ohne ihn.
Du bist jetzt ein Wilderweise, rief Barclay sich in Erinnerung und dieser Gedanke tröstete ihn – zumindest ein wenig. Denn ein Wilderweise zu sein, war Barclays sehnlichster Wunsch. Auch wenn sie ihm nie dafür danken würden, wollte er Städte wie Biederford und Knunx beschützen.
Und die Biederforder wollten ihn so oder so nicht haben. Sie hatten ihn nie wirklich gewollt – bevor er ein Wilderweise wurde, war er für sie lediglich ein rauflustiger Waisenjunge gewesen, der zu viele Regeln brach. Auch wenn Barclay ein paar gute Erinnerungen an seine Heimatstadt hatte, bedeutete es nicht, dass er jemals wirklich dazugehört hatte.
Taron marschierte mit geballten Fäusten über den Strand. Aus der Ferne beobachtete Barclay, wie er ein paar arglose Schafe anbrüllte, die ihn jedoch links liegen ließen.
Runa tauchte neben Barclay bei dem gekenterten Schiff auf. Der Wind wehte so stark, dass sich ihr Zopf gelöst hatte, und sie prustete blonde Haarsträhnen aus dem Mund. »Leider ist niemand bereit, uns zum Weiten Meer überzusetzen, egal, wie viel wir ihnen dafür zahlen. Sie behaupten, es würde ein Sturm aufziehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das der einzige Grund ist.«
»Sie haben einfach Angst, das ist alles«, murmelte Barclay. Und schon wieder verteidigte er Anderlinge. Er kannte diese Leute nicht einmal.
Runa blickte grimmig aufs Wasser hinaus. »Nach allem, was ich gehört habe, sollten sie das auch.«
Beunruhigt wollte Barclay gerade nachfragen, was Runa damit meinte, als sein Mal schmerzhaft zuckte, wie jedes Mal, wenn Gefahr drohte.
Keine Sekunde später gellte ein Schrei über den Steg. Eine Frau kauerte am Ruder eines der angedockten Schiffe und verscheuchte eine Möwe.
Nur ähnelte diese Möwe keiner der anderen, die Barclay auf ihrer Wanderung entlang der Klippe gesehen hatte. Sie war mindestens dreimal so groß und hatte vier Flügel und einen Schnabel so lang und scharf wie ein Speer.
Es war gar keine Möwe. Es war ein Wilderbiest.
»Das kann nichts Gutes bedeuten«, sagte Runa. Doch sie sah nicht zu den Stegen, sondern in den Himmel.
Über ihren Köpfen wirbelten Hunderte von Wilderbiestern – ein Schwarm so dicht gedrängt, dass er noch dunkler erschien als die Gewitterwolken.
Und auf einmal stießen alle Vögelbiester herab.
Kapitel 2
Die Möwen-Wilderbiester schwärmten ins Dorf und griffen alles an, was sich bewegte. Kreischend stießen sie herab und wirbelten mit den kraftvollen Schlägen ihrer vier Flügel Sandböen auf, die Knunx verschluckten. Die Ladeninhaber flüchteten schreiend in ihre Geschäfte, während die Seeleute ins kalte Wasser sprangen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Schafe stürmten panisch die Straße hinunter und warfen dabei Kisten, Tische, Schubkarren und alles andere auf ihrem Weg um.
Barclay und Runa gingen neben dem gestrandeten Schiff in Deckung.
Fump! Fump! Fump! Fump!
Die speerartigen Schnäbel der Biester durchbohrten das Boot hinter ihnen. Barclay sprang gerade noch rechtzeitig aus dem Weg, bevor er aufgespießt wurde.
»Was sind das für Biester?«, schrie er und hob die Arme, um seine Augen vor dem auffliegenden Sand zu schützen. »Und warum greifen sie einen Anderort an?«
Auch wenn in Biederford gelegentlich Wilderbiester in die Hühnerhäuser geschlichen waren, hatte die Stadt nie eine so große Invasion erlebt.
»Das sind Sleágobs, Speerschnäbel«, antwortete Runa. »Und ich bin mir nicht sicher, warum sie hier sind. Ein oder zwei Biester, ja, vielleicht … aber Hunderte? Geh und such Taron und Viola. Wir vier müssen die Dorfbewohner beschützen.«
Daraufhin eilte Runa in Richtung Wasser. Sie warf beide Arme zur Seite und eine gewaltige Welle aus gefrorenem Eis türmte sich vom Meer in den Himmel auf und schloss ein Dutzend Sleágobs in sich ein. Schwer beeindruckt fiel Barclay die Kinnlade herunter. Obwohl er schon seit Wochen mit Runa unterwegs war, hatte er sie noch nie ihre Wilderkraft benutzen sehen und war noch kein einziges Mal ihren Wilderbiestern begegnet.
Ihre Bewegungen waren so schnell, dass sie vor seinen Augen verschwammen. Frostige Schwaden schimmerten um ihre Finger, als sie sich einen Weg zum Ufer bahnte und dabei immer wieder neuen Angriffen auswich. Ihr Kettenpanzer glänzte wie eine Ritterrüstung, als sie einen Tunnel aus Eis über den Köpfen der Seeleute erschuf, die über den Strand rannten.
Der Flügel eines Speerschnabels traf Barclay mit voller Wucht in die Brust. Mit einem überraschten »Uff« fiel er rücklings in den Sand. Hack! Der Sleágob wollte ihn mit seinem Schnabel durchbohren, aber Barclay rollte gerade noch rechtzeitig zur Seite. Hack! Dieser durchstach seinen Schal und nagelte ihn damit am Boden fest.
»Hau ab …! He …! Nein …« Barclay wollte ihn wegstoßen, aber der Sleágob schlug wild um sich. Seine völlig weißen Augen rollten wie im Rausch von Seite zu Seite. Barclay würgte, als sein Schal enger zugezogen wurde.
Schließlich hob Barclay eine Hand zum Speerschnabel und dachte: Wind! Eine Luftspirale schoss aus seiner Handfläche auf das Biest zu und wirbelte es davon.
Keuchend rappelte Barclay sich auf und hielt in dem Chaos nach seinen Freunden Ausschau. Er entdeckte Viola, die breitbeinig auf dem Heck eines Schiffes stand, während Mitzi über ihrem Kopf flatterte. Da sie nur ein Babydrache war – genau genommen ein Welpe –, war Mitzi kleiner als die Sleágobs. Dafür war sie aber viel wendiger. Schnell wie der Blitz schoss sie aus dem Weg, bevor die anderen Wilderbiester ihre silbernen Flügel oder ihren spärlich gefederten Schwanz zerhacken konnten.
Währenddessen benutzte Viola ihre Wilderkraft und feuerte gewaltige Lichtstöße aus ihren Handflächen, die so grell waren, dass Barclay von dem Blinken ganz schwindlig wurde. Doch schien das die Speerschnäbel nicht aus der Ruhe zu bringen. Wie Motten um die Flamme einer Laterne flatterten sie um sie herum und Viola plumpste kreischend auf den Steg.
»Viola!«, schrie Barclay, während er auf sie zurannte. Er rief eine zweite Windböe herbei und fegte die Sleágobs weg, die sie bedrängten.
Viola taumelte an seine Seite, während sich Mitzi an ihre Schulter klammerte.
»Ich verstehe das nicht!«, keuchte sie. »Es scheint, als würden die Sleágobs alle völlig durchdrehen! Warum würden sie …«
»Keine Ahnung«, erwiderte Barclay. »Aber wir müssen Taron finden.«
Er blickte zum Schafstall, wo er den anderen Lehrling das letzte Mal gesehen hatte. Doch Taron war nicht dort.
»Komm.« Barclay drückte Violas Hand. Gemeinsam stürmten sie vom Strand ins Dorf und Mitzi folgte ihnen in der Luft. Die Straßen waren übersät mit Sand, Federn und zerbrochenen Fensterscheiben. Die Dorfbewohner schlugen mit Besen und Angelruten nach den Biestern. Die Sleágobs bohrten ihre Schnäbel in Mauern und zerlöcherten jede Oberfläche, als wäre Knunx eine riesige Dartscheibe.
»Da!« Viola zeigte um die Ecke, wo Taron gegen eine Mauer gedrängt stand und versuchte, zwei Speerschnäbel mit einer Harke zu vertreiben.
Als Barclay die Riesenvögel wegfegte, flogen mehrere Dachziegel von angrenzenden Gebäuden gleich mit davon.
»Eine Harke?«, blaffte Viola Taron an. »Was Besseres ist dir nicht eingefallen?«
Ein weiterer Sleágob stieß auf sie herab und goldene elektrische Funken schossen zischend die Harke hinauf. Mit einem lauten Zap briet Taron dem Vogelbiest eins über. Der Speerschnabel krächzte und segelte davon.
»Sie ist aus Metall und leitet Elektrizität«, erklärte Taron. Sein Wilderbiest war ein Nathermara, ein gigantisches elektrisches Neunauge. Mit seiner Wilderkraft konnte Taron Wasser kontrollieren und Blitze erschaffen.
Obwohl man Wilderbiester nur schwer verletzen konnte und ihre Wunden schnell wieder heilten, musste Taron den Sleágob wütend – sehr wütend – gemacht haben. Dieser kreischte und schwenkte wieder in ihre Richtung und ein weiteres Dutzend Speerschnäbel schlossen sich ihm an.
»Wir werden gleich aufgespießt!«, schrie Barclay.
»Wir sollten uns einen Unterschlupf suchen.« Viola stieß Taron und Barclay in den Rücken. »Los! Bewegt euch!«
Sie rannten eine breite Straße hinunter. Taron stürzte sich auf die nächste Tür und hämmerte dagegen. »Lasst uns rein!«, rief er. Aber niemand war dazu bereit.
Barclays Wilderkraft verlieh ihm Geschwindigkeit – er würde vor diesen Vögeln problemlos davonlaufen können. Nur würde er dann Viola und Taron hinter sich lassen. Deshalb grub er die Fersen in die gepflasterte Straße und wirbelte herum. Er hob beide Arme und konzentrierte sich.
Wind!
Diesmal rief er einen Tornado herbei, der sich vom Boden in die Höhe schraubte und nach oben zu einem gigantischen Trichter weitete. Alle Sleágobs in der Nähe wurden hineingesaugt und zurück in den Himmel gespuckt. Aber auch nachdem sich die drei Lehrlinge außer Gefahr befanden und die Straße frei war, löste sich der Wirbel nicht wieder auf.
Barclay konnte ihn nicht aufhalten. Auch wenn er Wind herbeirufen konnte, war Wind nun einmal ein wildes Element. Je mächtiger die Wilderkraft, umso weniger konnte er sie kontrollieren. Kurz darauf wurden Dachziegel, Muschelschalen und Sand in die Luft gefegt, peitschten gegen Barclays Haut und zwangen ihn, die Augen zusammenzukneifen. Weil die Wucht des Ganzen ihn beiseitezuschleudern drohte, sank er auf die Knie. Sogar der Boden schien zu zittern und hinter ihm krachte etwas herunter.
Nach fast einer Minute legte sich der Wind endlich und Barclay öffnete die Augen. Den Fischerhütten um ihn herum, die bereits voller Löcher gewesen waren, fehlten nun auch ganze Holzlatten und der Großteil ihrer Dächer. Auf der Straße bildeten die Trümmer einen Kreis um Barclay, als wäre er das Auge des Sturms gewesen. Das Krächzen der Sleágobs war nur noch aus der Ferne zu hören.
Aber Knunx war noch nicht gerettet.
»Pass auf!«, schrie Taron und als Barclay herumwirbelte, erblickte er noch einen letzten Speerschnabel, der direkt auf ihn zuflog.
Etwas Heißes und Grelles explodierte vor Barclay – Feuer.
»Was zum …« Er torkelte nach hinten, als sich zwischen ihm und dem Sleágob eine Flammenwand erhob. Das Biest gab einen verängstigten Schrei von sich und flog davon. Das Feuer erlosch.
»Geht es dir gut?«, fragte jemand und zwei Gestalten traten aus einer nahe gelegenen Gasse. Die erste war ein hagerer Mann. Sein Gesicht war schweißgebadet und sein Hemd hing in Fetzen herunter. Ein wenig getrocknetes Blut klebte in seinem Stoppelbart.
Neben ihm stand ein Junge, der nicht älter als Barclay aussah. Er hatte gelocktes blondes Haar und die blasseste Haut, die Barclay je gesehen hatte, wie die Farbe von Sauerkraut. Seine Miene war ebenso säuerlich, auch wenn sie größtenteils hinter dem Kragen seines riesigen Pelzmantels verborgen war. Eine kleine Flamme tanzte über jedem seiner Finger. Dann schloss er die Faust und die Feuer erloschen.
Obwohl sie ihn gerade gerettet hatten, war Barclay so verdutzt, dass er nichts anderes herausbrachte als ein zittriges: »W…wer seid ihr?«
»Wilderweisen wie ihr. Was uns zu Freunden macht, hoffe ich doch«, antwortete der hagere Mann und lächelte sie freundlich an. »Heilige Bratpfanne, was hat euch diese Straße bloß angetan? So einen Schlamassel habe ich ja noch nie gesehen … Oh, ich mach nur Witze. Was für ein Glück, von euch sieht keiner allzu mitgenommen aus.«
Barclay war da anderer Ansicht. Tarons Pulli hatte jetzt mehrere Löcher. Federn und Zweige ragten aus Violas Haarknoten. Und Barclays Wange pochte, wo ihm ein Trümmerstück im Vorbeiwehen einen Schnitzer verpasst hatte.
Neben Barclay riss Viola die Augen weit auf. »Aber … Sie sind verletzt.« Barclay folgte ihrem Blick zu den Rippen des Mannes. Sein zerrissenes Hemd war blutgetränkt.
»Was, ach das?« Der Mann kicherte und schmierte das Rot weg. Obwohl Barclay keine Wunde erkennen konnte, bemerkte er zwei Narben auf seinem Unterleib, wie zwei Einstiche. Aber sie sahen sehr alt aus, viel zu alt, um von heute zu sein. »Ich habe Heil-Wilderkraft, was bei einem Kampf leider keine große Hilfe ist.«
»Dann hast du also Barclay gerettet«, sagte Taron zu dem Jungen, dessen Hände rußverschmiert waren. »Und das Erdbeben erzeugt.«
»Erdbeben? Ich habe nichts Derartiges gespürt.« Der Mann legte den Kopf schief und klopfte dem Jungen auf die Schulter. »Yascha benutzt Feuer-Wilderkraft. Und stellt mal wieder seinen Lehrer in den Schatten … Langsam macht er eine Gewohnheit daraus.«
Der Junge – Yascha – winkte ab, als wäre eine so mächtige Wilderkraft gar nichts. »Es war einfach Glück, dass ich dich gesehen habe, das ist alles.«
»Aber was macht ihr in den Anderorten?«, fragte Barclay.
»Wir sind gerade erst angekommen«, antwortete der Mann. »Wir versuchen, eine Überfahrt zurück zum Weiten Meer zu finden. Orla hat erwähnt, dass ihre Probleme seit unserer Abreise nur noch größer geworden sind. Jetzt sehe ich, dass sie recht hat! Stellt euch das mal vor, ein ganzer Schwarm Sleágobs, der eine Anderling-Stadt in Angst und Schrecken versetzt!«
Mit welchen Problemen das Weite Meer auch immer konfrontiert war, die Hohe Wilderweise hatte offensichtlich nicht nur Runa zu Hilfe gerufen.
Bevor Barclay fragen konnte, was das für Probleme waren, blickte Viola zum dunklen Himmel hinauf. »Die Speerschnäbel sind weg. Wir sollten Runa suchen.«
»Runa?« Der Mann runzelte leicht die Stirn. »Du meinst doch nicht etwa Runa Rasgar, die Nachtklaue?«
»Doch. Sie ist unsere Wilderkraft-Meisterin«, antwortete Viola. »Kommt. Ihr könnt sie kennenlernen.«
Die Gruppe ging zurück zum Strand, wo die Überreste von Runas Eis-Wilderkraft im kühlen Frühlingsnachmittag tauten. Auf dem Steg stritt sich Runa mit einer Dorfbewohnerin, wobei das meiste Geschrei von der Einheimischen zu kommen schien. Als Runa die anderen erblickte, sagte sie lautlos Tarons Namen.
Taron verdrehte die Augen. »Sie spricht die Sprache nicht gut. Bin gleich zurück.«
Er ließ die vier am Stadtrand zurück. Die Zerstörung, die die Sleágobs angerichtet hatten, war verheerend – Knunx hatte mehr Löcher als eine Käsereibe. Die Hälfte der Boote versank im Meer und die Schafe hatten in ihrer Panik fast alle Zäune niedergetrampelt.
»Du blutest«, sagte der Mann zu Barclay. Dann kramte er in seinen ausgebeulten Taschen und mehreren Rucksäcken, die aus allen Nähten zu platzen schienen. »Nein, nicht die Narbenmilch … Oh, das ist mein gutes Messer! Danach habe ich schon gesucht … Hm, Kritter, Gegengifte, ein Schnorchel und … Aha! Ich wusste doch, dass ich noch was davon übrig habe.«
Triumphierend zückte er ein schleimiges silbriges Stück Seetang und klatschte es auf Barclays Wange. Es roch nach Sauerkraut.
Viola kicherte.
»Was dagegen, wenn ich das verarzte? Dauert nur eine Minute«, fuhr der fremde Wilderweise fort, auch wenn Barclay es vorgezogen hätte, gefragt zu werden, bevor man ihm Seetang ins Gesicht klebte. Der Wilderweise hielt seine Hand über Barclays Wange und ein linderndes, kribbelndes Gefühl breitete sich über seiner Haut aus.
»Oh, ähm, danke«, sagte Barclay.
»Nicht nötig! Wir Wilderweisen müssen zusammenhalten.«
Während er darauf wartete, dass der Mann mit seiner Behandlung fertig war, beobachtete Barclay, wie Taron sich dem Streit mit der Dorfbewohnerin anschloss. Im Gegensatz zu Runa hatte er keine Probleme, die Frau anzuschreien.
»Wie läuft es Ihrer Meinung nach wohl?«, fragte Barclay.
Der Mann kicherte. »Schreist du denn normalerweise, wenn ein Gespräch gut verläuft?«
»Aber wir haben Knunx vor den Sleágobs gerettet!«, warf Viola ungehalten ein. »Dafür sollten sie uns danken.«
»Ah, leider funktioniert das nicht so. Aber … die gute Neuigkeit! Deine Wange ist schön verheilt. Zum Glück hatte ich noch ein wenig eingelegtes Schnodderkraut übrig. Mit dem Kraut und meiner Wilderkraft könntest du nirgendwo besser geheilt werden.«
»Danke«, sagte Barclay noch einmal. »Aber kann ich … das hier … abnehmen?« Er versuchte es und scheiterte dabei, sich das schleimige Schnodderkraut von der Haut zu ziehen.
»Äh, es wird da noch Stunden kleben. Vielleicht sogar Tage …«
»Tage?«, wiederholte Barclay. Violas Kichern wurde zu Gelächter und sogar über Yaschas Gesicht huschte ein Lächeln.
»Es wird abfallen, wenn es so weit ist. Oh, wappnet euch lieber …«
Die Dorfbewohnerin, mit der sich Runa und Taron gestritten hatten, kam herübergestapft. Sie bohrte ihren Finger dreimal in Barclays Brust und auch wenn sie ihm dabei nicht wehtat, war die Frau sehr groß und sehr furchterregend. Und Barclay war selbst für einen Elfjährigen sehr klein.
»Ich verstehe nicht, was Sie sagen!«, sagte er, wobei seine Stimme in dem Geschrei der Frau unterging.
Dann packte sie Barclay am Handgelenk und zerrte ihn eine Gasse hinunter, ohne auf die Proteste von Viola und dem Mann zu achten.
»W…was auch immer Sie mir zeigen wollen«, stammelte Barclay, »ich habe nur versucht, die Sleágobs zu verscheuchen! Ich habe die Stadt beschützt …«
Er verstummte, als er sah, wohin die Frau ihn geschleppt hatte – zu einem komplett zerstörten Haus, von dem nur ein Trümmerhaufen übrig geblieben war. Obwohl die Frau nicht aufhörte zu brüllen, schien Barclay sie nicht mehr zu hören. Es erinnerte ihn zu sehr an das Fest in Biederford, als seine Wilderkraft außer Kontrolle geraten war und den berühmten Uhrenturm der Stadt zerstört hatte. Es war eine seiner schlimmsten Erinnerungen, weil sich damals alle, die ihn kannten, gegen ihn gewandt hatten.
Hatte er das getan?
Und selbst wenn, es war diesmal nicht dasselbe wie in Biederford. Er hatte Knunx gerettet, nicht zerstört.
Aber die wütende Menge, die sich um ihn versammelte, war da ganz anderer Meinung. Sie brüllten ihn alle an und obwohl Barclay kein Wort verstand, waren ihre Stimmen so laut und gemein, dass er am ganzen Leib zitterte.
»Seine Schuld?«, fuhr Taron einen Dorfbewohner an, der auf der anderen Straßenseite in einen weiteren Streit verstrickt war. »Ihr habt es ihm zu verdanken, dass nicht eure ganze armselige Stadt so aussieht!«
Barclay hatte noch nie gehört, dass Taron ihn verteidigte, war aber zu frustriert, um dankbar dafür zu sein. Denn Taron hatte recht. Knunx sollte ihm danken. Doch würden sie Wilderweisen jetzt vermutlich noch mehr misstrauen als zuvor.
Etwas traf Barclay am Rücken und ein fauler Holzapfel purzelte auf den Boden. Jemand hatte ihn damit beworfen – hier war es auch nicht anders als in Biederford.
Die Menge teilte sich, als Runa an Barclays Seite trat. »Komm. Wir sind schon viel zu lange hier. Und wir müssen jemanden finden, der uns zum Weiten Meer übersetzt, bevor dieses Gewitter losbricht.«
Falls die Dorfbewohner noch mehr verfaultes Obst vorrätig hatten, wagten sie es nicht, Barclay mit Runa an seiner Seite damit zu bewerfen. Er hatte einen Knoten im Bauch und ließ sich zusammen mit Viola und Taron von Runa zurück zum Strand führen. Der hagere Mann und Yascha warteten am Steg auf sie.
»Kopf hoch, Junge«, tröstete der Mann Barclay. »Du hast es mit einem ganzen Schwarm Speerschnäbeln aufgenommen. Das ist viel mehr, als ich von mir behaupten kann.«
»Und Sie sind?«, fragte Runa, die den Fremden genau musterte, als wäre sie sich nicht sicher, ob sie sich schon einmal begegnet waren.
»Edwyn Lusk.« Der Mann machte eine kleine ausschweifende Handbewegung. Mit der anderen hielt er die Fetzen seines Hemds zusammen. »Und das ist mein Lehrling, Yascha Robinowitsch. Wir suchen auch nach einer Überfahrt zum Weiten Meer.« Er sah zum Himmel, wo sich dunkle Wolken zusammenballten. »Auch wenn das wohl nicht das richtige Wetter dafür ist.«
»Sprechen Sie die Sprache des Weiten Meeres? Der hier«, Runa warf Taron einen strengen Blick zu, »redet nicht gerade mit Engelszungen.«
Taron schaute böse.
»Leider nur gut genug, um etwas zu trinken zu bestellen«, erwiderte Edwyn.
»Das muss reichen«, grummelte Runa, während sie Taron am Ärmel seines Pullis mit sich zog und Edwyn ein Zeichen gab mitzukommen.
Nachdem sie den Steg hinuntergegangen waren, blickte Barclay bedrückt auf das Wasser hinaus. Wenn er seine Wilderkraft besser unter Kontrolle gehabt hätte, hätte er vielleicht die Meinung der Bewohner von Knunx über Wilderweisen ändern können. Aber auch die Biederforder hatten ihn verbannt, obwohl sie ihn sein ganzes Leben lang gekannt hatten. Was er sich erträumte, war vermutlich aussichtslos.
»Oh, sei nicht so missmutig«, sagte Viola zu ihm. »Die Anderlinge hier hätten dir nie gedankt, egal, was du getan hättest.«
»Ich fand deine Wilderkraft sehr beeindruckend«, meinte Yascha ernst. »Bist du schon lange in der Lehre?«
»Erst seit der Wintersonnenwende«, antwortete Viola für Barclay, der kein Problem damit hatte, weil er sowieso nicht in Plauderlaune war. »Und du?«
»Seit etwa einem Jahr. Ich habe meine Lehre mit elf begonnen.«
»Oh! Ich bin schon genauso lange Lehrling …« Viola unterbrach sich und räusperte sich verlegen. Bevor sie Runas Lehrling wurde, hatte sie einen anderen Meister gehabt – Cyril Harlow, Runas berühmten Erzfeind. Aber Cyril hatte Viola gefeuert, worüber sie nie gerne redete. »Ich meine, du bist uns wahrscheinlich schon weit voraus. Ich bin übrigens Viola. Viola Dumont. Und das ist Barclay Torn …«
»Dumont, wie Leopold Dumont? Der Groß-Wilderweise?«
Viola schaute verlegen. »Er ist mein Vater, ja.«
»Ich habe gehört, dass er drei Mythische Biester hat«, sagte Yascha, der skeptisch klang. »Stimmt das?«
Barclay fragte sich, ob Yascha seinen Namen überhaupt mitbekommen hatte, und versuchte, sich nicht darüber zu ärgern. Er konnte nun einmal nichts daran ändern, dass Viola viel interessanter war. Ihr Vater war das Oberhaupt des Wilderreichs und Barclay war bloß ein Junge aus den Anderorten, der sich seiner Kräfte kaum bedienen konnte, ohne dabei alles in seiner Nähe zu zerstören.
Und so überließ er die beiden ihrer angeregten Unterhaltung und ging hinunter zum Strand. Mehr als alles andere wünschte er sich, er könnte jetzt einfach mit Krux rennen – und das so schnell, dass sie zu Wind wurden und er seine Probleme hinter sich lassen konnte. Aber der Lufthund hatte für einen Tag schon genug Schrecken ausgestanden.
Eine Frau tippte ihm auf die Schulter. Sie war sehr alt, ihre Falten sahen wie geriffelte Linien im Sand aus. Ihr gestrickter Schlapphut erinnerte ihn an Bibliothekarin Havener aus Biederford.
Barclay spannte sich an und machte sich darauf gefasst, dass sie ihn wie alle anderen anschreien würde.
Stattdessen hielt sie ihm eine Muschel hin. Es war eine Trompetenmuschel wie die, die der Fischer vorhin umklammert hatte.
»Es tut mir leid. Ich … Ich wollte einfach nur helfen«, stammelte Barclay, unsicher, ob sie ihn verstehen konnte.
Sie lächelte und legte ihm die Trompetenmuschel in die Hände. Barclay begriff, dass es ein Geschenk war.
»Danke«, sagte er zu ihr, obwohl er wusste, dass dieser Talisman ebenso nutzlos war wie sein Stinktieramulett. Aber es war ein Geschenk, das ihm jemand zum Dank in einer Stadt wie Biederford gab. Und das machte es wertvoll.
Die alte Frau sah aus, als wollte sie etwas sagen, doch sie verschwand, als Runa, Edwyn und Taron auf Barclay zugingen.
»Die gute Nachricht ist«, erklärte Runa, »dass wir jemanden gefunden haben, der bereit ist, uns nach Munsey zu bringen.«
»Die schlechte Nachricht ist«, stöhnte Taron, »dass sein Verstand noch undichter ist als diese Boote.«
Der fragliche Mann erschien hinter ihnen. Er war unglaublich groß und hatte ein papageiähnliches Wilderbiest auf der Schulter, dessen glitzernde scharlachfarbene Federn zu dem roten Bart des Mannes passten.
»Ja, hallo«, grüßte er sie und beugte sich zu Barclay hinunter, der ihm nur bis zur Brust ging. »Wie ich höre, haben wir hier ein paar gestrandete Wilderweisen, die ein Schiff benötigen.« Er grinste und seine Holzpfeife wippte zwischen seinen Lippen. »Zufälligerweise bin ich auch ein Wilderweise. Und ich liebe es, in einem Sturm zu segeln.«
Kapitel 3
Eine Stunde später bot Barclay Yascha einen Holzeimer an, während Yascha sich über die Steuerbord-Reling der Bewlah übergab. Das Schiff war von mittlerer Größe und hatte zerfledderte graue Segel, die aus verschiedenen Stoffen zusammengeflickt waren. Bewlah, das papageiähnliche Wilderbiest und der Namensvetter des Schiffes, sang Yascha ein Ständchen vor, während sie auf seinem Kopf hockte.
»Es war mal ein Junge mit Locken,der Segeln fand gar nicht verlockend.Denn ohne Latrinegrün war seine Mieneund hoch kamen die Frühstücksflocken.«
Barclay versuchte, Bewlah zu vertreiben, aber sie beachtete ihn nicht.
»Entschuldigt Bewlah«, sagte der Kapitän, der auf dem oberen Deck am Ruder stand. Obwohl das Schiff für einen einzelnen Seemann riesig erschien, war der Kapitän so groß, dass er als mindestens zwei weitere Crewmitglieder zählen konnte. »Zu Kindern ist sie unglaublich frech. Sie mag sie einfach nicht.«
Da fing Bewlah an, auf Yaschas Ohren herumzuhacken.
»Hau ab«, grummelte Yascha und scheuchte sie weg. Bewlah flog auf die Schulter des Kapitäns. Dann packte Yascha den Eimer, den Barclay ihm hingehalten hatte, und übergab sich ein weiteres Mal. Er bedankte sich leise und Barclay ließ ihn in Ruhe und verzog sich zu Krux am Bug. Der Lufthund streckte die Zunge heraus, während die Meeresbrise sein schwarzes Fell zerzauste.
»Hey, Kumpel«, sagte Barclay zu ihm. Er ließ sich gegen die Schiffsreling sacken und kraulte Krux hinter dem Ohr. Das sollte sein erstes großes Abenteuer sein und doch konnte er das Bild der wütenden Dorfbewohner nicht aus dem Kopf bekommen. Eine ganze Jahreszeit war vergangen, seit man ihn aus Biederford vertrieben hatte, aber aus irgendeinem Grund schmerzte diese Wunde noch immer.
Krux, der Barclays Kummer spürte, drückte ihm den Kopf in die Seite und stieß gegen die Trompetenmuschel, die in seiner Tasche verstaut war. Barclay nahm sie heraus. Auch wenn sie ein Geschenk war, war sie doch bloß ein nutzloses, abergläubisches Amulett. Er sollte sie vermutlich ins Wasser werfen.
»Du trägst die Muschel immer noch mit dir rum?«, fragte Taron hämisch, der im Schneidersitz neben Viola auf dem Deck saß.
Barclay steckte die Muschel schnell zurück in seine Umhängetasche. »Nein … Ich meine, ich hab sie nur noch nicht weggeschmissen.« Aber das würde er, sobald sie das Weite Meer erreichten.
Taron war offenbar schlecht gelaunt. Er funkelte Viola böse an und blaffte: »Warum musst du das ständig lesen? Bist du nicht langsam mal damit fertig?«
Viola schaute über den Rand ihres Exemplars von Ein Reisetagebuch gefährlicher Wilderbiester von Conley Murdock, ein Wilderweise, der für seine fantastischen und gewagten Studien von mächtigen Wilderbiestern berühmt war. So war er einmal auf einem Pterodrachyn geritten und hatte die Zahnschmerzen eines Hakenhais kuriert. Doch diese gefährlichen Unternehmungen hatten schließlich zu seinem Tod geführt: Letzten Sommer war Conley nach dem Verrat seines Geschäftspartners Soren Reiker von Lochmordra verschlungen worden, dem Legendären Biest des Weiten Meeres.
Und Conley Murdock war Tarons Vater.
»Ich habe es schon ein paarmal gelesen, aber es gibt einfach so viel zu lernen«, erwiderte Viola. »Und wenn ich eines Tages zur Groß-Wilderweisen gewählt werden will, muss ich noch viel lernen. Aber ich kann es weglegen, wenn es dich stört.«
»Es stört mich nicht.« Taron zog die Knie an die Brust und betrachtete das Wasser mit grimmiger Miene.
Barclay überlegte, auch ein wenig zu lesen. Er war noch nicht mit dem Lehrbuch fertig, das Runa ihm geliehen hatte: Die neun wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Wilderweisen (Sie sind wirklich passiert!) von Gruscha Dudnik. Nur hatte er gerade keine Lust auf Hausaufgaben. Stattdessen starrte er wie Taron grimmig auf die grauen Gewässer des Golfs und fragte sich, wann sie zum Weiten Meer wurden.
»Anstatt wie ein Haufen Gammelaffen rumzuhängen«, sagte Runa zu den dreien, die Hände in die Hüften gestemmt, »habe ich mir für jeden von euch ein paar Übungen überlegt. Ihr habt Knunx sehr gut vor den Sleágobs verteidigt, aber eure Wilderkräfte können immer noch verbessert werden.«
Das munterte Barclay auf, weil er Wilderweisen-Unterricht vorzog, bei dem er tatsächliche Wilderkraft benutzen konnte.
»Viola«, begann Runa. »Du hattest heute Schwierigkeiten, weil du es nicht gewohnt bist, dich auf so viele schnelle Ziele gleichzeitig zu konzentrieren.«
Viola schluckte und spielte an ihren Anstecknadeln herum. »Ich … So viel Schwierigkeiten hatte ich gar nicht. Ich hätte …«
»Momentan kannst du Licht aus deinen Händen scheinen lassen«, fuhr Runa fort, ohne auf Violas Unbehagen zu achten, »aber nur als gebündelte Strahlen. Es fällt dir schwer, einen ganzen Raum oder Ort zu erleuchten, vor allem länger als ein paar Minuten. Deshalb möchte ich, dass du an deiner Stärke und Ausdauer arbeitest. So wirst du bald in der Lage sein, alle nahe gelegenen Ziele gleichzeitig zu treffen statt eines nach dem anderen.«
Da sie offenbar wieder Mut fasste, steckte Viola Ein Reisetagebuch in ihren Rucksack und nickte eifrig. »Also gut.«
»Taron«, sagte Runa als Nächstes. »Du kannst …«
»Wozu soll ich noch trainieren?«, wollte er wissen. »Ich bin doch schon der Stärkste hier.«
Runa zog die Augenbrauen hoch. »Komisch. Ich dachte, ich wäre die Stärkste hier.«
Daraufhin verschränkte Taron die Arme – und Barclay prustete. Runa hatte natürlich recht.
»Du kannst deine Wasser-Wilderkraft selbstständig einsetzen«, sagte Runa, »brauchst aber einen Leiter für deine elektrische Wilderkraft. Ich möchte, dass du daran arbeitest, Funken ohne Wasser oder Metall zu erzeugen. Versuch es erst mal mit den Fingern. Positioniere sie so.« Sie zeigte mit beiden Zeigefingern aufeinander und ließ eine kleine Lücke zwischen ihnen. »Schau, ob du …«
»Ja, ja, schon kapiert.« Taron stand auf und stapfte an das andere Ende der Bewlah, um zu üben.
»Nur weil ich ihn schon kenne, seit er ein Baby war, heißt das nicht, dass er so mit mir reden kann.« Runa schüttelte den Kopf und wandte sich Barclay zu. »Und du. Für dich habe ich eine etwas andere Aufgabe. Du musst an deiner Kontrolle arbeiten. Damit du deine Wilderkraft stoppen kannst, bevor alles wie heute aus dem Ruder läuft.«
»Aber Wind ist wild.« Barclay wurde bewusst, dass er ihr fast genauso unhöflich widersprochen hatte wie Taron, und normalerweise gab er Erwachsenen keine frechen Antworten. »Ich meine … Ich glaube nicht, dass man Wind kontrollieren kann. Es ist nicht wie Licht oder Wasser oder Eis.«
»Alle Wilderweisen können lernen, ihre Wilderkraft zu kontrollieren. Es ist lediglich eine Frage der Übung.« Runa sah sich auf dem Schiff um und hob einen Flaschenverschluss vom Deck auf. Sie reichte ihn Barclay. »Nimm das. Probier mal, ob du ihn über deiner Hand schweben lassen kannst, indem du ihn nur mithilfe von Wind an Ort und Stelle hältst.«
»A…aber Wind hält nicht still«, stammelte Barclay. »Das schaffe ich doch nie!«
»Würde ich dir eine Aufgabe geben, die nicht zu bewerkstelligen ist?«, fragte Runa spitz.
»Nein, aber …«
»Würde ich dir eine Aufgabe geben, die du meiner Ansicht nach nicht bewältigen kannst?«
Barclay seufzte. »Nein.«
»Dann mach dich an die Arbeit. Der Sturm wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.«
Über ihnen waren die Wolken dunkler geworden, von Grau zu einem tiefem Violett, wie ein riesiger blauer Fleck am Himmel. Und die Wellen um sie herum waren mittlerweile unruhig und höher als vorher.
Frustriert, bevor er überhaupt angefangen hatte, verdrückte sich Barclay auf das obere Deck, wo Edwyn auf einer Holzbank tief und fest unter einer Wolldecke schlief. Die Auseinandersetzung mit den Sleágobs hatte ihn offensichtlich ermüdet.
Barclay drückte den Flaschenverschluss in seiner Faust zusammen. Er glaubte immer noch, dass Wind-Wilderkraft zu wild war, als dass man sie kontrollieren könnte, aber falls sie doch kontrolliert werden konnte, hatte Knunx jedes Recht, wütend auf ihn zu sein. Er war nur ein billiger Abklatsch eines Wächter-Lehrlings – oder eigentlich jeder Art von Wilderweisen.
Er blickte über die Schulter zu Viola und Taron hinüber, die beide übten. Viola hatte es geschafft, ihre Wilderkraft von einem Strahl zu einer kleinen Lichtkuppel anwachsen zu lassen, und zwischen Tarons Fingerspitzen knisterten bereits Funken.
Barclay drehte sich wieder um und sah Krux an, der sich auf dem Oberdeck zu ihm gesellt hatte. »Glaubst du, ich kann das?«, fragte er nervös.
Krux bellte und drehte sich im Kreis. Und so nahm Barclay all seinen Mut zusammen und beschwor seine Wilderkraft herauf, um den Flaschenverschluss von seiner Handfläche zu heben und ihn in der Luft zu halten.
Stattdessen schoss der Verschluss sofort in die stürmischen Winde und hüpfte über die Bodenbretter.
»Das war Pech«, sagte der Kapitän, als Barclay sich aufrappelte, um ihn sich zu schnappen.
Barclay nickte, es war ihm peinlich, ein Publikum zu haben. Aber Wind herbeizurufen, war ihm auch nicht gleich beim ersten Mal gelungen. Er musste einfach nur üben.
Doch beim zweiten Versuch passierte genau das Gleiche. Und beim dritten Versuch flog der Flaschenverschluss so hoch in die Luft, dass Barclay ihm hinterherrennen musste, um ihn einzufangen, bevor er ins Meer plumpste.
Derweil sang Bewlah:
»Es war mal ein ganz kleiner Fratz,dessen Kraft machte zu viel Rabatz.Das Mädchen schuf Blitze.Auch sein Freund war echt spitze.Nur was er tat, war schlicht für die …«
»Bewlah!«, brüllte der Kapitän. »Sei nett.« Barclays Wangen glühten vor Scham und der Kapitän wandte sich freundlich zu ihm: »Deine Wilderkraft ist knifflig, das ist alles. Was für ’n Biest isser denn?«
Krux streckte die Brust heraus, als man von ihm redete.
»Ein Lufthund«, antwortete Barclay.
»Dann gehört er zur Exquisiten Klasse, was?«

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











