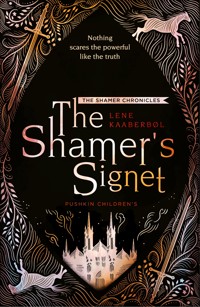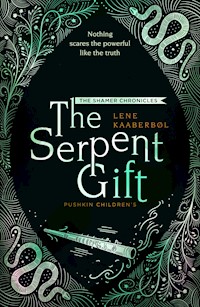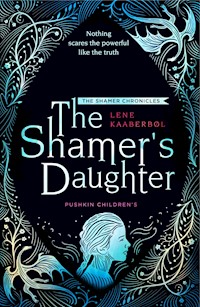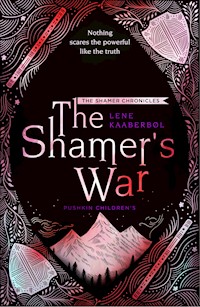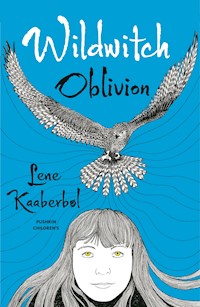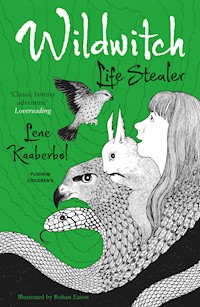Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Wildhexe
- Sprache: Deutsch
Tante Isa ist bei dem Versuch, Clara zu helfen, einem geheimnisvollen Zauber zum Opfer gefallen. Claras Vater liegt verletzt im Krankenhaus und ihre Mutter kämpft mit Erinnerungen an alte Hexen-Prüfungen, bei denen sie ihre beste Freundin verlor. Clara und ihr Freund Oscar müssen allein versuchen, den Rätseln der wilden Welt auf die Spur zu kommen. Doch erst als Claras Mutter ihren Widerstand gegen die Wildhexerei aufgibt, durchdringen sie das Labyrinth der Vergangenheit – und können so der wilden Welt, den Tieren und Claras Freunden helfen. Der fünfte Band der preisgekrönten Abenteuerserie für alle Tier- und Naturfreunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lene Kaaberbøl
WILDHEXE
Das Labyrinth der Vergangenheit
Aus dem Dänischenvon Friederike Buchinger
Carl Hanser Verlag
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Vildheks – Fjendeblod im Alvilda Verlag, Kopenhagen.
Published by agreement with Lars Ringhof Agency ApS, Copenhagen.
ISBN 978-3-446-24840-3
© Lene Kaaberbøl 2013
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München 2015
Umschlaggestaltung: Stefanie Schelleis, München
Umschlagmotiv und Vignetten: Bente Schlick
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
WILDHEXE
1 EINE ERSTARRTE SEKUNDE
»Was hast du mit meinem Vater gemacht?«
Kahla stand in der Tür. Ich hatte sie nicht kommen hören, aber das war vielleicht gar nicht so überraschend – ich hatte auf dem Sofa geschlafen wie ein Bär im Winterschlaf, auf dem Bauch das leise schnarchende Katerchen, halb versteckt unter Tante Isas alter Wolldecke. Draußen war es stockfinster, und ich hatte das verwirrende Gefühl, es wäre mitten in der Nacht.
Wirklich überraschend war dagegen, dass Tumpe keinen Mucks von sich gegeben hatte. Normalerweise drehte er völlig durch, wenn sich einer seiner Lieblingsmenschen dem Haus näherte, aber dieses Mal stand er einfach mitten im Zimmer und sah verwirrt aus. Es schien, als wäre er genauso überrumpelt wie ich.
Mama war immer noch nicht wieder da, stellte ich fest. Aber nachdem sie den ganzen Weg zurück in die Merkurgade fahren, Oscar abliefern und alles zusammenpacken musste, was sie für die eine Woche in Tante Isas Haus brauchen würde, die sie mir versprochen hatte … Und dann sollte ja auch noch Papa aus dem Krankenhaus entlassen werden. So was konnte dauern, das wusste ich aus eigener Erfahrung.
Kahla war triefnass, aber noch etwas an ihr war ungewöhnlich. Sie war nicht wie sonst in drei Mäntel, vier leuchtend bunte Schals und mindestens zwei Wollmützen eingepackt. Sie hatte nur einen ganz gewöhnlichen schwarzen Regenmantel an und nichts auf dem Kopf – außer Haaren natürlich.
Kahlas Haare sind pechschwarz, glänzend und dick – und in diesem Moment waren sie außerdem noch nass.
»Regnet es?«, fragte ich dumm. Ich war wohl immer noch nicht ganz wach.
»Mein Vater«, wiederholte sie, und ihre Stimme klang wütend und kalt. »Wo ist er? Was ist mit ihm passiert?«
Schlagartig war alles wieder da. Wie um alles in der Welt sollte ich Kahla erklären, dass Meister Millaconda steif wie eine Statue in einem Bett in der großen Eingangshalle von Vestmark lag, ganz genauso wie Tante Isa, Frau Pomeranze, Shanaia und Herr Malkin? Tante Isas gesamter Hexenkreis. Sie alle lagen dort, und ich konnte nicht einmal mit Sicherheit sagen, ob sie tot oder lebendig waren.
»Es … es ist etwas passiert«, sagte ich.
Kahla war trotz ihrer sonnengebräunten Haut ohnehin schon blass gewesen. Jetzt wurde sie noch blasser.
»Was?«, fragte sie. »Jetzt sag schon!«
Also musste ich wohl damit herausrücken. Der ganze schreckliche Kampf in der Grotte, bei dem Bravita Blutsschwester aus ihrem vierhundert Jahre alten Gefängnis entkommen war und versuchte hatte, durch mich ins Leben zurückzukehren.
»Sie wollte mich verschlingen«, sagte ich leise. »Dann wäre in mir keine Clara mehr gewesen, sondern nur noch Blutsschwester. Kater und Tante Isa haben versucht, sie aufzuhalten, aber sie waren nicht stark genug. Und dann … dann habe ich gerufen. So, wie Herr Malkin es mir beigebracht hat: Adiuvate. Und sie sind gekommen. Alle. Der ganze Kreis. Gemeinsam haben sie die Blutsschwester abwehren können, doch … doch … danach waren sie … nicht tot, zumindest glaube ich das nicht, aber wie erstarrt. Und … und … das sind sie immer noch.«
»Wo?«, fragte Kahla nur.
»In Vestmark.«
Sie stellte sich ganz dicht vor mich.
»Zeig es mir«, sagte sie.
Ich bekam fast Angst vor ihr. Ich wusste zwar, dass sie manchmal ziemlich verschlossen und feindselig wirken konnte, auch wenn sie gar nicht unbedingt in der Stimmung war, einen in irgendetwas Warziges, Ekliges, Krötenartiges zu verwandeln, aber … also, wenn sie einen so ansah, war das doch wirklich kein Wunder.
Du hast ihr eben erzählt, dass ihr Vater mehr tot als lebendig ist, ermahnte ich mich. Hast du erwartet, dass sie einfach lächeln und das ganz in Ordnung finden würde?
»Jetzt?«, fragte ich und hörte selbst, dass meine Frage genauso dumm und unüberlegt klang wie die mit dem Regen.
»Ja. Jetzt!«
Sie streckte mir ihre Hand entgegen, als wollte sie mich mit Gewalt auf die Beine ziehen. Plötzlich war das Katerchen nicht mehr die kleine, schlafende und nahezu unsichtbare Beule unter der Decke. Er richtete sich zu voller Größe auf – es waren so circa zwanzig Zentimeter – und fauchte Kahla böse an.
Kahla zog die Hand zurück.
»Was ist das?«, fragte sie.
»Katerchen«, sagte ich.
»Ja, danke, ich sehe sehr wohl, dass das ein Kater ist, aber was macht er –«, sie unterbrach sich selbst und musterte Katerchen und mich genauer.
»Wo ist Kater?«, fragte sie dann.
Meine Sehnsucht nach ihm wurde so groß, dass ich kaum einen Ton herausbrachte.
»Er … kommt nicht mehr«, flüsterte ich.
»Und stattdessen hast du diese halbe Portion bekommen?«
»Er ist keine … Ich weiß selbst, dass er noch nicht besonders groß ist, aber …« Sie schüttelte den Kopf. »Ist mir egal, solange der Zwerg uns nicht aufhält. Jetzt komm!«
Katerchen riss die Schnauze wieder weit auf und fauchte, dieses Mal ziemlich leise. Ganz eindeutig war das zwischen ihm und Kahla nicht gerade Liebe auf den ersten Faucher.
Ich drückte ihn an mich, als ich aufstand. Ich wollte nicht, dass er Kahla tatsächlich angriff – das wäre ihm mit Sicherheit nicht gut bekommen.
»Wo geht ihr hin?«, fragte Nichts verschlafen auf ihrer Schlafstange neben dem Holzofen.
»Nach Vestmark«, sagte Kahla. »Ich will meinen Vater sehen!«
Meister Millaconda lag auf dem Rücken und starrte in die Luft. Er sah ziemlich grimmig aus, denn seine Stirn war so stark gerunzelt, dass sich seine schwarzen Augenbrauen beinahe in der Mitte berührten. Es war exakt derselbe Gesichtsausdruck, den er unten in der Grotte gehabt hatte. Es hatte sich nichts verändert. Keiner von ihnen, auch nicht Tante Isa, hatte sich auch nur einen Millimeter bewegt, seit Oscar und ich sie am Vortag zurückgelassen hatten.
Nachdem jetzt fünf Matratzen darin lagen, kam mir die große Halle gar nicht mehr so groß vor wie sonst. Sieht aus wie ein Krankenhauszimmer, dachte ich. Und konnte mich selbst nicht daran hindern weiterzudenken: oder eine Grabkammer.
Kahla stieß einen Laut zwischen Japsen und Schluchzen aus. Sie stürzte zu ihrem Vater, sank neben seine Matratze und nahm seine Hand. Aber sie ließ sie sofort wieder los.
»Er ist ja ganz kalt!«, sagte sie. »Wieso habt ihr nicht dafür gesorgt, dass er ordentlich warm ist?«
Ich versuchte ihr zu erklären, dass wir uns ja bemüht hatten, mit Decken und Kaminfeuer und Wärmflasche und allem.
»Es macht keinen Unterschied«, sagte ich. »Es ist einfach so.«
Sie hörte nicht zu. Sie hielt die Hand ihres Vaters wieder fest, und der Wildgesang strömte aus ihr heraus, hoch, scharf und brennend, fast wie eine Ohrfeige. Mein Herz machte einen hoffnungsvollen Satz, und ich spähte nach einer Reaktion, einem Lebenszeichen, nach irgendetwas anderem als dieser schrecklichen Reglosigkeit. Soweit ich es sehen konnte, tat sich nichts, außer dass Kahla sichtbar müder wurde, je länger sie sang. Trotzdem machte sie weiter und weiter, fast eine Stunde lang, glaube ich, bis ihre Stimme brüchig wurde und sie selbst so erschöpft war, dass ich ihr auf die Beine helfen musste, als sie schließlich aufgab.
»Es wirkt nicht«, sagte sie heiser. »Wieso wirkt es nicht?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich.
»Ich verstehe nicht, wieso es nicht wirkt …« Sie konnte sich kaum auf den Beinen halten, und ich musste ihr in die Küche helfen, damit sie sich hinsetzen konnte. Nichts flatterte bekümmert hinter uns her und stieß dabei einen Schwall kleiner »Oh nein, oh nein, oh nein«-Ausrufe aus.
Über dem Küchentisch hing ein Haken. Nichts schaute unvermittelt hoch, und ich konnte sehen, wie sich ihr Gefieder aufstellte. An dem Haken hatte damals ein Käfig gehangen, und in diesem Käfig hatte ich Nichts das erste Mal gesehen. Ein kümmerliches, schniefendes und verdrecktes kleines Wesen, das die Erwartungen seiner Schöpferin nicht erfüllen konnte und nur in diesen Käfig gesteckt worden war, weil es Chimära auf die Nerven ging, dass Nichts ihr überallhin folgte. Sie hatte nicht gewusst, was die Worte »Freund« und »Freiheit« bedeuteten. Das lernte sie erst jetzt nach und nach, und es war bestimmt nicht schön für sie, wieder hier zu sein. Auch als sich ihr Gefieder nach ein paar Minuten wieder glättete, sah sie ängstlicher aus als sonst. Und nicht nur wegen ihrer Erinnerungen, wie sich zeigte.
»Wieso sind sie so still?«, fragte sie. »Isa … sie … ihre Augen sind ganz starr. Glaubst du, es tut ihr weh?«
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. »Hast du eine Ahnung, was ihnen fehlt?« Ich hoffte so sehr, dass Kahla eine Antwort hatte. Sie war eine wirklich gute Wildhexe, viel besser als ich.
Aber Kahla schüttelte den Kopf.
»Ich habe so etwas noch nie gesehen«, antwortete sie. »Es sieht so aus, als … als wären sie erstarrt. Vielleicht hängt das irgendwie mit der Zeit zusammen.«
»Was meinst du?«
»Mein Vater hat mal gesagt, wenn man etwas wirklich Heftiges, Großes ausführt – also etwas Magisches –, dann macht das etwas mit der Zeit. So, als würde sie langsamer vergehen oder sogar für ein paar Sekunden anhalten.«
Ich dachte an die Male zurück, in denen ich »etwas wirklich Heftiges, Großes« miterlebt hatte. Ich konnte mich gut an das Gefühl erinnern, als würde die Zeit stehen bleiben – als würde alles in Zeitlupe ablaufen.
Wenn Kahla recht hatte – hieß das dann, dass die fünf reglosen Körper ganz einfach angehalten worden waren? Für eine lange, erstarrte Sekunde, zwischen einem Herzschlag und dem nächsten, mitten zwischen zwei Atemzügen? Das war fast ein beruhigender Gedanke, auf jeden Fall besser, als sich vorzustellen, dass sie hinter den starren Blicken und den unbeweglichen Muskeln bei vollem Bewusstsein waren.
»Und wie setzt man die Zeit wieder in Gang?«, fragte ich.
Kahla warf mir einen finsteren Blick zu.
»Glaubst du nicht, dass ich es längst getan hätte, wenn ich es wüsste? Ich weiß ja nicht einmal, ob es wirklich diese Sache mit der Zeit ist! Ich rate nur.«
»Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Meinst du, die Rabenmütter können uns helfen?«
Kahla stützte die Ellenbogen auf den Tisch und hielt sich mit beiden Händen die Stirn. Ich hörte ein leises Geräusch, irgendetwas zwischen Seufzen und Zischen, und sie schob ihre schwarzen Haare ein wenig zurück. Sie ringelten sich ungewöhnlich lebendig um ihre Finger, wie ich fand.
»Wir müssen es wohl versuchen« sagte sie. Aber sie klang nicht sonderlich optimistisch.
Ich dachte an Tumpe, Stjerne und die Ziegen, die alleine zu Hause waren. Jedenfalls so lange, bis Mama zurückkam.
»Ich schreibe meiner Mutter nur schnell eine SMS«, sagte ich. »Damit sie daran denkt, die Tiere zu füttern. Los jetzt, Kahla – lass uns aufbrechen. Die Rabenmütter wissen, was wir tun müssen!«
Ich dachte an Thuja, die Erste im Kreis der Rabenmütter. Sie war so ziemlich die klügste Wildhexe, die ich kannte.
Kahla stand auf. Ihr Gesicht war hart und entschlossen.
»Halt das Katzenvieh gut fest«, sagte sie. »Wenn wir etwas erreichen wollen, sollten wir uns besser beeilen, und ich habe keine Zeit, auf den Wilden Wegen herumzurennen und nach ihm zu suchen, falls er abhaut.«
Ich wollte gerade protestieren und erklären, dass Katerchen keiner war, der einfach weglief, aber dann blieb ich doch lieber still. Was wusste ich schon über Katerchen und auf welche Ideen er kommen konnte? Sicherheitshalber schob ich ihn unter meinen Pulli.
Es sollte sich herausstellen, dass das eine kluge Entscheidung war …
2 DER RABENSTURM
Der zähe Nebel war dicht und feucht und … und beinahe warm. Klebrig. Die Wilden Wege waren nie ungefährlich, selbst erfahrene Hexen konnten sich ernsthaft verirren. Und wir waren nicht erfahren. Nicht einmal Kahla, auch wenn sie in allem, was mit der Wilden Welt zusammenhing, ungefähr hundertmal besser war als ich.
»Ist es noch weit?«, fragte ich. Ich hatte das Gefühl, seit einer Ewigkeit unterwegs zu sein. Katerchen maunzte verschlafen und streckte eine Vorderpfote aus, rollte sich dann aber wieder unter meinem Pulli zusammen.
»Ich weiß nicht …«, flüsterte Kahla. »Es kommt mir so vor, als wäre irgendwas anders. Irgendetwas … stimmt nicht.«
»Haben wir uns verlaufen?«, piepste Nichts aus meinem Rucksack.
»Nein«, sagte Kahla. »Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Rabenkessels. Es fühlt sich nur so an, als würden die Wilden Wege … Widerstand leisten.«
Ja. Genau das war es! Deshalb kam es mir so vor, als wären wir seit hundert Jahren unterwegs. Ich hatte eher den Eindruck, durch Wasser zu waten als durch Luft. Oder sogar durch etwas, das zäher als Wasser war – Öl vielleicht.
Warmes, klebriges Öl. Es drückte. In den Ohren, gegen die Stirn, in Nase und Mund. Ich hatte Kopfweh bekommen, so richtiges Gewitterkopfweh. Unter meiner Schädeldecke war irgendwie nicht mehr genug Platz für alles, was dort hingehörte. Aber es gewitterte nie auf den Wilden Wegen. Hier gab es kein anderes Wetter als Nebel.
Oder doch?
Eine Brise bewegte meine verschwitzten Haare und kühlte meinen Nacken ein wenig. Ich dachte gerade noch, dass das merkwürdig war, als mir bewusst wurde, wie grundverkehrt es war.
»Hier windet es nie …«, sagte ich.
Da hörte ich ein Grollen, und der Wind frischte auf. Ich drehte mich um. Eine jähe, harte, brühheiße Böe schlug mir entgegen, und der Nebel hinter uns war nicht mehr grau, sondern schwarz.
»Halt dich fest!«, rief ich Nichts zu und umklammerte selbst mit beiden Händen Kahlas Oberarm.
Ich verlor den Boden unter den Füßen. Der Wind hob mich hoch und riss mir die Beine weg, ich wurde durch die Luft gewirbelt wie ein Blatt im Herbststurm, und irgendetwas traf mich am Kinn, scharf wie ein Peitschenhieb. Das Katerchen wand sich unter meiner Jacke und krallte sich mit allen Krallen fest. Wir flogen. Wir taumelten. Erst konnte ich nichts als Nebel sehen und hörte nichts als das Brüllen des Sturms. Dann füllte sich die Luft mit heiseren Schreien, und ich knallte gegen einen Baum.
Der Baum brach. Nicht meinetwegen, sondern durch den Wind. Ich spürte ein Knacken im Arm und einen Ruck, der so heftig war, dass er eigentlich kaum wehtat. Der Schmerz kam erst hinterher.
Ich war von Kahla losgerissen worden, aber wenigstens flog ich nicht länger durch die Luft. Ich lag auf der Erde, auf feuchter, dunkler kalter Erde, und der Sturm tobte über mir und um mich herum. Es prasselte und knackte, die Luft war angefüllt mit Schreien und schwarzen Federn, und ein seltsamer Regen, der nur stellenweise fiel, tropfte warm auf mich herunter und klebte in meinen Haaren, auf meinem Gesicht und auf dem Arm, den ich mir über den Kopf hielt.
Es dauerte eine Ewigkeit. Oder vielleicht auch nur ein paar Sekunden. Zeit spielte keine Rolle mehr.
Überall krachte und knallte es. Irgendetwas stürzte auf mich herunter – es fühlte sich an wie ein Ast, aber ich konnte nicht sehen, was es war, denn der Wind riss es sofort wieder mit sich und die Dunkelheit war total. Ich konnte Nichts’ verängstigtes »Oh nein, oh nein, oh nein …« hören und dachte gerade, dass sie wenigstens noch da war, da hinten im Rucksack, und nicht weggewirbelt oder von irgendetwas tödlich getroffen worden war, als es plötzlich still wurde.
Der Wind erstarb.
Die Dunkelheit dauerte noch einen Moment an, dann löste sie sich auf und Sonnenlicht sickerte durch die Baumwipfel auf uns herunter. Ich tastete nach meinem Arm.
Gebrochen, dachte ich, aber ganz sicher war ich mir nicht. Ich hatte keine Ahnung, wie sich ein gebrochener Arm anfühlte, und außerdem konnte ich meine Finger ja noch beugen und strecken.
Dann entdeckte ich, dass der Regen kein Regen gewesen war. Eine einzelne schwarze Feder segelte langsam zu Boden. Meine Hände, meine Arme und ganz bestimmt auch mein Gesicht waren mit klebrigen Blutspritzern übersät, und auf dem Boden vor mir, nur wenige Meter entfernt, lagen die zerfetzten Reste eines Raben.
»Oh nein«, jammerte Nichts und befreite sich flatternd aus dem Rucksack. »Was ist nur geschehen? Oh nein, oh nein.«
Ich sah mich um. Trotz der abgeknickten Zweige und umgestürzten Bäume erkannte ich den Pfad, der in den Rabenkessel führte.
Wir waren am Ziel. Ich hätte erleichtert sein sollen. Aber ich hatte schon da die kalte, bange Ahnung, dass die Rabenmütter uns nicht mehr helfen konnten.
3 STILLE
Es war so still. Der Himmel war blau und Sonnenlicht glitzerte in den Pfützen und auf den nassen Zweigen. So, wie diese Sonne schien, hätte man meinen können, es wäre alles in bester Ordnung. Rund um den Rabenkessel waren einige Bäume umgestürzt, aber die meisten standen noch immer fest verwurzelt. Und doch stimmte rein gar nichts. Die Zweige waren leer. Kein einziger Rabe war zu sehen oder zu hören. Nicht einmal eine Krähe. Der Himmel über uns kam mir nackt vor ohne die kreisenden schwarzen Vögel, und die Stille ohne ihre heiseren Rufe war ganz einfach … falsch.
»Sind sie alle … weg?«, flüsterte Nichts.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich. Aber ich hatte ein kaltes, schreckliches Gefühl im Magen, ein Gefühl, das mir sagte: Ja – jeder einzelne. Mein Arm, der vielleicht gebrochen war oder auch nicht, tat weh und pochte, und es wäre schön gewesen, wenn eine erwachsene Wildhexe den Schmerz einfach weggesungen und mir eine Tasse Baldriantee zum Schlafen gekocht hätte, aber ich wusste tief in meinem Innersten, dass mein schmerzender Arm im Angesicht der Katastrophen, die uns umgaben, nur ein kleines, unbedeutendes Problem sein würde.
Eine riesengroße alte Esche war in den Rabenkessel gestürzt. Viele abgebrochene Zweige lagen einfach wie Brennholz oder Reisig herum, aber etliche der dicken Äste hatten sich tief in die Erde gebohrt, als wären sie von einem Riesen wie Zelt-Heringe in den Boden gerammt worden. Dazwischen konnte ich etwas Dunkles sehen.
Nein. Nicht etwas. Jemanden.
Unter der gewaltigen Krone der Esche war ein Mensch eingeklemmt. Ein Mensch, der den schwarzen Ordensmantel der Rabenmütter trug.
Lass es nicht Thuja sein, dachte ich, auch wenn es natürlich in jedem Fall schrecklich war, ganz gleich, welche der Rabenmütter dort lag. Es war nur so, dass ich Thuja für die Klügste von ihnen hielt, sie war diejenige, der ich am meisten vertraute.
»Da liegt jemand …«, sagte ich und zeigte mit meinem gesunden Arm zu dem Baum. »Kahla, wir müssen helfen –«
Kahla war schon unterwegs. Sie nahm sich nicht einmal die Zeit, zu der abschüssigen Erdrampe zu gehen, die normalerweise als Ein- und Ausgang des Rabenkessels diente, sondern rutschte den Abhang hinunter, steil wie er war, während sie einen schnellen, fragenden Wildgesang summte, um herauszufinden, ob es eine lebende oder eine tote Rabenmutter war, die wir befreien mussten.
Eine lebende oder eine tote Rabenmutter. Ich glaube, erst bei diesem Gedanken wurde mir der Ernst der Lage wirklich bewusst. Als hätte ich mich, seit wir in den Sturm geraten waren, in einer Blase aus Unwirklichkeit befunden und als hätte diese Blase gerade eben erst ein Loch bekommen.
Was, wenn die Rabenmutter dort wirklich tot war? Der Sturm hatte bereits Hunderte von Raben getötet, natürlich konnte auch ein Mensch darin umgekommen sein. Erst recht, wenn er unter einem riesigen Baum begraben worden war. Ich rannte los, obwohl mein Arm pochte und das Katerchen seine Krallen in meinen Pulli und die Haut darunter grub.
Als ich ein wenig näher kam, sah ich, dass es nicht Thuja war, sondern Valla, die etwas behäbige männliche Rabenmutter. Er war damals äußerst unwirsch gewesen, weil wir mitten in der Nacht durch den Wald wandern mussten, als ich die Feuerprobe ablegen sollte, um dem Rat zu beweisen, dass ich die Wahrheit gesagt hatte und Chimära log. Zum Glück war er nicht unter dem Stamm der Esche eingezwängt, sondern nur unter einem Haufen von Zweigen und Ästen gefangen. Einer davon hatte sich wie ein Spieß durch seinen Arm gebohrt und ihn am Boden festgenagelt, aber er war nicht tot, das konnte ich sehen und hören. Er jammerte leise und kratzte mit den Stiefelkappen über den Boden, als versuchte er wegzukrabbeln, ohne zu begreifen, dass das unmöglich war.
»Warte!, rief ich ihm zu. »Bleib liegen. Wir befreien dich.«
Wo waren die anderen Menschen? Da mussten noch mehr sein, sie konnten wohl nicht alle tot und verletzt sein. Oder doch? Bei dem Gedanken zog sich mein Herz zusammen.
Kahla hatte schon den Wildgesang angestimmt, und darin war sie wesentlich besser als ich. Dafür hatte ich das Taschenmesser, das Oscar mir zum Geburtstag geschenkt hatte, und damit sägte ich den Ast vorsichtig links und rechts von Vallas Arm ab. Natürlich mussten wir auch das Holz aus dem Arm bekommen, aber das erforderte Vorbereitungen. Warmes Wasser, Verbände, viel mehr Wildgesang … Hilfe, sofern hier noch irgendwo Hilfe zu bekommen war.
Und wenn nicht, müssen wir es ohne schaffen, sagte ich streng zu mir selbst.
Valla jammerte wieder. Dieses Mal mit Worten, aber es war kaum zu verstehen, was er sagte. Er schwitzte vor Schmerz, und seine grau melierten Haare klebten ihm an Nacken, Wangen und Stirn.
»Die Raben«, murmelte er. »Die Raben …«
Ich mochte ihn eigentlich nicht besonders, aber jetzt tat er mir leid. In dieser Situation dachte er nicht an sich selbst, obwohl jeder, der einen spitzen Ast im Arm stecken hatte, wahrlich Recht auf ein bisschen Selbstmitleid hatte.
»Es … es wird bestimmt alles gut« war das Einzige, was mir einfiel, um ihn zu trösten. Ich konnte ihn nicht anlügen und sagen: »Den Raben geht es gut.« Meine Kleider waren übersät mit Rabenblutspritzern.
Kahla sang immer noch, und es war deutlich zu sehen, dass es half. Ihre Stimme klang heiser und matt, weil sie bereits so lange vergeblich für ihren Vater gesungen hatte, aber ihr Gesang war trotzdem kraftvoll. Valla war schon nicht mehr so blass, und er blutete weniger als am Anfang. Er wollte sich aufsetzen.
»Warte kurz«, bat ich und hielt ihn zurück. »Warte, bis der Wildgesang zu Ende ist.«
Obwohl er benommen und verwirrt war, verstand er, was ich gesagt hatte. Er blieb still liegen, bis der letzte heisere Ton verklungen war.
»Die Raben«, sagte er wieder. »Sind noch welche da?«
Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen.
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich.
Er stieß einen Laut aus, als wäre etwas in seinem Inneren zerbrochen. Dann schlug er die unverletzte Hand vor das Gesicht, und ich glaube, er weinte.
»Wo sind die anderen?«, fragte ich. »Thuja, Arkus … die anderen Rabenmütter. Was ist mit ihnen passiert?«
Er ließ langsam die Hand sinken.
»Wir müssen suchen«, sagte er. »Wir müssen suchen, bis wir sie gefunden haben.«
»Wo hast du sie zuletzt gesehen?«, fragte Kahla.
»Es ging alles so schnell«, erklärte er. »Ich saß gerade da und las, als mit einem Mal ein Windstoß durch den Schornstein fuhr, der so kräftig war, dass das Feuer ausging. Ich konnte etwas hören … seltsame Geräusche. Ein Heulen, ein Knacken. Obwohl das Feuer ausgegangen war, wurde es furchtbar warm. Und dann spürte ich … dann … dann starb Hugin. Mein Rabe. Ich konnte nichts dagegen tun, es dauerte höchstens eine Sekunde. Und ich wusste … mein Wildsinn sagte mir … dass er nicht der Einzige war. Ich lief nach draußen, aber … der Wind hob mich hoch und schleuderte mich wieder auf den Boden. Ich hörte die Bäume brechen, und dann …«
Er griff nach seinem durchbohrten Arm. »Ich konnte mich nicht befreien. Ich dachte, ich würde sterben, und vielleicht … wäre es das Beste gewesen.«
»Das ist nie das Beste«, sagte Kahla hart. »Man kann immer etwas aus seinem Leben machen.«
Wieso schimpfte sie mit ihm? Merkte sie nicht, wie unglücklich er war? Ich sah sie bittend an. Ihre schwarzen Haare bewegten sich im Wind, fast so, als ob sie lebendig wären, aber ihr Gesicht war ausdruckslos und starr.
Das Merkwürdige war, dass Valla sich ihre Worte offenbar zu Herzen nahm und sich aufrichtete.
»Du hast recht«, sagte er. »Wir müssen nachsehen, ob in der Bruthöhle alles in Ordnung ist.«
»Erst müssen wir uns um deinen Arm kümmern«, wandte ich ein, aber er wollte nicht auf mich hören.
»Bruthöhle«, wiederholte er. »Die Eier. Ich muss wissen, ob wir alles verloren haben oder ob es noch Hoffnung für die Rabenmütter gibt.«