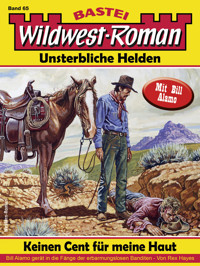1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Um ein Haar wäre der Texas-Ranger Bill Alamo dem Mann begegnet, der den Prospektor Hugh Darnell kaltblütig ermordet hat, und eine Menge Unannehmlichkeiten wären ihm erspart geblieben. So aber läuft er blindlings einem Aufgebot in die Arme, das in ihm den Mörder des Prospektors sieht. Eine fatale Situation, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. Welches Interesse hat der Deputy Barley, Bill Alamo zu lynchen? Das ist eine der Fragen, auf die er lange keine Antwort erhält. Und als Bill glaubt, am Ziel zu sein, muss er erkennen, dass er in Wirklichkeit in eine tödliche Falle getappt ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Spuren im Staub
Vorschau
Impressum
Spuren im Staub
Von Rex Hayes
Die Geier kreisen unruhig über den staubigen Hügeln, stürzen herunter und steigen dann wieder empor.
»Shadow«, sage ich zu meinem Pferd, »dort vorne muss etwas liegen, was schon ziemlich tot ist.«
Shadow zögert nicht lange und trabt ganz von alleine los. Er jagt den nächsten Hügel hinauf und drüben hinab. Das braune, verbrannte Bunchgras raschelt unter seinen Hufen.
Wir durchreiten eine Mulde, und dann sehe ich einen roten Blitz. Ein grauer Rauchball rollt über das Gras. Eine Kugel zischt vor Shadow in den Staub und wirbelt Dreck hoch. Dann kommt auch der Knall, der hallende Echos aus den Hügeln zurückwirft ...
Ich bin auf so etwas nicht gefasst gewesen. Darum presse ich mich erst an Shadows Hals und rutsche dann auf dem Sattelbock zurück. Schließlich lasse ich mich aus Letzerem fallen, rolle mich seitwärts ab und greife nach dem Revolver.
Wieder flammt es fahlrot über den Spitzen des Grasmeeres auf, und die harte Detonation eines zweiten Schusses erreicht meine Ohren.
Shadow macht kehrt und verschwindet hinter der Deckung eines Hügelrückens.
Ich liege da und überlege, wer so brennend daran interessiert sein könnte, mir das Lebenslicht auszublasen.
So vergeht eine lange Zeit. Die Sonne treibt mir den Schweiß auf die Stirn. Die Bussarde, die bei dem plötzlichen Schießen auseinandergestoben waren, haben sich wieder versammelt und ihren Kreisflug aufgenommen.
Was, zum Teufel, liegt da vorne? Ein totes Pferd vielleicht. Aber auch ganz bestimmt ein Mann, der noch nicht so erledigt ist, um sein Schießeisen nicht mehr zu gebrauchen.
Ich nehme den Hut ab, stecke ihn auf den Revolverlauf und bewege ihn vorsichtig über dem Gras. Nichts geschieht. Ich muss mir also etwas anderes einfallen lassen.
Mir wird plötzlich bewusst, dass die Geier tiefer fliegen. Sie sind dreister geworden. Es ist auch kein dritter Schuss mehr gefallen. Schweigend und wie tot liegt das heiße Land unter den Strahlen der unbarmherzigen Sonne.
Auf Finger- und Fußspitzen krieche ich vorsichtig in einem großen Bogen auf die Stelle zu, wo ich vorhin das Mündungsfeuer gesehen habe.
Ich bin ziemlich erledigt, als ich die nächsten fünfzig Meter zurückgelegt habe.
Dann aber erreiche ich den Rand einer kleinen Mulde. Es ist nicht mehr als eine flache Vertiefung von zehn Schritt Durchmesser, angefüllt mit heißem Staub. Und inmitten dieses Staubes liegt der reglose Körper eines Pferdes.
Damit hätte ich eine Erklärung für die Geier. Aber ein totes Maultier kann unmöglich auf mich geschossen haben. Wo steckt der Schütze?
Ich schiebe mich noch ein wenig vor, und dann entdecke ich am Rand der Mulde den Mann. Er liegt inmitten des Bunchgrases auf dem Bauch. Seine Hand ist ausgestreckt und hält den Kolben eines altmodischen, langläufigen Grenzercolts, Modell Texas-Patterson.
Der Kopf des Mannes ist vornübergesunken. Sein Gesicht berührt die Erde. Das ist eine merkwürdige Haltung für einen Mann, der vor wenigen Minuten noch einen anderen erschießen wollte und in Erwartung einer Gegenreaktion sein muss. Oder ist dieser Bursche gar tot?
Der Gedanke elektrisiert mich. Ich ziehe den Colt und springe auf. Der Mann rührt sich nicht. Ich gehe langsam vorwärts, die Mündung des Revolvers fest auf die leblose Gestalt gerichtet.
Nichts geschieht. Der Mann liegt still und stumm unter der Sonne. Jetzt kann ich seinen Kopf sehen. Er trägt keinen Hut, und das ist sonderbar. Sein Haar ist weiß – und blutig.
Ich stecke den Revolver ein und bin mit drei langen Sätzen bei ihm. Ich schiebe die Hand unter seine Schultern und drehe ihn langsam auf den Rücken. Vor mir liegt ein alter Mann in der abgerissenen, verwetterten Kleidung eines Prospektors. Seine Augen sind geschlossen und sein Gesicht ist eingefallen, aber seine Brust bewegt sich noch ein wenig. Ich entdecke eine blutige Schramme dicht unter seiner linken Schläfe und einen großen, dunklen Fleck auf seinem fadenscheinigen Hemd. Als ich es öffne, sehe ich das Kugelloch, und nun weiß ich, dass es für diesen alten Mann keine Rettung mehr gibt.
Ich nehme ihm vorsichtig die Schusswaffe aus der verkrampften Hand und pfeife Shadow heran. Der Rappe kommt gehorsam. Ich hole die kleine Whiskyflasche, die ich immer bei mir führe, aus der Packtasche und ziehe mit den Zähnen den Korken heraus. Dann setze ich die Flasche an den Mund des alten Mannes, aber er schluckt nicht. Seine Kiefer sind fest zusammengebissen. Ich muss sie auseinanderdrücken. Endlich gelingt es mir, ihm etwas von dem scharfen Alkohol einzuflößen. Er schluckt und muss husten. Seine Lider beginnen zu flattern. Plötzlich macht er die Augen auf und schließt sie gleich darauf wieder.
»Wasser!«, röchelt er. Blutiger Schaum tritt über seine Lippen.
Ich weiß, was das bedeutet. Ich kenne die Zeichen. Zu viele Männer habe ich schon so liegen sehen. Lungenschuss – da ist nicht mehr viel zu machen. Jedenfalls nicht hier draußen in der Wildnis, wo es keinen Arzt und keine Hilfe gibt.
Ich hole die Feldflasche vom Sattel und lasse den Alten trinken. Plötzlich schlägt er die Augen auf.
»Wer sind Sie?«, keucht er.
Ich versuche zu grinsen. »Der Mann, den Sie vorhin erschießen wollten.«
»Ich dachte, er wäre zurückgekommen, um mich ganz auszulöschen ...«
»Von wem sprechen Sie?«, frage ich.
Der Alte bewegt vage die Schultern.
»Weiß ... es nicht. Wurde angeschossen ... von den Hügeln her. Fiel hin. Ein Reiter kam ins Lager. Ich zog, aber ... er schoss zuerst und traf mich ... am Kopf. Wurde bewusstlos ...«
»Wie sah er aus?«
»Ziemlich groß ... so wie Sie. Tuch vor dem Gesicht. Nur Augen gesehen ... kalte Augen.«
»Was wollte er von Ihnen?«
»Mein Gold ...«
Jetzt wird mir manches klar. Der Alte sieht wie ein Prospektor aus. Sicher hat er irgendwo in den Bergen Gold gefunden, ist dabei beobachtet und nun ausgeraubt worden.
»War es viel Gold?«, frage ich heiser.
Sein flatternder Blick wird plötzlich scharf.
»Wer sind Sie, Fremder?«
Ich hole mein Ranger-Abzeichen aus der Gürteltasche.
»Genügt Ihnen das?«
Er wirft einen Blick auf den Stern. Dann fällt sein Kopf zurück.
»Ein Ranger ...« Seine Haltung entspannt sich, sein ausgemergelter Körper wird schlaff. Seine Hand tastet nach der meinen. »Ranger, Sie werden ... mir helfen. Ich bin beraubt worden. Vierzigtausend Dollar. Ich hatte ... sie in Pearson für mein Gold bekommen ...«
»Haben Sie einen Verdacht? Wer hat Sie in Pearson mit dem Gold gesehen?«
Er keucht und ringt nach Atemluft. Ich gebe ihm noch einmal Whisky. Das ist das Einzige, was ich für ihn tun kann.
»Nur der Bankier«, ächzt er. »Heißt McDonald und sieht ehrlich aus.«
Seine dürren Finger pressen sich um meine Hände und umklammern sie wie in einem Schraubstock.
»Ranger ... suchen Sie meinen Mörder und nehmen Sie ihm mein Geld ab. Es ist für meine ... Tochter bestimmt. Sie soll es einmal besser haben als ich ...«
Seine Augen schließen sich, seine Finger öffnen sich plötzlich.
»Alter!«, rufe ich und versuche, ihn noch einmal ins Leben zurückzubringen. »Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Wo kann ich Ihre Tochter finden?«
Mit unendlicher Mühe öffnet er noch einmal die Augen. Ich muss mein Ohr an seinen Mund legen, um diese letzten, gehauchten Worte zu verstehen, die über seine Lippen kommen.
»Hugh Darnell mein Name ... Kate lebt in Dallas ... bei ihrem Onkel, einem Bruder ihrer Mutter ...«
»Sein Name?«, rufe ich. »Wie heißt dieser Mann?«
Aber ich bekomme keine Antwort mehr. Hugh Darnells Kopf ist auf die Seite gesunken. Sein Atem stockt.
Ich lasse ihn sanft in den heißen Sand gleiten und richte mich auf.
Ich finde Darnells Hut und verdecke mit ihm das Gesicht des Alten. Dann sehe ich mich etwas genauer um. Das Maultier ist mit einem Gewehr erschossen worden, aber der Alte war nur mit einem Revolver bewaffnet. Also hat man ihn niedergeschossen, ohne ihm eine Chance zu geben. Auf eine Distanz, bei der er seinen alten Colt nicht gebrauchen konnte.
Ich entdecke die Spur, die Darnells Pferd durch den Staub gezogen hat. Campgerätschaften liegen verstreut umher, und ein paar dürre Äste deuten darauf hin, dass der Alte hier sein Lager aufschlagen und ein Feuer anzünden wollte.
Dann finde ich noch eine zweite Spur. Die Spur eines Reiters. Sie kommt in das Camp herein und verlässt es wieder in der gleichen Richtung. Kein Zweifel, das ist Darnells Mörder gewesen, der sich seine Beute geholt hat.
Ich folge der Fährte, die sich bald auf dem harten, verbrannten Boden verliert. Hinter dem nächsten Hügelkamm finde ich die Eindrücke eines großen Körpers im verdorrten Gras. Hier hat ein Mann gelegen und auf einen anderen gewartet. Und ich finde noch etwas: zwei leere, gelbe Patronenhülsen.
Ich nehme die Hülsen in die Hand und setze mich hin. Von hier oben aus kann man wunderbar in Darnells Camp hineinblicken. Jede Einzelheit ist zu erkennen.
Hier oben lauerte der Mörder seinem Opfer auf, schoss Darnell nieder und tötete das scheuende Pferd mit einem zweiten Schuss. Dann ritt er in das Camp hinab, um seine Beute zu holen. Als er sah, dass der alte Mann noch nicht tot war, jagte er ihm noch eine Revolverkugel in den Schädel, nahm das Geld und verschwand. Und als Darnell zu sich kam und mich entdeckte, hielt er mich für den Mörder und feuerte seinen alten Grenzercolt auf mich ab.
Ich stehe auf und gehe in das Camp hinab. Die beiden Patronenhülsen nehme ich mit. Es sind nämlich besondere Hülsen, von einem Kaliber, wie es bei uns selten benutzt wird.
Als ich das Camp erreiche, setze ich mich auf den Rand der Mulde und überlege.
Ich muss einen Mann suchen, der ziemlich groß ist und harte, kalte Augen hat. Und der eine Springfield vom Kaliber 30/30 benutzt. Das sind verdammt wenige Anhaltspunkte.
Wo soll ich mit der Suche anfangen?
Mir fällt ein, dass Darnell den Namen Pearson erwähnte. Diese Stadt muss etwa zwanzig oder dreißig Meilen entfernt sein. Aber das spielt keine Rolle, ich brauche ja nur auf Darnells Spur zurückzureiten. Und dann werde ich diesem Bankier McDonald ein paar recht unangenehme Fragen stellen.
So sitze ich ziemlich lange. Was soll ich mit dem Toten machen? Es widerstrebt mir, ihn hier draußen in der Wildnis zurückzulassen.
Während ich noch grüble und nach einem Ausweg suche, geschieht etwas, was mich aller Sorgen enthebt.
Eine harte Stimme sagt plötzlich hinter mir: »Greifen Sie zum Himmel – und keine Tricks!«
Ich fahre auf und entdecke sechs Reiter, die lautlos durch den tiefen Staub herangekommen sind. Banditen, ist mein erster Gedanke. Aber dann sehe ich, dass ihr Anführer den Stern eines Sheriff-Deputys auf seinem Cordrock trägt.
Ich will die Arme herunternehmen – will irgendetwas erklären, aber der Mann mit dem Stern lässt mir keine Zeit dazu. Er hebt seinen Colt, dessen Mündung auf mich gerichtet ist.
»Lassen Sie ja die Hände oben, oder ich erschieße Sie!«
Diese Warnung ist massiv, und ich beeile mich, ihr zu gehorchen. Das hier ist ein Aufgebot, und was ich in den Augen der Männer lese, spricht eindeutig gegen mich. Sie sehen mich im Camp eines erschossenen Mannes, sie sehen den leergeschossenen Revolver, der neben dem Toten liegt ... Unter diesen Umständen sind schon viele Männer im Westen gehängt worden, ohne Jury und Richter und so weiter.
Mir wird plötzlich schwül unter meinem großen Hut.
»Hören Sie«, sage ich, aber der Anführer unterbricht mich barsch.
»Maul halten! Schnallen Sie Ihren Gurt ab – aber benutzen Sie nur die Linke dazu!«
Ich gehorche. Erst als mein Gurt zu Boden poltert, merke ich, welchen Fehler ich gemacht habe. Innen in einer Gürteltasche steckt mein Abzeichen, unerreichbar für mich. Na schön, dann eben nicht. Ich bin gespannt, wie sich dieses Spiel weiterentwickelt.
Der Deputy schnippt mit dem Finger. »Powell, kommen Sie her. Ist das der Mann?«
Ein Reiter drängt sein mageres Pferd nach vorne. Er beobachtet mich scharf, dann zuckt er mit den Schultern.
»Ich bin mir nicht sicher, Tom. Aber immerhin könnte er es sein. Die Größe stimmt.«
»Das genügt«, entscheidet der Anführer. »Fremder, ich verhafte Sie wegen Mordes an diesem alten Mann. Haben Sie mich verstanden?«
Ich nicke. »Natürlich, Sie sprechen ja laut genug. Wo sind Ihre Beweise, Sheriff?«
Er macht eine unwillige Handbewegung. »Die werden wir schon bekommen. Powell hat Sie gesehen, das reicht für den Strick.«
»Er hat nur einen Mann gesehen, der von meiner Größe war«, werfe ich ein. »Das ist nicht genug, um einem Mann einen Mord anzuhängen.«
»Aber wir haben Sie im Camp Ihres Opfers gefunden!«, ruft der Sheriff. »Und ich will hängen, wenn das nicht Beweis genug ist.«
Ich könnte ihm etwas anderes sagen. Ich könnte ihm die Stelle droben auf den Hügeln zeigen, wo der Mörder gelegen hat, und ihm die beiden Patronenhülsen übergeben. Dann würde die Anklage gegen mich scheitern, denn in meinem Gewehrschuh steckt eine .44er-Winchester und keine Springfield 30/30.
Ich mustere die Männer, die einen Halbkreis um mich bilden. Sie sind staubbedeckt von den Spornrädern bis zu den Kronen ihrer großen Hüte, und ihre mageren Rinderpferde müssen schnell und scharf geritten worden sein. Sie sind so mürrisch und verbissen, wie es nur Männer sind, die einen langen und beschwerlichen Ritt hinter sich haben und nun den Erfolg ihrer Bemühungen nach Hause bringen wollen.
»Wohin bringen Sie mich?«, frage ich vorsichtig.
Der Deputy streicht sich über den struppigen Schnauzbart, der auf seine Oberlippe herabhängt.
»Nach Pearson. Dort werden Sie vor ein Gericht gestellt.«
Ich mustere ihn scharf, und plötzlich beginnt sein Blick zu flattern.
Was weiß er? Was weiß dieser Mann? Weiß er, dass ich gar nicht der Mörder sein kann? Kennt er vielleicht sogar den Mann, der Hugh Darnell erschossen hat?
Wieder beschließe ich, diesem Mann nichts von meinem Fund und meinen Beobachtungen zu erzählen.
»Smith, Sie nehmen den Toten auf Ihr Pferd!«, befiehlt der Deputy. »Bronc, helfen Sie ihm dabei. Und geben Sie mir die Waffen von diesem Burschen.«
Die beiden Reiter gehorchen. Der eine hebt meinen Gurt mit dem .45er auf und zieht mein Gewehr aus dem Sattelschuh. Dann hilft er dem anderen, Darnell in eine Zeltplan zu wickeln und auf einen Pferderücken zu wuchten. Als er an mir vorübergeht, fange ich einen schnellen Blick aus einem Paar kühler, grauer Augen auf, und nun mustere ich den Mann etwas näher.
Er ist fast so groß wie ich und sehr hager. Sein Haar ist sandfarben, und seine Augen sind von jenem kühlen Grau, das einen Mann durchbohren kann. Sein Nasenbein ist gebrochen.
Mir fällt ein, dass der Deputy diesen Mann Bronc genannt hat. Sicher ist es nur ein Spitzname, aber ich habe das Gefühl, dass nur dieser Name und kein anderer zu diesem Mann passt.
»Bradley, ich glaube, Sie machen einen Fehler«, sagt Bronc schleppend, während er sein Pferd besteigt. Seine Stimme ist Musik in meinen Ohren – der schönste Texanerslang, sanft und doch bestimmt.
»Wieso das?«, hakt der Deputy nach.
Bronc grinst. »Nun, ich habe mir eben die Wunden angesehen. Der Alte wurde mit einem Gewehr erschossen, und zwar von hinten. Sehen Sie sich diesen Burschen genau an. Glauben Sie wirklich, dass er zu so einer solchen Tat fähig wäre?«
Bradley entgegnet: »Bronc, Sie sagen das nur, weil er auch ein Texaner ist wie Sie: Ich habe es sofort an seiner Stimme erkannt.«
Bronc stützt die Hände gegen das Sattelhorn und mustert Bradley kühl.
»Nun, Tom, alle Texaner ähneln sich ein wenig. Sie haben eine Vorliebe für den Revolver – aber die wenigsten von ihnen enden an einem Strick. Daran sollten Sie denken, bevor Sie etwas unternehmen.«
»Das soll Sheriff Mitchell entscheiden«, knurrt der Deputy, und ich erkenne, dass er beinahe an seiner Wut erstickt. »Vorwärts jetzt! Setzt diesen Mann auf sein Pferd und passt auf, dass er euch nicht entwischt! Fremder, wie hießen Sie?«
»Bill Somers«, sage ich, denn ich habe keine Lust, diesem Mann meinen wirklichen Namen zu nennen.
»Gut, Somers, wenn Sie einen Fluchtversuch wagen, werden Sie schneller tot sein, als Sie ,drei' sagen können, verstanden?«
Ich nicke. Einer der Männer bringt mein Pferd. Bradleys Augen werden groß und rund. Trotz Staub und Schweiß ist Shadows Klasse für jeden Kenner nicht zu übersehen. Ich fixiere den Deputy scharf unter gesenkten Lidern und erkenne die Gier in seinen Augen. Das beunruhigt mich etwas. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mann von einem sogenannten »Gesetzesvertreter« angeblich auf der Flucht erschossen wird, nur weil dem anderen sein Pferd oder seine Ausrüstung so gut gefällt.
Ich sitze auf. Bradley gibt einem der Reiter einen Wink: »Bindet ihn fest!«
Aber Bronc mischt sich ein: »Warum das? Der Weg nach Pearson ist kein Kinderspiel. Wenn er uns sein Wort gibt, dass er nicht flieht, brauchen Sie ihn nicht zu fesseln. Bradley. Warum, zum Teufel, müssen Sie allen Leuten das Leben so schwermachen?«
»Zur Hölle mit Ihnen, Bronc!«, flucht Bradley und beißt sich auf die Lippen. »Warum sind Sie überhaupt mitgekommen, he? Ich sehe einen verdammten Schafhirten nicht gern in meinem Aufgebot.«
Bronc bleibt ganz ruhig. »Über den Schafhirten sprechen wir noch einmal, Tom.« Er wendet sich an mich. »Wie ist es, werden Sie uns Schwierigkeiten machen?«
Ich schüttle den Kopf. »Natürlich nicht. Sie brauchen mich nicht an meinen Sattel zu binden.«
Bradley flucht, sagt aber nichts mehr. Die Reiter formieren sich und nehmen mich in die Mitte. Dann gibt er den Befehl zum Abmarsch, und wir verlassen das Camp.
Während wir den Weg nach Pearson unter die Hufe nehmen, habe ich Zeit, noch einmal über alles nachzudenken.
Komisch, von dem Geld, das Hugh Darnell bei sich führte und um dessentwillen er erschossen wurde, hat Bradley kein Wort gesprochen. Weiß er nichts davon oder will er nur nicht davon reden, um die anderen nicht darauf aufmerksam zu machen?
Das ist ein Punkt, über den ich gründlich nachdenken muss. Schließlich hat jeder Mörder ein Motiv, und auch diese Männer hier müssten sich sagen, dass Darnells Mörder eins gehabt haben muss. Sie müssten sich darum kümmern. Zumindest Bradley als Beamter.
Wenn Bradley mich für den Mörder hält, warum hat er mich dann noch nicht nach meinem Motiv gefragt?
Warum hat er sich nicht davon überzeugt, dass Hugh Darnell einem Raubmord zum Opfer gefallen ist?
Die Antwort darauf ist sehr einfach: Weil er mich dann sofort hätte freilassen müssen, denn ich habe kein Stück von Darnells Eigentum auch nur angerührt.