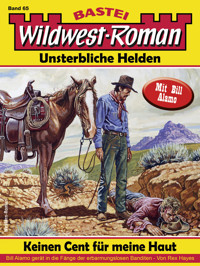
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Es ist eine ganz harmlose Sache", sagt Jim McNelty zu Bill Alamo, seinem Ass unter den Texas-Rangern. Und in der Tat sieht es harmlos aus, was sich da am Big Muddy abspielt. Rinder werden gestohlen, und einige davon kommen nach ein paar Tagen sogar zurück. Nur wenig später werden sie allerdings trotzdem getötet. Bald müssen auch Menschen ihr Leben lassen. Nun ist die Angelegenheit gar nicht mehr so harmlos, wie Jim McNelty zunächst dachte. Es hagelt Blei, und es gibt Überraschungen am Big Muddy. Einige davon sind tödlich ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Keinen Cent für meine Haut
Vorschau
Impressum
Keinen Cent für meine Haut
Von Rex Hayes
Der Mond kommt gerade hinter der gezackten Linie des Gebirges hoch, als ich die Anhöhe erreiche. Tief unter mir liegt eine flache, vom Mondlicht versilberte Mulde.
Ich halte Shadow an und richte mich in den Bügeln auf. Ich habe die Skizze, die man mir im Rancherbüro von Harrisville gegeben hat, genau im Kopf.
Das hier muss der Platz sein.
Ich setze mich wieder in den Sattel zurück und warte, bis meine Augen sich an das Mondlicht gewöhnt haben. Und dann entdecke ich die Hütte. Sie steht an der anderen Seite der Mulde, genau unter einer schroffen, düsteren Felswand, und der Schatten der Berge fällt auf sie.
Es ist eine ziemlich komische Geschichte, warum man mich in diesen abgeschiedenen Winkel geschickt hat. Und die will ich jetzt erzählen ...
Die Rancher haben sich beschwert, sie haben in der letzten Zeit viel Vieh verloren. Mehr jedenfalls, als es eine Weide auf die Dauer vertragen kann.
Die Viehzüchter-Schutzgenossenschaft hat sich an die Ranger um Hilfe gewandt, und meinem Freund und Boss, Captain Jim McNelty, ist nichts Besseres eingefallen, als mich mit dieser Angelegenheit zu betrauen.
Denn da ist noch ein Haken dabei.
Mit gewöhnlichem Viehraub würden sich die Texas-Ranger kaum abgeben. Dazu ist der örtliche Sheriff da. Oder die Rancher müssen sich zusammenschließen und sich selbst helfen. Aber hier scheint etwas anderes im Spiel zu sein.
Die Grenze nach Mexiko hinüber ist nahe, und vielleicht kommt auch noch Schmuggel dazu. Menschenschmuggel etwa, denn das gibt es hier unten auch: Halbverhungerte mexikanische Peons und Landarbeiter, die bei Nacht und Nebel über die Grenze gebracht werden – ohne Pass und Visum, versteht sich.
Drüben bei ihnen herrscht bitterste Armut, deshalb sind sie ganz scharf darauf, in das gelobte Land der Vereinigten Staaten zu kommen. Mit ihren billigen Arbeitskräften überschwemmen sie den ganzen Südwesten und drücken die Löhne. Es gibt eine gewisse Sorte Menschen bei uns, die sich mit dieser Art des Schmuggels einen ganz schönen, einträglichen Job geschaffen hat.
Nur verstehe ich nicht, was das mit den Viehdiebstählen zu tun haben soll.
Es wird aber noch mehr geschmuggelt hier unten, Rauschgift zum Beispiel.
Ich verstehe zwar auch hier nicht, wie das mit den Kühen zusammenhängen soll, die man den Züchtern von den Weiden klaut. Aber irgendetwas muss jedenfalls an dieser Sache dran sein. Die Leute im Büro der Rancher-Schutzgenossenschaft in Harrisville haben ziemlich geheimnisvoll getan.
Ich hole die Skizze noch einmal aus meiner Brusttasche und vergleiche sie mit dem Gelände.
Kein Zweifel, das da unten muss die Hütte sein, in der ich neue Weisungen bekommen soll. Sie sieht einsam und verlassen aus. Wahrscheinlich ist sie schon jahrelang nicht mehr bewohnt.
Ich nehme die Zügel auf, und Shadow setzt sich gehorsam in Bewegung. Wir erreichen die Mulde, und das Mondlicht versilbert die Staubwolke, die wir aufgewirbelt haben.
Vorsichtig reite ich auf die Hütte zu.
Alles bleibt ruhig. Ich erreiche die Hütte und sitze ab. Sie ist noch älter und verwahrloster, als ich sie mir vorgestellt habe. Das Schindeldach ist hinten eingesunken, die braunen Balkenwände sind vermorscht. Die beiden Fenster sind ziemlich hoch angebracht, klein und schießschartenähnlich.
Ich fühle, wie sich die Haut zwischen meinen Schulterblättern zusammenzieht, während ich auf das finstere, verkommene Bauwerk starre. Dabei habe ich das Gefühl, als ob eine riesengroße Gefahr auf mich zukäme. Das ist natürlich Unsinn. Es sind das gespenstische Mondlicht und die ganze bedrückende Atmosphäre dieses düsteren Ortes. Trotzdem ziehe ich vorsichtshalber meinen alten Revolver aus dem Holster.
Ich mache einen Rundgang um das Haus. Nichts ist zu sehen. Das beruhigt mich etwas. Zur nächsten Siedlung sind es mindestens zwanzig Meilen, und es gibt keinen Mann im ganzen Westen, der auch nur einen Bruchteil dieser Strecke zu Fuß zurücklegen würde. Ein Pferd aber ist nicht da. Es ist überhaupt keine Spur von Leben zu entdecken. Wahrscheinlich werde ich hier lange auf den Burschen warten können, der mich mit Informationen versorgen soll.
Ich kehre zu Shadow zurück und klopfe ihm den Hals.
»Was meinst du, Alter? Soll ich ’reingehen, oder wollen wir draußen zwischen den Hügeln warten, bis es hell wird?«
Shadow schnauft und stellt die Ohren auf. Er reibt seine Nase an meiner Schulter. Natürlich kann er mir auch nicht helfen.
»Also gehen wir ’rein«, sage ich entschlossen.
Die Tür ist zu meiner Überraschung noch ziemlich fest und hängt gerade in ihren Angeln. Man muss sie erst in letzter Zeit erneuert haben.
Ich lege die Hand auf den Griff, und sie schwingt unter meinem Druck zurück. Rasch trete ich über die Schwelle und schiebe sie mit dem Absatz hinter mir zu. Das Innere der Hütte liegt um mich wie ein schwarzer Sack. Ich warte eine Sekunde, nichts regt sich. Ich spitze die Ohren und horche angestrengt, ob ich nicht das Atmen eines Menschen vernehmen kann. Wieder nichts. Aufatmend lasse ich den Colt ins Holster rutschen und greife in die Tasche, um ein Zündholz herauszufischen.
Und in dieser Sekunde rieche ich es!
Tabakrauch – und er ist noch nicht kalt.
Es muss jemand hier sein. Vielleicht steht er jetzt hinter mir, mit einem Revolver in der Hand. Wenn es der Beauftragte der Rancher wäre, brauchte er doch nicht so geheimnisvoll zu tun.
Aber wer ist es dann? Einer von der Gegenpartei, der Wind davon bekommen hat, dass ein Texas-Ranger eingeschaltet werden soll?
Ich kann nicht verhindern, dass mir eine Gänsehaut über den Rücken kriecht.
Sekundenlang stehe ich starr und rieche den warmen, scharfen Duft des Tabakrauches. Dann knarrt ein Dielenbrett hinter mir. Ich will herumwirbeln, aber ich komme nicht mehr dazu.
Ein harter Gegenstand bohrt sich in meine Seite, und eine Stimme schnarrt: »Guten Abend – El Halcon!«
Ich wage nicht, eine Bewegung zu machen.
»Wer sind Sie?«, frage ich und wundere mich selbst, wie rau meine Stimme klingt.
Der andere, von dem ich in der Dunkelheit auch nicht eine Spur erkennen kann, lacht leise.
»Das werden Sie gleich sehen.«
Er macht eine Bewegung, und dann höre ich, wie ein Zündholz an der Wand angerissen wird. Das kleine Flämmchen flackert auf, und vor mir liegt ein trostloser, unsagbar schmutziger Raum. Den Mann kann ich nicht sehen. Er steht hinter mir, und sein Revolverlauf ist immer noch fest auf meine Niere gepresst.
Aus, denke ich. Sie haben dich ’reingelegt. Irgendwo in Harrisville muss ein Verräter sitzen, der dich ans Messer geliefert hat. Diesmal kommst du nicht mehr davon.
Ich spanne alle Muskeln an, denn jeden Augenblick muss der Schuss fallen.
Nichts geschieht.
Der Druck in meinem Rücken verschwindet plötzlich. Der Mann geht an mir vorbei, das Zündholzflämmchen versengt beinahe seine Fingerkuppen. Er nimmt den Zylinder von der Petroleumlampe auf dem Tisch und setzt den Docht in Brand. Dann lässt er das Streichholz fallen und schlenkert die Hand. Er dreht sich um, lehnt sich mit dem Rücken gegen die Tischplatte und lächelt mir zu.
»Nun?«
Ich sehe jetzt, dass sein Revolver im Holster steckt, dass er ihn gar nicht gezogen hat.
Dieser verdammte Kerl hat mir die ganze Zeit über seinen Zeigefinger in den Rücken gebohrt.
Und ich bin darauf ’reingefallen.
»Wer sind Sie?«, frage ich.
Er ist groß und ziemlich schlank, mit breiten Schultern, schmalen Hüften, langen Beinen und der ganzen wohlausgewogenen Figur eines Reiters. Sein Haar ist schwarz, und seine Augen sind von einem hellen Blau. Er trägt die verstaubte, etwas mitgenommene Kleidung eines Ranchmannes und einen .45er-Colt im Holster.
»Wer sind Sie, zur Hölle?«, wiederhole ich.
Er grinst. »Glenn Davis. Sagt Ihnen der Name etwas?«
Natürlich sagt er mir nichts. Die Leute in Harrisville waren vorsichtig genug, mir den Namen ihres Vertrauensmannes nicht zu nennen. Sie haben etwas anderes getan.
»Der Big Muddy führt in diesem Jahr viel Wasser«, sage ich langsam und beobachte den Mann scharf.
Er nickt. Das Lächeln um seinen Mund vertieft sich.
»Ja, gutes, süßes Wasser«, gibt er gedehnt zur Antwort und streckt mir die Hand hin.
»Verdammtes Theater! Sie sind also unser Mann!«
Ich atme auf. Er hat die Parole gewusst. Das erklärt seine Anwesenheit.
»Woher wussten Sie meinen Namen?«
»Welchen Namen?«
»Nun, El Halcon, der Falke. So nannten Sie mich doch vorhin.«
Er lacht. »Den hatten mir unsere Leute in Harrisville mitgeteilt. Ihr Spitzname, was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ranger so heißt.«
Ich nicke und deute auf meine etwas gebogene Nase. »Ja, mein Spitzname – und deswegen. Die Mexikaner haben ihn mir verpasst. Aber ich wäre Ihnen dankbar, Glenn, wenn Sie ihn für sich behalten würden.«
»Warum?«
»Weil die wenigsten hier unten wissen, wer sich hinter El Halcon in Wirklichkeit verbirgt. Die meisten halten mich für einen Revolverhelden, sogar die Sheriffs, und ich lasse sie in ihrem Glauben, denn es kommt meiner Arbeit nur zugute. Mein richtiger Name ist Alamo, Leutnant Bill Alamo vom Grenzbataillon der Texas-Ranger.«
Davis kann eine Bewegung der Überraschung nicht unterdrücken.
»Was? Sie sind Bill Alamo, der Mann, von dem man sich bei uns die tollsten Sachen erzählt? Es freut mich, dass die Ranger endlich einen guten Mann zu uns geschickt haben. Es wurde aber auch höchste Zeit.«
Ich setze mich auf die schmutzige Bank und beobachte ihn scharf. Dieser braungebrannte Junge sieht nicht aus wie jemand, der seine eigenen Angelegenheiten nicht selbst regeln kann. Trotzdem scheint ihm das Wasser bis zum Hals zu stehen. Das ist seltsam.
»Davis, sagen Sie mir jetzt, was bei Ihnen vorgeht.«
Er seufzt abgrundtief. »Viehraub – und so schlimm, dass wir ruiniert sind, wenn nicht bald etwas geschieht.«
»Wer ist das – wir?«
»Nun, alle Rancher im Big Muddy-Tal. Vieh wird überall gestohlen, wo die Weiden offen sind, und kein Züchter sagt etwas, wenn es sich in erträglichen Grenzen hält. Aber was bei uns in den letzten Wochen geschehen ist, übersteigt alle Maße.«
»Nur Viehraub?«, frage ich.
Er hebt überrascht den Kopf.
»Wie meinen Sie das!«
»Nun, wird nur Vieh gestohlen, oder ist damit noch eine andere Sache verknüpft?«
Davis zuckt mit den Schultern.
»Keine Ahnung. Wir Rancher vom Big Muddy sind nur daran interessiert, dass die Räubereien endlich aufhören. Um das andere kümmern wir uns nicht.«
Das habe ich mir gedacht. Den Viehzüchter interessiert nur sein Vieh. Was darüber hinausgeht, sieht er nicht. Meine Aufgabe wird schwerer sein, als ich es mir vorgestellt habe.
»Ich kenne die Viehdiebe«, sage ich nachdenklich. »Meistens arbeiten sie nur in kleinen Trupps. Das hier scheint das Werk einer großen, gut organisierten Bande zu sein. Aber eine Bande braucht einen Stützpunkt. Die Leute wollen nicht immer nur in den Bergen hocken. Sie wollen das leicht verdiente Geld auch wieder ausgeben – bei Schnaps, Karten und Frauen. Außerdem brauchen sie laufend Nachschub: Lebensmittel, Patronen und andere Vorräte. Wo könnte der Stützpunkt dieser Bande sein? Kennen Sie ihn, Glenn?«
Davis nickt finster. »Genau. Es ist Placer, das heißeste Höllennest, das Sie je gesehen haben. Sie werden sich wundern, wenn Sie es betreten.«
»Warum werde ich mich wundern?«
»Weil die Banditen in Placer das Regiment führen. Sie gehen in den Lokalen frei ein und aus, und niemand krümmt ihnen ein Haar, obwohl jedermann weiß, dass es Halsabschneider, Wegelagerer und üble Viehdiebe sind.«
Ich grinse. »Sieh mal an! Und was sagt der Sheriff dazu?«
»Es gibt keinen Sheriff hier in zweihundert Meilen Umkreis. Und der City Marshal in Placer sagt, dass er nur für die Stadt zuständig sei. Er habe keinen Grund einzugreifen, solange sie sich in seiner Stadt anständig aufführten.«
»Ziemlich kluger Bursche, was?«
»Wer? Frank Snider?«, fragt Davis. »Ach nein, nur feige. Er trägt nie ein Schießeisen, und die Banditen halten auch nicht seinetwegen Ruhe. Sie sind nur klug genug, sich die Bevölkerung von Placer nicht zu Feinden zu machen, verstehen Sie? Die Leute dort verdienen gut an ihnen, und darum machen sie vor allem beide Augen zu.«
»Hm. Sieht so aus, als ob ich nach Placer gehen und mit dem großen Aufwaschen beginnen müsste«, sage ich.
»Das wäre ein schwerer Fehler, Alamo«, erwidert Davis nach einer Weile.
»Ein Fehler?«
Er hebt den Kopf, unsere Blicke kreuzen sich.
»Weil Sie nicht länger als vierundzwanzig Stunden am Leben bleiben würden. Hut ab vor Ihren Qualitäten, Bill, aber gegen die schlechten Elemente in Placer hätten Sie keine Chance. Sie würden allein stehen und eine prächtige Zielscheibe für eine Kugel bieten, die aus einer dunklen Gasse heraus auf Sie abgefeuert würde. Verstehen Sie mich?«
»Genau. Schöne Aussichten, nicht wahr?«
»Außerdem schleichen da eine Menge Mexikaner ’rum«, fährt Davis fort, »und das sind die Schlimmsten von allen. Die arbeiten vorzugsweise mit ihren Messern.«
Das wird ja immer besser. Ein Marshal, auf dessen Hilfe ich nicht zählen kann. Eine Einwohnerschaft, die von den Banditen lebt und sie stillschweigend hinnimmt. Schussfertige Revolver und scharfgeschliffene Wurfmesser, die mich erwarten.
»Was soll ich machen, Glenn?«, frage ich etwas ratlos. »Sie kennen doch die Lage besser als ich. Ich denke, Sie haben sich schon was einfallen lassen.«
Er nickt. »Sicher. Es hat keinen Zweck, wenn Sie mit einem Rangerstern nach Placer gehen. Die Burschen dort haben nicht den geringsten Respekt davor. Und selbst als Revolvermann El Halcon würden Sie sich nicht lange genug halten können, um etwas zu erreichen. Nein, wir müssen uns etwas ganz anderes einfallen lassen.«
»Was schlagen Sie vor?«
Er mustert mich. Ein amüsiertes Lächeln huscht für einen Augenblick über sein braungebranntes Gesicht.
»Sie müssen als das Gegenteil dessen in Placer aufkreuzen, was Sie in Wirklichkeit sind«, sagt er. »Ohne Revolver und ohne Pferd. Als ein harmloser Einfaltspinsel, den keiner für voll nimmt. Wenn sich niemand um Sie kümmert, werden Sie am besten Gelegenheit finden, die Augen aufzumachen und diesen Burschen auf die Spur zu kommen.«
»Natürlich.« Ich grinse und schlage mir die Hand vor den Kopf. »Das ist der Weg! Warum bin ich nur nicht selbst darauf gekommen?«
»Ihr Pferd und Ihre Ausrüstung nehme ich zu mir auf meine Ranch. Natürlich brauchen Sie in Placer einen Job. Dafür habe ich schon gesorgt. Ein Freund von mir hat eine Kneipe dort, das Treckhome. Er wird Sie einstellen – als Barkeeper.«
»Als was, bitte?« Ich bin nun doch überrascht.
»Als Barkeeper. Hoffentlich haben Sie ein bisschen Talent für diesen Posten.«
Ich seufze. Man muss Opfer bringen in seinem Beruf.
»Angenommen«, sage ich. »Wie komme ich nach Placer?«
»Sie reiten mit mir und kleiden sich bei mir ein, wie es Ihre Rolle verlangt. Dann nehmen Sie die nächste Kutsche. Es muss alles ganz echt aussehen.«
»Gut. Sagen Sie mir nur noch eines: Sie sind doch nicht zu Fuß hierhergekommen. Wo steckt denn Ihr Pferd?«
Er lacht. »Haben Sie danach gesucht? Ich hab' es droben zwischen den Hügeln gelassen. Man muss vorsichtig sein.«
Dieser schwarzhaarige, junge Rancher ist nicht aus Pappe. Wenn die anderen Rancher nur ein paar Prozent von seinem Kaliber haben, dann wundert es mich, wieso sie ihre Weiden nicht selber sauber halten können. Die Bande in Placer muss mächtig stark und gut organisiert sein. Das sieht nach einem klugen Kopf aus, der sie führt. Das wird meine Aufgabe nicht gerade erleichtern.
Wir verlassen die Hütte, und wieder fällt mir auf, wie gut erhalten Tür und Fenster sind. So, als ob diese alte Bude öfters für geheime Zusammenkünfte benutzt wird.
Shadow begrüßt mich mit freudigem Schnauben, und Davis ist von seinen Qualitäten beeindruckt, die er als echter Pferdemann sogar in dem ungewissen Mondlicht erkennen kann.
Ich nehme den Schwarzen an den Zügeln, und zusammen gehen wir auf die Hügelkette zu, die sich hinter der Hütte vor der dunklen Felswand erstreckt. Der Boden unter unseren Füßen besteht aus geriffeltem, vom ewig streichenden Wind festgepressten Sand.
»Zu hart«, erklärt Davis und deutet unter sich, »deshalb konnten Sie auch meine Spuren nicht entdecken. Und die paar Eindrücke, die entstehen, werden sofort wieder zugeweht.«
Hinter den Hügeln steht sein Pferd, eine hübsche, hellbraune Stute mit einem schön gearbeiteten Sattel. Davis sitzt auf, und zusammen reiten wir über die Hügel weg nach Süden.
»Wo treffen wir uns«, frage ich, »wenn wir uns etwas zu sagen haben? Auf Ihrer Ranch?«
Glenn Davis schüttelt den Kopf. »Viel zu gefährlich. Ich habe schon daran gedacht. Als Barkeeper haben Sie jeden Montag frei. Mieten Sie sich ein Pferd und kommen Sie ’raus zum Deadman's Home. Jeden Montag, einverstanden?«
Ich ziehe die Zügel an. »Deadman's Home? Was ist das?«
Er lacht und dreht sich im Sattel um. Tief unter uns liegt die alte Hütte, genau im Schatten der Gebirgskette.
»Sie haben es bereits kennengelernt«, sagt Davis grinsend. »Das da unten ist Deadman's Home. Schöner Name, nicht wahr?«
Ich habe plötzlich einen Kloß im Hals. »Wieso hat man es so genannt?«
Die hellen Augen meines Begleiters sehen im Mondlicht aus wie kalter, blauer Stahl.
»Vor zehn Jahren hat da unten ein Mann gelebt, ein Schwede. Ich war damals noch ein Junge, kann mich aber noch ganz gut an ihn erinnern. Eines Tages kam ein Trupp Comanchen, die gerade auf dem Kriegspfad waren. Sie holten ihn ’raus und fesselten ihn an seine Hütte. Dann skalpierten sie ihn. Der Mann starb, an der Wand seines Hauses hängend, und seitdem heißt die alte Hütte ,Deadman's Home'.«
Davis wirft mir noch einen scharfen Blick zu, dann wendet er seine Stute und reitet davon.
Zwei Tage später sitze ich in der Überlandkutsche der Wells-Fargo-Linie, die von Ellington heraufkommt und zweimal in der Woche Placer ansteuert.
Ich habe mich etwas verändert. Kein Mensch würde in mir ein Mitglied der Ranchertruppe erkennen. Ich trage einen grauen Lindsay-Konfektionsanzug, halbhohe, plumpe Stiefel aus angeschwärztem Rindleder und habe eine Fahrkarte im Band meines runden, steifen Hutes stecken. Es fällt mir schwer, das harmlose Gesicht zu machen, das zu diesem Auftrag gehört. Jeder Mann im Westen, der mich so sieht, weiß, was ich bin: Ein Greenhorn aus dem Osten, das im Westen sein Glück machen will.





























