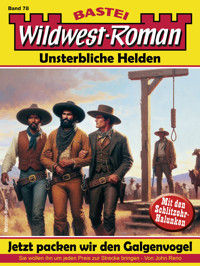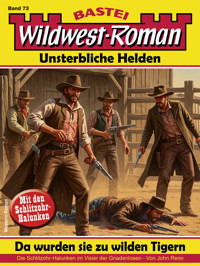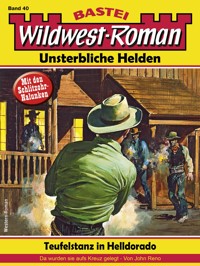1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mädchenraub! Es war ohne Zweifel der niederträchtigste Job, den man sich im Wilden Westen nur vorstellen konnte. Wer waren die Schurken, die sich auf dieses dreckige Spiel eingelassen hatten? Genau diese Frage stellten sich Whisky-Jack und Luis Barranca, die beiden Schlitzohr-Halunken, denn für die Lösung des Falls winkte ein hübscher Batzen Dollars. Die Entführer merkten bald, wer ihnen da auf den Fersen war, und sie traten den beiden Haudegen mächtig auf die Zehen. Aber dabei hatten sie eines vergessen: Wer sich mit Whisky-Jack und Luis Barranca anlegte, spielte mit dem Feuer ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Tiger darf man nicht reizen
Vorschau
Impressum
Tiger darf man nicht reizen
Von John Reno
Mädchenraub! Es war ohne Zweifel der niederträchtigste Job, den man sich im Wilden Westen nur vorstellen konnte. Wer waren die Schurken, die sich auf dieses dreckige Spiel eingelassen hatten? Genau diese Frage stellten sich Whisky-Jack und Luis Barranca, die beiden Schlitzohr-Halunken, denn für die Lösung des Falls winkte ein hübscher Batzen Dollars.
Die Entführer merkten bald, wer ihnen da auf den Fersen war, und sie traten den beiden Haudegen mächtig auf die Zehen. Aber dabei hatten sie eines vergessen: Wer sich mit Whisky-Jack und Luis Barranca anlegte, spielte mit dem Feuer ...
Wo steckte der Kerl?
Jack wusste, dass der Typ ihm seit einer Viertelstunde auf Schritt und Tritt folgte. Seit er den Black Cat Saloon und seinen Amigo Luis Barranca verlassen hatte, um den Mann aufzusuchen, der ihm Informationen über die Bande der Mädchenhändler versprochen hatte.
Jack spähte durch das Dunkel der Passage zwischen dem General Store und Fisher's Restaurant. Allerlei Gerümpel lag dort herum, und es stank nach verdorbenen Waren und Schnapsresten in geleerten Flaschen.
Und noch etwas stank.
Schweiß.
Jack hätte geschworen, dass es der Schweiß des Mannes war, der ihm vom Saloon aus gefolgt war. Der Kerl hatte gewiss seit Wochen nicht mehr gebadet.
Jack legte die Rechte auf den Revolver.
Langsam trat er einen Schritt weiter in die dunkle Passage.
Er war entschlossen, sich den Stinker zu schnappen. Es war immer gut, zu wissen, mit wem man es zu tun hatte, und außerdem wollte er den Schatten loswerden.
Dann ertönte ein metallisches Klicken zu seiner Linken.
Jack helte seinen Revolver hervor, zog den Hahn zurück und wirbelte herum.
Er sah die Bewegung im Dunkel bei einigen Fässern.
»Stopp!«, rief er.
Da blitzte und krachte es, und heißes Blei fauchte ihm entgegen.
Jack ließ sich fallen und feuerte zurück.
Damit hatte er nicht gerechnet. Das war kein kleiner Stinker, der ihn nur beobachten wollte. Das war eine Kanaille, die ohne Warnung schoss!
Vermutlich wusste die Bande der Mädchenhändler schon, dass ihr jemand dicht auf den Fersen war.
Jacks Kugel knallte gegen ein Fass.
Jack hechtete hinter einen Stapel Kisten. Flaschen klirrten, und er landete in etwas Weichem, Klebrigem.
Abermals blitzte es aus dem Dunkel bei den Fässern auf. Nur einen Sekundenbruchteil später drückte Jack ab, und das Krachen der Schüsse donnerte ohrenbetäubend durch die Passage.
Es folgte ein erstickter Aufschrei, der jäh verstummte.
Und ein dumpfer Aufprall war zu hören.
Dann herrschte Stille.
Jetzt stank es zusätzlich nach Pulverrauch.
Jack spähte vorsichtig über die Kisten hinweg. Er glaubte, eine ausgestreckte Gestalt neben einem der Fässer zu erkennen.
Mit dem schussbereiten Colt in der vorgereckten Faust schlich er darauf zu.
Dann atmete er tief durch. Er hatte getroffen. Der Kerl, der das Feuer auf ihn eröffnet hatte, war keine Gefahr mehr.
Jack zog ihm den Revolver aus den starren Fingern und untersuchte den Mann.
Er lebte.
Um kein Risiko einzugehen, nahm Jack dem Fremden zusätzlich ein Messer und einen Taschenrevolver ab.
Der Stinker hatte bewiesen, wie gefährlich er war.
Jack drehte den Bewusstlosen auf den Rücken, rieb ein Zündholz an und leuchtete ihm ins Gesicht.
Der Mann war vielleicht vierzig, und das Auffallendste an seinem schmalen, unrasierten Gesicht war eine Warze neben der spitzen Nase. Zwei schwarze Haare wuchsen aus der Warze, und auch aus den Nasenlöchern sprießten Haare.
Jack hatte beim Abtasten nach Waffen eine dicke Brieftasche entdeckt. Er zog sie aus dem verschlissenen Jackett.
Ein Bündel Banknoten, vielleicht vierhundert Dollar, ein Brief in einem abgegriffenen Kuvert, ein paar Zettel mit Adressen oder Notizen.
Und eine Visitenkarte.
Jack las: Bruce Spielman, Detective, Casa Grande. Und darunter versprach der Text: Ermittlungen aller Art – schnell – erfolgreich – unauffällig – diskret.
Nun, schnell mochte der Detektiv sein – und zwar mit der Hand beim Colt. Doch von erfolgreich konnte wohl kaum die Rede sein.
Er hatte Jack beschattet wie ein Anfänger. Als Jack einmal stehen geblieben war, um sich eine Zigarette anzuzünden, verharrte Spielman ebenfalls auf der Stelle und hatte sich interessiert ein Schaufenster angesehen. Sein Pech, dass gerade dieser Laden völlig leer war, wie Jack zuvor gesehen hatte.
Und unauffällig war er erst recht nicht.
Wer so stinkt, sollte besser im Schweinestall arbeiten, anstatt Detektiv zu spielen, dachte Jack.
Er rümpfte die Nase und schob dem Mann die Brieftasche ins Jackett.
In diesem Augenblick hörte er ein Geräusch hinter sich.
Er fuhr herum und hielt schon den Colt in der Hand.
Dann ließ Jack die Waffe sinken.
Vor der Passage auf der Main Street, noch vom Schein einer Laterne am Store erhellt, stand der dicke Mann mit dem Stern an der Weste.
Marshal Bob Stone.
Er schritt schwerfällig mit der Parker Gun im Anschlag näher.
»Sie sind verhaftet«, sagte er dann mit seiner Bassstimme.
Sie hieß Miriam, und sie war keine schwarze Katze, wie man sie eigentlich im Black Cat Saloon erwarten konnte, sondern eine Blondine.
Sie trank abwechselnd Pfefferminzlikör und Whisky. Der Pfefferminzlikör war nur kalter Pfefferminztee, wie Luis Barranca festgestellt hatte, als Miriam mal kurz verschwunden war, um auf dem Hof nach dem Rechten zu sehen, wie sie gesagt hatte.
Aber Luis war nicht zum Vergnügen im Black Cat Saloon. Er wollte Informationen von Miriam, und da Luis und sein Amigo Jack bei dem letzten Auftrag gut kassiert hatten, machte es Luis Barranca nichts aus, den teuren Pfefferminztee und die Whiskys für das blonde Animiermädchen zu bezahlen.
Miriam war der Mädchenhändlerbande in die Hände gefallen. Sie hatte an die Apachen verkauft werden sollen, doch durch die Unachtsamkeit eines Wächters der Banditen war ihr die Flucht gelungen. Ein US Marshal auf der Jagd nach der Bande hatte sie in den Vulture Mountains gefunden und in Sicherheit gebracht. Aus Furcht vor der Bande hatte Miriam ihre Heimatstadt Wickenburg verlassen und war nach Mesa, der kleinen Stadt südöstlich von Phoenix und dem Gila River, gezogen.
Luis und Jack hatten den Auftrag eines reichen Geschäftsmannes aus Coolidge in der Tasche, dessen Frau und Tochter von Banditen entführt worden waren. Ihre Ermittlungen hatten sie schließlich über das US-Marshal-Büro zu Miriam nach Mesa geführt. Doch es sah ganz so aus, wie der US Marshal gesagt hatte: Von Miriam war nicht viel zu erfahren.
Das Versteck der Bande war verlassen gewesen, als der US Marshal dort mit einer Posse aufgetaucht war. Natürlich hatte sich die Bande schnell ein neues Hauptquartier gesucht, nachdem ihnen eine der Gefangenen entkommen war. Und mit den Beschreibungen der Banditen, die Miriam gegeben hatte, war auch nicht viel anzufangen gewesen. Den Boss hatte sie nicht zu Gesicht bekommen, und sie konnte nicht einmal etwas Genaues über die Stärke der Bande sagen. Sie war von vier Banditen verschleppt worden, und man hatte ihr die Augen verbunden, bevor man sie ins Versteck gebracht hatte. Erst nach der Flucht hatte sie die Lage des Camps aus der Erinnerung beschreiben können.
Luis und Jack war nichts anderes übrig geblieben, als dort neu anzufangen, wo das Gesetz aufgehört hatte.
Vielleicht konnte sich Miriam doch noch an etwas erinnern, an irgendeine Besonderheit, die ihnen weiterhelfen konnte.
»Prost«, sagte die hübsche Blondine mit ihrer rauchigen Stimme und kippte abermals teuren Pfefferminztee hinunter, wobei sie verstohlen, doch nicht verstohlen genug zu dem feisten Wirt hin zwinkerte, der sofort einen neuen Strich auf den Zettel machte.
»Du hast das Herz auf dem richtigen Fleck«, fügte Miriam mit einem koketten Augenaufschlag hinzu und lächelte Luis an, als sie sich vorneigte, ihr gefülltes Whiskyglas ergriff und den Tee mit einem kräftigen Schluck Whisky hinunterspülte.
»Ja, genau unter der Brieftasche«, bemerkte Luis Barranca grinsend und gönnte sich einen Blick in den tiefen Ausschnitt ihres pfefferminzgrünen Kleides, in dem es wogte.
Sie lachte herzlich, und ihre blaugrauen Augen funkelten fröhlich.
Luis befürchtete schon, dass er einen weiteren teuren Pfefferminztee bezahlen musste. Doch dann bemerkte er, dass Miriams Blick an ihm vorbei zur Tür ging und dass sie Mühe hatte, ein Erschrecken zu verbergen.
Luis widerstand der Versuchung, sich umzudrehen.
Er sah in den großen Spiegel, der zwischen den beiden Türen hing, die zu Privaträumen führten.
Zwei Männer hatten den Saloon betreten. Sie sahen wie Gentlemen aus, gut gekleidet und gepflegt, und in den gleichen Anzügen wirkten sie wie Zwillinge.
»Komm nach Feierabend auf mein Zimmer im Rosebud-Hotel«, flüsterte Miriam hastig. »Zimmer 13. Ich glaube, ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen.«
Und schon war sie durch die Tür hinter der Bar verschwunden.
Luis fragte sich, was das zu bedeuten hatte.
Das hatte ja wie eine Flucht ausgesehen! Als hätte sie Angst vor den beiden Männern.
Die beiden Gentlemen schritten zur Bar. Und jetzt bemerkte Luis, dass sie keine Zwillinge sein konnten und dass sie auch keine Gentlemen waren.
Der schmalgesichtige, schwarzhaarige Typ mit den schwarzen Triefaugen und dem Pferdegebiss rempelte Luis an, obwohl genug Platz an der Bar war, denn Luis war der einzige Gast dort.
Der etwas jüngere Kerl mit dem breiten Gesicht, das verblüffende Ähnlichkeit mit dem eines traurigen Boxerhundes hatte, hieb mit der Faust auf die Bar und knurrte: »He, Schnapspanscher, Whisky vom besten und ein bisschen plötzlich!«
Luis Barranca unterdrückte seinen Ärger und machte den beiden Platz. Er kannte solche Typen, die sich mit ihrem wilden und großspurigen Gehabe den Respekt verschaffen wollten, der ihnen nicht gebührte. Das waren zumeist lächerliche Karikaturen von Männern, die es nötig hatten, sich aufzuspielen. Meistens zogen sie sofort den Schwanz ein, wenn sie an einen Mann gerieten, der sich nicht von ihnen beeindrucken ließ.
Luis sah, wie Whittaker, der feiste Wirt, eingeschüchtert dreinschaute. Der Mann überschlug sich fast, als er die Gäste bediente, die Luis an seiner Stelle erst einmal hätte warten lassen, damit sie Benehmen lernten.
Der Kerl, der Luis angerempelt hatte, musterte ihn ärgerlich von der Seite, wie Luis im Spiegel hinter der Bar sah.
Pferdegebiss war offenbar sauer, weil Luis nicht auf die Provokation hereingefallen war. Der Kerl suchte vermutlich Streit, doch Luis tat ihm den Gefallen nicht. Schließlich hatten sie ihn nicht wie den Salooner beleidigt, und der kleine Rempler war nicht so schwerwiegend, dass Luis etwas unternehmen musste.
»Ich glaube, hier stinkt's, Lester«, sagte der Streitlustige und nickte zu Luis herüber.
Luis ignorierte ihn weiterhin. Der Kerl hatte schließlich noch nicht genau erklärt, was ihn störte.
Lester ging nicht darauf ein. Er zog etwas aus seiner Rocktasche, entfaltete es und hielt es dem Wirt vor die Knollennase. Eine Zeitung.
»He, Dicker, hast du die schon mal hier in der Stadt gesehen?«
Der Wirt wich ein Stück zurück, denn direkt vor der Nase konnte er nichts erkennen. Dann wurden seine kleinen braunen Augen größer. Er starrte an der Zeitung vorbei auf Luis Barranca.
Er öffnete den Mund, doch er brachte keinen Ton hervor.
Er sah noch einmal auf die Zeitung und dann wieder auf Luis – erschrocken, bestürzt, besorgt.
Die beiden Männer folgten seinem Blick. Sie starrten Luis an. Er sah, wie sich ihre Haltung straffte.
Seine Sinne signalisierten ihm Gefahr.
Doch die beiden waren zu schnell.
Es folgte eine kaum wahrnehmbare Bewegung des Kerls mit dem Boxergesicht, und im nächsten Augenblick bohrte sich eine Revolvermündung in Luis Barrancas Seite.
»Haben wir dich, du Bastard!«, zischte der Mann, und Luis hörte, wie der Revolver gespannt wurde.
Luis erstarrte.
»Was soll das?«, fragte er mit erzwungener Ruhe.
»Ganz einfach«, begann der Kerl, der seinen Revolver in Luis Barrancas Seite gebohrt hatte. »Wir werden ...«
Der andere unterbrach ihn. »Kein Gelaber, Sammy. Leg ihn schon um!«
Jack Bullwhip, bei seinen Freunden auch als Whisky-Jack bekannt, staunte.
Das ganze Zimmer war mit Bierdeckeln tapeziert! Die Wände und sogar die Decke. Und der Teppich zeigte gestickt einen Bierkeller, in dem eine Gruppe Landsknechte zechte. HOPFEN UND MALZ – GOTT ERHALT'S war auf eine Fahne gestickt, die einer der Zecher hochhielt.
»Gefällt es Ihnen, Mr. Bullwhip?«, fragte Marshal Bob Stone lächelnd, als er Jacks Miene sah.
Bob Stone hatte inzwischen den verletzten Detektiv beim Doc verhört und Jack daraufhin freigelassen. Zu Jacks Überraschung hatte Spielman ausgesagt, dass er das Feuer eröffnet hatte, weil er in der Dunkelheit Jack mit jemandem verwechselt und sich bedroht gefühlt hätte. Der Detektiv aus Casa Grande mochte vor Dreck und Schweiß stinken, doch er war offenbar eine ehrliche Haut. Manch anderer hätte ein Lügenmärchen erfunden, um sich an dem Mann zu rächen, der ihm eine Kugel verpasst hatte, und Jack hatte sich schon innerlich darauf vorbereitet, bis zum Eintreffen des Richters festgehalten zu werden, wie der Marshal angekündigt hatte.
So kann man sich irren, dachte Jack.
Und er ahnte nicht, dass er sich wiederum irrte: Spielman hatte seine Gründe, weshalb er für Jacks Freilassung sorgte. Tausend-Dollar-Gründe. Doch das sollte Jack erst später erfahren, wenn er eine böse Überraschung erleben würde.
Im Augenblick war er von dem Bierdeckel-Museum überrascht. Das waren gewiss noch mehr Bierdeckel als die, die im gesamten Westen von Saloonern verwahrt wurden, die hofften, dass Jack und Luis irgendwann einmal die Zeche beglichen, die darauf verzeichnet war.
»Sind die alle bezahlt?«, fragte Whisky-Jack grinsend den wohlbeleibten Marshal.
Bob Stone blickte verdutzt um sich. Dann kratzte er sich am Doppelkinn und wirkte verlegen.
»Natürlich«, sagte er mit seiner Bassstimme. Der Fremde brauchte nicht zu wissen, dass er die meisten Bierdeckel in Saloons stibitzt hatte.
Er wies auf die halben Bierfässer, die als Sitzgelegenheiten um ein großes Eichenfass gruppiert waren, das als Tisch diente.
»Was darf ich Ihnen anbieten?«, fragte er. »Sozusagen als Haftentschädigung.«
»Ein Whisky wäre nicht schlecht!«, brummte Jack und zog den Tabaksbeutel hervor, um sich eine Zigarette zu drehen.
Der Marshal nickte, und sein Doppelkinn wabbelte. Er öffnete eine Klappe in dem Fass-Tisch und zog eine Flasche und Gläser aus der eingebauten Bar heraus.
Kentucky Bourbon, versprach das Etikett.
Jack zündete die Zigarette an und sah sich in diesem Bierdeckel-Museum um. Das war die originellste Tapete, die er je gesehen hatte. Dann fiel sein Blick auf ein eingerahmtes Plakat, und er versuchte, die verschnörkelten Buchstaben zu entziffern. Es gelang ihm nicht. Das war eine uralte Schrift, und es war ein ausländischer Text.
Marshal Stone bemerkte Jacks rätselnden Blick. »Das ist altdeutsch«, erklärte er stolz. »Ein Original aus meiner Heimat. Übersetzt heißt es: Bekanntmachung. Hiermit gibt der Fürst bekannt, dass am Mittwoch Bier gebraut wird und deshalb ab Dienstag nicht mehr in den Bach geschissen werden darf.«
Whisky-Jack lachte, und der Marshal fiel dröhnend ein. Sie tranken Bourbon, und Bob Stone erzählte von seinem Hobby.
Eigentlich hieß er Robert Stein und stammte aus Germany. Dort war Stone-Stein Besitzer einer Brauerei gewesen, doch wegen zu hoher Steuern war er pleitegegangen und hatte die Lust verloren, weiter in diesem Land zu arbeiten. Er war ausgewandert, hatte sich in California eine neue kleine Brauerei aufgebaut und war abermals zahlungsunfähig gewesen. Der Grund dafür bestand darin, dass er von den Geiern hier genauso mit Steuern und allerlei Abgaben geschröpft worden war wie in der alten Heimat. Nach einer Reihe von Gelegenheitsjobs war ihm dann der Stern angeboten worden, und bei diesem ruhigen Job war er dick und zufrieden geworden.
Stolz zeigte er Jack seine Sammlung. Er besaß auch Bierkrüge in allen möglichen Varianten – unter anderem einen in Nachttopfform – und allerlei Bücher und Dinge, die die hohe Kunst des Brauens dokumentierten. Jack versprach, für ihn Bierdeckel zu sammeln und ihm gelegentlich zuzuschicken, damit er seine Sammlung ergänzen konnte.
Aus dem einen Drink wurden alsbald drei. Doch dann besann sich Jack darauf, dass er den Mann aufsuchen musste, der ihm Informationen über die Mädchenhändlerbande geben wollte. Ein Thomas Brandon, der ihn auf sein Zimmer im Rosebud-Hotel bestellt hatte, wo er ihm für dreihundert Dollar einen Tipp geben wollte, wie er an die Banditen herankommen konnte, die Frau und Tochter des Geschäftsmannes in Coolidge entführt hatten. Brandon hatte sich als Informant angeboten, als Jack und Luis in Mesa Fotos der Verschollenen herumgezeigt hatten.
Jack wollte sich gerade von dem originellen Marshal verabschieden. Da krachten die Schüsse.
Schräg gegenüber vom Marshal's Office. Im Black Cat Saloon oder davor.
Ein schauriger Schrei ertönte und ging im abermaligen Aufdonnern einer Waffe unter.