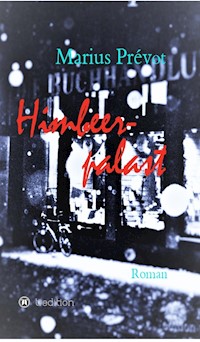9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bevor Anna endgültig nach Boston übersiedelt trifft sie sich noch einmal mit Stefan auf "seiner" Insel, um einen alten Traum zu verwirklichen. Die Absichten, die beide damit verbinden, sind jedoch unterschiedlich: ... Abends, im Alten Landgasthof legen sie Schicht für Schicht ihrer Vergangenheit frei, treten das Dilemma und die innere Widersprüchlichkeit der über viele Jahre vom Erfolg verwöhnten Menschen zutage, streiten sie über unterschiedliche Sichtweisen dessen, was sie erlebten und noch vom Leben erwarten, und müssen letztlich doch erkennen, dass alles nur Theater ist, das bei genauerer Betrachtung zweierlei offenbart: Die Absurdität der Handlung, die nur durch die ihr immanente Komik zu ertragen ist und die Sinnlosigkeit, sich gegen jene Puppenspieler aufzulehnen, an deren Schnüren sie baumeln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bevor Anna endgültig nach Boston übersiedelt, trifft sie sich noch einmal mit Stefan auf ‚seiner‘ Insel, um einen alten Traum zu verwirklichen. Die Absichten, die beide damit verbinden, sind jedoch unterschiedlich: Während sie hofft, ihn doch noch an sich zu binden, weicht er ihr aus, bevorzugt er Liebe und Freiheit gleichermaßen. »Was uns beide betrifft, hast Du immer nur geträumt und Pläne geschmiedet. Du hast es nie geschafft, etwas in die Realität umzusetzen.« Zum ersten Mal hört er Verbitterung aus ihren Worten. Abends, im Alten Landgasthof legen sie Schicht für Schicht ihrer Vergangenheit frei, treten das Dilemma und die innere Widersprüchlichkeit der über viele Jahre vom Erfolg verwöhnten Menschen zutage, streiten sie über unterschiedliche Sichtweisen dessen, was sie erlebten und noch vom Leben erwarten, und müssen letztlich doch erkennen, dass alles nur Theater ist, das bei genauerer Betrachtung zweierlei offenbart: Die Absurdität der Handlung, die nur durch die ihr immanente Komik zu ertragen ist und die Sinnlosigkeit, sich gegen jene Puppenspieler aufzulehnen, an deren Schnüren sie baumeln.
Marius Prévot, geboren 1942, Autor und Wirtschaftswissenschaftler lebt in Franken. Zuletzt erschienen sind:
Noch einmal Paris (2021), die Neuauflage von Himbeerpalast (2022), und ein Erzählband mit Skizzen und Gemälden: Am Wasser und zu Lande (2022).
Marius Prévot
Wille und Vernunft
Roman
© 2023 Marius Prévot
ISBN gebundene Ausgabe:
978-3-347-74728-9
ISBN Taschenbuch:
978-3-347-74725-8
ISBN e-Book:
978-3-347-74729-6
Umschlagmotiv: Marius Prévot
Layout und Gestaltung: Marius Prévot
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Ja, mach nur einen Plan
Sei nur ein großes Licht!
Und dann mach’nen zweiten Plan
Gehn tun sie beide nicht.
Denn für dieses Leben
Ist der Mensch nicht schlecht genug.
Doch sein höheres Streben
Ist ein guter Zug.
Bert Brecht, 3groschen Oper, August 1955
1
Fünf Jahre zuvor wollte Anna nach Dresden. Jetzt ist es Boston. Damals hatte ihr Stefan zugeraten. Und sie blieb. Vielleicht deshalb. Als sie ihm am Telefon mitteilte, dass sie sich beruflich soeben für Boston entschieden hat, dachte er, dass es ihm eigentlich egal sein könne, was sie tat, und wohin sie ging.
Der Zustand gewollter Gleichgültigkeit währte nicht mal eine Stunde.
Warum nach Boston? Diese Frage brannte sich in seinen Kopf ein.
Warum Boston?
Boston!
Und eine zweite Frage kam hinzu:
Liegt Boston am Meer?
Ja, es liegt!
In den Wintermonaten hatte man die Bänke auf dem Mittelsteg, auf dem er ihre Ankunft mit dem Fährschiff erwartete, neu gestrichen.
Seegrün.
In einem Grün, wie man die See sich gerne vorstellt. Die See dort ist aber nicht grün. Und schon gar nicht seegrün, wie das der Bänke. Früher waren die Bänke braun. Es war die Zeit, in der uns in unserer nachträglichen Verklärung alles viel besser erscheint als es tatsächlich war. Aber die See war auch damals nicht braun. Nicht einmal bei »Schietwetter« gab es den Hauch einer Rechtfertigung für Bänke mit solch einem
Braun
Auf einem Steg, der ins offene Meer führt und an dem in früheren Zeiten bei Flut der Dampfer sich nach Seeluft sehnende, blasse Badegäste absetzte. Irgendwann müssen die Stadtväter zu der Einsicht gelangt sein, dass die Zeiten im Allgemeinen (was Inselbewohner ohnehin wenig interessiert) und im Besonderen auf ihrer kleinen Insel in der Nordsee nicht so schlecht sein konnten, wie die Bänke auf dem Mittelsteg braun. Man entsann sich eines berühmten Schriftstellers aus dem Alpenland, der von Rudeln von Möwen schrieb, die wie ein Feld weißer Narzissen auf dem Wasser vor der Insel aussehen. Die Bänke wurden weiß.
Weiß
löst das Problem der Farbe, müssen die Inselbewohner und der Kurdirektor, und der für den Fremdenverkehr Verantwortliche, gedacht haben – vereint es doch alle Farben in sich. Wie die Farbe der Narzissen, die die Farben all ihrer farbenfrohen, verführerisch blühenden Artgenossen als Summe in sich trägt – und doch nur weiß ist.
Weiß ist langweilig. Man sieht sich daran satt. Und es blendet. Stellten sie später enttäuscht fest.
Dem Weiß geht es wie den Menschen, die alles haben und die sich dennoch langweilen. Zuviel des Guten blendet. Also: nicht alle zusammen, nur eine einzige Farbe wird gewünscht:
Seegrün.
Der Wunsch, dass die See endlich grün und nicht grau, graubraun, selten violett oder nur langweilig weiß, war wohl der Vater der Entscheidung für diese Farbe. Wie bei den Arbeitsschiffen, die im küstennahen Bereich herumdümpelten. Bei ihnen entschied man sich für
Ozeanblau.
Sie leuchten im klaren Licht des Nordens, als würde man ihnen vor Griechenlands Küste begegnen. Und die Insel grüßt sie vom Steg und der Strandpromenade aus mit farbenfrohen, im Wind schlagenden Flaggen und den beschwingten Rhythmen aus dem kleinen Pavillon.
Farben bedeuten viel in seinem Leben. Und es gab Zeiten, in denen er gerne Maler in einem fremden, bunteren Land gewesen wäre, um der Realität zu entfliehen. Seine Realität war grau.
Grau.
Das Grau verrußten Sandsteins, des Schiefers auf Dächern und an manchen Hauswänden, wo er das morsche Holz maroden Fachwerks schamvoll verbarg, und das Grau des holprigen Granitpflasters, das seine baumlose Straße beherrschte. Ebenso die vom Krieg gezeichneten Menschen. Und all die buckligen Straßen und Gassen um ihn herum. Bis hinunter zu den sattgrünen Auen, in denen sich uralte, knorrige Erlen und Weiden über einen eher unauffällig dahinschlängelnden Fluss beugten als wollten sie sich ehrerbietig ihre gichtigen Hände reichen.
Nur ein kleiner Ausschnitt am Ende der Straße, war vom Fenster seiner Kindheit davon zu sehen.
Alles andere war Phantasie.
Sehnsucht.
Manchmal Wehmut. Mitunter sogar Wut. Dann wieder Resignation. Weil die aus der Phantasie geborene Realität so unerreichbar fern schien. Aus ihr entwickelte sich langsam und stetig der Keim des Aufbegehrens.
2
Es war erstaunlich. Sie hatten sich einige Jahre nicht gesehen, die letzten beiden Jahre nicht einmal miteinander telefoniert. Dennoch, es gab nichts Störendes, was zwischen ihnen lag. Jeder war für den anderen ein weit aufgeschlagenes Buch, in dem sie vor langer Zeit selbst die entscheidenden Seiten entfernt hatten. Es gab auch keine Voreingenommenheit, nicht einmal, dass einem der andere jemals wirklich gleichgültig gewesen wäre. Weshalb hätten sie sich sonst auch verabreden sollen. Es war noch immer jenes prickelnde Gefühl in ihnen, wie die ganzen Jahre zuvor, wieder so unmittelbar, seit jener einen Stunde der gewollten Gleichgültigkeit, als ihn Anna endlich am Telefon erreicht hatte, um ihm die Verabredung vorzuschlagen: Sie sei seit einem Jahr in Hamburg tätig, hatte sie ihm erzählt, und sie schlug ihm ein Treffen auf der Insel vor. Er zeigte sich überrascht, fragte aber nicht warum. So ließ die Phantasie alles offen.
Und dann, mit einem Mal, war alles wieder fragwürdig geworden. Nicht, dass er an ihrer Zuverlässigkeit zweifelte, es war Beklommenheit, die in ihm hochkroch, Lampenfieber, wie vor einem ersten Auftritt, als er vor der Landungsbrücke stand. Wahrscheinlich hatte er zu viel erwartet, begann er sich vorzuwerfen, als er sie nicht am Oberdeck der anlegenden Fähre stehen und ihm zuwinken sah. Wenig später ließ man die ersten Autos an Land fahren, aber kein einziges Motorrad, bis der letzte Fahrgast das Schiff verlassen hatte. Er begann sich Sorgen zu machen, sah Anna irgendwo im Straßengraben liegen; warum hatte sie nicht auf ihn gehört? ging es ihm durch den Kopf, eine Harley hätten sie sich auf der Insel leihen können. Wie viele Jahre war das her, dass sie darüber gesprochen hatten, und jetzt?
Der Liliputaner mit dem verwitterten Gesicht, der ungewöhnlichen Hautfalte auf dem großen kahlen Kopf, hatte ihn beobachtet. Er stand immer an der Landungsbrücke neben dem kleinen Unterstand aus Holz, wenn ein Schiff einlief, die Hände in den Hosentaschen. Immer in denselben braunen Hosen. Und immer mit demselben braunen Pullover mit Norwegermuster und V-Ausschnitt. Nur die Hemden wechselten. Er hatte Stefans Enttäuschung bemerkt. Sie kannten sich, aber er sagte nichts. Stefan hätte sich auch gewundert. Dann war Stefan zum Mittelsteg gegangen, überlegte währenddessen, was er tun könne, setzte sich auf eine der seegrünen Bänke und schaute in Richtung Dagebüll, und wartete erst einmal auf das nächste Schiff. Es gelang ihm nicht, die Bilder ihres leblosen Körpers, ihres blassen Gesichtes unter dem Motorradhelm, aus seinen Gedanken zu verdrängen. Er war erstaunt über die seltsame Anwandlung von Hysterie, verärgert über seine Ohnmacht, nichts unternehmen zu können, während die Kinder unter ihm Sandburgen bauten, mit Käschern Taschenkrebse aus dem Wasser fischten, in Eimern sammelten, damit vor Freude jauchzend zur Kurpromenade davonrannten. Er mag die Sommermonate auf der Insel nicht. Das Geschrei der Kinder, wenngleich er zugeben muss, dass er derjenige ist, der hier fehl am Platze ist, Kinder haben das Recht, glückliche Sommertage zu verbringen, sollen ihre Freiheiten ausleben und sie ausloten in der Geborgenheit einer flach auflaufenden See, losgelöst von der nervenden, sie einengenden Obhut besorgter Mütter. Er hätte es sich in ihrem Alter auch gewünscht. Er wusste damals nicht, dass es ein Meer gab. Später wurde er auf Reisen mit seinen Eltern mit den Bergen konfrontiert. Totes Gestein, das ihn einengte, ihn bedrückte, seinen Gedanken keinen Freiraum zugestand, ihm andere Grenzen aufzeigte als später das Meer mit seiner Weite, seiner, ihn immer aufs neue faszinierenden Unendlichkeit. Sehr viel später konnte er die gleiche Begeisterung bei seiner eigenen, kleinen Tochter erleben, wenn sie viele Wochen im Jahr in ihrem Haus am Meer lebten. Das Meer prägt. Wie oft konnte er die Bestätigung dieser Erfahrung gerade von jüngeren Leuten hören, die er im Zug nach Hamburg traf.
Und dann, etwa eine Stunde später, war mit einem Mal alles sehr schnell vergessen. Es war heiß. Doch ein leichter Nord-West sorgte für angenehme Temperaturen. Und er trieb das Wasser vom Mittelsteg weg in Richtung Festland, direkt auf den im Sonnenlicht leuchtenden Klinkerbau des Siels zu. »Es ist die Frage, was man bereit ist aufzugeben, was einem das neue Leben, mit all dem Reiz des Unbekannten, dem Erfolg und der Anerkennung im Beruf, zu bieten vermag«, versuchte Anna ihre Entscheidung noch immer zu rechtfertigen. Sie kramte einen Taschenspiegel aus ihrer Lederjacke und er war sich sicher, sie musste darin eine glückliche, junge und begehrenswerte Frau erblicken und Stefan, während sie ihm ihr Gesicht zuwandte, er hätte gerne gewusst
wo sie in diesem Augenblick
da der Wind ihre wirren, kurzen Haare ordnete, die Nachmittagssonne dieses noch immer puppenhaft zarte und frische Gesicht mit den Sommersprossen in jugendlichen Glanz tauchte
er hätte gerne gewusst, wo ihre Gedanken wirklich waren; sie hatte kein Make-up aufgetragen, wie auch sonst nicht, sie war das natürliche Mädchen geblieben. »Ich möchte mich nur ausziehen und mich frisch machen«, war ihr Wunsch und er bot ihr an, mit zum Hotel zu fahren, aber sie lehnte ab, »Nein, ich kann dies auch hier auf dem Steg erledigen, ohne dass ich jemanden schockiere.«
Da war es wieder, was er lange vermisst hatte, diese herrlich erfrischende Unkompliziertheit, androgyn und schön, wie aus einem Film sah sie aus, als er sie in ihrem schwarzen Lederanzug und den hohen Stiefeln aus dem Schatten der Strandpromenade, vorbei am grünen Altglascontainer und den im Halbrund der Schipperbank lallenden und ihr nachpfeifenden, altgedienten Kapitänen aus der Walfangzeit mit ihren verwitterten Gesichtern, den kalten Pfeifen im schiefen Mundwinkel, zum sonnenüberfluteten Mittelsteg kommen sah, und sie winkte ihm von weitem strahlend und erwartungsvoll mit ihren langen Handschuhen zu, als wäre sie noch immer zwanzig
während draußen die vollbesetzte weiße Fähre mit winkenden Menschen auf dem Oberdeck wieder die Insel verließ, und vor dem Mittelsteg, ihnen zum Abschied die zwei gelben Schornsteine zeigend, endlich in Richtung Festland abdrehte
sie hatte den Helm wie eine Trophäe unter den linken Arm geklemmt, als wäre es der abgeschnittene Kopf eines Menschen, die giftgrüne Ledertasche über der Schulter, bückte sie sich vor ihm, um sie auf einer, der zum Wasser hinunterführenden Stufen abzustellen, und er sah das schwarze, glatte Leder, das sich über das kleine Dreieck ihres Slips spannte, und Anna:
»Tut mir leid, dass du so lange warten musstest!« und er dachte an das gelbe Kleid mit den kleinen bunten Blumen, dachte an den nassen Fleck an derselben Stelle, als sie vor ihm die Treppe zu ihrer Wohnung hochstieg und er erinnerte sich, wie er ihr das Kleid Knopf für Knopf öffnete bis es zu ihren nackten Füßen endlich in sich zusammenfiel …
Boston! – ein stummer Aufschrei, längst vergangene glückliche Tage endlich zurück zu holen.
Ich möchte, dass wir uns im Meer lieben, in einer Vollmondnacht, hatte sie sich schon immer gewünscht, und eigentlich hätte zufrieden sein müssen, mit dem was sie gerade taten und mit dem Ort, wo sie sich gerade liebten, aber immer wollten sie etwas anderes – darin waren sie sich absolut einig; aber im Meer, im Meer würden sie nur an das eine, an das einzig Wahre denken, in dem sie sich beide selbst verwirklichen würden, schweigend, wie bei einer Andacht, jeder im jeweils anderen, für immer und ewig in Gedanken vereint, eine heilige Kommunion sollte es sein, gleichgültig, was danach käme …
»Es ist schon merkwürdig«, sagt Stefan, »nach all den Jahren sitzen wir hier in diesem kleinen Café in der Kurpromenade, als wäre es das selbstverständlichste der Welt, beide sind wir frei, können tun und lassen, was wir wollen.
Endlich!«
»Und Simone?«
Irgendwann musste sie fragen.
»Das letzte Mal trafen wir uns am Flughafen als wir unsere Tochter verabschiedeten. Ich kenne nicht mal ihre Adresse. Wenn sie etwas will, wird sie sich melden; davon gehe ich aus.« Information im Telegrammstil. Sie sollte merken, dass er keine Lust auf große Erklärungen hat. Es war nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, wann in einer Ehe die Liebe aufgebraucht ist; weder bezogen auf den ihres jetzigen Zusammenseins noch auf den, der Annas Alter betraf. Eine nutzlose Diskussion würde es sein, über das, was man vorher, in den ersten gemeinsamen Jahren, am anderen als liebenswerte Eigenschaft betrachtet hatte, sich mitunter selbst zu eigen machte. Bis man irgendwann begann, lieber darüber hinweg zu schauen. Und dann fällt uns später auf, wie wir zu uns selbst zurückkehren, durch unser Verhalten, das uns noch so fremd und anstößig erscheint und uns deshalb auffällt, weil sich unsere genetische Botschaft, sich vieles unserer Vorfahren, was uns an ihnen störte, durchzusetzen beginnt, Verhaltensweisen, Eigenarten (auch hässliche), die wir bisher verleugneten oder nicht wahrhaben wollten. Die Erkenntnis des Älterwerdens, dass wir zunehmend in der Wahrheit leben, auch den anderen endlich so sehen, wie er ist, nicht wie wir ihn sehen wollen. Welch eine Ungerechtigkeit in unserer Beurteilung, der jeweils andere würde zunehmend skurriler in seinen Ansichten, in seiner Beurteilung der Mitmenschen, nur weil er oder sie, seiner oder ihrer eigenen Wahrheit folgt. Und dann die Vergänglichkeit, die wir im anderen sehen. Ein schon halb blinder Spiegel, den wir schließlich zerstören. Nur um uns selbst zu retten. Nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt mit Anna darüber zu reden.
»Wir haben lange dazu gebraucht und haben viel Zeit verloren. Du hast dich verändert in den letzten Jahren … lass dich mal anschauen … du bist grau geworden, an den Schläfen«, sie lacht, als könne sie ihn damit ärgern. Sie genießt die Schadenfreude.
»Und du? du hast dich überhaupt nicht verändert … nein, es stimmt nicht, du bist noch hübscher geworden«; dies war nicht geschmeichelt. Es ist tatsächlich so. Schlanker ist sie geworden, was ihm gefällt. Zum natürlichen Rot ihrer Haare ist sie zurückgekehrt.
»Na, ich weiß nicht«, sie will seinen Worten nicht recht glauben, hört sie aber gern. »Ich frage mich immer wieder, wo die Zeit geblieben ist.«
»Wenn ich mir vorstelle, dass meine Tochter inzwischen erwachsen ist …«
»Ja, Wahnsinn … wenn ich mir vorstelle, sie könnte unsere Tochter sein«, und nach einer Weile: »Ist dir das eigentlich bewusst?«
Wahnsinn, dieses Wort, fällt ihm auf, das sie noch immer so gerne gebraucht, noch immer dieselbe Wortmelodie, dieselbe Klangfarbe. Sie hatte recht. Und auch wieder nicht. Unsere Tochter würde jetzt auch so alt sein wie seine Tochter, überlegt er, aber nie könnte meine Tochter unsere Tochter sein. Genauso, wie er behaupten kann, Anna könnte seine Tochter sein, schließlich ist sie zweiundzwanzig Jahre jünger als er. Wenn also meine Tochter unsere Tochter sein könnte und Anna meine Tochter wäre, dann hätte ich zwei Töchter, wobei die eine Tochter die Tochter der anderen wäre …, überlegte er sich. Er musste lachen.
Bis Anna Stefans Phantasien unterbrach: »Was ist?«
»Nichts!«, entgegnete er. Für sein Gedankenspiel würde sie ohnehin kein Verständnis aufbringen.
Wie auch immer, ist es nicht nur das Ergebnis verpasster Chancen, die unser Leben manchmal so traurig erscheinen lassen? Wenngleich er zugeben muss, dass es dann, wenn es sich tatsächlich so entwickelt hätte, zwar nicht mal so traurig, wohl aber ungemein komplizierter geworden wäre. Bis zu einem gewissen Grad sogar amüsant. »Was uns beide betrifft, hast du immer nur geträumt und Pläne geschmiedet. Du hast es nie geschafft, etwas in die Realität umzusetzen.« Er hört Verbitterung aus ihren Worten. Zum ersten Mal, dass ihm das auffällt.
»Aber, es ist ja noch nicht zu spät.«
»Nichts ist zu spät!«, sagte sie sibyllinisch.
Stefan zog es vor, das Thema zu wechseln:
»Erzähl mir von der Fahrt.«
»Lieber nicht«, sagte Anna, »ich hätte auf deinen Rat hören und die Straße hinter dem Deich bis zum Hauke-Haien-Koog fahren sollen. Stattdessen fuhr ich über Bredstedt. Es ist nicht besonders angenehm, wenn man als Motorradfahrer Zeuge eines schweren Unfalles wird und sich vorstellt, selbst mit gebrochenen Knochen im Rettungshubschrauber abtransportiert zu werden.« Und nach einer Weile fügt sie hinzu: »Das Dumme ist, dass man sich nicht davor schützen kann, außer man fährt mit der Bahn, aber selbst da – du weißt es selbst … ich glaube immer mehr, dass unser Leben ohnehin vorbestimmt ist, wir tun, was uns auferlegt ist«, und dann, unerwartet nachdenklich: »nicht mehr und nicht weniger, egal ob es einen Sinn macht oder der größte Blödsinn ist, und selbst dann tun wir es, wenn wir uns dessen bewusst sind.«
»Beziehst du das auch auf deinen Entschluss nach Boston zu gehen?«
»Nö, eigentlich nicht.« Sie lacht, als wäre es ihr gleichgültig, was sie erwartet, da sie ohnehin nichts ändern könne. Er dagegen wollte immer wissen, wie er dran ist, und hat es nie geschafft. Nein, so stimmt es nicht. Er muss sich eingestehen, wenn alles klar vor ihm lag, empfand er Langeweile, die zur Unzufriedenheit wurde. Verbissen suchte er dann nach neuen Herausforderungen; ging dafür Risiken ein, deren Tragweite er im Voraus nicht abschätzen konnte. Mag sein, dass er zu viel von Hermann Hesses Stufengedicht gelesen hatte. Er wollte nie auf derselben Stufe stehen bleiben, schon gar nicht auf einer, auf der sich andere breitmachen und sich womöglich ausruhen. Stufen sind da, um auf ihnen nach oben zu steigen. Seine Treppe war eine, sich nach unten bewegende Rolltreppe, auf der er versucht nach oben zu kommen. Seit Jahren schon.
Wer begibt sich schon auf die falsche Rolltreppe, wenn er nach oben will? Hatte er nicht Acht gegeben? Hatten andere sie eingeschaltet, als er schon fast oben war? Man erkennt nicht immer die Laufrichtung der Rolltreppe, solange sie nicht eingeschaltet ist. Oft hatte er den Mut verloren, wenn ihm die Puste ausging; das Ziel dort oben wieder in weite Ferne rückte. Dann war es plötzlich, als kehre jemand die Laufrichtung der Treppe um, dann ging es umso schneller nach oben, bis diese blöde Treppe unerwartet stehen blieb, und er Mühe hatte, nicht völlig aus dem Gleichgewicht zu geraten; um ein Haar wäre er bis ganz nach unten gestürzt und hätte sich womöglich noch das Genick gebrochen.
Eine verdammt gefährliche Treppe dachte er dann, aber die paar Stufen, die schaffe er auch so!
denn zu diesem Zeitpunkt war er bereits – in Gedanken – schon wieder weit über sein Ziel hinaus …
Andere sahen ihm dabei zu, die einen von unten, viele von oben, für die ersteren war er noch immer relativ groß; für die letzteren schon ziemlich klein und unbedeutend, Überheblichkeit spiegelte sich in ihren Gesichtern. Wenige litten mit ihm, oft aus sehr eigennützigen Gründen. Vielen war es egal, sie schauten einfach weg, bei manchen machte er sogar Schadenfreude in den Gesichtern aus.
Nur wenige meinten es ehrlich, und fragten, wie sie ihm helfen könnten. Sie gehörten zu denen, die noch immer unten an der Treppe standen. Ihnen hätte er auch gerne geholfen, selbst nach oben zu gelangen. Wenn er gekonnt hätte.
»Du hast recht, es scheint tatsächlich so, dass wir uns nicht dagegen schützen können, auf was für einen Blödsinn wir uns im Leben einlassen. Und welchen Menschen wir begegnen möchten und welchen lieber nicht«, sagte er dann zu Anna.
Sie ging auf die Toilette, um sich frisch zu machen. Die grüne Umhängetasche und der Motorradhelm lagen neben ihm auf dem weißen Plastikstuhl. Er sah die Kurpromenade entlang, die alten Ulmen, die der dänische König einst gestiftet hatte, sind längst jungen Bäumen gewichen. Ausladende Kastanien, als Schattenspender für die auf der Promenade Flanierenden gedacht. Das Flair vergangener Zeiten können sie nicht wiederaufleben lassen. Es mag an den Kurgästen, den Tagesausflüglern, dem Massentourismus liegen. Draußen die weißen Passagierschiffe in der Nachmittagssonne. Ein klarer Tag, an dem man bis zum Festland schauen kann. Aus dem Pavillon dröhnt die in der Luft liegende Schlagermusik eines kleinen tschechischen Orchesters, der Geruch nach Fisch, nach in der Sonne trocknenden Algen. Das Klirren der Schnüre an Fahnenmasten begleiten den Segelsteg zum Meer.
Dann stand sie plötzlich oben auf den Stufen des Cafés. Dieses Lachen, dieses unbekümmerte Lachen, das ihm sogleich auffiel, ihn begeisterte. Es machte sie unwiderstehlich. Und diese Unbeschwertheit. Sie konnte schon immer das Leben leichtnehmen, entsinnt er sich, selbst damals, als sie keinen Job hatte und sie sich von ihrem Mann trennte. Aber sie hatte stets ein Ziel, das sie nie aus den Augen verlor. Die anderen Tische vor dem Café waren vollbesetzt, es war laut, der Wind wehte Servietten von den Tischen, eine träge Menschenmasse bewegte sich vor ihnen, uneinsichtige, jugendliche Radfahrer schlängelten sich dazwischen, Kinder schrien. Dazwischen sich angeregt unterhaltende Ansammlungen von Menschen, Wiedersehensfreude, Dialekte, die man kaum verstand.
»Ich habe mir ein Stück Käsekuchen ausgesucht«, sagte sie freudestrahlend, als sie die wenigen Stufen herunterkommt, er ging zur Seite, für einen Augenblick sahen sie sich nebeneinander in der großen Panoramascheibe, dahinter die stahlblaue, nahezu ruhige See eines klaren Sommernachmittags, und draußen, die weißen, aufgeblähten Segel der Yachten, bunte Segel von Katamaranen, wie Schmetterlinge im Wind, der weiße Adler, der zurück nach Sylt fuhr. Das Flirren der Luft über der See, die Halligen, das Festland, als würden sie darüber schweben. Drinnen war es dunkel, jeder wollte an diesem Sommertag im Freien sitzen, alles schien ihnen vertraut, als wären sie beide die ganzen Jahre zusammen hier gewesen.
»Ich habe uns im Landgasthof in Nieblum ein Zimmer reserviert … wir werden erst gegen Abend kommen, sagte ich … wir könnten später zum Südstrand gehen, nachdem ich dir die Stadt gezeigt habe.«
»Oh?, du sagtest die Stadt?«, große braune Augen schauen ihn verwundert an, sie lacht.
»Nun ja, den Ort gezeigt habe.«
Sie schlenderten die Kurpromenade entlang. An niedrigen Häusern vorbei, die im maroden Charme vergangener Zeiten dahindämmern, als hätte sie der Sozialismus berührt. Dazwischen wenige Bausünden der sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, Sichtbeton, grau, trostlos, wie die davorliegende See an Regentagen. Das Grün gepflegt, Blumenrabatten, als wäre der Friedhofsgärtner dafür verantwortlich, Kurortmentalität für Leute, die den größten Teil ihres Lebens hinter sich haben, malerische Seitenstraßen, in denen sich Althergebrachtes, Friesisches versteckt, sauber, ohne sichtbares Leben, als wäre es Teil eines unbewohnten Frei- lichtmuseums.
»Was ist mit dem Haus deiner Großeltern?«
»Ich habe es vermietet«, sagt Anna. Sie sieht ihn an, hofft, dass er nicht noch mehr darüber wissen will.
»Und für welchen Zeitraum?«
»Lange«, und nach einer Weile »sehr lange«, sagt sie, als könne sie es selbst nicht glauben.
»Und wenn du zurückwillst?«
Sie sieht ihn an. Ernst. Als hätte sie Angst, dass er mit der Wahrheit nicht fertig werden könnte: »Ich habe nicht vor, zurückzukehren«, sagt sie schließlich. »Ich werde hier alles aufgeben. Dem Mieter habe ich eine Option eingeräumt, falls er das Haus einmal kaufen möchte.«
Erstaunlich, denkt Stefan, es ist wie das Ende einer Ehe. Schlimmer noch, wenn man bedenkt, dass eine Ehe endet, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. – »Wie lange wirst du bleiben?«
»Bis morgen Vormittag. Dann muss ich zurück nach Hamburg – übermorgen geht meine Maschine nach New York. Und ich muss noch meine Sachen packen.«
Stefan kann seine Enttäuschung nicht verbergen und fragt sich unter solchen Voraussetzungen nach dem Sinn ihres Treffens.
»Entschuldige, es geht wirklich nicht anders … es tut mir ja auch leid … ich dachte, wir hätten mehr Zeit füreinander. Aber gestern Morgen erhielt ich überraschend ein Fax aus Boston … Alles vorverlegt, teilte man mir mit, nachdem jemand in der Kanzlei dort ausgefallen ist. Ich werde zunächst im Hotel wohnen, bis in zwei Monaten die Wohnung in Beacon Hill frei ist … aber sie haben mir versprochen, dass ich dann mehr als zufrieden sein werde, wenn ich mich erst eingewöhnt habe.« Zum ersten Mal seit langer Zeit empfand er, was es heißt, jung zu sein, was es bedeutet, wenn einem die Welt offensteht, man noch Pläne schmieden und man das Leben mit beiden Händen anpacken kann. Diese Gedanken lösten zunächst eine gewisse Wehmut in ihm aus. Gründe hierfür gab es vielfältige. Also, warum nicht Boston? Seine Gedanken begannen diese Frage systematisch einzukreisen. Bis sie zum Kern vorstießen:
Boston!
Welche Möglichkeiten sich plötzlich eröffneten und seinen Gedanken etwas Leichtes, Schwebendes verliehen. Nie mehr das Ziel Unendlichkeit aus den Augen verlieren, dachte er. Schließlich liegt Boston am Meer. Und: Es ist Zentrum einer geistigen Provinz – dem berühmtesten Think Tank der Welt. Lieber Backbencher am MIT in Cambridge sein als Penner in einer geistlosen, grauen Provinz, beflügelten ihn seine davoneilenden Gedanken.
Und er stellte sich die Ziegelfassaden der alten Villen des 19. Jahrhunderts in Beacon Hill vor, das holprige Kopfsteinpflaster der engen Straßen, einst Ballast für die vom alten Europa nach Boston kommenden Segelschiffe, gesäumt von Straßenlaternen im alten Stil, wie er es aus einem Merian Heft über Neuengland kennt, und er verglich damit die klinkerroter Fischerund Kapitänshäuser in den, hinter ihm von der Strandpromenade wegführenden Straßen und Gässchen, in denen er viele Jahre über dasselbe bunte und bucklige Kopfsteinpflaster aus dem Granit der Eiszeit stolperte, und die – gesäumt von ebensolchen Straßenlaternen – lebendiger und stilvoller sind als das eintönige Grau des Granitpflasters seiner Kindheit
und vor dem Kliff am Südstrand liegen die bunten Quader, die sein Schiff beschweren werden und mit denen sein Drang nach Freiheit den Zoll einer stürmischen See entrichten wird, ging es ihm durch den Kopf
aber Boston – ist dort nicht alles noch schöner, noch größer, noch hoffnungsvoller, einfach grenzenloser als hier auf seiner bescheidenen Insel, die man in gut sechs Stunden umlaufen kann?
Boston. – Warum also nicht?
Wenn nur das Meer in der Nähe ist, der salzige Geruch der See, die unendliche Weite des Universums, die ihre Sinne betört, ihre Gedanken weit fortträgt, nur nicht über den Atlantik zurück, um dieses eine, dieses in das Gedächtnis gebrannte Verlangen, diesen Traum aller Träume, endlich verwirklichen zu können und um alles Zurückliegende zu vergessen …
Man muss es realistisch sehen: In diesen einzigartigen Augenblicken der Illusion sah er das Glück zum Greifen nah, und er begann über sich hinauszuwachsen und alles zu vergessen, was ihn jemals bedrückt haben konnte … Hätte er sich in diesem Augenblick wirklich fragen sollen, ob er sich nicht selbst überschätzt?
3
Abends entscheiden sie sich im Restaurant des alten Landgasthofes in Nieblum für einen Tisch am Fenster, von dem aus sie die gegenüberliegende Inselkirche und den Friedhof sehen können. Anna wählt den Platz, der ihr den Blick auf ein imposantes und sie beeindruckendes Ölgemälde gewährt. Die in einem unnatürlichen und aufdringlichem Blau dargestellte stürmische See soll wohl – wenn man bereits den Raum betritt – auf der gegenüberliegenden Wand die Blicke auf sich ziehen, doch sie ist sich nicht sicher, ob das Gemälde ihre Gefühle in einer Weise anspricht, das ihrer beiden Vorhaben nicht entgegensteht. Anna wendet ihren Blick nach draußen. An der Bushaltestelle warten braungebrannte Urlauber in Shorts und Bermudas, Polohemden und Sandalen, zusammengerollte Strandmatten unter den Arm geklemmt, vor sich Kühltaschen und Picknickkörbe abgestellt. Schreiende Kinder mit aufgeblasenen Gummitieren stürmen zum Feuerlöschweiher und werden, aus verständlichen Gründen, daran gehindert; Stefan empfindet sie als eine, die Beschaulichkeit störende, befremdliche Unruhe. Ein Tourist studiert – kaum fünf Meter von ihrem Platz entfernt – mit zusammengekniffenen kurzsichtigen Augen, den Bügel der herabhängenden Sonnenbrille im Mund, die Speisekarte im Glaskasten neben dem Eingang, bespricht sich mit anderen und sie schütteln ungläubig den Kopf; sicherlich sind ihnen die Preise zu hoch, »Wie findest du das Bild«, fragt Anna, und Stefan meint: »Ich finde es zu dominierend und vor allem zu kalt.«
»Das beruhigt mich, dass du dies auch so empfindest. Aber ich nehme an, dass es dir nichts ausmacht …«
»Was soll mir nichts ausmachen?«
»Das Bild anzuschauen … komm, lass uns die Plätze wechseln.«
Dann sprechen sie über die Touristen an der Bushaltestelle, über deren Leben, das sie von zu Hause mitbringen, und ihre Unzufriedenheit, die sie für zwei oder drei Wochen nicht bereit sind abzulegen und über das, was sie hier so angenehm finden und dennoch mit ihrem Leben nicht in Einklang bringen können, weil ihnen die Phantasie oder einfach die Bereitschaft dazu fehlt.
Die Kellnerin kommt an ihren Tisch. Stefan beobachtete sie schon als sie die Bestellungen anderer Gäste aufnahm. Sie ist schlank und groß. Er sieht an ihren langen Beinen hoch. Eigentlich ist alles dünn und flach, denkt er, je weiter sein Blick nach oben gleitet. Und dennoch. Irgendetwas reizt ihn an dieser Person. Anna amüsiert sich über seine offensichtliche Musterung, über seine Kopfbewegung, die so auffallend seinem Blick folgt, wie die eines Kurzsichtigen, der im Museum ein Aktgemälde betrachtet, etwas zu finden hofft, das bereits im Entstehen Opfer der Abstraktion wurde. Es muss die pure Illusion sein, denkt Anna, einen immer noch schärferen Blickwinkel aus den Gleitsichtgläsern der Brille herauszuholen. Ihr Gesicht ist hübsch, ihre braunen, kurzen Haare lassen altmodische Granatohrringe erkennen, sie wirkt unsicher, aber beherrscht, als wäre es ihr erster öffentlicher Auftritt.
»Sie sind noch nicht lange hier«, stellt Stefan fest; er will sie nicht noch mehr verunsichern, eher will er ihr in väterlicher Weise zeigen, dass er Verständnis für ihre Lage empfindet.
»Erst seit zwei Wochen«, sie lächelt, wird für einen Augenblick rot, sucht mit ihrem Blick Zuflucht bei Anna: »Darf ich ihnen die Speisekarte bringen?«, fragt sie höflich, mit zarter Stimme, und zündet mit einem Streichholz die Kerze an.
»Bei vielen liegt der Grund darin«, sagt Stefan »dass sie nicht wissen, was auf sie zukommt.« Er liest in der Speisekarte, die ihnen die Bedienung gerade überreicht hat und nach einer Weile fährt er fort, ohne zunächst aufzuschauen »ich meine damit im Beruf oder in ihrer Ehe oder mit ihren Kindern … sie sehen keine greifbare Lösung, und jetzt, da sie Zeit haben, darüber nachzudenken, werden sie erst recht unzufrieden.«
»Aber sie stehen nicht am Abgrund wie du« sagt Anna, »sie können zumindest so weiterleben wie bisher, solange sie selbst keine Entscheidung zugunsten einer besseren Lösung getroffen haben, sie können ihre Lage selbst in die Hand nehmen, können aus ihren Träumen etwas machen. Das ist doch mehr als man vom Leben erwarten darf.«
»Du meinst, sie sollten deshalb nicht unzufrieden sein?«
»Das meine ich«, entgegnet Anna und nach einigem Überlegen: »vielleicht sind sie auch nur müde und gelangweilt, oder gerade von ihren Kindern genervt.«
»Nein, auch wenn sie nicht müde wären, würden ihre Gesichter genauso unzufrieden aussehen. Es gibt einen Schriftsteller, der über die Langeweile der Menschen schrieb – ich möchte das, was ich draußen sehe, nicht als Langeweile definieren: es ist in Wirklichkeit die permanente Unzufriedenheit …«
»der sie davon zu laufen versuchen«, ergänzt Anna.
»Du meinst es gut mit den Menschen – das spricht für dich.«
Stefan dreht sich zur Bedienung an der Theke um. »Willst du sie fragen, ob sie unzufrieden ist?«, spöttelt Anna. Er bestellt zwei trockene Sherrys. Den Wein wollen sie erst entscheiden, wenn sie sich über das Essen im Klaren sind.
»Das wäre nicht fair … ich müsste sie schon fragen, ob sie zufrieden ist.« Er will sie schließlich nicht noch mehr verunsichern.
Später erfährt er, dass es die Tochter des Architekten ist, der für ihn einige Jahre zuvor sein Haus auf dieser Insel umbaute. Inmitten der Kurpromenade, genau am Mittelsteg. Er ist erstaunt, dass sie ausgerechnet als Kellnerin arbeitet. Sie will einmal auf die Hotelfachschule, sagt man ihm.