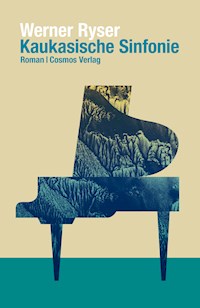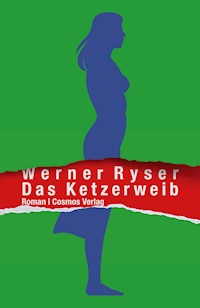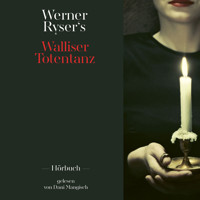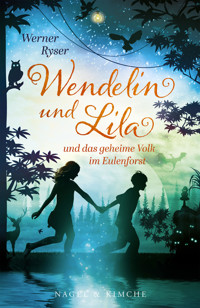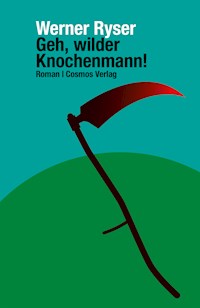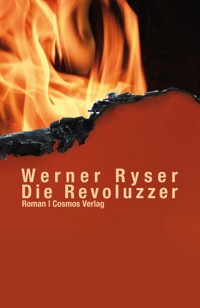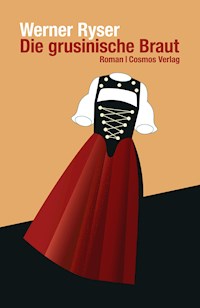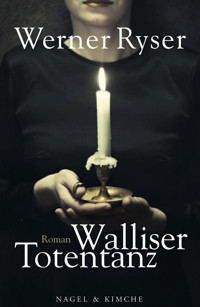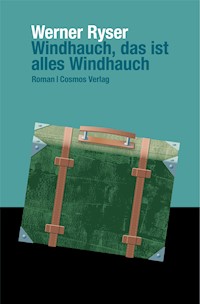
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cosmos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Jetzt kehre ich als Bettler dorthin zurück, wo man Vater um sein Erbe betrogen hat.» Am 18. Juli 1930 verlässt Hannes mit seiner Familie Georgien, das Land, in dem er geboren wurde. Simon, sein Vater, war 1866 in Langnau im Emmental aufgebrochen, um in Grusinien, wie die Russen Georgien nannten, seinen Traum zu verwirklichen: ein Geschlecht von angesehenen Bauern zu gründen. Als Simon 1918 starb, hinterliess er Hannes einen Gutshof mit mehr als tausend Kühen. Doch nach dem Einmarsch der Roten Armee und der Machtübernahme der Bolschewiki in Transkaukasien verliert die Familie ihren ganzen Besitz. Die Schweizer Auswanderer dürfen nicht mehr mitnehmen, als in einem Koffer Platz hat. Und sie haben noch Glück: Die deutschen Kolonisten werden deportiert – viele von ihnen verlieren in Sibirien ihr Leben. Der letzte Band von Werner Rysers kaukasischer Tetralogie hat beklemmende Parallelen zu aktuellen Ereignissen auf der Welt. Es scheint, als wiederhole sich die Geschichte. Immer wieder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Ryser
Windhauch, das istalles Windhauch
Roman
Cosmos Verlag
Im Gedenken an meinen Vater, der sein Leben langHeimweh nach seiner Kindheit in Georgien hatte.
Alle Rechte vorbehalten
© 2023 by Cosmos Verlag AG, Muri bei Bern
Lektorat: René Karlen, Roland Schärer
Umschlag: Stephan Bundi, Boll
Satz und Druck: Merkur Druck AG, Langenthal
Einband: Schumacher AG, Schmitten
ISBN 978-3-305-00492-8
eISBN 978-3-305-00493-5
Das Bundesamt für Kultur unterstütztden Cosmos Verlag mit einem Förderbeitragfür die Jahre 2021–2024
www.cosmosverlag.ch
Windhauch, Windhauch,sagte Kohelet, Windhauch,Windhauch, das ist alles Windhauch.Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz,für den er sich anstrengt unter der Sonne?Eine Generation geht, eine andere kommt.Die Erde steht in Ewigkeit.
Buch Kohelet 1, 2–4
Inhalt
Marie
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Der Anfang vom Ende
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Die Roten
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Die Rückkehrer
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Nur eine Fussnote der Geschichte
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Nachwort
Werner Ryser im Cosmos Verlag
Geh, wilder Knochenmann!
Die grusinische Braut
Kaukasische Sinfonie
Die Revoluzzer
Das Ketzerweib
Marie
Ich sehe dich vor mir, immer wieder dich. Es ist für mich ein erregendes Ereignis, dass du jetzt manchmal neben mir liegst, wenn ich erwache. Noch schläfst du. Durch die Vorhänge, die immer einen Spalt weit offen sind, dringt das frühe Morgenlicht. Deine Brust hebt und senkt sich regelmässig. Ich beuge mich vorsichtig über dich und betrachte dein vom schwarzen Haar umrahmtes Gesicht. Es ist ganz entspannt. Hinter den geschlossenen Lidern scheinen sich, kaum merklich, deine Augen zu bewegen. Ob du wohl träumst? Und falls ja, wovon? Du sprichst nie darüber. Die Geheimnisse deiner Seele hältst du vor mir verborgen. Sie erschliessen sich mir nur indirekt: in deinen Blicken, deinen Berührungen, deinem Geigenspiel. Dank dir nehme ich die Welt erstmals nicht allein mit meinem Verstand wahr, sondern mit allen meinen Sinnen. Dank dir spannt sich der Himmel blauer über das weite Tal der Maschawera, dank dir ist das Gras grüner, sind die Blumen farbiger, die Früchte aus den Hirschgärten saftiger und die Trauben vom Kirchlesberg süsser, und selbst die Menschen erscheinen mir liebenswerter. Jetzt öffnest du die Augen. Du lächelst, streckst die Arme nach mir aus, ziehst mich an dich.
Es ist wie ein Wunder: In einer Zeit von Revolution, Krieg und einer Seuche apokalyptischen Ausmasses, einer Zeit von Leid und Tod, die auch von uns ihren Tribut fordert, darf ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren, was es heisst, zu lieben und geliebt zu werden.
Katharinenfeld, im Herbst 1919
1
Der Grosse Krieg, der bereits das Leben von Millionen junger Männer auf den Schlachtfeldern Europas gekostet hatte, dauerte schon dreieinhalb Jahre, als Karl Diepoldswiler, der einzige Arzt in Katharinenfeld, im Frühling 1918 zum ersten Mal von jener unheimlichen Influenza hörte, die unter den kämpfenden Truppen wütete. Es hiess, dass das Fieber, verbunden mit Schüttelfrost und Hustenanfällen, innerhalb weniger Stunden ansteige und dass die Betroffenen über Kopf- und Gelenkschmerzen klagten. Für manche verlief die Krankheit tödlich. Sie starben an einer Lungenentzündung. Aber weder die georgischen Gesundheitsbehörden noch die Presse nahmen die Sache sonderlich ernst. Der Krieg, die revolutionären Ereignisse in Russland und die Geschehnisse in Transkaukasien beherrschten die Schlagzeilen.
Als sich die Seuche im Juni auch in den Städten ausbreitete, hatte Karl Aleko gebeten, ihn nach Tiflis zu fahren. Der junge Mann wartete im Sonntagsanzug und mit einer Schirmmütze auf dem Kopf neben einer auf Hochglanz polierten roten Limousine vor dem Haus des Arztes an der Kreuzgasse. Aleko hatte seinem Vater, Mate Peradse, klargemacht, dass der Benzinmotor früher oder später auch in Katharinenfeld Pferd und Wagen verdrängen werde und man sich darauf einrichten müsse, dass aus seiner Fuhrhalterei an der Nikolaistrasse irgendeinmal eine Garage samt Tankstelle werde. Der Alte hatte sich überzeugen lassen und zwei gebrauchte Autos angeschafft: einen Lastwagen, mit dem er den Wein der Winzergenossenschaft nach Tiflis transportierte, und einen Panhard-Levassor, den man samt Aleko als Chauffeur mieten konnte.
In den Dörfern, durch die sie fuhren, blieben die Menschen am Strassenrand stehen und schauten ihnen nach. Aleko unterrichtete seinen Fahrgast laufend über die Geschwindigkeit, mit der sie unterwegs waren: dreissig Stundenkilometer auf kurvigen Strecken, sechzig, wenn es geradeaus ging. Das sei gar nichts, behauptete er. Vor dem Krieg habe Bob Burman, ein Amerikaner, in einem Benz mit zweihundertachtundzwanzig Stundenkilometern einen Weltrekord aufgestellt.
Bereits zwei Stunden nachdem sie aufgebrochen waren, betrat Karl das Café am Jermolow-Eriwanski-Platz, wo Merab Metreveli, sein ehemaliger Schulfreund, bereits auf ihn wartete. Er war Jurist und inzwischen ein hoher Beamter im Gesundheitsministerium. Karl erhoffte sich von ihm Aufschluss über das Wesen der unheimlichen Krankheit.
«Wir sind nicht einmal sicher, ob es sich um eine Grippe handelt», gestand Merab. «Wegen des oft bösartigen Verlaufs sprechen manche Wissenschaftler von einer neuen Form der Lungenpest. Was uns irritiert, ist die Tatsache, dass die Krankheit bei Kindern und älteren Menschen harmloser verläuft als bei jungen, kräftigen Männern.» Er dachte nach. «Ausserdem wissen wir, dass sie sich dort, wo viele Menschen nah neben- und miteinander leben und arbeiten, schneller verbreitet als in den Villenvierteln. Das ist kein Wunder», fügte er hinzu. «Es trifft immer zuerst die Armen.»
«Spricht da der Regierungsbeamte oder der Sozialdemokrat?», erkundigte sich Karl amüsiert. Merab war ein bekennender Menschewik.
«Beide», lachte der. «Beide.»
Viel mehr wisse er leider auch nicht, weil er sich als Jurist vor allem mit Verwaltungsaufgaben beschäftige. Aber Karl solle ihn doch ins Ministerium begleiten, wo er ihm einige Berichte von Militär- und Zivilärzten über die neue Krankheit geben könne.
Etwas später nahm Karl in einem Besuchersessel im Büro seines Freundes Platz und studierte die Akten, die ein Sekretär gebracht hatte.
«Das sieht nicht gut aus», meinte er schliesslich.
Merab, der an seinem Schreibtisch sass und arbeitete, hob den Kopf. «Ja», bestätigte er, «wir sind im Krieg und jetzt diese Seuche. Nun fehlt nur noch eine Hungersnot, um das Mass vollzumachen. Die ersten Monate unserer Republik stehen unter keinem glücklichen Stern.»
Da hatte er weiss Gott recht, dachte Karl. Kurz nach der Unabhängigkeitserklärung vom vergangenen Mai hatten osmanische Einheiten, unterstützt von kaukasischen Tataren, die Grenze Sakartvelos überschritten und drangen der Kura entlang Richtung Osten vor. Unterstützt von deutschen Truppen versuchten die Georgier, sie zurückzuschlagen. Auch die Nordgrenze war gefährdet. Dort kämpfte die Rote Armee gegen die reaktionären Weissen, welche die Revolution in Russland rückgängig machen wollten. Im Innern entlud sich die jahrhundertealte Feindschaft zwischen Armeniern und Tataren in periodischen Gewaltexzessen. Und jetzt noch diese Seuche! «Weiss man, woher die Krankheit kommt?»
«Einige behaupten, die Deutschen hätten spanische Konserven vergiftet und über Umwege an die Armeen der Alliierten geliefert. Andere sind überzeugt, sie hätten die Erreger in amerikanischen, englischen und französischen Theatern freigesetzt, um ihre Feinde zu schwächen.»
«Glaubst du das?»
Metreveli hob die Schultern. «Einerseits ist bekannt, dass die Oberste Heeresleitung unter Hindenburg und Ludendorff nicht davor zurückschreckt, im Krieg das verbotene Senfgas einzusetzen, andererseits ist auch das Reichsheer von der Seuche betroffen. Irgendeinmal wird man mehr wissen.»
Erst auf der Rückfahrt nach Katharinenfeld wurde Karl Diepoldswiler bewusst, dass in keinem von Merabs Berichten von erfolgversprechenden Behandlungsmethoden die Rede gewesen war. Stand man der neuartigen Krankheit hilflos gegenüber? Er machte sich Sorgen. In Katharinenfeld leitete Karl zu dieser Zeit ein Lazarett, in dem junge Männer behandelt wurden, die im Feldzug gegen die Osmanen verwundet worden waren. Was, wenn einer von ihnen die Seuche einschleppte und sie sich auch im Dorf ausbreitete? Er schaute schweigend hinaus in die Landschaft. Auf einer Brache suchten Hunderte von Saatkrähen nach Nahrung. Aleko hupte. Schimpfend flatterte die schwarze Schar in die Höhe. Wie Russflocken wirbelten sie durcheinander und verdunkelten für ein paar Augenblicke den Himmel.
Im August ebbte die Influenza ab. Karl atmete auf, ohne zu ahnen, dass sie nur ein Vorbote für Schlimmeres gewesen war. Im Herbst 1918 schlug die Spanische Grippe, wie man sie inzwischen nannte, erneut zu. Gnadenlos. Innert weniger Wochen verbreitete sie sich rund um den Globus. Diesmal traf es auch Katharinenfeld. Lilit, die fünfjährige Tochter von Ruben und Nare Jemazian, war die Erste, die krank wurde.
Die Familie, die aus Ostanatolien stammte, lebte seit drei Jahren im Dorf. Es war dem jungen Paar gelungen, mit ihrem Töchterchen rechtzeitig vor den Osmanen zu fliehen, die über eine Million der in der Türkei lebenden Armenier abgeschlachtet oder auf Todesmärschen hatten umkommen lassen. Ruben war Anwalt. Seine Kanzlei befand sich im Haus von Lotte Erchinger am Äusseren alten Wingert. Zu seiner Klientel gehörten vor allem die kaukasischen und russischen Bewohner des Dorfes. Kurz nach seiner Ankunft in Katharinenfeld suchte er Karl Diepoldswiler auf. Er erklärte auf Russisch, dass ihm ein Gallenleiden zu schaffen mache. Als ihm der Arzt auf Armenisch eine leichte, fettarme Diät mit viel Obst und Gemüse empfahl und ihm riet, täglich zwei grosse Tassen heissen Mariendisteltee zu trinken, wunderte sich Ruben: «Sie sprechen unsere Sprache?»
Karl erzählte ihm von Mayranoush, die seine Mutter aufgezogen hatte und ihr und auch den drei Diepoldswiler Söhnen Armenisch beigebracht hatte.
«Was ist aus dieser Mayranoush geworden?», wollte der Anwalt wissen.
«Die Türken haben sie umgebracht.»
Seine Augen wurden dunkel. «Ein Opfer des Aghet von 1915?»
Karl nickte.
In den folgenden Wochen freundeten sie sich an. Ruben Jemazian war ein gebildeter Mensch. Sie unterhielten sich über Gott und die Welt. Manchmal spielten sie Schach. Der Arzt war dem Anwalt hoffnungslos unterlegen. Bei den Partien ging es lediglich darum, in wie vielen Zügen er von ihm mattgesetzt wurde. Aber allmählich durchschaute er dessen Taktiken, so dass Ruben mit der Zeit länger um den Sieg kämpfen musste. Karls heimlicher Ehrgeiz war es, den Armenier irgendeinmal zu schlagen.
Mitte Oktober erschien Ruben in seiner Praxis. Er war aufgeregt. «Lilit ist krank, sie hat die Seuche», sagte er. «Sie müssen sofort kommen.» Die Kleine war sein einziges Kind. Er und seine Frau liebten sie abgöttisch.
Karl begleitete ihn zu seinem Haus am Fuss des Kirchlesbergs. Nare stand schon unter der Türe. Sie hielt das Mädchen, dessen magerer Körper von Hustenattacken geschüttelt wurde, in den Armen. Auf Lilits heissen Wangen mischten sich Schweiss und Tränen. Sie hatte hohes Fieber. Der Arzt wies die Mutter an, das Kind aufs Bett zu legen, damit er es untersuchen könne. Ruben hatte recht. Es bestand kein Zweifel: Die Spanische Grippe hatte sich in Katharinenfeld ihr erstes Opfer ausgewählt. Karl verordnete, was er in den nächsten Monaten immer wieder verordnen würde: Codeintropfen, die den Husten linderten, Chinin und Essigwickel gegen das Fieber, Bettruhe und leichte Nahrung. Er riet dringend, die Wohnung regelmässig zu lüften und von Zeit zu Zeit auszuräuchern. «Beschränken Sie den Körperkontakt zu Ihrem Töchterchen auf das absolute Minimum – es nützt ihr nichts, wenn Sie sich auch anstecken. Und jetzt waschen wir uns alle gründlich die Hände mit Seife, und das tun Sie von nun an mehrmals am Tag», schloss er.
Wie das nach den Berichten, die er in Merabs Büro gelesen hatte, zu erwarten war, überstand Lilit die Influenza gut – wie die meisten Kinder und Alten. Es gab aber auch schwere Verläufe.
Während jener Jahre, in denen er als Arzt in Sankt Petersburg praktizierte, hatte Karl Diepoldswiler üble Ausbrüche von Typhus und Cholera erlebt und wusste deshalb, mit welchen Massnahmen die Ausbreitung einer Seuche halbwegs tief gehalten werden konnte. Auf dem Schulzenamt verlangte er, für die Dauer der Spanischen Grippe gesellige Veranstaltungen, Vereinsanlässe, die Proben des Kirchenchors und des Sinfonieorchesters zu verbieten und die Schule zu schliessen. Christian Beck war damit einverstanden, lediglich die Forderung, auch den sonntäglichen Gottesdienst einzustellen, lehnte er ab. «Wir sind eine fromme Gemeinde», erklärte er und fügte hinzu: «Ausserdem würde sich Pastor Hahn nicht davon abhalten lassen zu predigen.»
Karl zuckte mit den Schultern. Aus Erfahrung wusste er, dass eine Epidemie weder Gläubige noch Ungläubige verschont. Aber es war wohl sinnlos, mit dem Dorfschulzen darüber zu streiten. Immerhin war Beck damit einverstanden, den Pavillon im Lustgarten, der bereits im Sommer als Lazarett für verwundete Soldaten gedient hatte, erneut als Hospital einrichten zu lassen.
Die erste Tote im Dorf war Erna, die Frau des Winzers Hermann Eppinger. 1916 war sie von den Russen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, weil sie ihr loses Mundwerk nicht im Zaum hatte halten können und einem Offizier, der ihre Pferde requirierte, erklärte, sie hoffe, dass Kaiser Wilhelms Soldaten an der Ostfront den Russen die Hosen strammziehen würden. Als Georgien die Unabhängigkeit erlangte, war sie freigekommen. Mit der Tuberkulose, die sie sich in der Kerkerhaft zugezogen hatte, war sie für die Spanische Grippe eine leichte Beute. Erna starb am 1. November 1918.
In der ersten Novemberwoche hatte man vierundzwanzig Dorfbewohner, Einheimische und Schwaben, im Notspital aufnehmen müssen. Fünf lagen bereits auf dem Gottesacker. Ihre Betten blieben nicht lange leer. Es schien, als sei das der Beginn einer Seuche, verheerend wie ein mittelalterlicher Pestzug. Immer mehr Menschen erkrankten. Nach Möglichkeit liess Karl die Patienten in der Obhut ihrer Familien und nahm nur jene ins Lazarett auf, die schwere Symptome aufwiesen und fiebernd um ihr Leben kämpften. Katharinenfeld war fest im Würgegriff der Influenza. In den Landwirtschafts- und Handwerksbetrieben fehlte es an Arbeitskräften. Die Wirte in den beiden Gaststuben räumten die Hälfte der Tische weg, damit die ohnehin wenigen Gäste nicht befürchten mussten, sich anzustecken.
Wie immer bei solchen Ereignissen breitete sich in Teilen der Bevölkerung eine Panik aus, die an Hysterie grenzte. In der Kaukasischen Post, der Wochenzeitung der deutschen Kolonisten, boten Quacksalber für überrissene Preise völlig nutzlose Mittelchen gegen die unheimliche Krankheit an. Besorgte Bürger forderten vom Schulzenamt, Händeschütteln mit Bussen zu bestrafen, Leute, die auf der Strasse spuckten, für ein paar Tage ins Gefängnis zu stecken, die Häuser von Kranken mit roter Farbe zu markieren und das Kirchengeläute einzustellen, damit die Patienten Ruhe hätten. Eine der wenigen, die vernünftig reagierte, war Lotte Erchinger. In einer Zeitschrift hatte sie gelesen, dass die Krankenschwestern in Amerika Masken trugen, mit denen sie Mund und Nase bedeckten, um sich vor Ansteckungen zu schützen. Sie veranlasste die Damen des Mütter- und Frauenvereins, dem sie vorstand, unzählige solcher Masken zu nähen, die man im Notspital tragen musste.
Während die Grippefälle in einem erschreckenden Ausmass zunahmen, ging der Grosse Krieg zu Ende. Deutschland kapitulierte und Kaiser Wilhelm II. musste abdanken.
Cornelius Fresendorff und Karl entfernten die Tafel, die der deutschtümelnde Pastor Hahn, kraft seines Amtes als Inspektor, am Schulhaus hatte anbringen lassen. Es handelte sich um die letzte Strophe von Emanuel Geibels Gedicht. «Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen», deklamierte Cornelius pathetisch die letzten zwei Zeilen. Er stammte aus dem Baltikum und lehnte Nationalkonservative wie Paul Hahn ab. Bevor er Schuldirektor in Katharinenfeld wurde, war er Hauslehrer auf Eben-Ezer gewesen. Karl hatte ihm viel zu verdanken. Er hatte seinerzeit dafür gesorgt, dass der begabte Junge das Gymnasium in Tiflis besuchen und später in Sankt Petersburg Medizin studieren durfte. Inzwischen waren die beiden Freunde. Während Jahren sassen sie als Klarinettisten nebeneinander im Sinfonieorchester, dessen Leitung inzwischen Cornelius übernommen hatte.
Als sich Karl im vergangenen Sommer im umfunktionierten Musikpavillon um Kriegsversehrte kümmerte, hatte er geglaubt, schlimmer könne es nicht mehr kommen. Er hatte Schuss- und Stichwunden behandelt, deren Anblick schier unerträglich war. Aber immerhin war es ihm und seinen Helferinnen gelungen, die meisten der Blessierten wenigstens wieder so weit herzustellen, dass sie in ihr früheres Leben zurückkehren konnten. Bei der Spanischen Grippe fühlte er sich hilflos. Nachts studierte er Artikel aus medizinischen Fachzeitschriften, aber sie brachten ihm keine neuen Erkenntnisse. So machte er, was er für vernünftig hielt. Er wies die Pflegerinnen an, die Kranken mit Eukalyptusöl angereicherten Wasserdampf inhalieren zu lassen, jenen, die über Kopfweh klagten, kalte Kompressen auf die Stirne zu legen und zu versuchen, das Fieber mit Wickeln oder absteigenden Bädern zu senken. Das brachte manchen vorübergehende Linderung. Natürlich verschrieb er auch verschiedene Medikamente, für die er sich in Absprache mit Eduard Fiechter, dem Dorfapotheker, entschieden hatte. Das half in einigen Fällen. Aber zahlreiche Patienten starben ihm unter der Hand. Manche kurz nachdem sie eingeliefert worden waren. Andere mussten sich länger quälen. Er konnte nicht viel mehr tun, als ihnen das Sterben mit Morphium zu erleichtern. Am Schluss gab meistens eine blutende Lungenentzündung den Ausschlag, und die armen Geschöpfe, deren Haut sich aufgrund des Sauerstoffmangels blau verfärbte, rangen bis zum letzten Atemzug verzweifelt um Luft. Im Übrigen bestätigte sich, was Karl in den Berichten der Militärärzte gelesen hatte: Die Mortalität war bei kräftigen, jungen Menschen zwischen zwanzig und vierzig Jahren am höchsten. Die Toten wurden in den Keller getragen, wo man sie einsargte. Am nächsten Tag wurden sie von Mate Peradse und seinem Sohn Aleko im schwarzen Leichenwagen, vor den zwei Rappen gespannt waren, zu den Friedhöfen der verschiedenen Religionsgemeinschaften gebracht. Auf Karls Empfehlung gaben nur die engsten Angehörigen und ein Geistlicher den Verstorbenen das letzte Geleit.
Die Hilfsbereitschaft war gross. Es gab wohl keine Familie im Dorf, in der nicht mindestens jemand seinen Beitrag zur Bewältigung der Krise leistete. Die Seuche liess die Leute ihre Herkunft vergessen. Schwaben, Armenierinnen, Georgier, Russinnen und Tataren arbeiteten Seite an Seite in der Pflege, in der Wäscherei und in der Küche. Es gab Krankenträger, Sargschreiner und Totengräber. Es war, als forme die tödliche Influenza aus den Leuten eine Gemeinschaft, in der Nationalität und Religion keine Rolle mehr spielte.
Auch Marie, blass, mit zerquältem Gesicht und verquollenen Augen, meldete sich zum Dienst im Lazarett. Sie trug eine schwarze Witwentracht und hatte ihr Haar, wie die frommen Katharinenfelderinnen zu einem freudlosen Nackenknoten geknüpft. Die Trauer um ihren Mann und der Kampf gegen die tödliche Influenza seien zwei Dinge, die sich gegenseitig nicht in die Quere kämen, sagte sie.
Als sie wenige Tage zuvor von Karl erfahren hatte, Jakob sei im Gebirge ermordet und dort von seinen Brüdern begraben worden, hatte sie mit erstickter Stimme gefragt: «Wie soll ich ohne ihn weiterleben?»
Erwartete sie eine Antwort? Auch er würde ihn vermissen. Während dessen Studium am Konservatorium in Sankt Petersburg hatte Karl mit dem Bruder drei Jahre gemeinsam in einer Wohnung an der Moika gelebt. Bei der Hochzeit von Jakob und Marie war er Brautführer gewesen. Später, als er seine Praxis in Sankt Petersburg aufgab und sich in Katharinenfeld niederliess, verkehrte er regelmässig in Lotte Erchingers Haus, wo das junge Paar die elterliche Wohnung bezogen und die Mutter sich im zweiten Stockwerk eingerichtet hatte. Manchmal fuhren sie zu dritt nach Tiflis ins Konzert oder in die Oper.
Karl bewunderte seine Schwägerin, die eine brillante Violinistin war. Vor allem aber imponierte ihm die Unbefangenheit, mit der sie sich über die dörflichen Konventionen hinwegsetzte. Sie war die erste und lange Zeit einzige Frau in Katharinenfeld, die sich vom Fischbeinkorsett und den jedes Stückchen Haut verhüllenden Röcken befreite. Stattdessen trug sie bequeme Reformkleider, die den Blick auf ihre wohlgeformten Unterschenkel zuliessen. Es amüsierte Karl, wie Marie die Klatschbasen beiderlei Geschlechts ignorierte, die sich über sie das Maul zerrissen, weil sie bis zu Jakobs Tod ihr prachtvolles, schwarz gelocktes Haar offen getragen hatte, statt es in zwei züchtigen Zöpfen um den Kopf zu winden oder, wie ihre bigotte Schwester Martha, zu einem strengen Dutt zu knüpfen. Auch mit einundvierzig war sie noch immer eine schöne Frau, ein Paradiesvogel, der sich ins fromme Schwabendorf an der Maschawera verirrt hatte.
Bereits im Sommer hatte Marie als freiwillige Helferin Kriegsversehrte gepflegt, die bei der Verteidigung Sakartvelos gegen die vordringenden Osmanen verwundet worden waren. Sie, die Künstlerin, war nicht davor zurückgeschreckt, eiternde Wunden zu säubern, blutdurchtränkte Verbände zu wechseln, Erbrochenes aufzuwischen und Nachttöpfe zu leeren. Dazwischen hatte sie mit ihrer Geige die verwundeten Elendsgestalten für kurze Zeit aus der Hölle ihrer Erinnerungen an das Schlachtfeld geholt.
Wie damals zog sie jetzt einen weissen Schurz an, setzte ein Häubchen auf ihren Kopf und band sich eine Maske vor Mund und Nase. Ohne viel zu reden, erfüllte sie ihre Pflicht wie alle andern, wusch Patienten, die dazu selbst nicht mehr in der Lage waren, verteilte Essen, flösste Hustentropfen ein, bezog frei gewordene Betten neu. Sie sass schweigend neben Sterbenden, und wenn alles vorbei war, schloss sie ihnen die Augen. Marie war unermüdlich. Sie beklagte sich nie. Keine Arbeit war ihr zu viel. Vielleicht war das ihre Art, mit ihrem Kummer über den Verlust ihres Mannes umzugehen. Manchmal blieb sie stehen, stützte mit der rechten Hand ihr Kreuz. Hatte sie Rückenschmerzen? Einmal sprach Karl sie darauf an. Sie schüttelte nur den Kopf. «Es gibt Wichtigeres als meine Wehwehchen», meinte sie.
In den ersten Wochen hatte Karl Diepoldswiler kaum einmal ein paar freie Stunden. Er arbeitete auch sonntags. Jeder Tag begann mit der Morgenvisite, bei der er Justina Mack Anweisungen für die Pflege der Kranken gab. Seine noch junge Arzthelferin war ein energisches, rundliches Persönchen, vital und enorm tüchtig. Jetzt übernahm sie, wie schon im Juni, die Funktion einer Oberschwester. Die meist älteren Pflegerinnen ordneten sich klaglos ihrer Autorität unter.
Später machte Karl bis zur Vesperzeit Krankenbesuche im Dorf und fuhr dann im Einspänner, den Mate Peradse kostenlos zur Verfügung stellte, zurück in den Lustgarten, dessen Name zurzeit nicht einer gewissen Ironie entbehrte. Im Anschluss an die Abendvisite ass er bei Lotte im Äusseren alten Wingert eine Kleinigkeit und ging dann in seine Praxis an der Kreuzgasse, wo er den Papierkram erledigte. Selten kam er vor Mitternacht ins Bett. Er fühlte sich entsprechend ausgebrannt und müde. So war ihm Michel Vöhringers Angebot, im Notspital als Schriftführer zu arbeiten, hochwillkommen.
Karl mochte den jungen Mann, der mit seinen Brüdern Alfred und Gottlieb an Dorffesten zum Tanz aufspielte. Mit seiner untersetzten, kräftigen Gestalt und dem blonden Lockenkopf erinnerte er ihn an Hannes, der draussen in der Steppe den elterlichen Gutshof bewirtschaftete. Als im vergangenen Juni die Türken in Georgien einmarschierten, glaubte Michel, wie andere Jungmänner aus dem Dorf, den Helden spielen zu müssen und meldete sich als Freiwilliger an die Front. Kurz darauf wurde er im Lazarett eingeliefert. Als in seinem von einem Schuss zertrümmerten linken Bein Wundbrand ausbrach, musste es Karl, obwohl er kein Chirurg war, notfallmässig oberhalb des Knies amputieren. Für ihn und Justina, die dabei assistierte, war die Operation ein traumatisches Erlebnis gewesen.
In der Zeit danach haderte Michel mit seinem Schicksal. Aber als ihm Karl sagen konnte, Merab Metreveli habe versprochen, der Staat würde ihm eine Prothese mit einem mechanischen Knie- und Fussgelenk finanzieren, mit der er sich wieder leidlich bewegen könne, fand er allmählich zu seinem heiteren Wesen zurück. Inzwischen war er bereits einmal beim Prothesenmacher in Tiflis gewesen.
Gegen Ende November sprach er Karl auf der Strasse an. Er stand auf seinem unversehrten rechten Bein, in beiden Achselhöhlen eine Krücke. «Ich möchte auch gerne helfen», sagte er. «Als Krüppel kann ich keine schweren Arbeiten übernehmen, aber vielleicht könnte ich administrative Aufgaben erledigen, Formulare ausfüllen, Totenscheine ausstellen, das Patientenbuch führen, die Einsatzpläne für die Pflegerinnen schreiben. Ausserdem verstehe ich etwas von Buchhaltung.»
«Sie scheinen ja ziemlich genau zu wissen, welche Tätigkeiten im Büro eines Spitals anfallen, Michel.»
«Ich habe mich bei Justina erkundigt.»
«Soso, bei Justina.» Karl war amüsiert. Lotte Erchinger, für die der Mütter- und Frauenverein eine Quelle jener Neuigkeiten war, welche die Dorfleute beschäftigte, hatte kürzlich erwähnt, der junge Vöhringer und Justina seien ein Paar. «Möchten Sie mehr mit ihr zusammen sein?»
Michel schaute ihn gekränkt an. «Ich will helfen. Das hat nichts mit meiner Verlobten zu tun.»
Meine Verlobte. Also doch. Nun, das ging ihn als Arzt nur insofern etwas an, als er wohl bald eine neue Gehilfin suchen musste. «Jetzt seien Sie nicht gleich eingeschnappt, ein Spitalverwalter ist genau das, was uns noch fehlt.»
«Spitalverwalter», wiederholte der junge Mann und liess das Wort auf der Zunge zergehen. Karl verkniff sich ein Lächeln.
Man richtete für Michel auf der Bühne des Musikpavillons neben dem mit Tüchern abgedeckten Konzertflügel einen Arbeitsplatz ein: Tisch, Stuhl und einen Schrank für die Akten. Jeden Morgen, pünktlich um sieben Uhr, humpelte er in den Saal und erklomm die Treppe. Dabei durfte ihm niemand helfen. Er legte die Krücken ab, schlüpfte aus seiner Jacke und machte sich an die Arbeit. Hemdsärmelig thronte Michel hoch über dem Zuschauerraum, in dem inzwischen nie weniger als fünfzig Kranke und Sterbende lagen. Ab und zu hob er den Kopf. Wenn sich seine und Justinas Blicke trafen, lächelten sie sich an. Für alle war dieses Lächeln wie ein Sonnenstrahl, der für einen kurzen Moment die düstere Atmosphäre von Tod und Verderben erhellte.
Adam Kimmerle, der an der Dorfschule Musik unterrichtete, war als Pianist Jakobs begabtester Schüler gewesen. Nach dessen Tod übernahm er die Nachfolge als Organist und Leiter des Kirchenchors. Vor einem Jahr hatte er Gerda Grathwohl geheiratet, die Enkelin jener Barbara, die 1826 als junges Mädchen bei einem Tatarenüberfall ins Osmanische Reich entführt und auf einem Sklavenmarkt in Achalziche verkauft worden war. Vitus von Fenzlau, Karls Grossvater, damals noch russischer Offizier, hatte sie zwei Jahre später befreit und nach Katharinenfeld zurückbringen lassen. Gerda spielte im Sinfonieorchester Harfe. Das Instrument passte zu diesem ätherischen Wesen, das stets den Eindruck erweckte, als schwebe es durch die Strassen, statt wie andere Leute die Füsse zu benutzen.
Im Krippenspiel, das jedes Jahr am vierten Advent in der Kirche aufgeführt wurde, war sie der Engel Gabriel, welcher der Jungfrau die Geburt Jesu verkündete. Die Rolle schien ihr auf den Leib geschrieben. Sie stand mit ihrem lichtblonden Haar, das sie bei dieser einen Gelegenheit offen trug, in einem weissen Kleid vor Maria und zitierte mit ihrer hohen Stimme die Worte aus dem Evangelium nach Lukas: «Gegrüsset seist du, Holdselige! Der Herr ist mit dir, du Gebenedeite unter den Weibern … »
Adam vergötterte seine Frau. Er war ein langer, magerer Mensch und obwohl erst dreissig, hatte sich sein Haar bereits stark gelichtet. Seine hellen Augen schauten stets etwas verwundert durch die dicken Gläser seiner Brille. Einmal im Monat veranstalteten die Eheleute mit ihren Glaubensschwestern und -brüdern einen Hausabend. Er stand unter dem Motto «Gebet und Musik». Die kleine Gemeinschaft brachte dort ihren schwärmerischen Herz-Jesu-Pietismus bekennerhaft zum Ausdruck.
Im Christmonat erschien Adam täglich um die Vesperzeit im Notspital. Er setzte sich an den Flügel und spielte eine halbe Stunde lang Kirchenlieder und Choräle. An seinem Tisch hob Michel manchmal den Kopf und musterte den Pianisten mit einer Mischung aus Neugierde und leisem Grauen. Er schien gegen die Vorstellung anzukämpfen, Adam sei der Todesengel, der die Sterbenden auf ihr letztes Stündlein vorbereitete.
Vielleicht empfand Marie ähnlich. Als Adam Kimmerle bei seinem fünften Vesperkonzert zum fünften Mal die Bach-Kantate Ich steh mit einem Fuss im Grabe spielte, stieg sie zu ihm auf die Bühne, legte ihm ein Notenheft, das sie am Morgen mitgebracht hatte, auf den Flügel und sprach leise auf ihn ein. Er schüttelte heftig den Kopf, aber sie liess nicht locker. Endlich nickte er resigniert.
Als Karl am nächsten Tag von seinen Krankenbesuchen im Dorf zurückkehrte, hörte er bereits im Gang Geigentöne. Es waren die Zigeunerweisen von Pablo de Sarasate. Nur seine Schwägerin verfügte über das Können, dieses anspruchsvolle Stück konzertreif vorzutragen. Marie, die ihren Schwesternschurz abgelegt hatte, stand im schlichten, schwarzen Kleid mit ihrer Violine neben Adam. Der vierte Satz des Stücks mit seinem rasenden Tempo, den Spiccato-Läufen, den Flageoletts und Pizzicati forderte ihr alles ab. Kein Wunder, der vor zehn Jahren verstorbene Sarasate war selbst ein Violinvirtuose gewesen, der mit seinen Aires gitanos wohl die eigene Meisterschaft unter Beweis stellen wollte.
Karl war fasziniert. Im Saal rangen Bett an Bett die fiebernden Kranken würgend um Luft, während die beiden Musiker bald mit schwermütigen Tonfolgen, bald in überschäumender Fröhlichkeit das Leben in all seinen Facetten feierten. Die Pflegerinnen standen am Bühnenrand und hörten dem Spiel des frommen Pietisten und der trauernden Witwe gebannt zu. Von diesem Tag an erinnerte das ungleiche Paar immer um die Vesperzeit für eine halbe Stunde daran, dass jenseits von Leid und Tod auch Schönheit und Hoffnung existierten. Alle spürten es: die Patienten und die Pflegerinnen. Michel Vöhringer liess die Arbeit ruhen und konnte seinen Blick nicht von Marie abwenden, die ihren Part mit geschlossenen Augen spielte. Von jetzt an war auch Karl pünktlich um vier Uhr im Notspital, und wenn er sich einmal verspätete, warteten seine Schwägerin und Adam mit ihrem Vortrag, bis er eintraf.
2
In Katharinenfeld waren Advent und Weihnachten im Jahresablauf seit je eine besondere Zeit. Auch in diesem Jahr brannten überall die Kerzen, aber nirgendwo wollte die rechte Weihnachtsfreude Einkehr halten. Es gab kaum ein Haus, in dem nicht um Angehörige und Bekannte getrauert wurde, die der Seuche zum Opfer gefallen waren. Man betete für deren Seelenheil und dafür, dass man selbst vor der Influenza bewahrt bleibe. In seinen Sonntagspredigten verkündete Pastor Hahn, die grosse Heimsuchung sei die Strafe des Allmächtigen für die Sünden der Menschheit im Allgemeinen und die der Katharinenfelder im Besonderen. Karl schüttelte den Kopf, als ihm Lotte davon berichtete. Wenn die Spanische Grippe die Strafe eines gerechten Gottes wäre, sagte er, so würde sie die Brut jener gewissenlosen Potentaten dahinraffen, die im Grossen Krieg Millionen von Soldatenleben auf den Altären ihrer Machtansprüche geopfert hatten. Als der Pfarrer auch im Spital zu Busse und Umkehr aufrufen wollte, verbot es der Arzt rundweg und gestattete ihm lediglich, sich zu jenen ans Bett zu setzen, die ausdrücklich seinen Beistand verlangten. «Natürlich nur, falls Sie keine Angst haben, sich anzustecken, Herr Pastor», fügte er boshaft hinzu.
Der Mütter- und Frauenverein hatte es sich nicht nehmen lassen, für den Heiligen Abend einen grossen Christbaum auf der Bühne aufzustellen. Ein Jahr zuvor, als die Kolonisten und ihr geistlicher Hirte noch für den Sieg des Deutschen Reichs auf den Schlachtfeldern gebetet hatten, waren in vielen Familien kleine Kampfflugzeuge, Unterseeboote und Kanonen am Lichterbaum aufgehängt worden. Jetzt, nach dem verlorenen Krieg, besannen sich die frommen Schwaben darauf, dass man mit der Geburt Christi kein nationales Ereignis feierte, und so wurde die mächtige Tanne mit Äpfeln, versilberten Nüssen, Schwebeengeln und farbigen Glaskugeln geschmückt.
Während die Kerzen brannten, begleitete Adam Kimmerle auf dem Flügel die acht besten Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors, die vierstimmig fünf Choräle aus Bachs Weihnachtsoratorium vortrugen.
Anschliessend stellte sich Marie mit ihrer Geige neben ihn. Sie nickte Adam zu, und er schlug jene acht Akkorde an, die Jakob so oft gespielt hatte, wenn er gemeinsam mit Marie den Kanon in D-Dur spielte. Karl stand auf der Bühne hinter Michel Vöhringer und Justina Mack. Ihm war, als höre er die Stimme des verstorbenen Bruders. «Realisierst du, wie genial Pachelbel war», hatte dieser einmal zu ihm gesagt. Er hatte ihm das Ostinato vorgesungen: d – a – h – fis – g – d – g – a. «Diese schlichte Tonfolge. Aber was er daraus gemacht hat! Ich wiederhole die Akkordfolge achtundzwanzigmal auf dem Klavier und Marie folgt mir mit ihren Variationen des Kanonthemas, zuerst ruhig, dann immer verspielter und virtuoser.»
«Herrgott, war das schön», sagte Michel, als sie den Bogen sinken liess. «Wenn das nicht für Weihnachten bestimmt wäre, wünschte ich mir, sie würde es an unserer Hochzeit spielen.»
Karl legte ihm die Hand auf die Schulter. «Es soll eigens für eine Hochzeit komponiert worden sein. Sie können Marie und Adam fragen, ob sie das Stück spielen, wenn Sie und Justina heiraten.» Er schaute seine Helferin an. «Wann ist denn der grosse Tag?»
Justina errötete. «Wenn sich die Seuche totgelaufen hat», sagte sie.
«Wenn ich mein neues Bein habe», widersprach ihr Michel.
Der Arzt lachte. «Nun, dann wollen wir hoffen, dass die beiden Ereignisse zusammentreffen.»
Nach Weihnachten ebbte die zweite Welle der Spanischen Grippe ab. Das Notspital leerte sich allmählich. Ende Januar war es so weit. Das Sinfonieorchester durfte wieder im Musikpavillon proben. Cornelius Fresendorff plante bereits das erste Konzert: Die Uraufführung der Kaukasischen Sinfonie.
Mitte Februar schlug die Seuche aber ein drittes Mal zu, allerdings bei weitem nicht so heftig wie im Herbst. Man konnte alle Kranken zu Hause behandeln. Dennoch gab es drei weitere Tote zu beklagen.
In Katharinenfeld war Alfred, der älteste der drei Söhne von Grethe Vöhringer, das letzte Opfer der Spanischen Grippe. Als sie Karl rufen liess, ging es mit dem Kranken bereits zu Ende. «Gestern war er noch gesund», klagte die Mutter. Am Morgen hätten ihn heftige Kopfschmerzen geplagt. Das Fieber sei rasch angestiegen, und jetzt phantasiere er. Sie begann zu weinen. «Machen Sie etwas, Herr Doktor!»
Der knapp dreissigjährige Weinbauer, der seit dem Tod des Vaters den elterlichen Betrieb führte, lag im Bett. Er wurde von Hustenanfällen geschüttelt und rang nach Luft. Auf die Fragen des Arztes reagierte er nicht. Seine Haut hatte die typisch bläuliche Färbung angenommen. Das Fieberthermometer zeigte einundvierzig Grad, und er hatte den für die Krankheit typischen tiefen Puls. Ausserdem blutete er aus der Nase. Mit einem Spachtel öffnete der Arzt Alfreds Mund. Wie erwartet waren Hals und Rachen stark gerötet.
Während er den Kranken untersuchte, stand Michel, auf seine Krücken gestützt, in der Türe zum Krankenzimmer. «Es geht mit ihm zu Ende, nicht wahr, Herr Doktor.» Das war keine Frage. «Sie werden ihm jetzt Morphium spritzen.» Auch das war eine Feststellung. Michel hatte in den vergangenen Wochen viele Leute sterben sehen. Er wusste, was man tat, um ihnen den Todeskampf zu erleichtern.
«Es tut mir leid, Michel», sagte Karl, während er das Morphin in einer Spritze aufzog und es Alfred injizierte.
Im Mai 1919 schien der böse Spuk endgültig vorbei zu sein. An Christi Himmelfahrt, während sich die Gläubigen in der evangelischen Kirche zum Gottesdienst versammelten, spazierte Karl Diepoldswiler am Vormittag hinauf zum deutschen Friedhof, der am Fuss des Kirchlesbergs lag. Man hatte das Gräberfeld erweitern müssen, um Platz für die Opfer der Seuche zu schaffen. Er kannte die Zahlen. Michel Vöhringer hatte darüber Buch geführt. Mehr als ein Drittel der Dorfleute war an der Spanischen Grippe erkrankt, über hundert von ihnen waren daran gestorben. Sie lagen in der Nordwestecke des Gottesackers. Die Hände auf dem Rücken, ging er durch die Reihen. Vor jedem Kreuz blieb er stehen, las die Namen der Verstorbenen und versuchte, sie sich in Erinnerung zu rufen. Aber er sah nur ihre zerquälten Gesichter, die mit weit offenen Mündern um Luft rangen.
Vor Alfred Vöhringers Grab stand Michel. Eine Woche zuvor hatte er seine Prothese erhalten und benötigte keine Krücken mehr. Stattdessen hatte er sich in Tiflis einen Spazierstock aus Ebenholz mit Silbergriff angeschafft. Der Arzt hatte ihn schon von weitem gesehen. Jetzt trat er neben ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. «Vermissen Sie ihn?»
Der junge Mann wandte langsam den Kopf. «Er war das A unseres Trios», sagte er.
Jedermann in Katharinenfeld kannte die drei Vöhringers, Volksmusikanten, die sich Trio Amigo nannten – genannt hatten: A wie Alfred, Mi wie Michel, Go wie Gottfried.
«Natürlich können wir als Duo auftreten, Gottfried und ich. Um unsere Musik zu spielen, genügen Klarinette und Handharmonika. Aber die Bassgeige wird uns fehlen.» Er hatte Tränen in den Augen.
Karl zog ihn an sich.
Michel begann zu weinen. «Die vielen Toten», schluchzte er. «Ich kenne sie alle, und ich musste mit ansehen, wie sie starben.» Er verstummte. Nach einer Weile zog er ein grosses Taschentuch hervor, wischte sich über die Augen und putzte sich geräuschvoll die Nase. «Verzeihen Sie», murmelte er.
«Da gibt es nichts zu verzeihen», meinte der Arzt. «Es war eine schwere Zeit. Die Erinnerung an die grosse Heimsuchung und die Trauer um die Toten werden uns noch lange begleiten. Uns alle.»
Der Frühsommer dieses Jahres war für die schwäbischen Kolonisten in Transkaukasien wie das Erwachen aus einem Albtraum. Hinter ihnen lag der Grosse Krieg, in dem ihre Söhne für den Zaren gegen die alte Heimat hatten kämpfen müssen, der Feldzug gegen die Osmanen und zu schlechter Letzt die schreckliche Influenza. Aber jetzt, nach all den Prüfungen, begann man wieder an eine bessere Zukunft zu glauben.
Für Michel hatte sich alles zum Guten gewendet. August Biedlingmeier, der reichste Weinbauer in der Gegend, hatte ihm, dem Kriegsversehrten, die frei gewordene Stelle als Verwalter der Winzergenossenschaft Union verschafft. Michel verfügte nun über ein Einkommen, das ihm erlaubte, mit Justina einen eigenen Hausstand zu gründen. Ausserdem war es Karl gelungen, ihn als zweiten Klarinettisten für das Sinfonieorchester zu gewinnen. Er ersetzte Cornelius, der das Dirigentenamt übernommen hatte. Das sei nicht seine Musik, hatte Michel sich zunächst gesträubt.
«Papperlapapp», schaltete sich seine Verlobte ein. «Wenn der Herr Doktor dich bittet, dann gehst du!»
Als der Arzt ihm versprach, gemeinsam mit Marie und seinem Bruder Gottfried an seiner Hochzeit mit Justina zum Tanz aufzuspielen, gab er seinen Widerstand auf.
Im etwas zu weiten Frack des verstorbenen Vaters, gestützt auf seinen eleganten Spazierstock, führte Michel am Pfingstmontag Justina durch die mit Hunderten von Pfingstrosen geschmückte Kirche zum Altartisch, wo Pastor Hahn auf sie wartete. Der Kirchenchor sang aus Wagners Lohengrin:
Treulich geführt ziehet dahin,
wo euch der Segen der Liebe bewahr!
Siegreicher Mut, Minnegewinn,
eint euch in Treue zum seligsten Paar …
Nach Abschluss der Zeremonie begleitete Adam Kimmerle Marie auf der Orgel. Sie erwiesen dem Brautpaar mit einer besonders feierlichen Interpretation von Pachelbels Kanon die Reverenz, genauso wie sich das Michel an Weihnachten gewünscht hatte.
Am Nachmittag wurde auf der Wiese bei Kötzles Mühle an der Maschawera gefeiert. Das halbe Dorf sass an den langen, reich gedeckten Tafeln und liess in zahlreichen Reden Braut und Bräutigam hochleben. Nach dem Essen, das sich bis weit in den Nachmittag hineinzog, stiegen Gottlieb Vöhringer, Marie und Karl Diepoldswiler mit ihren Instrumenten auf ein behelfsmässiges Podest, das auf dem Platz vor der Mühle errichtet worden war. Mit Violine, Klarinette und Handharmonika spielten sie den Schneewalzer. Etwas wehmütig schaute Michel seinem Schwiegervater zu, den er hatte bitten müssen, ihn beim Brauttanz zu vertreten.
Später kam er aufs Podest. Er hatte seine eigene Klarinette mitgebracht. «Lassen Sie mich an Ihrer Stelle spielen, Herr Doktor», sagte er. «Dafür erlaube ich Ihnen, mit meiner Frau zu tanzen. Schliesslich bin ich Ihnen noch etwas schuldig.» Er klopfte sich mit der Hand auf die Prothese, die unter der schwarzen Hose verborgen war.
Und während Michel mit Marie und Gottfried Polkas, Mazurkas und Walzer zum Besten gab, verabschiedete sich Karl im Dreivierteltakt von Justina. In den vergangenen Jahren war ihm die tüchtige junge Frau ans Herz gewachsen. Er würde sie vermissen. Um sie herum drehten sich die schwäbischen Kolonisten mit ihren Frauen. Manchmal stiess jemand einen übermütigen Jauchzer aus. War diese ländliche Hochzeit ein Neubeginn? Würde von jetzt an das Leben wieder seinen gewohnten Gang nehmen, so wie in den weit zurückliegenden Jahren vor dem Grossen Krieg?
3
Wenn der letzte Patient sein Untersuchungszimmer verlassen hatte, pflegte Karl an der Maschawera einen Abendspaziergang zu machen. Das Zwitschern, Trillern, Flöten und Pfeifen der Vögel im dichten Ufergebüsch, die ja lediglich ihr Revier markierten oder um die Gunst eines Weibchens balzten, wurde für ihn zu einem grossen Konzert, das eine friedlich gewordene Welt pries.
Manchmal begleitete Marie ihren Schwager. Seit Mitte Mai arbeitete sie als Praxishilfe bei ihm. Als er ihr angeboten hatte, Justinas Stelle zu übernehmen, hatte sie ohne Zögern zugesagt. Sie war gleichermassen froh über den Verdienst wie über eine Tätigkeit, die ihrem Witwendasein Inhalt gab.
Auch jenseits der Arbeit und seinen Besuchen am Äusseren alten Wingert, verbrachten die beiden viel Zeit miteinander, was nicht nur im Mütter- und Frauenverein registriert wurde. Von Lotte wusste Karl, dass er in Katharinenfeld als eine gute Partie galt und einige Eltern heiratsfähiger Töchter ihn schon seit langem als möglichen Schwiegersohn ins Auge gefasst hatten. Aus betont beiläufigen Bemerkungen seiner Patientinnen wurde deutlich, dass man ihn und seine Schwägerin als Paar betrachtete. Aber so war es nicht. Marie trauerte noch immer um Jakob, den sie schon als kleines Mädchen geliebt hatte und den sie wohl noch lange über seinen Tod hinaus lieben würde. Für sie war Karl lediglich Jakobs Bruder. Mehr nicht.
In den Wochen nach Pfingsten berichtete sie ihm, ihr Pate habe sie gebeten, ihn zu besuchen, und sie fragte ihn, ob er sie begleiten würde. Wie jedermann kannte Karl Klemens Eichin. Der heute über Siebzigjährige war ein Freund von Maries verstorbenem Vater gewesen. Als vor ein paar Jahren seine Frau starb, war er von Katharinenfeld ins neun Werst entfernte Kveshi gezogen. Die Eichins waren seit Generationen Geigenbauer. Fast alle Violinen, Bratschen, Violoncelli und Bassgeigen der Streicher des Sinfonieorchesters, auch jene Maries, von der ersten Viertelgeige bis zum Instrument, das sie heute spielte, stammten aus seiner Werkstatt.
Am letzten Junisonntag mieteten sie bei Mate Peradse zwei Kabardiner und ritten eine Stunde lang der Maschawera entlang flussaufwärts. Im Verlauf der letzten hundert Jahre hatten die schwäbischen Kolonisten aus der bis dahin ungenutzten Talebene fruchtbares Bauernland gemacht. Das Korn auf den Feldern war erntereif. Die Halme standen hoch und leuchteten golden in der Sonne.
Da Marie seit ihrer Kindheit nicht mehr auf Kveshi Ziche gewesen war und das alte Gemäuer wieder einmal besuchen wollte, waren sie schon früh unterwegs. Die mittelalterliche Festung war nördlich des Dorfes auf einem felsigen Hügel erbaut worden. Sie sassen ab und banden ihre Pferde an eine junge Steineiche. Nachdem sie einen niedrigen tunnelähnlichen Eingang und zwei Innenhöfe durchquert hatten, kamen sie zu einer Treppe. Sie führte zu einer winzigen Kapelle. Sie traten ein. An den Wänden verblassten Fresken irgendwelcher Heiligen. Kurz darauf standen sie auf der Zinne der Umfassungsmauer der Burg. Unter ihnen lag das breite Tal. Der Wald an den steilen Hügeln im Süden und Westen bildete den dunkelgrünen Saum des Kleinen Kaukasus. Am Himmel jagten Rauchschwalben nach Mücken. Ihr heller Gesang erfüllte die sommerlich warme Luft.
Marie begann die erste Stimme der Hymne zu vokalisieren, die Jakob unmittelbar vor seinem Tod im Gebirge komponiert hatte. Aus seinen Notizen hatte sein Bruder geschlossen, dass es sich um die Einleitung zum letzten, unvollendeten Satz seiner Kaukasischen Sinfonie handelte. Die vierstimmige Melodie war ein Lob auf die Schönheit der georgischen Heimat. Als Marie und Karl die Noten studierten, wussten sie nicht, welche Instrumentierung er sich vorgestellt hatte. Sie entschieden sich, das Werk beim Abschiedskonzert für Jakob in einer Besetzung mit Violine, Klavier und zwei Klarinetten vorzutragen. Jetzt, als Karl seine Schwägerin das Stück singen hörte, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Sein Bruder hatte die Komposition dem polyphonen Gesang, wie er in orthodoxen Kirchen üblich war, nachempfunden. Aber wer hätte ihn singen sollen? Unwillkürlich musste Karl lächeln. Jakob wollte ihn stets für den Kirchenchor gewinnen. «Du hast einen ganz passablen Bariton», hatte er mehr als einmal gesagt. Passabel – das war aus Jakobs Mund ein hohes Lob. Gleichwohl lehnte Karl ab. Die Vorstellung, auf der Empore der Kirche den Predigten des stramm wilhelminisch gesinnten Pastors zuhören zu müssen, war wenig verlockend. Aber hier, auf Kveshi Ziche, intonierte er summend die zweite Stimme. Marie lehnte sich an seine Schulter. Tränen liefen über ihre Wangen. Ihr Haar kitzelte ihn in der Halsbeuge. Er hätte gerne ihren strengen Dutt aufgelöst und mit ihm die Trauer, die er einschloss. Stattdessen atmete er den Duft ihres Parfums ein und tastete nach ihrer Hand. So blieben sie lange stehen. Dann entzog sie sich ihm und rückte von ihm ab.