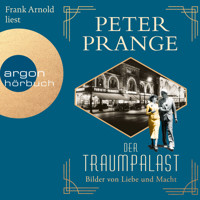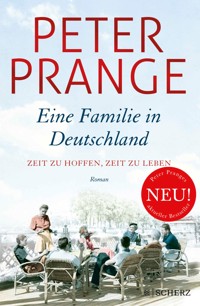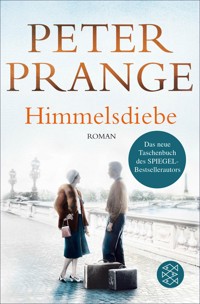9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie alles begann - der Roman für alle, die Peter Pranges Bestseller »Unsere wunderbaren Jahre« liebten. Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlorenen Krieges und der Angst vor einer ungewissen Zukunft, fehlt es den Menschen an allem, was sie zum Leben brauchen. Selbst Ulla, Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das baldige Weihnachtsfest erscheint da wie ein Licht in der Finsternis. In dieser Zeit veranstaltet Tommy Weidner, ein "Bastard", der nicht mal den Namen seines Vaters kennt, Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft? Alles spricht dagegen. Bis der Firma Wolf die Demontage droht, und Ullas Vater ausgerechnet Tommys Hilfe braucht ... Die Vorgeschichte zum Bestseller und ARD-TV-Erfolg »Unsere wunderbaren Jahre«. Peter Prange ist der Erzähler deutscher Geschichte. Mit diesem Roman schlägt er die Brücke von der Kriegs- zur Wirtschaftswunderzeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Prange
Winter der Hoffnung
Roman
Über dieses Buch
Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlorenen Krieges und der Angst vor einer ungewissen Zukunft, fehlt es den Menschen an allem, was sie zum Leben brauchen. Selbst Ulla, Tochter eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das baldige Weihnachtsfest erscheint da wie ein Licht in der Finsternis. In dieser Zeit veranstaltet Tommy Weidner, ein „Bastard“, der nicht mal den Namen seines Vaters kennt, Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft? Alles spricht dagegen. Bis der Firma Wolf die Demontage droht, und Ullas Vater ausgerechnet Tommys Hilfe braucht ...
Weitere Titel von Peter Prange:
›Unsere wunderbaren Jahre‹
›Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben‹
›Eine Familie in Deutschland. Am Ende die Hoffnung‹
›Das Bernstein-Amulett‹
›Himmelsdiebe‹
›Die Rose der Welt‹
›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹
›Die Philosophin‹
›Die Principessa‹
›Die Gärten der Frauen‹
›Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet‹
Die Website des Autors: www.peterprange.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Prange ist als Autor international erfolgreich. Seine Werke haben eine Gesamtauflage von über drei Millionen erreicht und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Zuletzt stand sein großer Roman in zwei Bänden, über die Zeit der Naziherrschaft, ›Eine Familie in Deutschland‹, auf den Bestsellerlisten. Mehrere Bücher, etwa sein Bestseller ›Das Bernstein-Amulett‹, wurden verfilmt. Im Frühjahr begeisterte der TV-Mehrteiler nach seinem Erfolgsroman ›Unsere wunderbaren Jahre‹ das Publikum. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Für meinen fetten Fetter
Otto Prange,
der genauso bekloppt ist wie ich,
nur völlig anders –
stellvertretend für die
ganze Bagage.
Sowie für
Dr. Andreas Hollstein,
der in einundzwanzig Amtsjahren als Bürgermeister
für Altena buchstäblich alles getan hat,
was man nur tun konnte –
stellvertretend für die
andere Bagage.
Und, last, not least, für meine Lektorin
Dr. Cordelia Borchardt,
ohne die, und das ist keine Phrase,
es dieses Buch nicht geben würde.
»Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns?«
Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1., Vorwort
Vorbemerkung
Die nachfolgende Geschichte ist, obwohl in der Heimatstadt des Autors angesiedelt, frei erfunden. Rückschlüsse auf noch lebende oder bereits verstorbene Personen sollen in keiner Weise nahegelegt oder ermöglicht werden. Die Handlungsstränge der Geschichte sind ebenso wie die Lebenswege der Protagonisten Erfindungen des Autors. Dies gilt insbesondere für die Verstrickungen einiger Handlungsträger in der Nazizeit und die Schilderung ihrer Privatsphäre. Alle intimen Szenen sowie die Dialoge und die Darstellung der Gefühlswelt des gesamten Romanpersonals sind reine Fiktion.
Teil EinsNacht
1.–2. Advent
»Die Erde aber war wüst und leer, und Finsternis lag über der Tiefe.«
Erstes Buch Moses, Kapitel 1, Vers 2
1
In lautloser Finsternis lag Altena da, erstarrt in klirrender Kälte. Wie stets in der heiligen Zeit waren die Einkaufsstraßen der kleinen, irgendwo zwischen Sauerland und Ruhrgebiet gelegenen Stadt mit Tannengrün geschmückt, doch anders als sonst erstrahlten sie in diesem Advent des Jahres 1946 nicht in vorweihnachtlichem Lichterglanz. Für die Illumination fehlte der Strom, und viele Girlanden waren bereits geplündert – zu groß war die Versuchung, die wertvollen Zweige zu stehlen. Obwohl der Krieg schon anderthalb Jahre vorbei war, bestimmte er mehr denn je das Leben der Menschen, mehr denn je mangelte es ihnen an allem, was sie zum Leben brauchten: Nahrung, Kleidung und eine warme Wohnung. Umso sehnlicher wünschten sie nun das bevorstehende Christfest herbei, und sobald sich gnädiges Dunkel über die Schrecken der Vergangenheit und die Angst vor einer allzu ungewissen Zukunft senkten, drängten sie sich in den Gotteshäusern der Stadt, in der evangelischen Lutherkirche ebenso wie in der katholischen Pfarrkirche St. Matthäus oder den Tempeln der Calvinisten und freikirchlichen Gemeinden, um ihre Herzen und Seelen im Warten auf die Ankunft des Herrn zu wärmen, auch wenn ihre Körper in den ungeheizten Gotteshäusern kaum weniger froren als in ihren kalten Wohnungen oder auf der Straße.
Thomas Weidner aber, von jedermann Tommy genannt, hatte Besseres zu tun, als in einer Kirche zu beten. Mit einem leeren Sack über der Schulter huschte er über das von Eis und Schnee bedeckte Bahnhofsgelände und lauschte in der Dunkelheit auf die Ankunft der »Schnurre«, der altersschwachen Kleinbahn, die, aus Lüdenscheid kommend, ihr Nahen für gewöhnlich mit einem Bimmeln ankündigte, um einmal am Tag Kohlen und Koks nach Altena zu bringen, zur Versorgung der frierenden Bevölkerung sowie der zahlreichen kleinen und großen Fabriken, die entlang der Lenne und ihrer zwei Nebenflüsse Rahmede und Nette vor allem Draht und sonstiges Metall-Halbzeug produzierten, soweit nach dem verlorenen Krieg dafür noch Nachfrage bestand. Denn Tommy brauchte dringend Brennstoff – in dem ausrangierten, auf einem toten Gleis abgestellten Eisenbahnwaggon, der ihm seit seiner Entlassung aus der britischen Gefangenschaft als Behausung diente, erwartete er an diesem Abend Damenbesuch.
Ungeduldig blickte er auf seine Pilotenuhr, die er für eine Stange Zigaretten erworben hatte. Die phosphorisierenden Zeiger standen auf zehn nach sieben. Wo zum Teufel blieb der Zug? Oder war das wieder einer der Tage, an dem die Schnurre gar nicht kam, weil es keine Kohlen gab? Auf der Stelle tretend, blies er sich in die Hände. Trotz Mütze und Schal fror er in seinem abgetragenen Wehrmachtsmantel wie ein Schneider. Kein Wunder, noch nie war es Anfang Dezember in Altena so kalt gewesen wie in diesem Jahr. Auf der Lenne trieben bereits Eisschollen, und die jahrhundertealte Burg, das Wahrzeichen der Stadt, das sich auf dem Schlossberg über dem Fluss im Mondschein erhob, wurde von den gewaltigen Schneemassen schier erdrückt.
Da – endlich näherte sich aus der Ferne ein Licht, ein lauter werdendes Schnaufen und Stampfen, und weiße Rauchwolken stoben in die Luft. Im selben Moment lösten sich überall zwischen den Gleisen geduckte Schatten aus der Dunkelheit, Kohlendiebe wie Tommy. Doch ihre Hoffnung währte nicht lange. Nein, das war nicht die Schnurre aus Lüdenscheid, das war nur ein gewöhnlicher Personenzug. Mit kreischenden Bremsen kam er auf Gleis zwei zu stehen.
Kaum eine Handvoll Menschen verließ die Waggons und verschwand in der Unterführung, die die Gleise mit dem Bahnhofsgebäude verband. Ein Fahrgast jedoch blieb im Schein der einsamen Funzel zurück, die den Bahnsteig so spärlich erhellte, dass sie die Dunkelheit noch zu vermehren schien. Allein und verloren stand er da und blickte sich um, als müsse er sich erst orientieren, bevor er seinen Weg fortsetzte: ein Mann, der aussah wie der Tod selbst. Wahrscheinlich ein Kriegsheimkehrer, der Kleidung nach aus Russland – er trug eine von diesen wattierten Jacken, die viel besser wärmten als jeder Wehrmachtsmantel und deshalb auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen kosteten, und dazu eine Mütze aus Fell.
Aber was bei allen Heiligen war mit dem rechten Arm des Kerls los? Der war ja völlig außer Rand und Band …
Tommy trat näher, um besser zu sehen. Doch er hatte noch keine zwei Schritt getan, da ertönte plötzlich ein scharfer, gellender Pfiff, und schwankende Laternen näherten sich.
Verflucht – Bahnpolizei!
2
Obwohl das Hausmädchen Betty bereits zweimal zum Abendessen gerufen hatte, ging Ulla noch rasch zur Tür, um nach der Post zu schauen. Als sie die Treppe heruntergekommen war, hatte sie gehört, wie Briefträger Lass die Abendpost eingeworfen hatte. Zwei Briefe lagen im Kasten. Einer war an ihren Vater adressiert, »Eduard Wolf – Fabrikant«, und mit dem Stempel der Kommandantur versehen. Der zweite trug ihren Namen in der Anschrift. Doch als sie das Kuvert umdrehte, stand auf der Rückseite kein Absender.
Nanu? Was hatte das denn zu bedeuten? Etwa ein heimlicher Verehrer?
»Wo bleibst du denn, Ulla?«, mahnte Betty, die gerade den Tee aus der Küche ins Esszimmer brachte. »Dein Vater hat schon das Gebet gesprochen.«
Als Ulla ihr folgte, saßen die anderen bereits vollständig versammelt am Tisch: am Kopf- und Fußende die Eltern Eduard und Christel Wolf – er, Anfang sechzig, mit bereits schlohweißem Haupt, sie, Mitte fünfzig, mit grau melierten Locken; links zwischen ihnen die jüngere Schwester Gundel, die ihr glattes braunes Haar zu Affenschaukeln aufgebunden hatte; und dieser gegenüber die ältere Ruth, die einzige Wolf-Tochter, die von der Mutter die dunklen Locken geerbt hatte und gerade ihrem Sohn Winfried, einem dreijährigen Jungen mit pechschwarzem, wie mit einem Lineal gescheiteltem Haar, ein Lätzchen umband.
»Da bist du ja endlich.«
Mit vorwurfsvoller Miene strich der Vater über sein sorgfältig gestutztes Menjou-Bärtchen und setzte zu einem Tadel an. Doch bevor er dazu kam, reichte sie ihm den Brief.
»Post für dich, Papa. Von der Kommandantur.«
»Das ist kein Grund, zu spät am Tisch zu erscheinen«, sagte er und öffnete den Umschlag. »Na, dann wollen wir mal sehen.«
Während Ulla an Gundels Seite ihren Platz einnahm, ließ sie den zweiten Brief im Ärmel ihres Pullovers verschwinden. Im Haus war es so kalt, dass man sogar beim Essen warme Wollsachen und Schals tragen musste. Das hätte die Mutter früher niemals erlaubt, man war schließlich nicht bei den Hottentotten, und inmitten der auf Hochglanz polierten Mahagonimöbel mit der schweren Anrichte und dem von Kristall nur so funkelnden Vitrinenschrank nahm sich der Anblick der vermummten Eltern und Geschwister so grotesk aus, dass Ulla laut hätte lachen müssen, wäre das Angebot auf dem Tisch nicht so deprimierend gewesen. Fröstelnd ließ sie den Blick über das Bild des Jammers gleiten. Statt Butter, Wurst und Käse gab es als Brotbelag auch an diesem Abend nur Margarine und Rübenkraut und dazu diesen wässrigen Hagebuttentee, den sie in normalen Zeiten nicht angerührt hätte. Aber was war in diesen Zeiten noch normal? Als wäre man bei armen Leuten, durfte auf Anweisung des Vaters in der Villa Wolf höchstens sechs Stunden am Tag geheizt werden, und eingekauft wurde nach Maßgabe der zugeteilten Lebensmittelmarken in den dafür vorgesehenen, regulären Ladengeschäften – aus Solidarität mit den vielen Menschen, die nicht genügend Geld besaßen, um sich mit ausreichend Brennstoff und besseren Lebensmitteln auf dem Schwarzmarkt zu versorgen. »Gemeinwohl vor Eigennutz!«, so lautete das unerschütterliche Prinzip. Ulla fand solche Prinzipienreiterei albern. Der Vater war immer noch ein wohlhabender Mann – was hatten die Armen davon, wenn die Familie Wolf darbte und fror wie sie? Doch immerhin gab es auf dem Tisch einen Adventskranz, auf dem sogar die erste Kerze brannte, um ihren anheimelnden Schein zu verbreiten. Darauf hatte die Mutter bestanden.
»Um Gottes willen!«, sagte plötzlich der Vater. Bleich vor Entsetzten, starrte er auf den Brief in seiner Hand. »Die Engländer wollen unsere Maschinen demontieren!« Wie stets, wenn er erregt war, fuhr seine Hand zu der Stelle am Hals, wo seine Fliege saß. Doch der Binder war hinter dem dicken Schal versteckt, so dass die Geste ins Leere ging.
Die Mutter rückte mit der Hand an ihrer Frisur. »Und was bedeutet das?«
»Fragst du das im Ernst, meine Liebe?« Der Vater ließ den Brief sinken. »Ohne Maschinen können wir nicht produzieren. Wovon sollen wir dann leben? Wir und all unsere braven Arbeiter mit ihren Familien?«
Die Mutter nahm einen Schluck von ihrem Hagebuttentee. »Jetzt male mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Das wird nur wieder eine von diesen Maßnahmen sein.«
»Was für Maßnahmen?«, fragte Gundel mit ihren unschuldigen braunen Rehaugen.
»Um uns für das zu bestrafen, was wir angerichtet haben«, antwortete Ulla.
»Fängst du schon wieder an?« Die Stimme des Vaters bebte vor unterdrückter Erregung. »Ich habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Also verbitte ich mir jegliche Andeutungen dieser Art, oder ich sehe mich gezwungen …«
»Ganz unrecht hat Ulla nicht«, unterbrach ihn die Mutter. »Immerhin haben wir diese Schreihälse gewähren lassen.«
»Aber darum kann man uns doch nicht unserer Existenzgrundlage berauben! Die Firma ist unser Leben. Das war so, das ist so, und das wird …«
»… immer so bleiben«, ergänzte seine Frau und bedachte ihn mit einem Lächeln, das Aufmunterung und Mahnung zugleich war. »Dafür sorgt schon mein Ficus. Solange der wächst und gedeiht, kann uns nichts und niemand etwas anhaben.«
Der Vater schüttelte unwillig den Kopf. »Bei aller Liebe, Christel, dein Gummibaum interessiert die Engländer nicht die Bohne!«
So ungewohnt heftig er gesprochen hatte – die Mutter ließ sich nicht beirren. »Schau nur, wie schön die Kerze brennt.« Mit dem Kinn deutete sie auf den Adventskranz. »Also tu mir die Liebe und gib die Hoffnung nicht auf. Die Menschen werden sich schon wieder vertragen, sie müssen sich doch vertragen, anders geht es ja gar nicht …«
Ulla hörte nur noch mit halbem Ohr zu. Ihr Brief war ein Stück weit aus dem Ärmel ihres Pullovers gerutscht und schaute unter dem Bündchen hervor. Eilig schob sie ihn wieder zurück, bevor jemand ihn sah.
»Warum gehen wir nicht endlich in den Salon, um zu musizieren?«, fragte Gundel, die keinen Streit länger als eine Minute ertragen konnte. »Heute ist doch Freitag!«
»Du hast recht«, sagte der Vater. »Musik ist Labsal für die Seele und reinigt die Gedanken.«
Er war schon im Begriff, die Tafel aufzuheben, um in den Salon hinüberzuwechseln, wo wie jeden Freitagabend die Instrumente für die Hausmusik bereitlagen, da klingelte es an der Haustür.
Verwundert schaute man sich an. Wer mochte das sein?
Im selben Moment kam Betty mit einem Mann herein, bei dessen Anblick Ulla zusammenzuckte. Ein Gesicht wie ein Totenkopf, darin zwei pechschwarze Augen, die aus tiefen Höhlen wie zwei Eierkohlen zu glühen schienen. Den anderen am Tisch erging es offenbar ähnlich. Alle starrten den Mann an wie ein Gespenst.
Während der kleine Winfried vor lauter Angst auf seinem Stuhl in sich zusammenschrumpfte, ließ Ruth plötzlich ihr Besteck fallen.
»Fritz – bist du das?«
Wortlos nickte der Fremde.
Ruth sprang von ihrem Platz auf, und während sie Anstalten machte, ihn zu umarmen, holten die Eltern tief Luft. Ulla wusste, warum, und konnte es ihnen nicht verdenken.
»Sieh nur, Winnie«, sagte Gundel. »Das ist dein Papa.«
Während Ruth den unheimlichen Ankömmling tatsächlich umarmte, hatte der kleine Winfried nur Augen für die rechte Hand des Mannes, der sein Vater sein sollte. Diese steckte in einem zerschlissenen Fäustling und bewegte sich auf dem Rücken seiner Mutter so rasend schnell hin und her, als wäre ein Dämon in sie gefahren.
3
Zurück in seinem Eisenbahnwaggon zog Tommy das Kabel, mit dem er die Oberleitung der Bahn angezapft hatte, durch die eigens zu diesem Zweck in die Wand eingelassene Klappe und verband das Ende mit dem Hauptverteiler, der alle elektrischen Geräte in seinem Zuhause mit Strom versorgte. Dann knipste er das Licht an und stellte das Radio ein.
Aus dem Lautsprecher ertönte die Stimme von Hans Albers.
Wir ziehen auf endlosen Straßen
Durch Tage und Nächte dahin,
Von Gott und den Menschen verlassen,
Ganz ohne Ziel und Sinn …
Tommy wusste, in einer halben Stunde würde Barbara da sein – und nichts war vorbereitet. Aber hieß sie wirklich Barbara? Oder nicht vielleicht Bärbel? Ach nein, Bärbel war vor ein paar Wochen gewesen … Doch ganz gleich, wie sie hieß, bei der Kälte würde sie kaum Lust verspüren, sich auszuziehen – am Fenster blühten die Eisblumen, dass es eine Pracht war. Er verfluchte seine eigene Nachlässigkeit, er hätte zur Sicherheit ein bisschen Holz organisieren sollen, statt sich auf die Kohlen aus Lüdenscheid zu verlassen.
Wir wandern auf endlosen Wegen,
Getrieben, verfolgt vom Geschick,
Einer trostlosen Zukunft entgegen.
Wann finden wir wieder zurück? …
Er ging in das angrenzende Waggonabteil, wo die Waren lagerten, mit denen er auf dem Schwarzmarkt handelte. In den Regalen stapelten sich Hemden und Pullover, Herrenanzüge und Brautkleider, Wintermäntel und Sommerjacken, gefütterte Lederfliegerhauben und Pelzkragen und dazu paarweise alle möglichen Schuhe, für Damen, Herren und Kinder, aber auch Musikinstrumente und Nähmaschinen, Volksempfänger und Weckuhren, Ofenrohre und Radiatoren. Suchend schaute er sich um. War etwas Brennbares dabei? In Frage kamen nur die Bücher, die er in der hintersten Ecke gehortet hatte, von »Mein Kampf« hatte er gleich ein paar Dutzend Exemplare, außerdem »Das Kapital« von Karl Marx in vier Bänden, die er buchstäblich für einen Apfel und ein Ei eingetauscht hatte in der Hoffnung auf den Bildungshunger der Altenaer beziehungsweise ihre Lust auf politische Veränderung. Diese Spekulation hatte sich jedoch als Irrtum erwiesen. Kein einziger Kunde hatte sich für den Schmöker interessiert.
Er nahm einen Stoß Bücher, trug sie in sein Wohn- und Schlafabteil und stopfte sie in den Ofen, die vier Bände von Marx’ »Kapital« zusammen mit einem Stapel »Mein Kampf«.
Nur ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot
Und Arbeit für unsere Hände,
Dann kämpfen wir gern gegen Unglück und Not
Und zwingen das Schicksal zur Wende …
Auf seinem Universaltisch, der ihm sowohl als Büro- wie auch als Küchen-, Wohnzimmer- und Esstisch diente, lag ein dickes Bündel Geld – ein paar tausend Reichsmark in alten Scheinen. Er griff eine Handvoll und steckte sie mit einem Streichholz an, die Scheine waren ja praktisch nichts mehr wert, taugten aber immerhin als Fidibus, um die Bücher im Ofen anzuzünden.
Als das Feuer zu prasseln begann, trat er ans Fenster und wischte mit dem Mantelärmel auf der zugefrorenen Scheibe ein Guckloch frei, um nach seinem Besuch Ausschau zu halten. Doch in der Dunkelheit sah er nur ein paar letzte Kohlediebe, die, nachdem die Bahnpolizei sich verzogen hatte, aus ihren Verstecken zurückgekehrt waren und immer noch auf die Schnurre aus Lüdenscheid warteten.
Die Welt soll wieder schön
In Freiheit und Frieden ersteh’n.
Wir lassen die Hoffnung nicht sinken
Wir glauben trotz Tränen und Leid,
Dass bessere Tage uns winken
In einer neuen Zeit …
Während Hans Albers mit dem letzten Rest von Hoffnung, der nicht in den Trümmern des großdeutschen Reichs untergegangen war, sein Lied zu Ende sang, traf Tommy die letzten Vorbereitungen für seinen Besuch. Und genau im richtigen Moment – als er gerade die Flasche Rotwein entkorkte, die er, eingewickelt in ein Lammfell, damit sie in der Kälte nicht platzte, für diesen Abend reserviert hatte – klopfte es an der Fensterscheibe seines Waggons.
4
Die unverhoffte Rückkehr von Ruths Mann – Fritz Nippert mit Namen – aus russischer Kriegsgefangenschaft hatte die Ordnung in der Villa Wolf so sehr durcheinandergebracht, dass an diesem Freitagabend die Hausmusik, sonst ein unverrückbarer Fixpunkt im Wochenkalender der Familie, entfiel. Ruth war zusammen mit Fritz und dem gemeinsamen Sohn in ihrem Zimmer verschwunden, und als die Mutter nur wenig später mit einem unterdrückten Gähnen ihre Müdigkeit angedeutet hatte, war dies für alle das Signal gewesen, sich zur Nacht zurückziehen zu dürfen. Von der Erlaubnis hatte jeder nur zu gern Gebrauch gemacht. Ruths Ehe mit Fritz Nippert war ein Thema, das man nach Möglichkeit umging.
Auf dem Weg in ihr Zimmer versuchte Ulla, sich in ihre Schwester hineinzuversetzen. Wie musste das für Ruth wohl sein, ihren Mann in diesem fürchterlichen Zustand wiederzusehen? So plötzlich wie ein Gespenst war er aufgetaucht, buchstäblich aus dem Nichts, nachdem sie gerade erst der Aufforderung der Stadtverwaltung an alle Angehörigen der noch in Kriegsgefangenschaft befindlichen Männer gefolgt war, deren Anschrift mitzuteilen, damit sie zu Weihnachten einen Gruß aus der Heimat bekamen …
Doch dieser Gedanke beschäftigte Ulla nur eine Minute. Kaum hatte sie die Tür ihres Zimmers hinter sich geschlossen, zog sie den Brief aus dem Ärmel ihres Pullovers hervor und riss mit dem Daumennagel das Kuvert auf, um ihn zu lesen.
Sehr geehrtes Fräulein Wolf,
wie Sie vielleicht der örtlichen Presse entnommen haben, findet am kommenden Sonntag, dem zweiten Advent, in der Aula des Jungengymnasiums ein Arienabend statt. Zum Vortrag kommt Schuberts Winterreise, dargeboten von Roderich Schmitz, lyrischer Tenor des Wuppertaler Stadttheaters, am Klavier begleitet von Hugo Gillesen, Co-Repetitor desselben Hauses. Es ist mir gelungen, zwei der überaus begehrten Karten für dieses herausragende Kulturereignis in unserer Stadt zu erwerben, und es würde mich über alle Maßen freuen, wenn Sie mir die Ehre Ihrer Begleitung an diesem besonderen Abend erweisen würden.
Hochachtungsvoll!
Ihr sehr ergebener Jürgen Rühling,
stud. rer. pharm.
Ulla wusste nicht, ob sie lachen oder sich ärgern sollte. Was bildete der Kerl sich ein? Jürgen Rühling war der Sohn von Dr. Rühling, dem Inhaber der Alten Apotheke, ein aufgeblasener Lackaffe, der ihr seit einiger Zeit den Hof machte, leider zur Freude der Eltern, er galt als gute Partie, an dem sie selbst jedoch nicht das geringste Interesse hatte.
Stud. rer. pharm. …
Kopfschüttelnd überflog sie ein zweites Mal die Zeilen. »Der Stil ist der Mensch« – von wem stammte der Spruch noch mal? Ulla hatte es vergessen. Auf jeden Fall traf er hier hundertprozentig zu. Jürgen Rühlings Ausdrucksweise war genauso albern wie er selbst.
Sie wollte den Brief schon beiseitelegen, da entdeckte sie am unteren Rand noch eine klein gedruckte Abkürzung: U.A.w.g. Wieder so eine Affigkeit: Um Antwort wird gebeten … Konnte man das nicht auch etwas weniger überkandidelt sagen?
»Na, deine Antwort sollst du kriegen!«
Sie zerknüllte den Brief und warf ihn in den Papierkorb. Sie nahm bereits den Schal ab, um sich für die Nacht auszuziehen, doch plötzlich zögerte sie. Und was, wenn jemand Jürgen Rühlings Einladung im Papierkorb fand? Dann würden die Eltern vielleicht noch auf dumme Gedanken kommen … Also holte sie den Brief noch einmal aus dem Papierkorb hervor und zerriss ihn in so kleine Stücke, dass niemand ihn je wieder zusammenfügen konnte.
Sicher war sicher!
5
Mit vereinten Kräften war es Adolf Hitler und Karl Marx gelungen, den Eisenbahnwaggon einigermaßen ausreichend für eine Liebesnacht zu heizen. Während »Mein Kampf« und »Das Kapital« in den Flammen untergegangen waren, waren die Eisblumen an den Fenstern nach und nach abgetaut, so dass Tommy jetzt, obwohl splitternackt, kaum noch fror, als er sich aus dem Bett beugte, um in seiner am Boden liegenden Hose nach Zigaretten und Streichhölzern zu tasten.
»Johnny Player?«, fragte Barbara, eine üppige Blondine Anfang dreißig, die ebenso nackt wie er neben ihm im Bett lag, sichtlich beeindruckt. »Woher hast du die denn?«
Betont gleichgültig zuckte er die Achseln. »Beziehungen …«
»Zu den Tommys?«
»Was meinst du wohl, woher ich meinen Spitznamen habe?« Er klopfte eine Zigarette aus der Packung und ließ sie von seinem Handrücken direkt zwischen die Lippen springen, indem er sich mit der Rechten auf den linken Unterarm schlug.
Das oftmals erprobte kleine Kunststück verfehlte auch diesmal nicht seine Wirkung. Voller Bewunderung schaute Barbara ihn an.
»Dein anderer Name gefällt mir übrigens noch besser«, sagte sie.
»Du meinst – Thomas?«
»Nein, Prince Charming.«
»Wer nennt mich denn so?«, fragte Tommy mit gespielter Ahnungslosigkeit.
»Tu nicht so scheinheilig«, erwiderte sie. »Ganz Altena – zumindest die weibliche Hälfte. Und ich gebe zu«, fuhr sie mit einem Lächeln fort, »ich war neugierig, ob du den Namen verdienst.«
Tommy blies den Rauch seiner Zigarette aus. »Und – zu welchem Ergebnis bist du gekommen?«
Sie fuhr mit der Hand unter die Bettdecke und strich mit den Fingerspitzen an seinem Körper entlang, erst über die Brust, dann über den Bauch, immer weiter in Richtung Süden –, bis sie schließlich an der Stelle landete, wo er es am allerliebsten hatte.
»Mein Kompliment. Du hast deinem Namen alle Ehre gemacht.«
Sich wohlig rekelnd genoss er ihre Worte, und noch mehr die neuerliche Berührung, und er wünschte sich nichts sehnlicher, als dass sie noch ein bisschen weitermachte. Aber als er ihr aufmunternd zunickte, sah er ihren Blick.
Im selben Moment verging ihm jegliche Lust. Er kannte diesen Blick. Immer wenn Frauen ihn »danach« so anschauten, kam eine Frage, die er fürchtete wie der Teufel das Weihwasser.
Barbara schien seine Gedanken zu erraten. »Keine Angst«, lachte sie. »Ich suche nichts Festes.«
Verwundert richtete er sich auf den Ellbogen auf. »Ach so?«
»Ja, du hast richtig gehört, mein Schatz.« Sie zog ihre Hand unter der Bettdecke fort und küsste ihn auf die Nasenspitze. »Ich bin nämlich verheiratet.«
»Verstehe. Dein Mann ist in Gefangenschaft.«
Ihre Miene wurde wieder ernst. »Ja«, sagte sie. »In Frankreich. Und im Gegensatz zu dir liebe ich ihn und kann es kaum noch erwarten, dass er endlich zurückkommt und ich ihn wieder in meine Arme schließen darf.«
Ihre Antwort verwirrte ihn noch mehr. »Aber … aber warum bist du dann hier?«
Sie nahm ihm seine Zigarette ab und steckte sie sich zwischen die Lippen, um selbst einen tiefen Zug zu nehmen.
»Ich wollte nur ein bisschen Vergnügen, genauso wie du. Um nicht immer traurig sein zu müssen. Und in Altena gibt’s ja nichts, um sich zu amüsieren, nur Arienabende.«
Während sie den Rauch in kleinen, blauen Ringen ausstieß, wusste Tommy nicht, ob er erleichtert oder beleidigt sein sollte. Doch er war noch zu keinem Schluss gekommen, da warf sie die Zigarettenkippe in die leere Weinflasche, in der sie mit einem leisen Zischen verglühte, und nackt, wie sie war, stand sie auf.
»Hast du was zu schreiben?«
»Ja, auf dem Tisch. Warum?«
Sie nahm einen Zettel und kritzelte darauf ein paar Zeilen.
»Meine Adresse. Für den Fall, dass du mal traurig bist.«
Sie klemmte den Zettel an den Spiegel neben der Waggontür, dann drehte sie sich zum Radio herum und schaltete den Apparat ein. Offenbar hatte sie einen amerikanischen oder englischen Soldatensender erwischt, denn als die Röhre des Volksempfängers aufglühte, kündigte ein Sprecher Frankie Carle und sein Orchester an.
Rumors are flying
That you’ve got me sighing
That I’m in a crazy kind of a daze
A lazy sort of a haze
When I go walking
I hear people talking
They say our affair is not just a passing phase …
Leise summte Barbara die Melodie mit und wiegte sich im Rhythmus des Slowfox. Tommy wusste nicht, ob sie den englischen Text überhaupt verstand, doch falls ja, hoffte er nur, dass sie dabei tatsächlich an ihren Mann und nicht an ihn dachte.
»Wie gern würde ich mal nach solcher Musik tanzen«, sagte sie. »Aber dafür müsste man schon nach Lüdenscheid oder Hagen fahren. Und wer kann sich das leisten?«
Ihr harmloser Wunsch rührte Tommy so sehr, dass er aus dem Bett sprang, um sie mit einer Verbeugung aufzufordern.
»Darf ich bitten?«
Barbara musterte ihn einmal von oben bis unten und lachte.
»Du willst so mit mir tanzen? Nackt?«
»Warum nicht? Du wolltest dich doch amüsieren! Und was die in Hagen oder Lüdenscheid können, können wir in Altena schon lange.« Ohne auf ihre Erlaubnis zu warten, nahm er ihre Hand und umfasste mit der Rechten ihre Taille. »Ich glaube, du hast mich gerade auf eine fabelhafte Idee gebracht.«
6
Als Christel mit ihren zwei Wärmflaschen das Bad verließ, hörte sie aus Ruths Zimmer Stimmen. Unwillkürlich blieb sie stehen. Doch die Versuchung, an der Tür zu lauschen, dauerte nur einen Moment. Nein, so etwas gehörte sich nicht! Also löschte sie das Licht im Treppenhaus und ging ins Schlafzimmer.
Eduard lag schon im Bett, begraben unter einem Berg von Decken und Kissen und Plumeaus, aus dem gerade noch sein Gesicht hervorlugte. Da die Kälte in dem ungeheizten Raum ihm oft solche Kopfschmerzen bereitete, dass sie ihn den ganzen nächsten Tag über plagten, hatte er sich angewöhnt, zur Nacht eine Schlafmütze zu tragen.
»Ich kann nur hoffen, dass die Engländer nicht wirklich ernst machen«, sagte er.
»Du meinst – mit der Demontage?«
Er nickte. »Ulla hat gerade eine so großartige Idee, was wir mit den Wehrmachtshelmen machen könnten, die wir noch auf Lager haben. Nudelsiebe!«, antwortete er, bevor Christel danach fragte. »Wir brauchen nur ein paar Löcher in die Helme zu stanzen, und schon sind sie fertig! Das zeigt, wie praktisch das Mädchen denkt! Ich habe ja schon immer gesagt, Ulla gehört in die Firma und nicht an die Universität. Hoffentlich können wir ihr die Flausen nur austreiben!«
Christel schaute ihn kopfschüttelnd an. »Haben wir nicht gerade andere Sorgen?«
Unwillig erwiderte er ihren Blick. »Andere Sorgen als die Firma?«
Sie streifte ihre Pantoffeln ab und legte sich zu ihm ins Bett. Wie jeden Abend, wenn sie das tat, lüftete er die Zudecke für sie, und wie jeden Abend reichte sie ihm seine Wärmflasche.
»Du weißt genau, was ich meine.«
Statt einer Antwort stöhnte er nur einmal leise auf. Dann knipste er das Nachttischlämpchen aus, und während nur noch der durchs Fenster fallende Mondschein das Zimmer erleuchtete, hörte sie eine lange Weile nichts als seinen schweren, gequälten Atem.
»Es sind die Falschen, die überlebt haben«, sagte er irgendwann in die Stille hinein.
Christel musste schlucken. Aus einer gerahmten, mit Trauerflor versehenen Fotografie an der Wand blickte ihr Sohn auf sie herab: Richard, die Offiziersmütze schräg auf dem Kopf, im Gesicht sein übermütiges Was-kostet-die-Welt-Lächeln. Das Bild zeigte ihn in seiner Panzergrenadieruniform und war am Tag seiner Beförderung zum Leutnant aufgenommen worden. Er hatte unter Feldmarschall Rommel in Afrika gekämpft und war in der Schlacht um El Alamein gefallen, im Juli 1942 – »gestorben für Führer, Volk und Vaterland«, wie es in der Todesnachricht geheißen hatte. Als das Schreiben eingetroffen war, hatte Eduard tagelang kein Wort gesprochen. Richard war die Zukunft der Firma gewesen, er hatte ihm mehr bedeutet als sein eigenes Leben.
Im Flur wurden Schritte laut, dann ein unterdrücktes Husten, und wenig später rauschte im Bad die Toilettenspülung.
»Stattdessen haben wir jetzt einen Nazi unter unserem Dach«, sagte Eduard.
Christel suchte unter der Bettdecke seine Hand, doch ohne sie zu finden. »Hauptsache, Winfried hat einen Vater. Und Ruth einen Mann.«
»Ich habe immer gesagt, dieser Mensch kommt mir nicht ins Haus. Niemals! Das wäre Verrat an allem, was mir heilig ist. Und was ich immer versucht habe hochzuhalten, auch damals, als es einen den Kopf kosten konnte.«
Endlich fand Christel seine Hand und drückte sie. »Denk an Weihnachten, mein Lieber. Immerhin sitzen wir als Familie wieder vollständig unterm Baum.« Erneut spürte sie den Blick ihres Sohnes auf sich, und während ihr die Tränen kamen, fügte sie hinzu: »Soweit es eben geht.«
7
Mit großen, angsterfüllten Augen starrte der kleine Winfried seinen Vater an. »Was will der Mann, Mama? Sag ihm, er soll wieder gehen.«
Obwohl Ruth genauso verstört war wie er, versuchte sie, sich nichts anmerken zu lassen. »Aber das ist doch der Vati«, sagte sie und streichelte ihm über den Kopf.
»Ich will aber keinen Vati!«
»Was redest du denn da, mein kleiner Liebling? Wir haben doch jeden Abend gebetet, dass der liebe Gott auf den Vati aufpassen und ihn zu uns schicken soll. Und jetzt hat der liebe Gott unsere Gebete erhört, und der Vati ist endlich da.«
»Aber ich will nicht, dass er da ist!«
Ruth wusste nicht, was sie tun sollte. Fritz hatte versucht, Winfried auf den Arm zu nehmen. Doch der war vor lauter Angst vor ihm davongelaufen und hatte sich hinter seinem Bettchen versteckt, und sie hatte es nur mit Mühe geschafft, ihn dort wieder hervorzuholen.
Fritz lachte bitter auf. »Jetzt wäre es dir wohl lieber, ich wäre nicht wieder aufgetaucht. Stimmt’s?«
»Um Gottes willen – wie kannst du nur so etwas sagen? Ich … wir … ich liebe dich doch!«
Ruth ließ Winfried los, um ihren Mann zu umarmen. Aber Fritz schaute sie so abweisend an, dass sie die Arme wieder sinken ließ.
»Lass das Theater«, sagte er. »Ich weiß, wie ich aussehe. Sogar in Sibirien gab’s Spiegel.«
Sie schaffte es kaum, seinen Blick zu erwidern. Mein Gott, wie hatten sie ihn nur zugerichtet … Es war keine vier Jahre her, dass sie sich in Fritz verliebt hatte, Hals über Kopf, irgendwo im belgischen Niemandsland, wohin sie von zu Hause durchgebrannt war, um als Krankenschwester deutsche Frontsoldaten zu pflegen. Er hatte sie mit seinem Motorrad aufgegabelt, als ihr Zug auf freiem Feld angehalten hatte und sie nicht wusste, wie sie zu ihrem Lazarett gelangen sollte. Fritz Nippert war der Mann gewesen, von dem sie immer geträumt hatte: kühn, willensstark, verwegen. Schon in der ersten Nacht war sie zu seiner Frau geworden, und als sie schwanger geworden war, hatte sie keine Sekunde gezögert, ihn zu heiraten. Nie zuvor und niemals später war sie in ihrem Leben so glücklich gewesen wie in dem Augenblick, als sie ihm in einer kleinen, schmucklosen Dorfkirche ihr Jawort gegeben hatte, zwei Tage bevor er an die Ostfront versetzt worden war.
Doch jetzt?
Jetzt war Fritz ein Spottbild seiner selbst, ein bis auf die Knochen abgemagertes Menschenwrack, ein Greis von kaum dreißig Jahren, mit einem Totenschädel zwischen den Schultern, wo früher einmal sein Kopf mit dem so hübschen Gesicht gewesen war, und einer sich rastlos hin und her bewegenden Schüttelhand, die keine Sekunde Ruhe gab. Sein einst kräftiges, schwarzes Haar, das sie so sehr geliebt hatte, war vollkommen ausgefallen, und seine Glatze mit Pusteln übersät.
Plötzlich musste sie an das Entsetzen ihrer Eltern denken, als sie mit einem Kind im Bauch, doch ohne Mann nach Altena zurückgekommen war. »Ein Rottenführer aus der Uckermark?«, hatte der Vater gefragt. »Wie konntest du uns das nur antun!«
Der kleine Winfried zupfte an ihrem Ärmel. »Bitte, Mama! Mach, dass der Mann weggeht!«
Fritz tat einen Schritt auf ihn zu und ging in die Hocke. »Hast du nicht gehört, was die Mutti gesagt hat?«, fragte er leise. »Ich bin dein Vati!«
Mit schräg geneigtem Kopf streckte er die Hand nach seinem Sohn aus. Ruth sah, wie für einen Moment etwas Weiches, Sanftes, Zärtliches in seinen Augen aufschimmerte. Doch wieder wich Winfried vor ihm zurück, und weinend versteckte er sich hinter Ruths Rock
Fritz’ Miene verhärtete sich. Abrupt wandte er sich ab und trat ans Fenster, um in die Nacht hinauszuschauen.
»Du darfst ihm nicht böse sein«, sagte Ruth, während Winfried mit seinen beiden kleinen Händchen ihre Rechte so fest umklammerte, als wolle er sie nie wieder loslassen. »Er ist doch noch ein Kind.«
Eine lange Weile stand Fritz mit dem Rücken zu ihr da, ohne eine Antwort zu geben.
»Ja, das ist er«, sagte er schließlich mit einem Räuspern und nickte. »Ein Kind. Ein Kind dieser Familie.«
Er hatte die Worte in einem so feindseligen Ton gesagt, dass Ruth fröstelte.
»Was … was willst du damit sagen?«
»Ist das so schwer zu erraten?« Mit einem Ruck fuhr er zu ihr herum, und seine schwarzen Augen funkelten böse. »Wie ein Ungeheuer haben sie mich angestarrt, deine feinen Eltern und Schwestern, als stünde der Leibhaftige vor ihnen. Dabei ist es noch nicht lange her, da … da haben solche Leute vor uns gezittert und gekuscht – in die Hosen haben sie sich geschissen, die Herrschaften, wenn jemand wie ich sie nur scharf angeschaut hat. Aber jetzt … jetzt verachten sie mich und uns alle und bilden sich ein, sie könnten auf unsereins herabschauen und auf uns spucken, obwohl wir es doch waren, die ihnen den Arsch gerettet haben, wir ganz allein, weil wir als Einzige den Mut hatten, den Mut und die fanatische Entschlossenheit …«
In unterdrückter, kaum noch beherrschbarer Wut schleuderte er die Worte aus sich heraus: all die Verletzungen und Enttäuschungen und Demütigungen, die er im Krieg und in dem sibirischen Bergwerk, wo er so lange gefangen gehalten worden war, erfahren hatte. Doch so plötzlich und unvermittelt, wie es aus ihm hervorgebrochen war, verstummte er.
»Ich hab Angst, Mutti!«, wimmerte Winfried.
»Pssst«, machte Ruth. Sie bückte sich und nahm ihn auf den Arm. »Ist ja schon gut, mein Liebling. Ist ja schon gut, ist ja schon gut …«
Ein ums andere Mal wiederholte sie die Worte. Dabei strich sie ihm über den Kopf, über den Nacken, über den Rücken, küsste seine vor Aufregung glühende Stirn und schmiegte ihre Wange an seine, die nass war von Tränen. Doch Winfried ließ sich nicht beruhigen, sein ganzer kleiner Körper zitterte, als bestünde er nur noch aus Angst – Angst vor diesem fremden, unheimlichen Mann, für dessen Rückkehr er gestern Abend noch zum lieben Gott gebetet hatte.
Fritz machte den Mund auf, wie um etwas zu sagen. Doch kein Laut drang über seine Lippen, die so dünn und schmal waren wie zwei Striche. Nur ein Rucken seines Adamsapfels, dann ein letzter böser Blick, und er kehrte ihnen wieder den Rücken zu, um weiter durch das Fenster in die dunkle Nacht hinauszuschauen.
8
Es war Montag, die neue Woche begann, und auf dem Adventskranz, der wie jeden Morgen auf dem Esstisch stand, brannte seit einem Tag die zweite Kerze. Während Ulla und Gundel hungrig ihr Frühstück verzehrten und auch Christel zwei Marmeladenbrote aß, war Eduard so nervös, dass er, obwohl ihm der Magen nicht weniger knurrte, keinen Bissen herunterbekam, weshalb ihm sogar der Muckefuck aufstieß, den es anstelle von Bohnenkaffee gab, weil heute ja nur ein gewöhnlicher Wochentag war.
»Wo sind eigentlich Ruth und ihr Mann?«, fragte Christel. »Liegen die etwa noch in den Federn?«
»Nein«, sagte Betty. »Die haben schon vor einer Stunde gefrühstückt, zusammen mit Winfried.«
Christel schüttelte den Kopf. »Das ist keine Art. Ich fürchte, ich muss mit Ruth mal ein ernstes Wort sprechen.«
Im Gegensatz zu seiner Frau war Eduard heilfroh, dass die beiden nicht am Tisch saßen, so blieb ihm der Anblick seines Schwiegersohns erspart. Während des Wochenendes war man sich, so gut es ging, aus dem Weg gegangen. Zum Glück war die Villa groß genug, auch hatte der Kerl keinerlei Neigung gezeigt, zusammen mit den übrigen Familienmitgliedern den Gottesdienst zu besuchen, wie es sich für gesittete Menschen gehörte. Während der Mahlzeiten hatte man sich angeschwiegen, und die Stunden dazwischen hatte Fritz Nippert auf Ruths Zimmer verbracht, ohne dass jemand danach fragte, was er dort eigentlich trieb. Eduard wusste, das war auf Dauer kein Zustand, es bedurfte einer schnellstmöglichen Entscheidung, wie man die vermaledeite Situation handhaben sollte. Aber nicht an diesem Montagmorgen. Denn da ging es um die Existenz der Firma.
Ulla trank den letzten Schluck aus ihrer Tasse und stand auf.
»Komm, Gundel, wir müssen los!«
»Wo wollt ihr denn hin?«, fragte Christel, die ebenfalls ihr Frühstück inzwischen beendet hatte.
»Zur Flüchtlingshilfe. Gemeinwohl vor Eigennutz.«
»Sehr lobenswert, doch eins nach dem anderen.« Die Mutter setzte ihre Brille auf und holte die Lebensmittelkarten aus der Tischschublade. »Erst müsst ihr beim Einkaufen helfen.«
»Seit wann kann Betty das nicht mehr allein? Dafür braucht sie doch nicht uns!«
»Und ob sie euch dafür braucht! Ich habe gestern mit Frau Pastor Michel gesprochen. Wisst ihr, wie die das macht? Jeden Morgen, bevor die Geschäfte öffnen, schickt sie alle ihre fünf Kinder los, damit in jedem Laden ein Michelkind immer ganz vorn in der Schlange steht. So halten wir das ab jetzt auch. Betty kann ja nur in einem Laden auf einmal sein, wenn’s losgeht, und bei den anderen guckt sie dann in die Röhre, weil schon alles aus ist.« Mit einer Schere schnitt sie die Marken von der Karte. »Nein, keine Widerworte!«, entschied sie, als Ulla etwas einwenden wollte. »Du gehst zu Metzger Schmale, Gundel zu Bäcker Hohage und Betty zu Milch Hottmann.«
Widerwillig nahmen die Mädchen die Brot-, Fleisch- und Buttermarken. Während die Mutter Gundel noch einschärfte, sich ja kein Sägemehlbrot andrehen zu lassen, wie es Frau Dr. Göcke neulich passiert sei, erhob sich Eduard vom Tisch.
»Ich mache mich dann auch mal langsam auf den Weg.«
Christel blickte ihn verwundert an. »Glaubst du, Herr Böcker ist schon im Rathaus?«
»Nein. Ich will ihn lieber zu Hause aufsuchen. Die Sache erfordert Diskretion.«
Christel schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht verstehen, wie die Briten diesen Mann zum Bürgermeister machen konnten.«
»Aber das waren doch gar nicht die Briten, meine Liebe. Das waren noch die Amerikaner.«
»Von mir aus auch der Kaiser von China. Man hat den Bock zum Gärtner gemacht.«
»Allerdings«, pflichtete Ulla ihr bei. »Dass Walter Böcker Dreck am Stecken hat, weiß doch die ganze Stadt. Warum darf der eigentlich seine Maschinen behalten?«
Eduard hob die Arme. »Vor Gericht und auf hoher See sind wir allein in Gottes Hand.«
9
Normalerweise schlief Tommy morgens so lange, bis entweder die Bettgenossin, die mit ihm die Nacht verbracht hatte, ein Sonnenstrahl oder aber einfach nur die Lust auf den neuen Tag ihn weckte. Doch an diesem Morgen hatte er sich den Wecker gestellt. Major Jones, der britische Stadtkommandant, liebte nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch deutsche Bräuche, und Pünktlichkeit gehörte bekanntlich dazu. Also war es besser, ihn nicht zu enttäuschen. Vor allem, wenn man etwas von ihm wollte.
Die Amerikaner, die im April 45 Altena eingenommen hatten, hatten das Amtsgericht in der Gerichtsstraße für ihre Kommandantur requiriert, doch die Engländer, die im Juni desselben Jahres auf die Amerikaner gefolgt waren, hatten mehr Geschmack bewiesen und ihre Militärdienststelle in die Burg Holtzbrinck verlegt, eine elegante Stadtburg aus dem 17. Jahrhundert am Ufer der Lenne, zu Füßen der eigentlichen, bereits im Mittelalter erbauten »Burg Altena«, die sich auf dem Schlossberg erhob.
Hier hatte sich Tommy um Punkt acht Uhr an diesem Montagmorgen eingefunden. Das Anliegen, das ihn zu dieser unchristlichen Zeit aus den Federn getrieben hatte, befand sich in seiner Aktentasche, in Gestalt eines Stapels frisch gedruckter Plakate, die er in ganz Altena anschlagen wollte und wofür er die Genehmigung der Besatzer brauchte.
»Prince Charming!« Major Jones, ein waschechter Brite unbestimmten Alters mit schütterem, rötlich blondem Haar, strahlte in seiner frisch gebügelten Uniform übers ganze Gesicht, als Tommy im Gefolge eines Sergeants sein Büro betrat. »What is it you Germans say? Pünktlich wie die Maurerleute!« Zur Begrüßung nahm er die Pfeife, die auch zu dieser frühen Stunde schon zwischen seinen Lippen klemmte, aus dem Mund. »Just five minutes, please.«
Damit wandte er sich wieder dem jungen Lieutenant zu, der ihm gerade rapportierte. Tommy sprach inzwischen genug Englisch, um das meiste zu verstehen. Die Rede war von einer Liste Altenaer Fabriken, die für die Demontage in Frage kamen. Gerade ging es um die Firma Wolf, die den Worten des Lieutenants zufolge offenbar von besonderem Interesse für die Briten war, wohl wegen eines Patents auf rostfreien Stacheldraht.
An seiner Pfeife saugend, hörte Major Jones aufmerksam zu. Dann fragte er den Lieutenant, wer die Liste erstellt habe.
Als Tommy die Antwort hörte, pfiff er leise durch die Zähne.
Was für ein Arschloch …
In der Hoffnung, mehr darüber zu erfahren, wie Altenas Fabrikanten versuchten, sich gegenseitig das Wasser abzugraben, spitzte er die Ohren. Doch leider beendete der Lieutenant bereits seinen Rapport und salutierte.
Als er den Raum verließ, drehte Major Jones sich zu Tommy herum und deutete mit seiner Pfeife auf einen Stuhl.
»Please have a seat, my friend. Was kann ich für Sie tun?«
10
Das Privathaus von Bürgermeister Böcker befand sich in der Freiheit, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Betten-Prange und Lotti Mürmanns Kolonialwarenladen, eine in dieser kleinbürgerlichen Umgebung sich seltsam fremd ausnehmende herrschaftliche Villa, zu der, da am Hang in einem parkähnlichen, jetzt aber von Eis und Schnee bedeckten Garten gelegen, eine schier unendliche Abfolge von Treppen hinaufführte, so dass Eduard, als er den obersten Absatz erreichte, für einen Moment innehalten musste, um wieder zu Atem zu kommen. Die eiskalte Luft drang mit solcher Schärfe in seine Lungen, dass es schmerzte. Er rückte sich die Ohrenwärmer zurecht, dann ging er die letzten Meter des mit Viehsalz und Kies gestreuten Wegs zum Eingang des Hauses.
Er hatte diesen gerade erreicht, da öffnete sich von innen die Tür, und ein Mann kam ihm entgegen, den er nie und nimmer an diesem Ort erwartet hätte: sein Schwiegersohn Fritz Nippert.
»Was haben Sie denn hier zu suchen?«
Der andere schien ebenso überrascht wie er. Feindselig blickte er ihn aus seinen dunklen Augenhöhlen an, und statt Antwort zu geben, zog er sich nur mit seiner Schüttelhand die Russenmütze in die Stirn und ging grußlos an ihm vorbei.
Irritiert schaute Eduard ihm nach, bis er die Treppen hinuntergegangen war und die Freiheitstraße erreichte, dann wandte er sich zum Eingang und betätigte die Klingel.
Die Haushälterin ließ ihn ein, Fräulein Steuernagel, eine stadtbekannte Juffer mit Klumpfuß und Buckel, die Walter Böcker, um Gerüchten entgegenzuwirken, in Ablösung eines bildhübschen Dienstmädchens eingestellt hatte, nachdem seine Frau sich von ihm hatte scheiden lassen. Jetzt nahm sie Eduard Mantel, Ohrenwärmer und Schal ab und führte ihn ins Jagdzimmer, eine dunkle, muffige Höhle voller ausgestopfter Wildtiere und Geweihe, in dem es nach abgestandenem Zigarrenrauch, Alkohol sowie den Ausdünstungen von nassem Fell roch.
Der Hausherr war gerade damit beschäftigt, etwas an einer Wand aufzuhängen. Eduard konnte nicht erkennen, was es war – wahrscheinlich eine weitere Jagdtrophäe. Böcker stand mit dem Rücken zum Raum, so dass sein massiger Körper den Blick verstellte.
»Herr Wolf ist da und möchte Sie sprechen«, sagte Fräulein Steuernagel und humpelte davon.
Der Angesprochene ließ sich durch die Ankündigung von seiner Tätigkeit nicht ablenken. Eduard trat näher, um zu schauen, was es so Wichtiges gab, um dieses ungehörige Verhalten zu entschuldigen. Als er es sah, traute er seinen Augen nicht. Die Trophäe, die Walter Böcker gerade anbrachte, war weder ein Geweih noch ein ausgestopftes Tier, sondern ein Bilderrahmen, und darin prangte, ausgestellt auf den Namen des Hausherrn, ein »Persilschein«, die Unbedenklichkeitserklärung, mit dem die Militärregierung Walter Böcker nach Abschluss des Spruchkammerverfahrens von jeder Verwicklung in Naziverbrechen freisprach und ihm eine makellose politische Vergangenheit attestierte.
Endlich drehte Böcker sich um. Als er Eduards Verblüffung sah, feixte er vor Vergnügen, und sein blaurotes, pockennarbiges Bulldoggengesicht wurde noch eine Spur dunkler.
»Na, da staunen Sie – was?«, lachte er mit seinem dröhnenden Bass.
»In der Tat … Immerhin, wie soll ich sagen … ich meine, in der Stadt geht das Gerücht, man hätte Sie nach Nürnberg geladen.«
»Ach was, olle Kamellen! Nur eine kleine Spritztour ins schöne Frankenland, bei freier Kost und Logis! Professor Schmitt hat mich nach einer Woche da wieder rausgehauen, Sie wissen schon, der berühmte Rechtsverdreher aus Plettenberg. Das Schlitzohr hatte selbst ein Verfahren am Hals, war ja früher in Berlin eine Riesennummer, als Görings juristischer Berater, und kennt sich bestens aus. Jetzt ist es amtlich, ich bin ein lupenreiner Demokrat, und wenn Sie mich fragen – schon immer gewesen!« Wieder lachte er sein dröhnendes Lachen. »Doch was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs? Wenn Sie schon vor dem Aufstehen hier aufkreuzen, hat das ja wohl seinen Grund.«
»Allerdings«, bestätigte Eduard, der nicht wusste, wie er es am elegantesten anfangen könnte. Aber es fiel ihm nichts ein. Also gab er sich einen Ruck und erklärte rundheraus: »Die Firma Wolf hat es erwischt.«
Böckers Miene wurde schlagartig ernst.
»Demontage?«
Eduard nickte.
»Scheiße im Kanonenrohr! Damit ist nicht zu spaßen.«
»Deshalb bin ich hier, Herr Böcker. Weil, ich dachte, Sie, als Bürgermeister …«