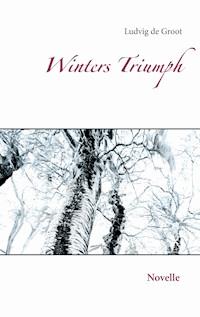
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein halbes Jahrhundert in Glücklosigkeit. Wie lange sich noch gedulden? Wie lange warten auf die Erfüllung? Hat es überhaupt einen Sinn, an diesem Punkt noch etwas vom Leben zu erwarten? Fragen, mit welchen sich der Universitätsprofessor Alexander Bolenius am Scheidepunkt seines Lebens konfrontiert sieht - und für deren Beantwortung er aus dem Trott seines Lebens ausbrechen muss. Eine Novelle über Glück und das Leben in dessen Abwesenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für jene, die wir zurücklassen
«Sie sehen also, meine Damen und Herren», adressiere ich meine Hörerschaft schlussfolgernd, «dass es in der Germanistischen Mediävistik problematisch ist, dem Autorenbegriff allzu viel Bedeutung beimessen zu wollen. Selbst in den seltenen Fällen, in welchen ein Schriftstück eindeutig mit einem Namen in Verbindung gebracht werden kann, lässt sich selten jemals abschliessend klären, ob dieser tatsächlich dem kreativen Kopf hinter dem Werk zuzuordnen ist oder bloss dem Schreiberling, welcher die ihm diktierten Worte festgehalten hat.» Geduldig warte ich, bis ich mir sicher sein kann, dass auch der letzte meiner Studenten seine Notizen vervollständigt hat. «Mit diesen Worten nun möchte ich die heutige Lesung schliessen», erkläre ich endlich. «Sollte jemand von Ihnen der Meinung sein, dass zur heute behandelten Materie weiterer Erklärungsbedarf besteht, ist diejenige Person gerne eingeladen, mir später in meinem Büro einen Besuch abzustatten. Ansonsten bleibt nichts anderes mehr zu tun, als Ihnen ein schönes Wochenende und erholsame Semesterferien zu wünschen. Ich hoffe, Sie alle im April wieder begrüssen zu dürfen.»
Einige der Studenten machen sich höflich die Mühe, meine Wünsche zu erwidern, wovon allerdings das Meiste im allgemeinen Getuschel ihrer in Aufbruchstimmung befindlicher Kollegen untergeht. Ich sehe darüber hinweg und beginne meinerseits meine Unterlagen wegzuräumen. Während ich mich der Ordnungspflege in meiner Aktentasche widme, leert sich der Saal schleichend bis ich schliesslich alleine im Raum bin.
Ich atme schwer aus. So also geht ein weiteres Semester an dieser Universität zu Ende, denke ich. Es ist dies das zwölfte, das ich hier gelehrt habe. Eine ausgesprochen unaufgeregte Zeit, wie ich retrospektiv festhalten muss. Manch einer mag sich nach einem ähnlich ruhigen Leben, wie ich es führe, sehnen, doch für mein Empfinden hat eben diese Ruhe nur allzu bald in regelrechte Langeweile umgeschlagen, die bisweilen gar mit tiefgründiger Trostlosigkeit aufzuwarten weiss. Dabei ist es freilich nicht so, dass mein Leben ausgesucht schlecht wäre, wie ich anmerken muss. Ich habe weder Schulden noch Gebrechen, keine Traumata oder Komplexe. Ich bin gesund, in jedem Sinne des Wortes. Publiziere regelmässig wissenschaftliche Abhandlungen, die in aller Regel durchweg lobendes Echo erhalten. Bloss… Eher häufig denn selten drängt sich mir die Frage auf, ob dies nun alles ist. Ob dies bereits alles sein kann. Oder ob mir meiner mehrfach gesicherten Existenzgrundlage zum Trotz doch etwas Grundsätzliches fehlt. Etwas, was zum Erreichen wahrer Glückseligkeit unabdingbar ist. Etwas, was mich erfüllen würde, durch und durch – denn noch scheine ich so etwas nicht gefunden zu haben.
Mein Name ist Alexander Bolenius. Ich bin vierundfünfzig Jahre alt und lehre als Professor für Germanistik an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Es ist dies ein Beruf, den ich nicht ungerne ausübe. Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Hier bin ich ganz in meinem Element – und trotzdem ist die Professur für mich nichts weiter als eine blosse Tätigkeit. Eine Beschäftigung, mit welcher ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Keine Leidenschaft. Und schon gar nicht die Erfüllung meines Daseins. Sicher hat der Gedanke, mein Wissen an die nächste Generation weiterzugeben, einen unbestreitbar romantischen Zug, doch ist dieser in meinen Augen zu wenig essenziell, als dass ich durch ihn Erlösung finden könnte.
Ich seufze. Müssige Gedanken. Dieselben müssigen Gedanken, jeden Tag. So sehr habe ich mich an sie gewöhnt, dass sie mich kaum mehr in irgendeiner Weise beeindrucken. Nach und nach sind sie mir so vertraut geworden, dass man sagen könnte, sie seien zu einem Teil meiner Persönlichkeit geworden. Einer Persönlichkeit, die niemals ausserordentliches Aufsehen erregt hat. Deren Leben niemals wirklich spannend gewesen ist. Niemals gefährlich oder ungewiss. Seit ich zurückdenken kann, hat sich niemals etwas ereignet, was mich erschüttert hätte. Nichts, was mir Furcht eingeflösst, oder mich Demut gelehrt hätte. Seit ich zurückdenken kann, bin ich einfach da gewesen. Ich bin einfach da gewesen, und die Welt hat mich mein Leben leben lassen. Und nun, ohne von nennenswerten Zwischenfällen berichten zu können, stehe ich hier. Vierundfünfzigjährig. Im Hörsaal einer Universität und lehre Germanistik. Was ist es, was ich verpasst habe? Seit langem schon quält mich ein Gefühl der Unvollständigkeit, ein Gefühl, das mehr Gewissheit ist denn blosse Empfindung. Doch was ist es, was mir fehlt? Wessen habe ich in den vierundfünfzig Jahren meines Lebens nicht habhaft werden können, was mich komplettieren würde?
Müde nehme ich meine Aktentasche vom Rednerpult. Es ist spät, sage ich resigniert zu mir selbst. Es hat keinen Sinn, länger in diesem Saal zu verweilen und sich das Hirn über solch unselige Fragen zu zermartern. Ich werde bloss noch kurz mein Büro aufsuchen und dann nach Hause fahren, nehme ich mir vor. Etwas Klügeres bleibt nicht zu tun.
Ich verlasse also den Hörsaal und ziehe die schwere Holztür in meinem Rücken ins Schloss. Der Gang, in den ich trete, weist augenfällige Merkmale der Ödnis auf. Von meinen eben erst entlassenen Studenten ist nicht einer mehr zu sehen. Auch sonst scheine ich die einzige lebende Seele im näheren Umkreis zu sein. Kaum erstaunlich. Meine Vorlesung ist heute als letzte angesetzt gewesen. Ich dürfte mittlerweile also mehr oder weniger alleine durch diese Gemäuer wandeln. Nicht, dass ich mich daran stören würde. Wieso auch? Mit meinen Kollegen, wie ich sie wohl nennen muss, teile ich ohnehin keine dermassen enge Verbundenheit, dass mir ihre Gesellschaft irgendeinen Nutzen bringen würde. Tatsache ist, dass ich von den meisten nicht viel mehr weiss als ihre Namen. Von manchen kenne ich gar nur den Familiennamen. Ich habe mir nie wirklich die Mühe gemacht, jemanden aus diesem Kreise näher kennenzulernen, muss ich gestehen – und auch auf mich ist in all den Jahren kaum jemand ernstlich zugekommen. Ich bin wohl einfach ein zu wenig interessanter Mensch, als dass ich den Leuten das Gefühl vermitteln würde, man müsse mich unbedingt kennenlernen. Selbstverständlich ist es an einer Universität nicht möglich, gänzlich aneinander vorbei zu leben, das ist klar. Mit Leuten aus demselben Fachbereich hat man regelmässig zu verkehren. Was mich anbelangt, beschränkt sich dieser Verkehr allerdings auf rein berufliche Aspekte. Ich habe nie geglaubt, die Musse zu haben, mich auf anderweitige Interaktionen einzulassen. Vielleicht würde ich anders darüber denken, wäre das Ergebnis solcher Bemühungen im Vornherein absehbar. So wie die Dinge aber liegen, sehe ich in dieser Hinsicht eine zu grosse Unsicherheit, als dass ich meine Zeit auf derartige Versuche verwenden würde. Zwar gibt es in meinem Leben nichts, was mich dermassen in Beschlag nehmen würde, dass ich nicht die geringste Zeit für solcherlei Vorstösse finden würde, doch sollte sich herausstellen, dass die ganze Sache in einem Fehlschlag kulminieren würde, bliebe mir letztlich nichts anderes, als mich der vergeudeten Mühe wegen zu grämen.
Nervös schüttle ich den Kopf. Schon wieder. Schon wieder solch triste Gedanken. Erschreckend wie ich nicht einmal bemerke, wenn ich beginne in diese grauen Tiefen meines Verstandes abzuschweifen. Da es allerdings auch nicht im Bereich des Möglichen zu liegen scheint, mich davor zu schützen, werde ich bis auf Weiteres wohl damit leben müssen, denke ich mutlos, als ich den Weg in Richtung meines Büros einschlage.
Als ich mein Ziel erreiche, mustere ich den matten Drahtglaseinlass, der die obere Hälfte der Tür ausmacht, vor welcher ich stehe. Prof. Dr. Alexander Bolenius





























