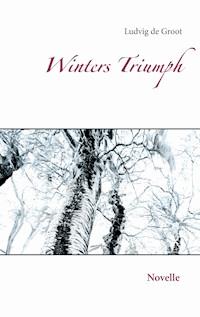Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Napa Valley, Kalifornien. Die Heimat der renommiertesten Weine des amerikanischen Kontinents - und der Zielort eines überaus lukrativen Auftrages für Vinzenz Preiss: Starönologe und als solcher gestandener Meister seines Fachs. Als unbeirrbarer Profi schreckt er vor keiner Herausforderung zurück - doch die Arbeit rückt in dem Moment in den Hintergrund, als er sich plötzlich mit der Person konfrontiert sieht, die sein Leben so nachhaltig geprägt hat, wie niemand sonst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für den Altar der schwarzen Tulpe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Eins
Mit einem simplen Knopfdruck lasse ich die Lehne des Flugzeugsitzes absinken und wage einen Blick aus der ovalen Fensteröffnung. Regen. Ein ungemütlicher Regen. Kein stürmischer Regen zwar und dennoch – ungemütlich. Wenn ich das Ganze so betrachte, drängt es mich überhaupt nicht, diese Maschine allzu bald landen zu sehen. Trotzdem wird der Flug nicht mehr übermässig lange andauern, dessen bin ich mir wohl bewusst.
Lustlos wende ich meinen Blick von der gräulichen Szenerie ab und krame die Aktentasche hervor, die ich unter meinem Sitz verstaut habe. Mit findigen Händen blättere ich meine Unterlagen durch und stosse bald auf das eine Schriftstück, aufgrund dessen ich mir diesen Flug überhaupt erst aufgebürdet habe. Flinken Auges überfliege ich die sich mir präsentierenden Zeilen als liesse sich durch deren wiederholtes Lesen ein Aspekt freilegen, der sich meiner Kenntnisnahme bislang entzogen hat. Wie zu erwarten war, bleibt ein entsprechendes Erlebnis aus. Nein. Es ist ein Auftrag wie jeder andere, dem ich bisher nachgekommen bin – und doch ist er andersartig als alles Bisherige.
Die erste Anfrage aus Amerika – aus dem Napa Valley, um präzise zu sein. Ich hatte bereits mit Kellereien in ganz Europa zu tun. Im Burgund half ich einem angeschlagenen Weingut wieder auf die Beine, einer Kellerei in der spanischen Levante verhalf ich zu einer regelrechten Monopolstellung in diesem Gebiet und auch im Piemont arbeitete ich mit einem alteingesessenen Weingut zusammen, das ich mittlerweile aufgekauft habe. Ich habe mir in den letzten Jahren durchaus einen Namen gemacht. Vinzenz Preiss ist Kennern der Branche längst ein Begriff und durch meine zahlreichen – oder sollte ich sagen zahllosen? - Aufträge habe ich ein Vermögen angehäuft, von dem es sich ohne weiteres für den Rest meines Lebens relativ gut leben liesse – aber Geld kann man ja bekanntlich nie genug haben. Aus diesem Grund hege ich auch nicht die Absicht, meine Karriere in nächster Zukunft an den Nagel zu hängen. Und trotzdem – wer hätte gedacht, dass es jemals so weit kommen würde, dass ich einen Auftrag aus Kalifornien annehme? Die Vereinigten Staaten waren mir seit jeher das am meisten verhasste der etablierten Weinländer. Selbstverständlich, es gibt guten amerikanischen Wein – es hätte keinen Sinn, dies bestreiten zu wollen – doch die Einstellung der Amerikaner zum Wein ist anders als überall sonst auf der Welt. Schon allein die önologischen Verfahren, die in nämlichen Kellereien schablonenhaft Anwendung finden, während sie anderenorts verboten und allgemein geächtet sind, sind mir ein Gräuel… Ich wage es einmal, die plumpe Behauptung aufzustellen, dass alles notorisch darauf ausgerichtet ist, ein immergleiches Produkt herzustellen. Allfällige Jahrgangsunterschiede sucht man so gut es geht zu eliminieren – als würde man die simple Wahrheit scheuen, dass Wein trotz aller kellertechnischer Eingriffe ein Naturprodukt ist, dessen Charakter meistenteils von den Bedingungen des Rebjahres abhängt. Man geht an das Produkt heran, als wäre man nichts weiter als ein stumpfsinniger Limonadenproduzent.
Ein weiterer Punkt, der es mir unmöglich macht, amerikanischem Wein mit viel mehr als desinteressierter Geringschätzung zu begegnen, ist das lachhafte Selbstverständnis seiner Produzenten, man könne den grossen Weinnationen – den tatsächlich grossen, meine ich – in Sachen Qualität und Renommee unmöglich nachstehen. Man sieht sich an einer gemeinsamen Spitze stehend – wenn man nicht gar so vermessen ist, sich eine Nasenlänge vorne zu wähnen. Geradezu frevelhaft, dieser Gedanke, wie ich meine. Wenn man beispielsweise einen preistechnisch eher als Luxusgut zu bezeichnenden Bordeaux kauft, dann bezahlt man nicht nur für den Wein, man bezahlt für die lange und ehrwürdige Geschichte, die hinter dem Weingut steckt, man bezahlt zugegebenermassen in grossen Teilen für den blossen Namen des Gutes, doch muss man sich dabei immer vor Augen halten, dass sich dieser Name etabliert hat; das Weingut hat sich bewährt über etliche Dekaden hinweg, und genau aus diesem Grund ist der Name des Gutes allein sein Geld in einem solchen Fall auch wert. Wenn man sich nun die Amerikaner anschaut – hier bezahlt man nicht für Tradition. Man bezahlt nicht für Geschichte. Nein, man bezahlt für den Stararchitekten, der das Weingut entworfen hat, und man bezahlt vor allen Dingen für den Starönologen, auf dessen Ansichten das ganze Projekt beruht. Bei den Amerikanern ist Weinbau vor allem eines: Business.
Ich werde an dieser Stelle nicht erklären müssen, dass ich mir der Ironie bewusst bin, dass ich mich trotz dieser persönlichen Ansichten von einem amerikanischen Weingut habe anheuern lassen. Manch einer mag sich vielleicht gar zu dem unschönen Wort Heuchelei hinreissen lassen, doch ich bin der Meinung, dass die ausgeschriebene Prämie besser in meine eigene Tasche wandert, als dass sie sich irgendeiner dieser rückgratlosen Dilettanten unter den Nagel reisst, deren einziger Antrieb es ist, sämtliche Weingüter, mit denen sie zusammenarbeiten, dem Irrglauben anheimfallen zu lassen, ihre Weine mit allen erdenklichen Mitteln in die Richtung prügeln zu müssen, die in den Augen eines bestimmten punktevergebenden Connaisseurs besondere Anerkennung verdient. Gerade in den USA lässt sich dieses Muster immer häufiger erkennen, weshalb ich nicht in geringem Masse überrascht war, als man sich mit eben dieser Anfrage ausgerechnet an mich wandte.
Mein Blick wandert ans untere Ende des Schreibens, wo die Unterschrift meines Auftraggebers zu lesen ist. Curtis Singleton. Schon der blosse Name lässt erahnen, in welchem Masse der Reichtum dieses Mannes zum Himmel stinkt. Ich habe mich im Vorfeld über eben jene Personalie informiert. Ein texanischer Ölmagnat, der anscheinend aus einer blossen Laune heraus beschlossen hat, in die Weinbranche einzusteigen. Naja. Jeder Mensch braucht Hobbys. Ich will ihm das seine nicht madig machen. Zumal er mit dem Entscheid, sich mit seinem Anliegen an mich zu wenden, eine gewisse Umsicht bewiesen hat, die so nicht unbedingt zu erwarten gewesen ist. Nur was die Namensgebung seines Projektes in Kalifornien anbelangt, hätte der gute Mr Singleton etwas mehr Kreativität an den Tag legen können. Lone Star Crest Winery soll es heissen. Für diesen Namen wird er nicht allzu viel Zeit aufgewendet haben. Nun gut, um sich auf dem amerikanischen Weinmarkt zu behaupten, wird es wohl genügen, denke ich, und verstaue das Schreiben wieder in meiner Aktentasche als die Information zum Beginn des Landeanfluges auf Santa Rosa aus den Lautsprechern tönt.
Als der Vogel schliesslich am Boden ist – die Landung ging etwas holpriger über die Bühne als ich mir dies gewünscht hätte, was dem guten Mann im Cockpit bei den schwierigen Sichtverhältnissen allerdings verziehen sein soll – und ich mir mein Gepäck wieder angeeignet habe, treffe ich in der Ankunftshalle auf einen Mann in schwarzer Uniform, der ein Schild mit meinem Namen hochhält. Der Fahrer, den ich engagiert habe, um mich während meines Aufenthaltes in Kalifornien durch die Gegend zu kutschieren. Zu meinem Leidwesen muss ich zugeben, dass ich niemals selbst gelernt habe ein Auto zu führen. Dies ist die Folge eines ausgeprägten Unwillens meinerseits sowie des beharrlichen Leugnens der Notwendigkeit, ein solches Gefährt beherrschen zu müssen – ausserdem bin ich der festen Überzeugung, dass ich ohnehin grandios gescheitert wäre, hätte ich den Versuch einer Prüfung denn jemals gewagt. In der heutigen Zeit eine sicherlich etwas sonderbar anmutende Tatsache, dessen bin ich mir durchaus bewusst, doch man hat mich seit jeher als Exzentriker betrachtet, daher kümmert es mich herzlich wenig, wenn ich deswegen schief angeschaut werde – und wer es sich leisten kann, einen persönlichen Fahrer anzuheuern, der zerbricht sich ohnehin nicht den Kopf über solcherlei Dinge.
Der Mann – vielleicht sechzigjährig, mit einem grauen Schnurrbart, der eine eigentümliche Ähnlichkeit mit dem eines Walrosses hat - stellt sich als Louis vor und fragt sogleich nach meinem Gepäck. Ich überlasse es ihm dankend und staune nicht schlecht als ich sehe mit welcher Geschwindigkeit der doch eher gebrechlich wirkende Mann meine vollgepackten Koffer in Richtung Ausgang trägt. Ich beeile mich, ihm zu folgen und kann gerade noch beobachten wie er mein Gepäck in den Kofferraum einer nachtschwarzen Limousine hievt, bevor er mir deren hintere Tür öffnet. «Bitte, Mr Preiss», sagt er und deutet dabei einladend auf die Sitzbank im Inneren des Wagens.
Als ich Platz genommen habe und auch Louis selbst eingestiegen ist, schlägt er vor, als erstes bei meinem Hotel vorzufahren. Ich lehne ab, da ich seit dem frühen Morgen nicht mehr dazu gekommen war, etwas zu essen und frage stattdessen, wo es auf dem Weg nach Napa am ehesten ein gutes Restaurant gebe.
Louis scheint etwas verlegen zu sein, da er nicht weiss, welche Küche ich bevorzuge. Erst als ich ihm mimisch zu verstehen gebe, dass ich eine Antwort erwarte, kann er sich dazu durchringen, ein Lokal namens Floral Springs vorzuschlagen. «Ausgezeichnete Küche, Sir», versichert er mir. «Wenn auch nicht ganz preiswert…»
Den zweiten Teil überhöre ich geflissentlich. «Klingt doch wunderbar», sage ich bloss. «Dann bringen Sie uns bitte als erstes dorthin, Louis.»
Der Fahrer tippt an seinen Hut. «Sehr wohl, Sir.»
Unsere Fahrt von Sonoma- nach Napa County ist von stetem Regenfall begleitet. Eine unfreundliche Szenerie, durch die wir uns bewegen. Kein Stückchen Blau am Himmel. Bloss kaltes Grau. So weit das Auge reicht. Aber irgendwo hat das schon seine Berechtigung, überlege ich mir. Ich bin kein Fan von Kalifornien und das Land ist offenbar kein Fan von mir, gemessen an dem kühlen Empfang, den es mir bereitet. Auch den Reben oder mehr noch den Trauben wird das viele Wasser nicht übermässig gut tun, so kurz vor der Ernte. Naja, man muss es nehmen wie es kommt. Das Wetter vermag selbst ich nicht zu beeinflussen, das wird auch Mr Singleton einsehen müssen. Auf jeden Fall ist dies nicht das Bild, das man im Kopf hat, wenn man an Kalifornien denkt. Aber gut, ich bin auch nicht hergekommen, um mich an der Schönheit der Landschaft zu ergötzen.
Wir passieren das Ortsschild von Napa und fahren stadteinwärts. Eine typisch amerikanische Plankartenstadt, wie ich sogleich feststelle. Eines der Dinge, die mir an US-Städten überhaupt nicht gefallen. Dieser pathologische Strukturierungszwang… Klar, ein Neuankömmling mag sich dank des Strassensystems hier vielleicht besser zurechtfinden als in einer altehrwürdigen Stadt in Europa, aber einer Retortenstadt wie Napa fehlt es ganz einfach an Charakter. Die beinahe perfekte Abwesenheit von Geschichte ist an einem Ort wie diesem förmlich spürbar. Die farblose Stadt vermag sich zugegebenermassen etwas positiver in Szene zu setzen, als wir in eine Promenade entlang des Napa Rivers einbiegen und sich uns der Blick auf den fernen Hafen eröffnet, doch als umwerfend lässt sich auch dieses Bild nicht bezeichnen.
Der Wagen wird nun langsamer und schleicht regelrecht am Strassenrand entlang bis Louis schliesslich einen freien Parkplatz findet. Kaum dass wir zum Stillstand gekommen sind, springt der Fahrer aus dem Wagen, umrundet diesen rasch und öffnet mir die Tür. «Bitte, Sir», sagt er präsentierend. «Das Floral Springs».
Ich steige aus und sehe an einer ockerfarbenen Häuserfront hoch. Oberhalb der gläsernen Eingangstür, an welcher ein Portier postiert ist, steht in Neonfarben der Name des Lokals geschrieben. Links und rechts davon sind ein paar ebenso grelle stilisierte Blumen zu sehen. «Sehr originell», murmle ich halblaut und rufe damit bei Louis ein verhaltenes Lächeln hervor.
«Nun, Mr Preiss», spricht mich der Fahrer schüchtern an. «Soll ich Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder abholen? Oder ist es Ihnen lieber, wenn ich gleich hier warte, Sir?»
Erwartungsvollen Blickes drehe ich mich zu ihm um. «Ach, warum leisten Sie mir denn nicht Gesellschaft, Louis?», frage ich ihn. «Kommen Sie, ich lade Sie ein.»
Das Erstaunen im Gesicht des Fahrers verrät mir, dass er solches von seinen Klienten nicht gewohnt ist. Es dauert eine Weile, bis er seine Stimme wiederfindet. «Wenn es Ihnen genehm ist, Sir», antwortet er sichtlich beeindruckt. «Danke, Mr Preiss.»
Ich lege ein gütiges Lächeln in meine Züge und lasse mir vom Portier die Tür zum Lokal öffnen. Fast perplex folgt mir Louis in die Räumlichkeiten des Restaurants.
Der Tisch, der uns zugewiesen wird, steht recht mittig des Saales, der unerwartet dezent eingerichtet ist. Amüsiert bemerke ich wie Louis sich, nachdem er Platz genommen hat, etwas beklommen umsieht. Es hat den Anschein, als wäre ihm nicht ganz wohl dabei, derart ausgestellt inmitten all dieser fein gekleideten Herrschaften zu sitzen. Offenbar ist er sich nicht bewusst, dass seine piekfeine Fahreruniform selbst im Vergleich zu den hier zur Schau getragenen Designerstücken keineswegs einen schäbigen Eindruck macht. Ich verzichte darauf, ihn dahingehend zu unterrichten und nehme stattdessen die Karte entgegen, die man mir reicht.
Wir bestellen unser Essen – Louis hat trotz mehrmaligen Versicherns meinerseits, er könne sich aussuchen, was er wolle, darauf bestanden lediglich einen grünen Salat und eine kleine Portion Gulaschsuppe zu essen – und lassen dazu eine Flasche Wein kommen. Einen neun Jahre alten Barbaresco von meinem eigenen Weingut in Castiglione Falletto. Louis gibt mir sogleich zu verstehen, dass er sich mit einem einzigen Glas davon begnügen würde. Ich erwidere, dass ich eine solche Flasche doch nicht allein trinken könne, wo ich doch an diesem Tag noch bei meinem Auftraggeber vorstellig werden muss. Louis merkt an, dass wir beide die zehn Kilometer bis nach Stags Leap zu Fuss gehen müssten, würde er mehr als ein Glas trinken. Ich erkenne sein Argument schliesslich als das gewichtigere an und gebe mich geschlagen.
Abgesehen von diesem kurzen Wortwechsel geht das Essen in relativer Stille vonstatten. Louis zeigt sich nicht unbedingt kommunikationsfreudig, was an der Situation liegen mag, die ihm womöglich noch immer nicht ganz geheuer ist. Ich störe mich nicht daran und dränge ihn auch nicht zum Gespräch. Bei meiner Einladung hatte ich ohnehin nicht im Sinn, einen Gesprächspartner zu finanzieren. Es ist bloss so, dass ich meine Mahlzeiten oft genug alleine einnehmen muss und die Aussicht auf ein Essen in Gesellschaft – mag diese auch stumm sein – genügt, um mir zu einem einigermassen wohligen Gefühl zu verhelfen. Zweifellos ein trauriger Gedanke, da gibt es keine zwei Meinungen. Mit dieser Erläuterung dürfte auch klar sein, dass bei meiner Geste nicht etwa ein wohltätiger Gedanke im Vordergrund gestanden hat, sondern allein mein eigenes Interesse. Ich bin ein ausgemachter Egoist, das gebe ich ganz unumwunden zu. Ich tue nie jemandem etwas Gutes, wenn ich davon nicht auch selbst profitieren kann. Wobei… Es gab einmal eine Zeit, in der das anders war. Vor vielen Jahren. Allerdings hatte dies weniger mit der Zeit an sich zu tun, sondern viel eher mit einer Person, die ich damals kannte. Ich habe einfach nicht anders gekonnt als diesem einen Menschen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Habe nicht anders gekonnt als ihn zu verehren. Ihm meine Zuneigung tagtäglich beweisen zu wollen. Ich wollte ihn lächeln sehen, wollte ihn glücklich machen. Wollte ihm begreiflich machen, wie viel er mir bedeutet, wenngleich ich immer wusste, dass meine Träume niemals Wirklichkeit werden könnten. Und ausgerechnet die einzige Bitte, die er jemals vorgebracht hat, habe ich ihm nicht erfüllen können… Und er, der mir stets ein guter Freund gewesen ist, hat mir bei allem Verständnis, bei aller Freundschaft, die er mir entgegenbrachte, nie das geben können, was ich mir so sehnlich gewünscht habe – mehr noch als alles andere. Ich weiss, es ist müssig, vergangenen Zeiten nachzuhängen, doch hat keine Episode in meinem Leben mein Dasein so nachhaltig beeinflusst wie eben jene Bekanntschaft aus Jugendjahren. Und er ist sich dessen nicht einmal bewusst… Aber jetzt ist nicht die Zeit, um in Schwermut zu versinken. Diesen Gedanken kann ich mich ohnehin kaum jemals verschliessen. Es gibt keinen Grund, sie nun auch noch so offenherzig in mein Bewusstsein einzuladen, schärfe ich mir ein und finde wieder Eingang ins Hier und Jetzt.
Als mein Teller ebenso wie der meines Gegenübers leer ist, und auch die Weinflasche nichts mehr hergeben will, genehmigen wir uns noch einen Kaffee und verabschieden uns schliesslich. Die Rechnung ist indes weniger hoch ausgefallen als ich dies erwartet habe, was Louis nicht davon abhält, sich auf dem Weg nach draussen noch ein gefühltes Dutzend Mal bei mir zu bedanken.
Als wir wieder im Wagen sitzen, sucht Louis meinen Blick im Rückspiegel. «Ins Hotel, Sir?», fragt er mit unterschwelliger Besorgnis.
Seine Sorge rührt augenscheinlich vom Barbaresco, den ich gezwungen war praktisch im Alleingang zu trinken, doch ich winke ab. «Ach was, Wein vermag mir nichts anzuhaben, ich bin ein Profi», sage ich, obschon mir mein Kopf doch etwas leicht vorkommt. «Nach Stags Leap. Ich nehme an, Sie haben die Adresse der Lone Star Crest Winery?»
Louis nickt. «Natürlich, Sir», bestätigt er fügsam. «Stags Leap, sehr wohl.»
Der Regen hat in der Zwischenzeit aufgehört zu fallen. Ein Blick in den Himmel lässt mich allerdings daran zweifeln, dass es fortan trocken bleiben würde. Noch immer hängen die grauen Wolken tief über der Landschaft. Richtig müdes Wetter, wenn man dem denn so sagen kann. Liegt vielleicht aber auch an mir, überlege ich. Hätte es im Springs diesen Kaffee nicht mehr gegeben, wäre ich wohl längst eingenickt. Womöglich wäre es doch besser gewesen, erst das Hotel aufzusuchen, damit ich mich etwas hätte hinlegen können… Aber gut, ich habe mich anders entschieden. Nun, da wir schon unterwegs sind, möchte ich bloss ungerne wieder Kehrt machen.
Die Strasse, der wir nun folgen, verläuft direkt an einem recht steil abfallenden Rebberg. Cabernet Sauvignon möchte ich meinen, wenngleich eine exakte Bestimmung aus dem fahrenden Wagen heraus natürlich kaum möglich ist. Zwischen den Reihen mache ich eine Handvoll Leute aus, die sich offenbar über etwas beraten. Ob die wohl einen Erdrutsch befürchten? Bei dieser Steigung des Hügels und dem nassen Boden? Kann ich mir zwar nicht recht vorstellen. Das Wurzelwerk der Reben sollte dem Erdreich eigentlich genügend Halt bieten. Aber selbstverständlich bin ich mit der Beschaffenheit des hiesigen Bodens nicht ausreichend vertraut, um hierüber ein abschliessendes Urteil fällen zu können.
Beim Näherkommen hefte ich meinen Blick auf die Arbeiter in den Reben und versuche zu erahnen, was sie wohl diskutieren. Als wir sie passiert haben, muss ich blinzeln. War das nicht…? Ich könnte schwören das war… Nein. Nein, unwahrscheinlich. Zu glauben, dass es den hierher verschlagen hat… Nein, ich muss mich getäuscht haben. Liegt wohl am Wein, rede ich mir ein und bin bemüht, die Sache als blosse Sinnestäuschung abzutun.
Ein paar hundert Meter die Strasse hinunter lässt Louis mich aussteigen. «Bitte, Sir», sagt er neben mir im nassen Kies stehend. «Lone Star Crest.»
Ich schenke ihm einen Blick als zweifle ich an seinem Verstand. Die Reaktion des Fahrers entfällt auf ein hilfloses Schulterzucken.
Vor uns erhebt sich eine einzige Baustelle. Im Vorhof des Hauptgebäudes, dessen tatsächliche Form aufgrund des Käfigs aus Baugerüsten und der grossflächigen Verhüllung durch milchig weisse Planen kaum mehr zu erahnen ist, stehen in scheinbar heillosem Durcheinander eine Handvoll Schubkarren, ein Zementmischer, zwei verschiedenartige Hubstapler und zahlreiche andere Utensilien und Gerätschaften herum. Gekrönt wird dieses Bild des Chaos von einem gelben Baukran.
Ich seufze. Mit einer solchen Aufwartung habe ich nun wirklich nicht gerechnet. «Nun denn, Louis», wende ich mich resigniert an meinen Fahrer. «Ich melde mich bei Ihnen, sobald ich hier fertig bin.»
Louis nickt ergeben. «Viel Erfolg, Sir.»
Ich murmle ein Wort des Dankes und setze mich in Bewegung. Als ich die Baustelle durchschreite, passiere ich eine Tafel, auf der geschrieben steht: Hier entsteht die Lone Star Crest Winery – Teil der Singleton Group.
Kapitel Zwei
Der Keller der künftigen Lone Star Crest Winery ist grösser als ich mir dies vorgestellt habe. Erstreckt sich über drei Ebenen und ist bisweilen recht verwinkelt. Eine Folge davon, dass über die Jahre hinweg immer wieder neue Kellerteile hinzugebaut worden sind – wenngleich der letzte Ausbau vor mehr als einer Dekade stattgefunden hat. Für einen Neuankömmling ist es alles andere als einfach, sich in diesem eigenwilligen Kellerkonstrukt zurechtzufinden, weshalb ich froh bin, von Mr Bonnet geführt zu werden.
Malcolm Bonnet ist der hiesige Kellermeister. Ihm gehörte das Weingut, das noch von seinem Grossvater Angus aufgebaut worden war, bis er vor Kurzem aufgrund andauernder Misswirtschaft gezwungen war zu verkaufen. Sieben Jahre lang hielt er die Zügel des Familienunternehmens in der Hand – und schien während all dieser Zeit nicht bemerkt zu haben, dass es aus wirtschaftlicher Sicht längerfristig nicht aufgehen würde. Vielleicht hat er es einfach nicht wahrhaben wollen. Dass er das Vermächtnis seines Grossvaters in den schleichenden Ruin trieb. Jedenfalls war es diese Untätigkeit, die letztlich im Verkauf des Gutes an Curtis Singleton resultierte.
Dem Mann ist deutlich anzusehen, dass es ihm zu schaffen macht, sein Unternehmen abgetreten haben zu müssen. Seinen Erläuterungen zufolge dürfte er etwa im gleichen Alter sein wie ich und doch könnte man meinen, es liegen mehr als zehn Jahre zwischen uns. Sein Gesicht wirkt - obwohl nicht unbedingt hager – doch unbestreitbar eingefallen und seine Haut weist einen markanten Blasston auf, wie er bei einem gesunden Menschen nicht zu finden sein sollte. Selbst sein Haar hat bereits zu ergrauen begonnen. Abgesehen von diesem erschreckenden Bild des vorzeitigen Alterns wirkt Mr Bonnet wie ein recht angenehmer Zeitgenosse. Ein wenig fahrig vielleicht, bisweilen etwas zerstreut, aber nicht unsympathisch. Trotzdem ist er nicht der Typ Mensch, der das Zeug dazu hat, einen Betrieb zu leiten, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Dafür wirkt er zu wenig entschlossen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Mr Singleton an einer langfristigen Beschäftigung Bonnets gelegen ist.