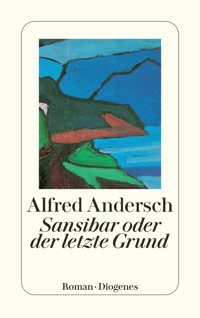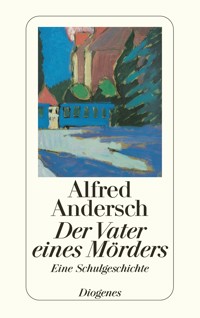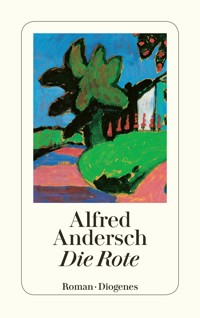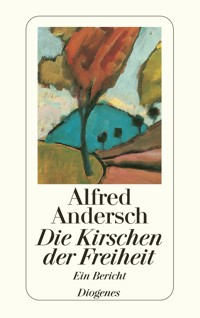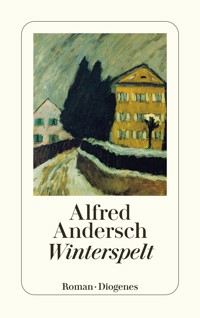
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Winterspelt, einem Eifeldorf, überschneiden sich am Vorabend der Ardennenoffensive im Oktober 1944 die Lebenswege von sechs Personen. Roter Faden ist der geplante Coup des Major Dincklage, eines Ritterkreuzträgers: Um sinnloses Blutvergießen zu verhindern, will er sein Bataillon kampflos den Amerikanern übergeben. Winterspelt, der 1974 als letzter Roman Anderschs erschienen ist, zeigt auf, wie es auch hätte sein können: »Geschichte berichtet, wie es gewesen. Erzählung spielt eine Möglichkeit durch.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Alfred Andersch
Winterspelt
Roman
Die Erstausgabe erschien 1974 im Diogenes Verlag,
1977 erstmals als Taschenbuch (detebe 20397)
Der Text der vorliegenden Ausgabe
entspricht demjenigen in Band 3
der 2004 im Diogenes Verlag erschienenen
textkritisch durchgesehenen und kommentierten Edition
Alfred Andersch, Gesammelte Werke in zehn Bänden,
herausgegeben von Dieter Lamping
Bibliographie der Sekundärliteratur zum Werk
von Alfred Andersch unter
www.diogenes.ch/andersch/bibliographie
Umschlagillustration: Gabriele Münter,
›Das gelbe Haus 1‹, 1911 (Ausschnitt)
Copyright © 2013 ProLitteris, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23604 0 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60081 0
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Gewidmet jener auf Seite 23 erwähnten, dem Verfasser als äußerst zuverlässig bekannten Person.
[7] Es war kalt, es goß, ein halber Sturm wehte, und vor uns lagen wie eine Mauer die schwarzen Forsten der Schnee-Eifel, wo die Drachen hausten.
Ernest Hemingway, 49Depeschen
Deutsch von Ernst Schnabel
Das Vergangene ist nie tot;es ist nicht einmal vergangen.
William Faulkner
[9] Inhalt
Feindlage, militärisch[13]
Im Westen nichts Neues [15] Hitler oder Die fehlende Tiefe [15] Bradley oder Acht Kilometer [17] Weisung an von Rundstedt, Generalfeldmarschall [19] Der arme General Middleton [19] Phasen eines Umschlags von Dokument in Fiktion [20] Georgia on my mind [22] Schwache Korrektur [23] Sandkasten [23]
Feindlage, ›geistig‹[25]
von Rundstedt, Model, Blaskowitz, von Manteuffel, Guderian, Balck, Hauser, Schulz, Thomale etc. [27] Churchill [27] Rote Armee [28] Reisige und Bauern [31] Geheimniskrämerei [32] Westlich des Limes [32] Beifall von der falschen Seite [34] Adverb und Adjektiv [35] Strategische Studie [36] Seinen Kohl bauen [36] Anläßlich Schefolds? [38]
Der Major Dincklage[39]
Biogramm [41] Momente [42] Zwölf Uhr mittags [66] Fachidiot [67]
Hauptkampfzone[71]
Krähennest [73] Biogramm [105] Momente oder Geologie und Marxismus [110] Retuschen an der Hauptkampfzone [135] Ende Krähennest [136]
Meldung über einen Vorfall auf Posten[137]
Einsatz eines Kuriers[189]
[10] Entstehung einer Partisanin[217]
Ein Licht aufstecken [219] »Herrgott, Käthe!« [228] Tirade über die Liebe [230] Biogramm [232] Die Reise in den Westen [234] Notizen zu einem Aufsatz über politisches Bewußtsein [267] Produktionsbedingungen, durchschaut [271] Während Käthe Kühe hütet [273] Verflechtung [274] Die Höhle am Apert [276] Miszellen über Käthes Verhältnisse [283] Für und Wider [291] Ein amerikanisches Manneswort oder Die Internationale der Offiziere [298] Aus Alberichs Schatz [301]
Schreibstuben-Vorgänge[303]
Der Hauptmann Kimbrough[387]
Maspelt 13Uhr [389] Marsch nach Osten [392] Maspelt 14Uhr [396] Über Realismus in der Kunst [403] Das größte Gemälde der Welt [404] Maspelt 15Uhr [406] Wheelers Wappen [408] Mitteilung einer Erfahrung betreffend Kameradschaft [411] Weiter: Maspelt 15Uhr [412] Biogramm [413] Maspelt und Fargo [417] Immobilien und blue notes [418] populist movement, civil war [421] Weiter: Maspelt 15Uhr [427] Segregation [428] Maspelt 16Uhr [430] Noch so eine Lehrerin [433] Maspelt 17Uhr [441] Von Alligatoren… [452] …und Schweinehunden [454] Maspelt 18Uhr [459] Regionalismus [466] Maspelt 19Uhr [469] Spät in der Nacht [469]
[13] Feindlage, militärisch
[15] Im Westen nichts Neues
Der westliche Kriegsschauplatz / Die Kampfhandlungen vom 25.September bis 9.Oktober 1944 / Im Großraum Aachen fanden nur örtliche, an Schwere jedoch zunehmende Kampfhandlungen statt; in der Eifel und an der Moselfront herrschte Ruhe. (Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht [Wehrmachtführungsstab], KTB, geführt von Helmuth Greiner und Percy Ernst Schramm, Bd. IV, S.400)
Hitler oder Die fehlende Tiefe
Der Führer rechnete damit, daß im Herbst das Wetter die feindliche Luftwaffe zeitweise ausschaltete und dadurch deren Überlegenheit herabgemindert werde. Ein operatives Vorgehen hielt der Führer schon deshalb für geboten, weil den Franzosen nicht die Gelegenheit gegeben werden durfte, ihre Verbände anschwellen zu lassen; denn nach seiner Auffassung waren die 70Verbände, mit denen bei den Anglo-Amerikanern zu rechnen war, nicht stark genug für eine Front von 700km. Es mußte daher nach seiner Meinung möglich sein, auf einer solchen Frontlinie eigene Kräfte so zu massieren, daß sie im Angriffsraum dem Gegner überlegen waren. Vorerst wurden die Burgundische Pforte und der holländische Raum als Ausgangsbasis ins Auge gefaßt. Zu diesem Zwecke stellte der WFStab in der Mitte der dritten September-Dekade die erforderlichen Kräfteberechnungen an.
[16] Jetzt handelte es sich jedoch nicht mehr um eine aus der Bewegung geführte Operation, welche Lücken in der feindlichen Front oder tiefe Flanken ausnutzen konnte, sondern um einen Angriff aus einer festen, durch die feindliche Luftaufklärung ständig überwachten Front, der erst in der – inzwischen vom Gegner ausgebauten – gegenüberliegenden Front ein Loch aufreißen mußte, also um eine Operation, die einer langen Vorbereitung bedurfte und für die – da das Westheer abgekämpft war – auch erst durch Auffrischung und Neuaufstellungen die Kräfte zu gewinnen waren. Schließlich war sogar noch mehr Zeit erforderlich, als sich anfangs voraussetzen ließ: von der Festlegung der ersten Pläne bis zum letzten Befehl vor dem Angriff vergingen rund 2½ Monate.
Die Leitung in dieser Zeit blieb ganz in der Hand des Führers, der nicht nur die Anregungen gab und die Entscheidungen traf, sondern sich auch um alle Einzelheiten kümmerte und dabei die Vorbereitung des Angriffs auf die Abwehr abstimmte, die in der Zwischenzeit an der Westfront zu leisten war.
Um die Wende vom September zum Oktober hatte sich als geeigneter Durchbruchsraum bereits die Front ostwärts Lüttich abgezeichnet. Da dort bereits im Mai 1940 der Durchbruch erzwungen worden war, wurden aus den nach Liegnitz ausgelagerten Archiven Unterlagen über die damaligen Operationen der 6. und 4. Armee angefordert. Diese wurden am 5.10. abgesandt. Leider ergaben sich in den Archivbeständen Lücken, da 1941 einem Brande wesentliche Akten zum Opfer gefallen waren. Jedoch fanden sich noch aufschlußreiche Aufzeichnungen, vor allem eine Geländebeurteilung vom Januar 1940, die zu dem Ergebnis gekommen war, daß ein Vormarsch in Luxemburg und Südbelgien weitaus günstigere Verhältnisse finde als im Abschnitt des nördlichen Nachbars, [17] da die Zahl der hintereinander gestaffelten Gelände- und Befestigungsabschnitte, die quer zum Angriff lagen, geringer und das Gelände sowie die Verkehrsdurchlässigkeit günstiger waren als im Nordteil der Ardennen.
Als Voraussetzung für die geplante Operation wurde angesehen:
das Halten der Weststellung, einschließlich der Niederlande und die Sperrung der Westerschelde, eine die Kräfte des BdE (Befehlshaber des Ersatzheeres, d. A.) nicht beanspruchende Ostlage,
Fortdauer des personellen und materiellen Zulaufs in den Westen zur Auffrischung,
Eintritt einer 10–14tägigen Schlechtwetterperiode als Ausgleich der fehlenden Luftwaffen-Unterstützung, schnelle Vernichtung des Feindes in der Front, um die fehlende Tiefe zu ersetzen, (KTB 1944, Bd. IV. Erster Halbband, 4. Abschnitt, Frankfurt a.M. 1961)
Bradley oder Acht Kilometer
Eine Zeitlang hatten wir zwischen Trier und Monschau auf einer etwa 120km breiten Front nur drei Divisionen stehen. Mehr als vier Divisionen konnten wir in diesem Gebiet niemals einsetzen. Während mein Stab sich ständig so eingehend wie möglich mit dieser Lage befaßte, sprach ich auch persönlich zu verschiedenen Malen mit Bradley darüber. Wir kamen zu dem Schluß, daß wir im Raum der Ardennen entschieden gefährdet waren, doch hielten wir es für falsch, unsere Angriffe an der ganzen übrigen Front lediglich aus Gründen der Sicherung einzustellen, bis aus den Vereinigten [18] Staaten alle Verstärkungen eingetroffen wären und unsere Stärke ihr Höchstmaß erreicht hätte.
Bei der Besprechung dieses Problems wies Bradley ausdrücklich auf die Umstände hin, die seiner Ansicht nach für die Fortsetzung der Offensive in seinem Abschnitt sprachen. Ich stimmte ihm in allen Punkten zu. Zunächst führte er die gewaltigen relativen Vorteile an, die sich im Hinblick auf die Verluste für uns ergaben. Der Feind hatte im Durchschnitt pro Tag doppelt soviel Verluste wie wir. Ferner glaubte Bradley, das Ardennengebiet sei der einzige Abschnitt, wo der Feind einen ernsthaften Gegenangriff unternehmen konnte. Die beiden Punkte, an denen wir Truppen der Zwölften Armeegruppe für Angriffsoperationen zusammengezogen hatten, flankierten aber diesen Raum unmittelbar. Der eine Teil derselben, der Hodges unterstand, befand sich gleich nördlich, und der andere, unter Patton, gleich südlich davon. Bradley meinte deshalb, für einen massierten Einsatz unserer Kräfte gegen die Flanken eines eventuellen deutschen Angriffs im Ardennengebiet könnte unsere Aufstellung gar nicht günstiger sein. Überdies vermutete er, der Feind werde bei einem überraschenden Angriff in den Ardennen große Nachschubschwierigkeiten haben, falls er den Versuch machen sollte, bis an die Maas vorzustoßen. Wenn es ihm nicht gelang, unsere großen Materiallager in die Hand zu bekommen, dann mußte er bald in Bedrängnis geraten, besonders, wenn unsere Luftwaffe zur gleichen Zeit wirkungsvoll operieren konnte. Bradley zeigte auf der Karte die Linie, welche die deutschen Spitzen seiner Meinung nach eventuell erreichen konnten. Diese Voraussagen erwiesen sich später als außerordentlich zutreffend. Er hatte sich nirgends um mehr als acht Kilometer geirrt. In dem Raum, den der Feind seiner Ansicht nach überrennen konnte, legte er nur sehr wenige Nachschublager an. Wir hatten zwar große Depots in Lüttich [19] und Verdun, aber er glaubte zuversichtlich, daß der Feind nicht so weit kommen würde. (Dwight D. Eisenhower, Crusade in Europe, New York 1948, zitiert nach der deutschen Ausgabe, Amsterdam 1950)
Weisung an von Rundstedt, Generalfeldmarschall
Am 3.10. wurde dem OB West mitgeteilt, daß ihm am 5.10. zum Einsatz in einer ruhigen Front aus Dänemark die 416. Inf.-Div. zugeführt werden solle. Dieser Befehl wurde am dahin ergänzt, daß der Führer befohlen habe, durch die 416. Inf.-Div. eine voll bewegliche Division herauszulösen. (KTB, Bd. IV, S.449)
Der arme General Middleton
Es überrascht nicht, daß die vier schwachen Infanterie-Divisionen, dünn verteilt über die 75Meilen der Ardennenfront, von der Wucht des feindlichen Angriffs überwältigt wurden. Trotz des schweren Sperrfeuers, das dem Angriff vorausging und das manche für ›freundlich‹ hielten, nahmen sie an, sie befänden sich in einem ruhigen Abschnitt, beinahe in einem Urlaubs- und Erholungsbezirk, in dem ›grüne‹ Truppen sich ohne große Gefahr an die Unbequemlichkeiten der Frontlinie gewöhnen konnten. Von den drei Divisionen des amerikanischen VIII. Corps unter General Middleton hatten zwei, die 4. und die 28., in den grimmigen Herbst [20] schlachten weiter nördlich furchtbare Schläge ausgehalten und schwere Verluste erlitten. Sie waren hundemüde und geplagt von ›Grabenfuß‹, Husten und anderen kleinen Beschwerden. Die dritte Infanterie-Division, die 106., hatte vier Tage zuvor die 2. Division an der Linie abgelöst, nach einer erschöpfenden Lastwagen-Fahrt durch Frankreich und Belgien in beißender Kälte. Sie war eine ›grüne‹ Division. Ihr beigegeben war die 14. Kavallerie-Gruppe, die in einer acht Meilen weiten Lücke zwischen dem VIII. und dem V. Corps patrouillierte, einer gefährlich schwachen Nahtstelle. Die rechts flankierende Infanterie-Division des V. Corps, die 99., vervollständigte das Bild. Sie war eine unerfahrene, aber gut ausgebildete Division. Sie bewies ihr Können. (R. W. Thompson, Montgomery The Field Marshal, London 1969, S.243)
Phasen eines Umschlags von Dokument in Fiktion
1.
Ob auch die deutsche 416. Infanterie-Division ihr Können bewies, konnte nicht eruiert werden. In den Verzeichnissen (KTB, Ellis, von Manteuffel) der Truppenverbände, die für die Ardennen-Offensive bereitgestellt wurden, findet sie sich nicht. Wahrscheinlich wurde sie vor Beginn des Angriffs aus der Front zurückgenommen und wieder durch eine voll bewegliche Division ersetzt.
Vollends reine Annahme ist es, daß sie sich im Oktober 1944 in dem Frontabschnitt befunden hat, der den Schauplatz der im Folgenden geschilderten Begebenheiten bildet; ferner, [21] daß sich unter ihren Bataillons-Kommandeuren ein Major namens Joseph Dincklage befand.
Infolgedessen braucht sich die 416. von dem, was hier berichtet wird, überhaupt nicht betroffen zu fühlen. Andererseits wird für einen Bericht wie diesen gerade eine Division wie die 416. benötigt. In einer Panzerdivision, Elite-Verbänden wie der 2. oder der 9. etwa, oder aber in irgendeiner sogenannten Volksgrenadier-Division, die schon ihre Bezeichnung, wie tapfer sie sich auch geschlagen haben mag, in die untersten Ränge des Heerwesens verweist, hätten sich die Vorgänge der in keinem Kriegsarchiv aufbewahrten Akte ›Verschluß-Sache Dincklage‹ von vornherein unglaubwürdig ausgenommen. Unter Umständen vorstellbar sind sie aber in einer gewöhnlichen Infanterie-Division – im Jahre 1944 verlieh der einfache Name ›Infanterie‹ einer Truppe etwas Seltenes und Altertümliches –, und das geisterhafte Auftauchen und Verschwinden einer solchen im Bereich des ob West paßt also ganz vorzüglich.
2.
Es hat aber nicht nur in der 416. Infanterie-Division, sondern auch in dem gesamten deutschen Heerbann, weder im Jahre 1944 noch vorher oder nachher, einen Offizier gegeben, der sich mit Absichten trug, wie sie hier dem Major Dincklage nachgesagt werden. Infolgedessen braucht sich nicht nur die 416. Infanterie-Division, sondern das deutsche Heer als Ganzes von diesem Bericht nicht betroffen zu fühlen.
[22] 3.
Aus den genannten Gründen konnte er auch nur in einer einzigen Form erstattet werden: als Fiktion.
Georgia on my mind
Die 106. amerikanische Infanterie-Division möge es dem Berichterstatter nachsehen, daß er sie schon ab Ende September 1944 an der Front auftauchen läßt. Bekanntlich (siehe Thompson u.a. Quellen) hat sie erst vier Tage vor Beginn der Ardennen-Offensive, also am 12.Dezember, ihre Stellungen bezogen. Daß ihr 3. Regiment (genaue Bezeichnung: 424. Regiment) den rechten Flügel bildete, also südöstlich Saint-Vith lag, ist immerhin authentisch. (Zum genauen Frontverlauf siehe den Abschnitt Retuschen an der Hauptkampfzone.) Ob die C-Kompanie eines Bataillons dieses Regiments den Abschnitt Maspelt sicherte und in diesem Dorf Quartiere bezog, ist kriegsgeschichtlich nicht nachweisbar, doch ohne weiteres möglich. Um eine völlig freie Erfindung handelt es sich jedoch, wenn ihr als Kompaniechef ein Captain John Kimbrough zugewiesen wurde. Der Himmel weiß, warum er aus dem Süden des Staates Georgia stammt, in der kleinen Stadt Fargo aufgewachsen ist, die an drei Seiten von dem Okefenokee-Sumpf umgeben ist. Die meisten Soldaten der 106. – das ist wieder bezeugt – wurden in Montana rekrutiert.
[23] Schwache Korrektur
Eine dem Verfasser als äußerst zuverlässig bekannte Person, die von 1941 bis 1945 in der Westeifel gelebt hat, möchte ihn dazu bewegen, seine im Passus 2 des Abschnittes Phasen eines Umschlags von Dokument in Fiktion aufgestellte Behauptung zu revidieren. Sie gibt an, des öfteren Gespräche deutscher Offiziere mitangehört zu haben, in denen Pläne erörtert wurden, die denen des Majors Dincklage entsprachen. Die Frage, ob solche Pläne zu irgendeinem Zeitpunkt und in irgendeiner Weise nicht nur erwogen, sondern auch realisiert oder wenigstens in das Anfangsstadium einer Realisation überführt worden sind, muß sie allerdings verneinen.
Sandkasten
Geschichte berichtet, wie es gewesen.
[25] Feindlage, ›geistig‹
[27] von Rundstedt, Model, Blaskowitz, von Manteuffel, Guderian, Balck, Hauser, Schulz, Thomale etc.
Andererseits ist in Rechnung zu stellen, daß es für die Oberbefehlshaber gar keine andere Möglichkeit gab, als ›weiterzumachen‹. Soviel wußten sie trotz ihrer unzulänglichen Orientierung über die Gesamtlage, daß bei der engen Verknüpfung der Westmächte mit der UdSSR kein Sonderwaffenstillstand, sondern nur eine Gesamtkapitulation denkbar war. Sie anzunehmen aber bedeutete, von den dreieinhalb Millionen Mann, die im Osten standen, zu verlangen, daß sie sich in sowjetische Kriegsgefangenschaft begaben – diese Überlegung hat ja auch den Männern vom 20.Juli schwere Gewissensunruhe bereitet. Für den, der nicht zu ihnen gehörte, gab es nur die Möglichkeit, mit der vagen Hoffnung, daß noch ein ›Wunder‹ geschehen könnte, den Krieg fortzusetzen – und das hieß: weiter zu gehorchen wie bisher, (KTB, Einleitung Die Rolle der Heeresgruppen- und Armeeführer)
Churchill
P. M. (der Premierminister, i.e. Winston Churchill, d. A.) nicht in Form wie gewohnt und ziemlich lustlos. Sein Kampfgeist allerdings ganz wie sonst; er sagte, wenn er Deutscher wäre, würde er seine kleine Tochter dazu bringen, dem nächstbesten Engländer eine Bombe unters Bett zu legen; seine Frau würde er anweisen, darauf zu warten, daß irgendein [28] Amerikaner sich über sein Waschbecken beugte, um ihm dann eins mit dem Nudelholz ins Genick zu geben, während er selber im Hinterhalt lag und ohne Unterschied auf Amerikaner wie Briten schoß. (Arthur Bryant, Triumph in the West 1943–1946, dargestellt unter Verwendung der Tagebücher und autobiographischen Aufzeichnungen des Feldmarschalls Viscount Alanbrooke, London 1959, S.320; Notiz Alanbrookes vom 2.11.1944)
Rote Armee
Ob Major Dincklage die Sorgen der Heeresgruppen- und Armeeführer beziehungsweise die schwere Gewissensunruhe der Männer des 20.Juli hinsichtlich der Zumutbarkeit sowjetischer Kriegsgefangenschaft geteilt hat, kann, wie vieles im schon ein wenig nachgedunkelten Bild dieses schwierigen Charakters, heute nicht mehr aufgehellt werden. Fest steht nur, daß er niemals an der Front im Osten stand und stets alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, um seine Abstellung nach Rußland zu verhindern, was ihm unter Hinweis auf seine sich seit 1942 entwickelnde Arthrose des rechten Hüftgelenks und entsprechende stabsärztliche Zeugnisse auch regelmäßig gelang. Dies ist um so bemerkenswerter, als Dincklage sonst jegliche dienstliche Rücksichtnahme auf seine Krankheit strikt ablehnte. Offen muß bleiben, ob solches Verhalten auf eine grundlegende Eigenschaft Dincklages verweist, eine in ihm angelegte Neigung, sich rätselhaft-widersprüchlich zu zeigen – wie sie beispielsweise in seiner verhängnisvollen Begegnung mit Schefold zu Tage tritt – oder auf politisch-historische Überzeugungen oder vielleicht nur auf eine rein [29] stimmungsmäßige Abneigung gegen ein Leben als Soldat im Osten. Möglicherweise haben alle drei genannten Motive dabei eine Rolle gespielt.
Mit der Roten Armee geriet er erst in Winterspelt in Berührung, und auch dort nur zu einer so frühen Stunde, daß er sie nicht genau erkennen konnte, denn es war noch dunkel, wenn die Russen die Dorfstraße herunter kamen. Dincklage beobachtete sie fast jeden Morgen, seitdem er in Winterspelt war. Er stand, auf seinen Stock gestützt, hinter dem Fenster der Schreibstube, in der er wegen der Verdunkelungsvorschriften das Licht nicht anzünden durfte. Da er regelmäßig gegen vier Uhr aufwachte und wegen der Schmerzen im Hüftgelenk nicht mehr schlafen konnte, gehörte es zu seiner Technik, sich die Zeit zu vertreiben, bis es im Bataillonsstab lebendig wurde, den Russen zuzusehen, wie sie zu ihrer Arbeit in den Höfen gingen. Von zwei Landsturm-Leuten, alten Männern mit umgehängten Gewehren, bewacht, erschienen sie in leidlicher Kolonne oben rechts im Ausschnitt der Straße, die von der Höhe namens Held ins Dorf führte. Jeweils zwei von ihnen scherten in die Höfe rechts und links aus, so daß die Kolonne immer kleiner wurde. Wenn sie den Hof Thelen erreichte, der dem Haus, in dem der Bataillonsstab untergebracht war, gegenüberlag, bestand sie nur noch aus zehn Männern. Die Russen waren keine deponierten Zivilisten, sondern reguläre Kriegsgefangene. Sie waren in einer Scheune auf der Held untergebracht. Dincklage hatte festgestellt, daß sie keine Schuhe trugen, sondern nur Holzpantinen, darinnen Fußlappen, die sie mit Schnüren umwickelt hatten. Mäntel schienen sie nicht zu besitzen. Dincklage fragte sich, wie sie in dieser Montur den kommenden Winter überstehen würden. Ein Gedanke wie dieser enthielt die Vorstellung, daß vor allem der Krieg den kommenden Winter überstehen würde.
[30] Die zwei, die Thelen zugeteilt waren, gingen zum Hofgebäude hinüber. Als sie die Türe öffneten und eintraten, wurde für einen Augenblick das Licht im Haus sichtbar. Gleich danach wieder, weil dann entweder die beiden Töchter Thelens, oder eine von ihnen zusammen mit Käthe Lenk, aus dem Haus kamen und sich im Hofraum zu schaffen machten, mit Milchkannen klapperten, Wasser pumpten.
Stabsfeldwebel Kammerer, der an einem Morgen neben ihm stand und gleich ihm zum Fenster hinaussah, hatte ihm den Vorgang erklärt. »Jetzt frühstücken die Iwans«, hatte er gesagt, »und die Mädchen passen auf. Wenn ein Posten kommt, um zu kontrollieren, hält die eine ihn auf, während die andere ins Haus läuft und die Kerle in den Stall scheucht.« »Ach so!« Dincklage hatte lachen müssen. »Den Bauern ist es nämlich verboten, die Russen zusätzlich zu verpflegen«, erläuterte Kammerer, »aber keiner von denen hält sich dran.« Er schien das Lachen Dincklages zu mißbilligen. »Die Russen kriegen zu fressen wie die Bauern selber.« »Na, Kammerer«, sagte Dincklage, »können Sie sich nicht vorstellen, was für einen Fraß die da oben in ihrer Scheune bekommen? Und dann sollen sie den ganzen Tag Schwerarbeit machen. Die Bauern müssen sie doch bei Stimmung halten.« »Herr Major«, sagte der Bataillons-Spieß unnachgiebig, »die Iwans fressen Sachen, die unsere Soldaten kaum noch kennen. Eier, Speck, Butter.« »Trotzdem«, erwiderte Dincklage, »wird in dieser Angelegenheit keine Meldung gemacht, Kammerer!« »Daran habe ich auch gar nicht gedacht, Herr Major«, sagte Kammerer.
Dincklage behandelte den Stabsfeldwebel energisch, freundlich. Es gab niemals Reibungen zwischen ihnen. Hauptsache war, schnell zu reagieren, wenn der Mann in das Denken des wahrscheinlich Wahnsinnigen zurückfiel. Kammerer war Mitglied der Partei, aber er schien davon im Jahre 1944 keinen Gebrauch mehr zu machen.
[31] Reisige und Bauern
Nur Dincklage wohnte im Stab selbst. Die übrigen Stabsangehörigen hatten sich bei den Bauern einquartiert. Kammerer war ein aufmerksamer Beobachter. Schon am dritten Tag ihres Aufenthalts in der Eifel hatte er zu Dincklage bemerkt: »Die Bauern hier mögen uns nicht.« Er belegte diese Behauptung mit einem Ausspruch des alten Thelen, der, als Kammerer in irgendeinem Zusammenhang eine Ansprache an ihn mit den Worten »Sie als deutscher Bauer« begann, den Feldwebel sogleich unterbrochen und erklärt hatte: »Ich bin kein deutscher Bauer, ich bin ein Eifelbauer.« Dincklage, der aus dem Emsland stammte, hatte überlegt, ob er diesem Thüringer und Protestanten, von dessen Waffenrock irgendwann während des Sommers in Dänemark das Parteiabzeichen verschwunden war, einen Vortrag über gewisse Eigentümlichkeiten stockkatholischer Bauernländer halten solle, hatte es dann gelassen. Er beschränkte sich darauf, einer möglichen Neigung Kammerers zur Denunziation die Spitze abzubrechen, indem er sagte: »Na, solange der alte Herr so was nur zu Ihnen sagt, redet er sich ja nicht um Kopf und Kragen.« Er wußte, daß er sich auf Kammerers Neigung zur Subordination verlassen konnte; Kammerer würde nie etwas tun, von dem er vermutete, es passe seinem jeweiligen unmittelbaren Vorgesetzten nicht in den Kram.
[32] Geheimniskrämerei
»Ich hoffe aber, du verläßt dich nicht auf ihn, wenn es um deinen Plan geht«, hat Käthe Lenk einmal zu Major Dincklage gesagt. »Da hört sein Hang zum Gehorchen nämlich auf. Wenn du Kammerer nur eine Andeutung machst, bist du geliefert.«
Dincklage, dem es ungewohnt war, von einer Frau taktische Ratschläge zu erhalten, erwiderte kurz: »Wenn alles klappt, wird Kammerer von der Aktion genauso überrascht werden wie das gesamte Bataillon.«
Dementsprechend wird Kammerer in der Erzählung kaum noch eine Rolle spielen, von einer Episode im Abschnitt Schreibstuben-Vorgänge abgesehen. Von allen Angehörigen des 4. Bataillons im 3. Regiment der 416. Infanterie-Division (›Dincklages Männern‹) wird einzig der Obergefreite Reidel ein Stück Ahnung von dem zugeteilt erhalten, was da im Busch war.
Westlich des Limes
Bei einem Vergleich zwischen Major Dincklage und Captain Kimbrough fällt sofort auf, daß einige Merkmale des ersteren nicht so genau bestimmt werden können wie die entsprechenden des letzteren. Sie bleiben unscharf. Während beispielsweise die Divisionsnummer Kimbroughs – die Nummer der Division, der er nicht angehörte – authentisch bezeichnet werden kann, handelt es sich bei derjenigen Dincklages um [33] eine reine Annahme. Ähnlich verhält es sich mit einigen Anschauungen der beiden Offiziere. Für Dincklage typisch ist es, daß nicht in Erfahrung zu bringen war, wie er über das Problem der Kapitulation im Osten dachte, indessen kein Zweifel darüber besteht, daß Kimbrough, wäre ihm bekannt geworden, was Churchill täte, wenn er ein Deutscher wäre, nur den Kopf geschüttelt hätte. Von der Lektüre der Notiz des Feldmarschalls Viscount Alanbrooke aufblickend, hätte er zu Bob Wheeler, dem G-2 des Regiments, gesagt: »Wenn Churchill ein Deutscher wäre, würde er also genau das tun, was Hitler von ihm erwartet!«
Die – imaginäre – Antwort Wheelers lautete: »Ich vermute, daß die Nazis nur von jemand geschlagen werden können, der imstande ist, sich in ihr Denken zu versetzen. – Falls man so etwas noch Denken nennen kann«, ergänzte er immerhin noch.
»Das glaube ich nicht«, hätte Kimbrough erwidert. »Man kann sie nur schlagen, wenn man ihr Denken grundsätzlich nicht annimmt.« Mit jener Messerschärfe, die er manchmal aufbrachte – er war im Zivilberuf Anwalt –, würde er hinzugefügt haben: »Übrigens sind es nicht die Engländer, die die Deutschen schlagen, sondern wir und die Russen.«
Bei der Fortsetzung dieser Unterhaltung kann auf Konditionalsätze verzichtet werden, denn sie hat stattgefunden. Kimbrough selbst hat darüber berichtet, und zwar in jenem Gespräch mit Schefold, in dem er ihm eingestehen mußte, daß das Regiment es, nach Rücksprache mit der Division, ablehne, auf Dincklages Pläne einzugehen. »Sie wissen ja, daß ich mit Major Wheeler befreundet bin. Er war mit mir bei dem Colonel drinnen. Als wir wieder rauskamen, sagte er zu mir: ›Hör mal, John, du machst einen Fehler. Du bildest dir ein, wir seien hier, um die Deutschen oder irgendwen sonst von diesem Monster zu befreien.‹ Er fing an, mir zu beweisen, daß [34] wir Amerikaner nicht in Europa seien, bloß weil irgendein europäisches Volk sich als Staatsform die Diktatur gewählt habe. Ich unterbrach ihn und sagte, das hätte ich auch nie angenommen. Er war ziemlich überrascht und fragte mich, was ich glaubte, warum wir hier seien. Ich sagte: ›Weil wir Lust haben, einen Krieg zu führen.‹ ›Das ist natürlich Unsinn‹, sagte er. Und er bewies mir wieder einmal, daß er Professor für mittelalterliche deutsche Literatur ist. ›Wir sind hier, weil wir die Römer des 20.Jahrhunderts sind‹, sagte er. ›Wir sind nicht so fein, nicht so kultiviert wie die Griechen, die wir verteidigen, aber zweifellos errichten wir einen Limes.‹ Ich fragte ihn, wer die Barbaren seien, gegen die er seinen Limes errichten wolle, und er sagte prompt: ›Die Russen.‹«
»Jetzt habe ich einen Grund mehr dafür, anzunehmen, wir hätten nicht herüberkommen sollen«, sagte Kimbrough zu Schefold.
Beifall von der falschen Seite
»Ein konsequenter Kopf, dieser amerikanische Professor«, sagte Hainstock, als Schefold ihm – bereits am nächsten Tag – über sein Gespräch mit Kimbrough berichtete. »Er denkt natürlich in Kategorien des Überbaus. Geisteswissenschaft: nennen sie das. Aber immerhin …«
Für den alten Marxisten Wenzel Hainstock ist es bezeichnend, daß er auf Wheeler rekurriert, während er Kimbroughs Bemerkung über die Lust am Kriegführen glatt überhört, so daß er sie auch Käthe Lenk nicht übermittelt, die – das ist anzunehmen – der Behauptung des Mannes aus Georgia spontan zugestimmt hätte.
[35] Adverb und Adjektiv
Aus einem Gespräch zwischen Wenzel Hainstock und Käthe Lenk: Nachdem er ihr die Imperialismus-Theorie auseinandergesetzt hatte, wandte sie ein: »Aber daran stimmt irgend etwas nicht. Die kapitalistischen Staaten haben sich heute mit der Sowjetunion verbündet, um Hitler zu schlagen. Also: Monopolkapitalismus mit Sozialismus gegen Faschismus, der, wie du sagst, nichts weiter ist als die Staatsform, zu welcher die Monopole greifen, wenn sie in eine ökonomische Krise geraten.«
»Dieser Krieg«, sagte Hainstock, »ist der Krieg eines kranken Gehirns. Hitler ist für den Kapitalismus untragbar geworden. Er diskreditiert die bürgerliche Gesellschaftsordnung, zeigt ihre Grundlagen zu offen.«
Sie war Deutschlehrerin, hatte zuletzt am Régino-Gymnasium in Prüm unterrichtet. Sie stieß sich an dem Wort ›untragbar‹.
»Du meinst unerträglich«, sagte sie.
»Meinetwegen«, sagte er, irritiert.
»Es ist ein großer Unterschied«, sagte sie, »ob man jemand für untragbar hält oder ob einem jemand unerträglich ist. Für meinen Vater zum Beispiel war Hitler einfach unerträglich.«
Ihr Vater hatte sogar zu verhindern gewußt, daß sie im BdM Dienst tun mußte, ihr später geraten, sich um den Eintritt in den NS-Studentenbund irgendwie herumzudrücken. Er war Werkzeugmaschinen-Vertreter gewesen, ein Mann, den sein Beruf zwang, sich umzuhören, sich auf alle möglichen Menschen einzustellen, Verständnis nicht nur zu heucheln. Dabei war er nicht eigentlich ein toleranter Mensch gewesen; Käthe hatte ihn eher als streng, trocken, skeptisch in Erinnerung. [36] Für ihre Mutter war er vielleicht nicht immer ein nur angenehmer Mann gewesen; etwas scharf Schattenhaftes hatte ihn begleitet, wenn er, gebückt unter dem Ansatz eines Buckels, durch das Haus am Hanielweg ging, eine Zeitung in der Hand, auf der Suche nach der Zigarre, die er in irgendeinem der zahlreichen Aschenbecher liegengelassen hatte. Ihre Mutter war schlank gewesen, dunkel, hübsch, immer aufgelegt zu lachen.
Wenn sie sich an ihre Eltern erinnerte, fand Käthe es unmöglich, zu glauben, daß das, was das Ungeheuer machte, die Grundlagen des Denkens von Bürgern enthüllte.
Strategische Studie
»Wie dem auch sei«, bemerkte Hainstock, nachdem er sich Schefolds Bericht über Kimbroughs Gespräch mit Wheeler angehört hatte – oder beendete er damit seine Diskussion mit Käthe über Lenins Imperialismus-These? –, »wie dem auch sei, die Amerikaner sind nur in den Krieg eingetreten, weil sie es nicht riskieren konnten, daß die Russen Hitler im Alleingang schlagen würden.«
Seinen Kohl bauen
Kimbrough hat keine privaten Gründe, wenn er Churchills Phantasie über sein Verhalten, wäre er ein Deutscher, instinktiv ablehnt. Er besitzt keine deutschen Vorfahren. Von [37] deutscher Geschichte und Kultur oder Anti-Kultur weiß er wenig. Sein Name weist auf schottische Einwanderer hin.
Die kleine Stadt Fargo liegt, darauf wurde schon hingewiesen, im Süden des Staates Georgia. Der Staat Georgia gehört zu den Südstaaten der USA. Mit seiner ›Südstaatlichkeit‹ hat Kimbrough motiviert, warum die Amerikaner seiner Meinung nach ›nicht hätten herüberkommen sollen‹. »Wir Südstaatler glauben, daß die USA sich nicht in die Welthändel hineinziehen lassen sollen«, hat er einmal zu Schefold gesagt. »Wir sind Isolationisten. Ich weiß nicht genau, warum wir Isolationisten sind. Vielleicht nur, weil die Yankees Anti-Isolationisten sind.«
»Außerdem sind wir Demokraten«, fuhr er fort. »Ich komme aus einer alten demokratischen Familie. Alle Leute in Fargo haben Roosevelt gewählt. Jetzt sind wir sehr enttäuscht darüber, daß Roosevelt uns in diesen Krieg verwickelt hat.«
»Ich bin nicht enttäuscht«, sagte Schefold. »Ohne Roosevelt würde Hitler neunzig Jahre alt werden.«
»Schafft euch euren Hitler doch selber vom Hals!« sagte Kimbrough, nicht grob, aber mit juristischer Kälte.
Schefold rätselte daran herum, warum ausgerechnet dieser Isolationist bereit war, für Dincklages Vorhaben einiges zu riskieren, während die ihm Vorgesetzten Offiziere, Militärs, die für Roosevelts Kriegsziele wahrscheinlich das größte Verständnis aufbrachten, den Plan des Majors glatt ablehnten.
[38] Anläßlich Schefolds?
Die Schlacht in den Ardennen wurde gewonnen und dem Feind eine schwere Niederlage zugefügt – durch vorzügliche Stabsarbeit, die im Felde von fähigen Befehlshabern unterstützt wurde, durch heroische Verteidigung, besonders von Saint-Vith und Bastogne, und durch die schnelle und meisterhafte Bereitstellung und Heranführung von Reserven. Alle diese Taten sind besungen worden und werden in den militärischen Annalen fortleben, aber die Zersetzung des feindlichen Plans, seine Verzögerung, von der sich der Feind niemals ganz erholt hat, wurde von anonymen Männern, anonymen Gruppen herbeigeführt, oftmals von Herumstreifern (stragglers) ohne feste Absichten, deren Aktionen immer unbekannt bleiben werden. (R. W. Thompson, Montgomery The Field Marshal, London 1969, S.244)
[39] Der Major Dincklage
[41] Biogramm
Joseph Dincklage, geb. 1910 in Meppen (Emsland) als einziger Sohn des Ziegeleibesitzers Joseph Dincklage und dessen Frau Amalie, geb. Windthorst, katholisch getauft, Abitur (1929) des Salesianer-Gymnasiums in Meppen, Studium von 1930 bis 1936 in Heidelberg, Berlin, Oxford (Nationalökonomie, Sprachen), kurzes Gastspiel in der Industrie (betriebswirtschaftliches Praktikum bei der DEMAG, Duisburg). Nach eingehenden Gesprächen mit seinem Vater, der ihn wegen seiner Branchen-Erfahrungen (Westwall-Konjunktur) über die Kriegsvorbereitungen informieren kann, beschließt der damals 28jährige Joseph Dincklage, Offizier zu werden, um, wie er sich ausdrückt, »den Nationalsozialismus auf halbwegs saubere Art zu überwintern«. (Dincklage senior, Katholik strenger Observanz, rät ihm davon ab. »Geh lieber wieder nach Oxford!« sagt er. »Oder noch besser in die USA! Ich werde schon dafür sorgen, daß das Pack mir deswegen nicht an den Wagen fährt.« Aber der Sohn geht auf diesen Vorschlag nicht ein.) Seit 1938 verschiedene Kriegsschulen, bei Ausbruch des Krieges Fähnrich, im Frühjahr 1940 Leutnant (Oberrheinfront), 1941/42Oberleutnant und Hauptmann (Afrika), 1943 Ritterkreuz und Ernennung zum Major (Sizilien), vom Herbst 1943 bis Herbst 1944 bei der Besatzung in Paris und Dänemark.
Unverheiratet, doch eher aus Mangel an Gelegenheit, infolge zu häufigen Ortswechsels. Als Siebzehnjähriger beginnt er ein über drei Feriensommer sich erstreckendes Verhältnis mit einer um fünf Jahre älteren und verheirateten Bäuerin aus der Grafschaft Bentheim. Die Erinnerung daran [42] erschwert es ihm, die üblichen Beziehungen zu Kommilitoninnen anzuknüpfen, besonders während der ersten Universitätsjahre. Flüchtige Begegnungen, gelegentlich ernsthafte, doch nicht anhaltende Interessen.
Dincklage ist 1,72 groß, also knapp unter Mittelgröße, von jener Schlankheit, die einfach darauf beruht, daß er kein Gramm Fett ansetzt (›drahtig‹). Dunkelblonde glatte Haare, graue Augen, gerade Nase mit breitem Nasenrücken, die Nase selbst setzt jedoch schmal an, langer Mund, Augen, Nase und Mund sind innerhalb des mageren, gleichmäßig bräunlich gefärbten Gesichts gut verteilt. Gleichgültiger Esser, Trinken und Rauchen (Zigaretten) streng dosiert.
Momente
Das leichte Sich-Senken der meadows zur Themse. Die Lese-Nachmittage in der Bodleian Library. Die Diskussionen über die Entstehung des Sozialprodukts, die lauten Streitereien über Keynes im Seminar von Professor Talboy, während das Licht vor den Fenstern von Merton College sich verwandelte: von Graugrün in Blaugrau. Wenn er nach Oxford zurückginge, würden ihn die Engländer bei Kriegsausbruch eine Weile internieren, später freilassen. Er konnte dann in aller Ruhe seine Arbeit über Funktionsveränderungen des Geldes im 16.Jahrhundert beenden. Stille, das Rascheln von Papier, lautloses Denken, die Glockenspiele über der High.
Er konnte sich das alles vorstellen. Er konnte es sich nicht vorstellen. Aus dem Fenster des Büros, in dem er mit seinem Vater sprach, auf den Komplex der Ziegelöfen blickend, sagte er: »Ich will doch lieber Offizier werden« und, sich einen [43] Anschein von Vernünftigkeit gebend: »Wenn schon Soldat, dann lieber Offizier als gewöhnlicher Muschkote.«
Acht Jahre später, in Winterspelt, sagte Käthe Lenk zu ihm, sie wolle nach Lincolnshire. Die einfache und entschiedene Art, in der sie diese Bemerkung machte, ließ ihm plötzlich seinen Verzicht auf England als den größten Fehler seines Lebens erscheinen. Sie gab keine Erklärung dafür ab, warum es ausgerechnet Lincolnshire sein müsse, erzählte nur, wie sie an den Namen dieses englischen Landstrichs geraten war. Da er einmal einen Ausflug nach Lincolnshire gemacht hatte, begann er, ihr die Gegend zu schildern, brach ab, als er bemerkte, daß sein Bericht sie nicht interessierte.
»Ich hätte mich in Lincolnshire einnisten und dort auf dich warten sollen«, sagte er dann. »Du wärest gekommen.«
Sie sagte nichts, ließ nicht erkennen, ob auch sie es wünschte, ihm dort begegnet zu sein.
Wenn ich aber in England geblieben wäre, widersprach er sich, in Logik zurückfallend, hätte ich Käthe Lenk nicht getroffen.
Diese Verknüpfung von Zufällen erschien ihm in jenem Augenblick, ganz im Gegensatz zu seinen sonstigen Überzeugungen, wie ein Schicksal.
Zu Käthe, weil sie, wie er bemerkt hatte, obwohl sie den Krieg haßte, doch von seinem Ritterkreuz beeindruckt war: »Nordwestlich Syrakus griffen die Amerikaner mit einem starken Tankverband an. Ich stand wieder einmal auf dem linken Flügel.« Er unterbrach sich. »Immer stehe ich auf dem linken Flügel«, sagte er, »der linke Flügel verfolgt mich.« Dann fuhr er fort: »Eigentlich war der Tankverband so, daß man nur abpfeifen und sich verdünnisieren konnte. Aber ich hatte damals einen MG-Zug in meiner Kompanie, und die [44] Kerle blieben einfach in ihren Löchern und dezimierten die begleitende Infanterie derart, daß die Panzer auf einmal stehenblieben und dann abdrehten. Eigentlich hätte das Ritterkreuz dem Führer dieses MG-Zuges, einem Oberfeldwebel Bender, verliehen werden müssen. Ich kam in die Stellungen dieses Zuges erst, als das Schlimmste schon vorbei war, konnte Bender nur noch gratulieren. Aber in unserem Verein bekommt immer irgendein Vorgesetzter den Lohn. Als ich den Orden für Bender reklamierte, winkte der Bataillonskommandeur nur müde ab. ›Im operativen Rahmen‹, sagte er, sehr von oben herab, ›hat Ihr linker Flügel, Herr Dincklage, diesen gefährlichen Einbruch abgewehrt.‹ – Das ist die Geschichte, wie ich an die Blechkrawatte gekommen bin«, schloß Dincklage seinen Bericht. »Ihr Zivilisten«, sagte er, »macht euch ganz falsche Vorstellungen über Ordensverleihungen. Ich bekomme jedes Vierteljahr für das Bataillon soundsoviel EKS zugeteilt, und natürlich verteile ich sie in erster Linie an die Chargen, weil ich sie bei Stimmung halten muß. Auf diese Weise wird ein Küchen-Unteroffizier EK-1-Träger.«
»Ich Zivilistin«, sagte Käthe, »bin sehr dafür, daß man nicht Scharfschützen, sondern Köche auszeichnet.«
Er konnte nicht aufhören, sich darüber zu wundern, daß ihm wie auch jetzt in Winterspelt – immer der linke Flügel zufiel. Schon als Junge war er bei den Bandenkämpfen, zu denen sich das Gelände der Ziegelei so hervorragend eignete, jeweils zum Anführer der linken Abteilung ›seiner‹ Bande gemacht worden – eine Anführer-Rolle mußte man ihm geben, weil er ja, mit Einwilligung seines Vaters, den Kriegsschauplatz (nach Betriebsschluß) zur Verfügung stellte –, und er erinnerte sich, wie er stets, gefolgt von unterdrückt schnaufenden, mit Latten und Stöcken bewaffneten Knaben, [45] die Wände der links gelegenen Öfen und Schuppen entlanggeschlichen war, hinter den Ecken der linken Gevierte aus trocknenden oder schon gebrannten Ziegeln dem Gegner aufgelauert hatte. Das Licht war immer ein Abendlicht gewesen, das aus dem durchsichtigen Himmel, der über den Emsland-Mooren stand, in die von Lehmgelb und Backsteinrot eingefaßten Gänge fiel, in Dämmerungen aus Ziegelstaub; es besorgte, daß die Zusammenstöße der Banden glimpflich verliefen, verwandelte die Kämpfe in Scheinkämpfe, Schattenboxen. Die Ermahnung von Dincklages Vater, sie sollten es nicht zu toll treiben, war unnötig.
In politischer Hinsicht hat Dincklage bei sich niemals einen Linksdrall feststellen können. Während seines Aufenthaltes in Oxford wich er Diskussionen über den Spanienkrieg, der damals (im Winter 1936/37) auf seinem Höhepunkt war, so gut es eben ging, aus. Er war so wenig links, daß er sogar die Sowjetunion verteidigte, wenn englische Studenten sie kritisierten, weil sie in Spanien nicht, wie Deutschland und Italien, militärisch intervenierte, sondern nur Waffen lieferte. »Die Russen rechnen eben mit längeren Zeiträumen«, sagte er. Den Vorwurf, er rede damit denen das Wort, die nichts täten, steckte er ein.
Apropos Emsland: natürlich war Dincklage elektrisiert, als Käthe ihm erzählte, sie habe auf ihrer Reise nach dem Westen auch das Emsland kennengelernt, sei sogar im Bourtanger Moor ›herumgestiefelt‹, wie sie sich ausdrückte.
»Sind Sie auch in Meppen gewesen?« fragte er. (Das Gespräch fand während eines sehr frühen Stadiums ihrer Bekanntschaft statt, als Dincklage und Käthe sich noch nicht duzten.)
Sie nickte. »Ich vermute, ich bin überall gewesen«, sagte sie. »Wenn Sie von Meppen aus ins Moor gegangen sind, [46] müssen Ihnen die großen Ziegeleien aufgefallen sein. An der Straße nach Wesuwe.«
Sie zuckte die Achseln. Vielleicht war sie eine andere Straße gegangen.
»Sie gehören meinem Vater«, sagte er. »Schade, daß wir uns erst jetzt kennengelernt haben. Sie hätten meine Eltern besuchen, bei ihnen wohnen können.«
Sie wußte nicht, was sie erwidern sollte. Wenn sie nicht alles täuschte, hatte sie einen Heiratsantrag erhalten, den ersten der beiden Anträge, die Dincklage ihr gemacht hat, wie sie später erkannte. Der erste war zu früh gekommen, der zweite zu spät.
»Meppen ist eine hübsche Stadt«, sagte er. »Haben Sie das Rathaus und die Gymnasialkirche gesehen? Eine der feinsten Baugruppen, die es in ganz Norddeutschland gibt!«
Sie brachte es nicht übers Herz, ihm zu sagen, daß Orte wie Meppen (und alle anderen Stationen ihrer Reise) sie an nichts weiter erinnerten als an Bouletten aus Gemüseresten, Grießsuppe, Brot mit Rübenkraut, Bier, Ersatzkaffee, an den stockigen Geruch von Zimmern, deren Wände mit brauner oder grüner Ölfarbe angestrichen waren, an stumme Nächte, in denen sie immer zu früh ins Bett gegangen war.
Aber sie ersparte es ihm nicht, ihm von den merkwürdigen Regionen zu berichten, an deren Grenzen sie in den Emsland-Mooren geraten war. Dort war sie auf bewaffnete Patrouillen gestoßen, die ihren Ausweis kontrollierten und sie, ohne Angabe von Gründen, auf der Straße zurückschickten, die sie gekommen war. Als sie Major Dincklage von dem Gebrauch erzählte, den man von seiner Heimat machte, rezitierte er eine Litanei. »Börgermoor«, sagte er, »Esterwegen, Aschendorfer Moor, Neusustrum«, und er schloß tatsächlich mit dem Wort ›Amen‹, stieß es aber aus wie einen Fluch.
[47] Afrika, Sizilien, Paris verwirrten ihn. Zwar sammelte er Eindrücke, verbot sich aber jeglichen Tourismus. An Offiziers-Ausflügen in die Cyrenaica, nach Segesta oder Chartres nahm er nicht teil, blieb lieber im Zelt oder in der Unterkunft, stand bei Gesprächen über Archäologisches oder Kunsthistorisches abrupt auf, verzog bei den immer schaler schmeckenden Witzen über das ›Reisebüro Deutsche Wehrmacht‹ nicht einmal die Lippen. Er konzentrierte sich völlig auf den Dienst. Einmal sagte sein Bataillonskommandeur, in Afrika, nachdem er ihn während eines Kasino-Abends beobachtet hatte, zu ihm: »Also wissen Sie, Leutnant Dincklage, Lebenskünstler sind Sie keiner!«
Nach einem Gefecht bei Benghasi (am 5.Februar 1941, das Datum hat er sich gemerkt) stieß es ihm zu, daß er lachen mußte, weil einige Männer seiner Kompanie, die auf dem Wüstensand lagen, überweht von den Staubfahnenschleiern der sich sammelnden Panzer, nicht sogleich wieder aufstanden und sich den Sand von den Uniformen klopften. Er kam erst wieder zu sich, als er bemerkte, daß Soldaten, die in seiner Nähe standen, ihn entgeistert anstarrten, weil sie annahmen, er lache über die Gefallenen. Dieses Gefecht war keineswegs seine Feuertaufe gewesen, er hatte sich längst an den Anblick von Toten gewöhnt; was ihn überwältigt hatte, war ein plötzliches Gefühl von Unwirklichkeit gewesen. Spätere Anfälle solcher Art kamen aus harmloseren Anlässen, waren meistens von déjà-vu-Erlebnissen begleitet. Beispielsweise nahmen die Zelte unter den Palmen von Martubah nicht nur zehn sonderbare Minuten lang die Konsistenz von Hirngespinsten an, er hatte sie auch schon einmal gesehen, er wußte nur nicht, wann. Oder eine Dorfstraße in der Nähe von Ragusa, die nicht aus zerbröckelnden sizilianischen Häusern, sondern aus irgendeinem wesenlosen Stoff bestand – und das, [48] während er sie an der Spitze eines Stoßtrupps durchkämmte! erinnerte ihn an die gleiche Straße, die er doch vorher nie betreten hatte, nicht einmal im Traum. Er prüfte sich unter philosophischem Aspekt, konstatierte, daß er für jene idealistisch-romantischen Gedankengänge, die Seiendes für ein Trugbild hielten, niemals etwas übrig gehabt hatte. Er war immer Realist gewesen.
In Paris konsultierte er einen Stabsarzt, von dem es hieß, er sei auch psychiatrisch ausgebildet. Der Medizinmann, zu Beginn angesichts Dincklages Ritterkreuz denkbar vorsichtig, ließ sich, nachdem er seinem Gegenüber auf den Zahn gefühlt hatte, schließlich doch herbei, zu erklären: »Natürlich haben Sie eine hübsche kleine Neurose, Herr Kamerad. Aber die ist heutzutage ja eher ein Zeichen von Gesundheit. Mir ist eher um die Herren angst und bange, die keine haben, weil sie alles, was sie erleben, ganz normal finden. Die Traumata, die sich da noch einstellen werden – na, ich danke!« Dincklage begriff, daß der Arzt ihm mitgeteilt hatte, er litte an einer Kollektivneurose. Sie vereinbarten eine weitere Besprechung, aber Dincklage ging nicht mehr hin, weil der Arzt beim Abschied zu ihm sagte: »Wenn ich Ihnen inzwischen schon mal einen Rat geben darf: suchen Sie sich eine nette Freundin, falls Sie das nicht schon getan haben!« Das hieß, seinen Fall denn doch zu sehr bagatellisieren, dachte Dincklage. Er wußte nicht, daß Dr.K. auf das Karteiblatt, das er anlegte, nachdem Dincklage gegangen war, schrieb: Schizophrenie-Schübe seit 1941. Wahrscheinlich eine Fehldiagnose! Die Halluzinationen, von denen Dincklage ihm berichtet hatte, waren keine Symptome einer beginnenden Spaltung des Bewußtseins. Dincklage war nicht schizophren, sondern schizothym, d.h. bloß hoch empfindlich.
[49] Gegen die Cox-Arthrose, die auch in Afrika begonnen hatte, nahm Dincklage seit ein paar Wochen ein neues Corticoid-Präparat ein, das der Stabsarzt bei der Division, Dr.H., an ihm ausprobierte. Es half ihm, hielt die Schmerzen wenigstens untertags von ihm fern. Er vermied es, seine Arznei in der Bataillons-Schreibstube einzunehmen, sich zu diesem Zweck ein Glas Wasser bringen zu lassen, obwohl er sich nichts vormachte: Spieß und Schreiber registrierten es, wenn er sich in der Küche ein Glas Wasser abfüllte und damit nach oben ging, in das Zimmer, in dem er sich sein Feldbett hatte aufstellen lassen.
Immer wenn er seine Tabletten schluckte, um elf Uhr am Vormittag, wurde das Dröhnen der Flugzeuge unüberhörbar. Dincklage trat ans Fenster, öffnete es. Die Geschwader flogen in großer Höhe nach Osten. Dincklage versuchte, auszurechnen, wieviele Staffeln Abfangjäger nötig wären, um Bomber-Verbände dieser Stärke zu zerstreuen. Wenn wir überhaupt noch Jäger hätten, dachte er, müßten sie die Amerikaner schon über Belgien abfangen. Statt dessen konnten die Amerikaner es sich leisten, ohne Jagdbegleitschutz zu fliegen. Dincklage regte sich über diese Zustände am Himmel nicht mehr auf, weil er sie schon 1943 in Sizilien und Anfang dieses Jahres in Frankreich erlebt hatte. Er wunderte sich nur darüber, daß er Satzteile wie wenn wir noch Jäger hätten oder den Namen Hermann Göring noch immer nicht ohne Erbitterung denken konnte. Anstatt mich über den ganzen Saustall zu freuen, dachte er. Schon das winzige Wort wir ist falsch. Was ich, vollständig automatisch, denken müßte, ist: sie haben keine Jäger mehr.
Den Himmel über Winterspelt betrachtend, wünschte er sich, ehe er das Fenster schloß, nach Dänemark zurück. In Dänemark war der Himmel leer gewesen. Die Felddienst [50] Übungen auf der Heide von Randers waren abgelaufen wie Gedichte. Den Kompanieführern konnte man den Wink geben, Ausmärsche an den Badeplätzen stiller Ostsee-Sunde enden zu lassen. Man selber schlenderte währenddessen durch eine Allee, war imstande, sich vorzustellen, man würde den Rest des Krieges damit zubringen, Strohdächer und Phlox zu betrachten.
Der Phlox erlosch ja ziemlich schnell, aber nicht einmal die Nachricht vom 20.Juli riß Dincklage gänzlich aus seinen Illusionen, auch wenn Oberst Hoffmann danach immer unleidlicher wurde. (Der Divisioner, General von C., hatte es sorgfältig vermieden, in seiner Ansprache vor den Offizieren das Wort ›Verräter‹ zu gebrauchen. Er hatte bloß von unverantwortlichen Elementen gesprochen, und noch dazu in einem Ton, der sich von einer Manöver-Kritik nicht unterschied.) Träumereien, Phantome. Die 416. Infanterie-Division, zu der man Dincklage im Frühjahr von Paris aus versetzt hatte, war keine Division, dazu bestimmt, in Dänemark vergessen zu werden.
Das halb städtische Einfamilienhaus, grau verputzt und charakterlos inmitten der weiß gekalkten Höfe, der rohen Bruchsteinställe des Dorfes Winterspelt, war schon von der Einheit, die sie abgelöst hatten, als Stabsquartier requiriert worden. Diese Einheit, die zur 18. mot. Division gehörte, hatte den ganzen Rückzug durch Nordfrankreich und Belgien mitgemacht, bis sie Anfang September im buchstäblich ersten deutschen Dorf hinter der Grenze zum Stehen gekommen war. Aus irgendwelchen Gründen hatten die Amerikaner nicht mehr nachgerückt. »Ich vermute, sie haben Nachschubschwierigkeiten«, hatte der Major gesagt, den Dincklage ablöste. »Dabei hätten sie uns bis zum Rhein jagen können, ohne weiteres bis zum Rhein, so fertig wie wir [51] waren.« Und er hatte begonnen, Geschichten vom Kessel von Falaise zu erzählen, dem die 18. mot. knapp entgangen war.
Er war in düsterer Stimmung gewesen, weil sein Verband, wie er behauptete (natürlich ohne es genau zu wissen), nach Rußland ginge. Er hatte Dincklage gratuliert. »Hier geht es zu wie im Herbst 1939. Wo waren Sie damals?« »Am Oberrhein.« »Na, dann wissen Sie ja Bescheid. Ein bißchen Aufklärung, ab und zu wird geballert, aber sonst? War doch ein komischer Krieg damals, finden Sie nicht?« Dincklage bestätigte es. »Sollte mich gar nicht wundern«, sagte Major L., »wenn der Krieg ebenso komisch aufhören würde, wie er angefangen hat. Wenn Sie Glück haben, Herr Kamerad, erleben Sie hier den Waffenstillstand.« Dinklage sah ihn an, als habe er einen Irren vor sich; dann lenkte er vom Thema ab. »Ich glaube nicht«, sagte er, »daß Sie nach Rußland gehen. Soviel ich weiß, bleibt Ihre Division dem dreiundfünfzigsten A. K. unterstellt.«
Er riet nur; wollte nichts weiter als dem anderen etwas Nettes sagen. Als seine Vorhersage eintraf und die 18. mot. nicht nach Rußland, sondern nur bis Koblenz kam (Bereitstellung für das Unternehmen, das damals aus Tarngründen noch Wacht am Rhein hieß), erwog der Major L. einige Tage lang, eine Meldung gegen Dincklage zu machen, wegen unverantwortlicher Preisgabe eines ihm offenbar bekannt gewesenen Operationsbefehls (Verstoß gegen den soeben nachdrücklich erneuerten Führerbefehl No. 002252/42 über die Geheimhaltung), ließ es dann aber bleiben, weil er erstens befürchtete, Dincklage würde in seiner Rückmeldung auf dem von ihm leichtfertig benutzten Begriff ›Waffenstillstand‹ herumreiten, zweitens von Natur aus ein bequemer Herr war.
[52] Wenn Dincklage, in der Unterhaltung mit anderen Offizieren, gelegentlich von seinen Männern spricht – »meine Männer brauchen bessere Verpflegung« o.ä. –, so klingt das besitzanzeigende Fürwort in seinem Munde immer so, als setze er es in Anführungszeichen. Der Regimentskommandeur, Oberst Hoffmann, ein Alles-Merker, hat ihn deswegen schon einmal angepfiffen. (»Ich verbitte mir diesen Ton, Herr Dincklage!« – »Jawohl, Herr Oberst!« – »Diese Männer sind wirklich Ihre Männer. Ich verlange, daß Sie das begreifen!« – »Ich werde mich bessern, Herr Oberst.«)
»Wenn ich verheiratet wäre«, hat er einmal zu Käthe gesagt, »würde ich den Ausdruck ›meine Frau‹ nur ungern gebrauchen.«
»Das hat dir natürlich Eindruck gemacht«, sagte Hainstock, als Käthe ihm diesen Ausspruch wiedergab. »Er weiß genau, womit er auf dich Eindruck machen kann.« Im allgemeinen vermied Hainstock es, seine Eifersucht zu zeigen.
Das Wort ›Feind‹ verwendet Dincklage genau so vorsichtig-zweifelnd wie die Possessiv-Pronomina. Er schätzt an Oberst Hoffmann, daß dieser niemals vom Feind, sondern immer nur vom Gegner spricht, außer wenn er um technische Bezeichnungen wie ›Feindlage‹ nicht herumkommt. »Für Sie genügt es ja, Ihre unmittelbare Feindlage zu kennen«, sagt er beispielsweise zu Major Dincklage, wenn dieser die Luftwaffe kritisiert. »Ihre Männer liegen auf den östlichen Höhen über dem Our-Tal, die Amerikaner auf den westlichen. Es bleibt Ihnen unbenommen, Stärke und genaue Position des Gegners festzustellen. Ich bitte mir aus, daß Sie Ihre Männer in dieser Hinsicht auf Trab halten.« Gerade in dieser Hinsicht hielt Dincklage ›seine‹ Männer nicht auf Trab; in seiner Frontlage (Trennung der Hauptkampflinien durch einen [53] Fluß) hielt er Spähtrupp-Tätigkeit zur Erkundung des Gegners für riskante und zwecklose Indianerspielerei; manchmal entsandte er einen Spähtrupp in das schwer zu kontrollierende Waldtal, das Schefold benützte, wenn er hinter die deutschen Linien kommen wollte. »Wäre es nicht empfehlenswert, den Viadukt bei Hemmeres zu sprengen, Herr Oberst?« fragte er. »Ich habe das der Division vorgeschlagen«, sagte Hoffmann, »es liegt ein ausdrücklicher Gegenbefehl vom A. K. vor. Das Ding soll stehenbleiben.« »Aha«, antwortete Dincklage. Die spöttische, ja verächtliche Färbung, die er den beiden, durch einen Hauchlaut getrennten Vokalen verlieh, konnte der Major sich herausnehmen, weil der Ton, in dem der Oberst gesprochen hatte, keinen Zweifel daran ließ, wie er über den operativen Gedanken dachte, der dem Stehenlassen des Dings zugrunde lag. Hoffmann bremste den Prozeß ihrer Übereinstimmung sogleich ab. »Sie scheinen manchmal zu vergessen, daß es Ihnen verboten ist, Schlüsse zu ziehen, Herr Dincklage«, sagte er. Er wandte sich ab. »Außerdem bin ich ja froh«, sagte er, »über jede Brücke, die jetzt noch stehenbleibt.«
Zu Dincklages, von Oberst Hoffmann angesprochenem, Disziplin-Verstoß: Auf Befehl des Herrn Chefs des Generalstabs des ob West wurde der Unteroffizier Rudolf Dreyer von der Führ.-Abt. des OB West am heutigen Tage in bestimmte Arbeiten, zu denen er Schreibhilfe zu leisten hat, eingewiesen. Unteroffizier Dreyer wurde darüber eindringlich ermahnt, zu niemandem über das, was er hört und schreibt, zu sprechen, auch keine Schlüsse aus dem Gehörten oder Geschriebenen zu ziehen. (Oberstlt. i. Gst. W. Schaufelberger, Geheimhaltung, Täuschung und Tarnung am Beispiel der deutschen Ardennenoffensive 1944, Zürich 1969, S.30)
[54] »Ich habe Meldungen«, berichtete Dincklage, »daß einzelne Amerikaner zur Our herunterkommen und dort Forellen angeln.« »Ah!« Hoffmann fuhr herum und sah ihn scharf an. »Und wie verhalten sich Ihre Männer?« »Ich habe den Eindruck, daß es ihnen schwerfällt, Leute, die angeln, unter Feuer zu nehmen.« »Das sind ja Zustände!« Der Oberst kicherte geradezu vor Empörung. »Herr Dincklage«, sagte er, »das Bataillon liefert mir spätestens übermorgen ein paar Forellen. Und danach hört dieser ganze Unfug natürlich auf!« »Ich bürge Ihnen dafür, Herr Oberst«, sagte Dincklage.
Ihn ärgerte die Angelei wirklich. Manchmal erwog er allen Ernstes, den amerikanischen Offizier, der diese Schlamperei bei seinen Leuten einreißen ließ, durch Funk zusammenzustauchen. (Das Regiment verfügte über einen Nachrichtenzug, der ständig damit befaßt war, die Frequenzen der Amerikaner anzupeilen. Im Oktober 44 bestand jedoch für die Westfront striktes Funkverbot.)
»Da hast du es«, sagte Hainstock, als Käthe ihm von Dincklages Wunsch erzählte, mit dem amerikanischen Kommandeur, der ihm gegenüberlag, Kontakt aufzunehmen. »Dieser Herr träumt noch immer von einem Krieg, der unter Offizieren geführt wird.« Er wunderte sich aber, daß Dincklage überhaupt militärische Probleme vor einer Frau ausbreitete. Vielleicht, dachte er, gehört es zu seiner Masche, an Käthe heranzukommen.
Die Our war ein fabelhafter Forellenfluß. Der Krieg war den Forellen der Our anscheinend glänzend bekommen. Die Angler der C-Kompanie – die meisten Soldaten der 106. Infanterie-Division stammten aus Montana, einem Land blitzender Bergflüsse – hatten geradezu sensationelle Fänge gemacht. Kimbrough hatte sie beneidet. Obwohl auf dem Lande aufgewachsen, war Kimbrough kein Angler; [55] sein Vater war enttäuscht gewesen, als er festgestellt hatte, daß es ihm unmöglich war, dem Jungen das Fischen beizubringen.
Als die Angler seiner Kompanie schließlich doch Zunder bekommen hatten, war Kimbrough fast erleichtert gewesen; er ließ die Kompanie antreten und verbot das weitere Betreten des Niemandslandes im Our-Tal, außer für militärische Unternehmungen, die er anordnen würde. Er mußte dafür sorgen, daß diese Angel-Affäre nicht ruchbar wurde. Der Bataillonskommandeur, Major Carter, würde ihn aufs schärfste kritisieren, dafür verantwortlich machen, daß seine Soldaten einer Schlamperei wegen, die er, Kimbrough, von Anfang an hätte verhindern müssen, unter Beschuß geraten waren. Da niemand getroffen worden war, konnte man die Sache vielleicht vertuschen.
Reidel war außer sich gewesen, als man ihn nicht in das Kommando aufnahm, das den Auftrag durchführen sollte, die amerikanischen Angler vom Ufer der Our zu vertreiben. Seine Meldung war zurückgewiesen worden. Er hatte sich beschwert. Feldwebel Wagner hatte die Achseln gezuckt und gesagt: »Tut mir leid, Reidel, aber diesmal kommen Sie nicht in Frage.« Und dann hatte Wagner zu Reidels maßlosem Erstaunen die größten Flaschen der Einheit (3. Zug der 2. Kompanie) ausgewählt, lauter Jungens – unter ihnen Borek –, die noch niemals bewegliche Ziele vor sich gehabt hatten. »Bewährungsaufgabe für Rekruten«, hatte Wagner gesagt, einigermaßen verlegen, »ausdrücklicher Auftrag vom Bataillon.« Als die Spunde am Abend ins Quartier zurückkehrten, hatte Reidel sie gefragt: »Na, wie viele habt ihr aufs Kreuz gelegt?« Er hatte das Geballer von seinem Schützenloch aus gehört, erbittert, weil man ihn nicht an diesem Scheibenschießen teilnehmen ließ. Statt dessen diese Flaschen! »Wissen wir doch [56] nicht«, hatte einer geantwortet. Aus ihren Mienen hatte er abgelesen, daß sie nichts als Fahrkarten geschossen hatten.
Schefold war froh gewesen, als die Angelei an der Our aufhörte. Er hatte es sich angewöhnt, den Talgrund von Hemmeres als neutrale Zone zu betrachten – als ›mein neutrales Gebiet‹, wie er zu Kimbrough sagte –, und deshalb die GIs, die unweit des Weilers zwischen Uferbüschen standen und fischten, immer mit Mißfallen betrachtet, als Kombattanten, die in eine Schweiz eindrangen, wenn auch nur, um Wassergetier zu wildern. Sie störten seinen Frieden. Jetzt waren sie verschwunden, und der Hof und die Wiesen lagen noch abwesender als sonst unter der Herbstsonne, die in das Tal fiel, von Schattenhängen umdrängt. Nur aus den Tunnel-Mündern zu beiden Seiten des Viadukts der längst stillgelegten Eisenbahn von Saint-Vith nach Burgreuland, der im nördlichen Hintergrund das Tal überspannte, erschienen manchmal, wie Kuckucke aus den Klappen sich öffnender Kuckucksuhren, die kleinen Figuren von Uniformierten, von links in Khaki, von rechts in Graugrün, wurden hergezeigt und automatisch wieder ins Schwarze zurückgezogen. Klapp, dachte Schefold, wenn das Schwarze sich hinter ihnen schloß. Schade, dachte er, daß es kein Glockenspiel dazu gibt, wie bei den Rittern am Schloßturm zu Limal.
Major Dincklage zeigt sich sehr interessiert, als Käthe Lenk ihm erzählt, Wenzel Hainstock sei Marxist. Er möchte ihn gerne kennenlernen, aber es kommt aus privaten Ursachen wie aus Gründen, die in der Technik politischer Untergrund-Arbeit liegen, niemals zu einer Begegnung Dincklages mit Hainstock. (Hainstock ist nicht sehr erbaut davon, daß Käthe dem Major überhaupt seinen Namen genannt hat. »Kein Glied in einer Kette«, sagt er, »darf den Namen des über [57] nächsten Gliedes wissen. – Nun ja, du hast das nicht wissen können«, fügt er hinzu, »woher solltest du auch wissen, wie man sich bei illegaler Arbeit verhält. Wenn du mir nur ein Wort gesagt hättest, ehe du …« Er schweigt, weil er bemerkt, daß Käthe ihr Gesicht mit den Händen bedeckt hat.)
Da die erste Hälfte von Dincklages Universitätsjahren noch in die Zeit der Weimarer Republik gefallen war – von Oxford ganz zu schweigen – und da er Nationalökonomie studierte, hatte er natürlich auch Marxismus-Studien betrieben. Neben Ricardo und Walras hielt er Marx für den Forscher, der die Bewegungsgesetze des Kapitalismus am reinsten dargestellt hatte, so rein, wie es überhaupt ging, denn in der Natur der Sache lag es, daß ein Rest blieb, der nicht aufzuklären war. Die Schilderung dieses Restes – des psychischen Antriebs der Ökonomie durch Leidenschaften – fand Dincklage bei Pareto. Er schwankte immer wieder zwischen Paretos zynischer Residuen-Lehre und Marx’ humanistischem Gedanken von der Selbstentfremdung des Menschen. Gerne hätte er sich vollständig zu letzterem bekannt, aber es gelang ihm nicht, sich davon zu überzeugen, die Selbstentfremdung würde durch eine bloße Veränderung im Besitz der Produktionsmittel aufgehoben.
Über das Interesse der großen Unternehmer an dem großen Geschäft mit dem Krieg gab er sich keiner Täuschung hin. (Sein Vater war in dieser Hinsicht ein weißer Rabe. Die Dincklageschen Ziegeleien zählten ja auch weiß Gott nicht zur Großindustrie.) Dennoch hielt Dincklage nicht dafür, daß ein Krieg wie dieser in der Absicht der von Marx vorausgesagten Monopole gelegen hatte. (Die aktuelle Weiterbildung von Marx’ Theorie der Akkumulation des Kapitals in Lenins Imperialismus-Thesen hatte er nicht mehr kennengelernt.) Mitsamt ihrer fabelhaften Intelligenz waren die Herren, die sie regierten, dennoch so schlichten Gemüts, daß [58] sie wähnten, sie könnten eine Kriegskonjunktur ohne Krieg haben. Sie wollten den Kuchen essen und ihn außerdem behalten. Aber von solchen subjektiven Kurzschlüssen abgesehen, entsprach der Weltkrieg, so glaubte Dincklage, nicht den Interessen und Tendenzen des Großkapitals. Ihnen entsprach – wenn man schon in Marxschen Kategorien dachte – viel eher eine sich immer mehr verfeinernde Weltausbeutung, eine Weltkultur der Ausbeutung sozusagen, ein Frieden in genußvoller Sklaverei bei hoher Gedankenfreiheit, aber nicht die Katastrophe.
Wenn aber dieser Krieg nicht aus quasi automatisch wirkenden Gesetzen der Ökonomie entstanden war, aus was dann? Dincklage zog sich, vor diese Frage gestellt, auf eine Minimal-Position zurück: der Mensch war ein Geschöpf aus Determiniertheit und Zufall. Er ließ sich ableiten aus Abstammung, Milieu, Erziehung, Konstitution und von vornherein in ihm angelegten psychischen Komplexen. Innerhalb dieser vorgegebenen Faktoren-Anordnung herrschte der reine Zufall, ja die Faktoren selbst waren Resultate zufälliger Vorgänge. Daß ein Mann vor zweihundert Jahren irgendeiner Frau begegnet war und nicht einer anderen, war Zufall, beeinflußte aber das Leben eines Nachkommen zweihundert Jahre später. Ein Milieu-Abstieg oder ein traumatischer Schock, beide durch Zufälle bewirkt, durch falsche Reaktion auf eine Geldentwertung oder durch den Anblick eines Brandes, spielten sich über Generationen hinweg in sogenannte Schicksale ein. Selbst scheinbar ganz freie Willensakte – jemand entschloß sich, einen Berg zu besteigen oder ein Buch zu lesen – waren bedingte Reflexe. Doch darüber ließ sich noch streiten, während es über die Entstehung einer Figur wie Hitler aus der ins Quadrat gesteigerten Häufung gewisser Erbanlagen und dem blinden Walten jener Sorte von Zufällen, das man Weltgeschichte nennt, nicht den geringsten [59] Zweifel gab. Wie aber nannte man ein Sein, in dem konstante Naturgesetze und reine Willkür sich ineinander verfingen und finster durchdrangen? Man nannte es Chaos. Dincklage war sich der Existenz des Chaos gewiß. Das Chaos allein erklärte ihm, warum es Ungeheuer gab.
Natürlich gab es sogar inmitten des Chaos und angesichts der Ungeheuer ethische Entscheidungen, die Wahl zwischen Gut und Böse, das Gewissen. Sie waren das Letzte, was Dincklage aus seiner katholischen Erziehung übrig behielt. Wahrscheinlich, dachte er spöttisch, handelte es sich auch dabei nur um einen durch das Emsland bedingten Reflex.
Folgendes stieß ihm jedoch zu: als er einmal mit anderen Offizieren bei einer Lagebesprechung saß, zeichnete er mit dem Zeigefinger der rechten Hand, mit der er den Stuhlsitz umklammert hielt (weil er Schmerzen hatte), unbemerkt von allen anderen, auf die Innenseite des Holzes irgendein Wort nach, das im Gespräch aufgetaucht war, sagen wir das Wort ›Bataillon‹. (Es ist wirklich gleichgültig, welches Wort es war.) Dergleichen hatte er schon öfters getan, fast war es bei ihm zum Tick geworden, Wörter nachzuzeichnen, immer in römischen Versalien und ohne daß andere die Bewegung seines Fingers erkennen konnten, aber dieses eine Mal hatte er plötzlich die Gewißheit, der Vorgang würde im Ablauf aller Zeiten und selbst in einem als unendlich gedachten Raum nicht untergehen. Es war unvorstellbar, daß jegliche Spur der Schrift und der Energie, die sie zeichnete, ausgelöscht werden und in Vergessenheit geraten konnte. Noch während der Besprechung schrieb er Datum und Zeit (3.Oktober 1944, elf Uhr zwanzig), auf einen Zettel, dazu das Wort (›Bataillon‹?) und steckte den Zettel in die linke Brusttasche seines Waffenrocks.
[60] In der folgenden Nacht träumte er, daß er an den Rand des Marktplatzes einer sehr schönen mittelalterlichen Stadt geraten sei. Besonders im Hintergrund des Platzes standen Häuser von geheimnisvoller Größe und Bedeutung aus schräg geführtem Fachwerk, ein dunkelbraunes lehnte sich gegen ein weißes, er träumte also Farben. Als er den Platz betreten wollte, um sie näher betrachten zu können, verweigerten ihm zwei Bewaffnete, Soldaten in Uniformen einer modernen, aber ihm unbekannten Armee, mit gefällten Gewehren den Zutritt. Er mußte sich damit begnügen, am Rande des Platzes entlangzugehen, an dem Puppenspieler ihre Theater aufgebaut hatten, Bühnen, überfüllt mit Marionetten und Flitter.