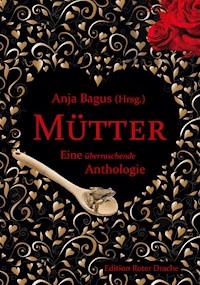Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Outbird
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Luci van Orgs stark biographisch gefärbter Novelle wird die Hauptfigur Vera nach dem Fund dreier Leichen in einem Spind in zahlreiche Ungereimtheiten und Wirklichkeitsverschiebungen verstrickt. Vera wird des Mordes verdächtigt, aber sie kann sich an nichts erinnern. Als sie selbst nach der Wahrheit zu suchen beginnt, begegnet sie einem ganzen Reigen seltsamer Charaktere, der Stalkerin mit dem Kindergesicht, dem evangelikalen Punkermädchen, dem feuerphobischen Mörderkind mit der Eisenstange, der Frau mit dem Muttersack... Wie sehr sie dabei immer mehr in Gefahr gerät, bemerkt Vera erst, als es fast zu spät ist. Nur der Friedensschluss mit sich selbst kann sie jetzt noch retten, aber der ist viel schwerer als gedacht. Denn Vera ist tatsächlich eine Mörderin - und das ist auch verdammt gut so. Ein Buch für alle von schlechten Eltern - und für alle, die sie überlebt haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WIR FÜNF UND ICH UND DIE TOTEN
Eine Novelle für alle von schlechten Eltern – und die sie überlebt haben
von Luci van Org
Impressum
August 2023© Edition Outbird, Gerawww.edition-outbird.de
Covergrafik: Luci van OrgLektorat: Vanessa-Marie Starker, Merri Holste, Tristan RosenkranzBuchsatz: Benjamin Schmidt
ISBN: 978-3-948887-60-5Preis: 6,99 €Alle Rechte vorbehalten.
Für Zerberus.
1. SPIND
Der Spind stand in der Sperrmüllecke gleich neben dem U-Bahn-Eingang. Keine Ahnung, wie lange schon. Wahrscheinlich war ich bereits wochenlang an ihm vorbeigelaufen, ohne ihn zu bemerken, weil ich hier sonst ja immer nur auf den Boden sah, um einen Tritt in Hundekacke oder Erbrochenes zu vermeiden. Heute aber wanderte mein Blick von der Straße über den Bahnhofsvorplatz, in die Unterführung daneben und wieder zurück, gierig auf der Suche nach irgendeiner Ablenkung, die mich im letzten Moment daran hinderte, wie geplant meine Eltern anzurufen. Etwas, das ich bevorzugt im Gehen erledigte, damit sich dabei dank der stetigen Bewegung nicht so viel Unbehagen anstaute.
Widerwillig stopfte ich die Kopfhörerknöpfe in meine Ohren, tippte die ewige Festnetznummer der Wohnung meiner Kindheit mit dem Daumen ins Handy, weil ich sie nicht gespeichert hatte. Schließlich würde ich sie ja sowieso nie vergessen, redete ich mir ein, obwohl ich insgeheim wusste, dass es mir schlicht zu unangenehm war, den Namen meiner Eltern in etwas hineinzuschreiben, das ich täglich benutzte.
Begleitet vom Sägen des Freizeichens und in Erwartung des Unvermeidbaren lief ich weiter auf den U-Bahn-Eingang zu, während der Spind in der Sperrmüllecke mehr und mehr meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Immer spannender erschien mir der mannshohe, an einigen Stellen bereits verbeulte Kasten aus schmuddelig-grau angelaufenem Metall, je näher ich ihm kam.
„Hier Tauber…?“
„Hallo Mama!“
„Rufst du auch mal wieder an...?“
Ich beschleunigte meinen Schritt, um dem Klumpen, den die Stimme meiner Mutter in meinem Magen verursachte, etwas entgegenzusetzen.
„Ich hatte eine Menge zu tun in den letzten Wochen. Und ihr habt euch ja auch nicht gemeldet.“
„Wir haben versucht, dich anzurufen. Aber du bist ja nie rangegangen.“
Der Spind war jetzt nahe genug, dass ich die Rostschlieren sehen konnte, die aus den Luftschlitzen in seiner Tür das Metall herunterliefen.
„Mama, moderne Telefone haben eine Anrufe-in-Abwesenheit-Anzeige. Da hätte ich jeden Anruf von euch gesehen, wenn es ihn denn gegeben hätte.“
„Wir haben versucht, dich anzurufen. Aber du bist ja nie rangegangen.“
„Ist ja auch egal“, entgegnete ich, obwohl es nicht stimmte, während der Klumpen im Magen sich schmerzhaft vergrößerte. Was jedes Mal passierte, wenn wir telefonierten. Weil wir beide jedes Mal ja auch genau dasselbe sagten. Seit Jahren. Am Geburtstag meiner Mutter, am Geburtstag meines Vaters, vor Ostern, vor Weihnachten. Mittlerweile die einzigen Gründe, aus denen ich anrief.
„Was macht ihr an Heiligabend?“
„Andreas will essen gehen.“
Der Magenklumpen bekam Gesellschaft von etwas, das sich schmerzhaft um meinen Solarplexus krallte. Immer dann, wenn jemand den Namen meines Bruders aussprach, vor dem ich mich seit mittlerweile dreißig Jahren versteckte.
„Also alles wie immer. Schön.“
Ich verlangsamte meinen Schritt, weil die Solarplexus-Kralle mich am Atmen hinderte. Der Spind war jetzt nur noch wenige Meter entfernt, und ich konnte sehen, dass das Schloss verbogen war. So, als hätte jemand dagegengetreten, um die Tür gewaltsam zu öffnen.
„Du willst ja nicht, dass wir zu dir kommen.“
„Mama!“, entfuhr es mir, obwohl ich eigentlich hatte schweigen wollen.
„Er war in der letzten Zeit ganz lieb. Und es ist auch gar nichts mehr passiert. Ich soll dich grüßen. Aber das willst du ja auch nicht.“
„Nein, Mama, ich will nicht von jemandem gegrüßt werden, der Frauen bei sich einsperrt, sie schlägt und mit Zigarettenkippen foltert und damit gedroht hat, mich umzubringen. Was ist daran so schwer zu verstehen?“, dachte ich.
„Mama, müssen wir darüber wirklich nochmal reden? In drei Tagen ist Weihnachten“, sagte ich.
Schweigen. So lähmend, dass ich stehenbleiben musste. Dass ich den Menschenstrom, der sich von der Ampel in Richtung U-Bahn-Eingang ergoss, kurz wie eine Flussinsel zerteilte, bis eine alte Frau ihren Rollator in mich hineinschob.
„Entschuldigung!“, murmelte ich der Frau hinterher und machte einen Schritt aus dem Menschenfluss heraus, um weitere Kollisionen zu vermeiden. Hinein in die Sperrmüllecke, direkt vor die Tür des Spinds.
„So halbherzig bringt das nun wirklich nichts.“
„Was…? Nein, Mama! Ich habe nicht dich gemeint!“
Zorn stieg in mir hoch. Vollkommen unnötigerweise in Anbetracht der Aussichtslosigkeit dieses doch schon zigfach auf dieselbe Weise geführten Gesprächs.
„Ist ja gut! Beruhige dich!“
„Ich! Bin! Total! Ruhig!“
Phase drei. Magenklumpen und Solarplexus-Kralle riefen ihre Kollegin Wutfaust zu Hilfe, die die Finger meiner Rechten krampfen ließ. So schmerzhaft, dass ich meine Hand aus der Manteltasche zog und die Faust gegen die Spindtür krachen ließ, um sie zu lockern. Woraufhin es im Inneren des Spindes metallisch klapperte. Irgendwas hatte sich durch den Schlag dort gerade ebenso gelöst wie der Krampf in meiner Hand.
„Was machst du denn da? Das ist sehr unangenehm im Ohr.“
„Nichts. Wie … geht es Papa?“, fragte ich.
„Papa ist…“, hörte ich meine Mutter sagen, bevor mir plötzlich mit voller Wucht die Tür des Spinds ins Gesicht schlug. Ich schrie auf vor Schreck, taumelte nach hinten, verlor den Halt, etwas Hartes krachte auf mein Nasenbein und etwas Schweres auf meinen Oberkörper, wodurch ich rittlings auf den Boden fiel. Mit dem Hinterkopf auf den Asphalt. Panisch versuchte ich mich aufzurichten, da schwappte ein Schwall Flüssigkeit in mein Gesicht. So eiskalt, dass mir die Luft wegblieb, ich meinen Mund aufriss, um Atem zu holen – woraufhin ein grässlicher Klumpen Haare dort hineindrängte, mit Kieseln und Holzstücken darin. Von denen ich da noch nicht wusste, dass es in Wahrheit Knochenteile waren. Und Zähne.
2. SALMIAK
„Hallo? Vera?“
Von irgendwo hörte ich eine angenehm warm klingende Frauenstimme und der Nebelschleier vor meinen Augen begann sich aufzulösen. Dahinter erkannte ich eine weiß überstrichene Ziegelwand und eine Metalltür, grau, voller Rostschlieren. Wie der Spind, schoss es mir durch den Kopf, das Letzte, an das ich mich erinnerte.
Wo war ich? Aus dem Augenwinkel nahm ich einen weitläufigen, leeren Raum mit hohen Kappendecken wahr, auf dessen Betonboden Pfützen glänzten. Fahles Licht drang durch zwei große, gänzlich trübe Industriefenster. Eine verlassene Fabriketage? Irgendwie war mir der Anblick vertraut. Aber nicht genug, dass mir eingefallen wäre, woher. Ich versuchte mich umzublicken, aber das machte mein Hals nicht mit. Schmerzhaft starr war er, als hätte ich ohne Nackenstütze eine lange Autofahrt verschlafen. Auch der Rest meines Körpers tat weh, und mein Nasenbein puckerte so stark, dass ich mich nicht traute es anzufassen, aus Furcht, einen Bruch zu ertasten.
Ich kam zu dem Schluss, dass ich, wie so oft, durch meine eigene Ungeschicklichkeit irgendwo herunter-, hinein-, oder der Länge nach hingefallen sein musste. Etwas, das mir seit meiner Kindheit immer mal wieder passierte, früher, weil ich so schlecht sah, heute, weil ich das, was ich dank diverser Augen-OPs sehen konnte, nicht richtig wahrnahm. Durch den Sturz war ich dann wohl, wie schon mehrmals zuvor, ohnmächtig geworden und irgendwie hier gelandet. Dass ich während einer Bewusstlosigkeit ganz woanders hingebracht worden war, hatte es in der Vergangenheit allerdings noch nie gegeben, und diese Vorstellung machte mir Angst.
„Was… ist passiert?“, erkundigte ich mich deshalb vorsichtig bei der mir unbekannten Stimme, in der Hoffnung auf eine weniger beunruhigende Erklärung.
„Das würde ich gern von dir wissen“, entgegnete diese. Mit unüberhörbar vorwurfsvollem Unterton. Etwas erschrocken versuchte ich, meinen Kopf in ihre Richtung zu drehen, wieder fuhr der Schmerz in meine Halsmuskeln, ließ sich aber aushalten, bis ich sie sehen konnte. Eine im Vergleich zu ihrer sonoren Stimmlage unerwartet kindlich wirkende Frau. Zwar schien sie in einem ähnlichen Alter zu sein wie ich, etwa Anfang 50, war aber auffallend kurz gewachsen, und zwei hüftlange, bronzefarbene Kleinmädchenzöpfe baumelten links und rechts neben ihren runden, blassen Wangen. Sie lehnte an der einzigen Säule inmitten des gänzlich leeren Gewerbegeschosses und machte – soweit ich das hinter ihrer großen Brille sehen konnte – ein sehr ernstes Gesicht.
„Falls…“, setzte ich vorsorglich zu einer Entschuldigung an, „irgendwas Unangenehmes vorgefallen sein sollte, tut mir das…“
„Irgendwas ‚Unangenehmes‘?“, unterbrach mich die Frau in einem beunruhigend anklagenden Tonfall. „Ist das dein Ernst?“
Hatte ich durch meinen Sturz etwas kaputtgemacht? Auch das war leider schon häufiger vorgekommen. Aber war ich vorhin nicht in der Sperrmüllecke gewesen? Wo doch eigentlich nur Dinge abgestellt wurden, die bereits kaputt waren?
„Was auch immer passiert ist, ich habe leider nichts davon mitbekommen“, versuchte ich zu beschwichtigen, „ich war ja ohnmächtig.“
Mein Mund fühlte sich sandig an beim Sprechen. Ängstlich fuhr ich mit der Zunge meine Zähne entlang, um sicherzugehen, dass keiner fehlte. Alle noch da. Zusammen mit einem widerlich faulig-süßlichen Geschmack. Hatte ich mich übergeben?
„Deine Ohnmacht interessiert mich einen Scheiß, Vera!“, herrschte mich die Bezopfte plötzlich an. So laut, dass der Nachhall durch die leere Fabriketage schepperte, und so aggressiv, dass meine Eingeweide vor Schreck leise zu gurgeln begannen. Was war das hier? Ein Verhör? Erst jetzt wurde ich der Tatsache gewahr, dass ich auf etwas Hartem, sehr Unbequemem saß, mit Lehne und mit Armstützen, die meine Schultern unangenehm in Richtung der Ohren hoben.
„Bitte, ich … weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ich kann mich an nichts erinnern!“
„Das würde ich an deiner Stelle auch sagen!“
Sie machte einige Schritte auf mich zu, biss sich dabei nervös auf ihre vollen, etwas entzündet geröteten Lippen und knetete mit den Fingern die überlangen Ärmel ihres Oberteils. Mir fiel auf, dass ihre gesamte Kleidung viel zu groß war. Der Saum ihrer dunkelbraunen, windelartig mit einem Koppelgürtel zusammengezurrten Cordhose schliff auf dem Boden, der Rollkragen ihres beigen Schlabbershirts hing an ihrem Hals wie ein Schlauchschal. Modisches Statement oder ästhetisches Unvermögen? In jedem Fall ließ das eigenwillige Ensemble sie aussehen wie das jüngste Kind einer Großfamilie, das die abgelegten Klamotten seines ältesten Bruders auftrug. Sogar seine Brille. Ein ausladendes Altherren-Doppelbügel-Metallgestell mit unvorteilhaft eckigen Gläsern – die auf ihrer Nase jetzt plötzlich einen kleinen Ruck nach vorn machten. Weil die Frau mit dem Kopf zuckte. Ein blitzschnelles Nicken. Gab sie jemandem ein Zeichen? Waren wir nicht allein? Aber nichts passierte. Außer, dass sie erneut zuckte. Einmal, zweimal, dreimal … seltsam unfreiwillig. War das eine Zwangsstörung? Ein Tic? Immer näher kamen das Zucken und die Zöpfe und mir wurde übel. Vor Angst, weil die Frau möglicherweise gefährlich war und vom Geruch aus ihrem Mund. Süßlich, beißend… Salmiakpastillen! Tatsächlich! An ihrem linken Vorderzahn klebte sogar noch ein Fitzelchen einer dieser grässlich nach Ammoniak stinkenden, schwarzen Rauten. Wobei ich als Kind ganz wild auf das Zeug gewesen war. Die einzige Süßigkeit, die mir meine Mutter manchmal freiwillig gegeben hatte, weil die Dinger so winzig waren – und damit nicht so schlecht für meine pummelige Figur, wegen der alle in meiner Familie mich „Dickmadam“ genannt hatten.
„Was ist? Ich warte!“, fauchte der Salmiakatem. Verzweifelt einen Würgereiz unterdrückend, drehte ich mein Gesicht vom Gestank weg. So langsam wie möglich, wegen der Nackenschmerzen, und um sie nicht vielleicht noch aufzuregen.
Die Tür stand einen Spalt offen! Das Türblatt bewegte sich sogar ganz sachte, als herrsche dort Durchzug. War das eben schon so gewesen?
Schlagartig begann mein Herz zu rasen vor Aufregung. Könnte ich aufspringen und wegrennen? Ganz vorsichtig spannte ich meine Beinmuskeln an, bewegte meine Zehen, meine Füße, meine Knie, meinen Rücken. Alles schmerzte, fühlte sich aber funktionstüchtig an.
Doch was, wenn sie mir folgen, mich sogar angreifen würde?
Andererseits, wenn die Frau wirklich einen Schaden hatte und mich hier festhalten wollte – hatte ich dann eine Wahl?
Erneut so langsam wie nur möglich ließ ich meine Unterarme von den Armlehnen rutschen, bemerkte dabei, dass sie aus glänzend poliertem Edelholz gefertigt und schneckenartig gedreht waren. Ein Biedermeiersessel. In einem Abbruchhaus… Zu angespannt, um mich weiter darüber zu wundern, setzte ich mich etwas auf, versuchte ein beschwichtigendes Lächeln.
„Leider müsste ich langsam mal los. Kann ich noch irgendwas für Sie tun?“
Die Frau lächelte jetzt ebenfalls, stützte sich dabei mit ihren Händen auf die Armlehnen des Stuhls.
„Glaubst du wirklich, es wäre so einfach, Vera?“
Sie umfasste das Holz so fest, dass ihre Knöchel weiß wurden. Ich konnte nicht umhin mir vorzustellen, dass sie dasselbe auch mit meinem Hals tun könnte.
Raus hier! Sofort! Langsam ehrlich panisch behielt ich aus dem Augenwinkel die Tür im Blick. Wie viele Schritte waren es bis dorthin – und was würde mich dahinter erwarten? Eine noch größere Gefahr? Oder nur ein Treppenhaus?
Ein Treppenhaus mit … einem Gitterfahrstuhl...?
Natürlich! Plötzlich fiel mir ein, woher ich das alles hier kannte! Die Metalltür, die Ziegelwand, die Kappendecke, die Säule... – die Beratungsstelle der Jugendhilfe! 1986, mit Fünfzehn, hatte ich in genau so einem Raum Herrn Eckstein gegenübergesessen. Herrn Eckstein, diesem unglaublich netten, älteren Mann mit dem Sozialarbeiter-Rauschebart, der mir damals zugehört und mir geglaubt hatte! Ganz kurz vertrieb ein warmes, fast euphorisches Gefühl meine Angst. Herr Eckstein hatte damals dafür gesorgt, dass ich von zu Hause ausziehen konnte. In eine winzige, völlig heruntergekommene Wohnung in einer ebenso heruntergekommenen Gegend – aber weg vom Gebrüll und den Schmerzensschreien, von berstenden Scheiben und splitternden Türfüllungen und den Faustschlägen und Tritten meines Bruders, der zwischen den Antiquitäten und Bücherwänden unserer Bildungsbürger-Altbauwohnung wütete wie ein angeschossenes Tier. Und weg von den unzähligen Lügengeschichten meiner Eltern von versehentlichen Stürzen und Haushaltsunfällen und angeblichen Missverständnissen, mit denen sie versucht hatten zu kaschieren, was bei uns zu Hause los gewesen war. Meine eigene Wohnung hatte mich gerettet – und Herr Eckstein war der Beginn dieser Rettung gewesen.
Dass dieser Ort mich ausgerechnet an ihn erinnerte, das konnte doch nur ein gutes Omen sein!
„Hören Sie“, fasste ich Mut, „ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich möchte nach Hause und werde deshalb jetzt gehen.“
„Vera…!“, unterbrach mich die Frau ein weiteres Mal. Diesmal nicht mehr aggressiv, dafür aber so genüsslich herablassend, dass ich erneut panisch wurde. „Vera, sieh dich doch mal an!“
Sie deutete auf meinen Bauch. Zögernd blickte ich an mir herunter, bemerkte, dass ich noch immer meinen langen, schwarzen Steppmantel trug. An vielen Stellen war er aber nicht mehr schwarz, sondern mit etwas Schleimig-Matschigem beschmiert. Etwas, das an einigen Stellen feucht glänzte, an anderen Stellen krustig eingetrocknet war und – seltsamerweise roch ich es erst jetzt – widerlich stank. Wie unsere Mülltonnen im Hof im Hochsommer, nur süßlicher, beißender, mit einer ranzigen Unternote. Ein furchtbares Gemisch, dass mir jetzt so unbarmherzig in die Nase stieg, dass ich einmal mehr würgen musste.
„Erstaunlich, wie zart besaitet du bist. Wo du doch jahrelang Zeit hattest, dich darauf vorzubereiten. Hast du damit wirklich nicht gerechnet, dass das alles irgendwann auffliegt, Vera?“
„Ich verstehe nicht, was Sie meinen!“, entgegnete ich verzweifelt, während ich am Bindegürtel meines Mantels etwas kleben sah, das aussah wie ein Stück Bratenkruste.
„Was ich meine, Vera? Ich meine, dass du doch wissen musstest, dass dir deine Leichen irgendwann um die Ohren fliegen! Im wahrsten Sinne des Wortes.“
„Meine … was?“
Die Bratenkruste hatte die Form einer halben Ohrmuschel.
An ihr haftete etwas.
Etwas, das einem menschlichen Fingernagel viel zu ähnlich sah.
„Du hast mich schon sehr gut verstanden, Vera!“
Ein Stück weiter unten, an meiner Manteltasche, klebte ein Büschel Haare.
Ich begann so sehr zu würgen, dass mir die Kehle wehtat, während alles hinter meiner Stirn das dringende Bedürfnis verspürte, wieder ohnmächtig zu werden. Der Rest meines Körpers aber wollte nur noch eins. Weg! Was auch immer geschehen war!