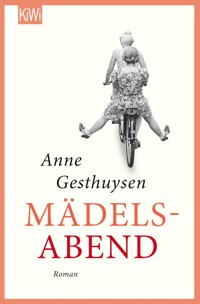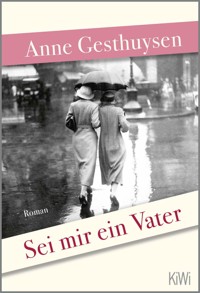9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern, drei Leben, drei Lieben – und das Porträt eines Jahrhunderts. Katty, Martha und Adele treffen sich zu Adeles 100. Geburtstag. Sie wollen ihre Zukunft planen, doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. Eindringlich verwebt Anne Gesthuysen Gegenwart und Vergangenheit und entfacht dabei ein Feuerwerk von Geschichten, die sich quer durch das 20. Jahrhundert ziehen. Sie erzählt von Katty, der charmanten Strippenzieherin, ihrer Verehrung für Adenauer und ihrer Liebe zu einem unerreichbaren Volksvertreter, von Adeles schicksalhafter Verlobung und dem Spion, den sie versteckte. Von Martha, die ihren Mann an Männer verlor und stets die Lebenslust bewahrte. Vom Tausch eines Huhns gegen ein Rembrandtgemälde, von einem Leumundsprozess, der den gesamten Niederrhein in Atem hielt, und von drei starken Frauen mit dem Mut zur Eigenständigkeit. Große Lebensgeschichten verbinden sich mit herrlichen Anekdoten, das Weltgeschehen mit dem Leben am Niederrhein. Ein unwiderstehliches Buch: so komisch wie berührend, so liebevoll wie wahrhaftig. »Das Leben der Menschen am Niederrhein wurde selten so anrührend genau geschildert wie in diesem besonderen Roman über drei sehr unterschiedliche Schwestern [...].« Deutschlandradio
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Anne Gesthuysen
Wir sind doch Schwestern
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Anne Gesthuysen
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Anne Gesthuysen
Anne Gesthuysen wurde 1969 am unteren Niederrhein geboren. Nach dem Abitur in Xanten studierte sie Journalistik und Romanistik. In den Neunzigerjahren arbeitete sie bei Radio France, ansonsten fühlt sie sich seit Ende der Achtzigerjahre in den deutschen Medien wohl. Als Reporterin hat sie für WDR, ZDF und VOX gearbeitet, schließlich auch als Moderatorin. Ab 2002 moderierte sie das »ARD-Morgenmagazin«. Diese Nachtschichten gab sie nach dem großen Erfolg ihres ersten Romans »Wir sind doch Schwestern« Ende 2014 auf, um sich tagsüber an den Schreibtisch zu setzen und weitere Bücher zu schreiben. Sie lebt mit ihrem Mann, Frank Plasberg, und ihrem Sohn in Köln.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Katty, Adele und Martha treffen sich, um Adeles 100. Geburtstag zu feiern. Sie wollen ihre Zukunft planen, doch vorher gilt es, die Vergangenheit zu klären. So bewegend wie komisch erzählt Anne Gesthuysen von drei alten Damen am Niedrrhein. Von Katty, der Strippenzieherin, und ihrer Liebe zu einem charismatischen Politiker, von Adeles schicksalhafter Verlobung und dem Spion, den sie versteckte. Und von Martha, die ihren Mann an Männer verlor und stets die Lebenslust bewahrte. Große Lebensgeschichten verbinden sich mit herrlichen Anekdoten vom Niederrhein. Ein liebevolles, charmantes und unwiderstehliches Buch.
»Das Leben der Menschen am Niederrhein wurde selten so anrührend genau geschildert wie in diesem besonderen Roman über drei sehr unterschiedliche Schwestern.« Denis Scheck, Deutschlandfunk
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2012, 2021, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Kurt Hutton/Getty Images
ISBN978-3-462-30611-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Disclaimer
Prolog
Gefallen auf dem Feld der Ehre
Läuse für die Leber
Endlich zu dritt
Franz und die Trautens
Das Schweigen der Fährendorfs
Eine unsägliche Kupplerin
Die Wahrheit über Wolodomir
Über das Leben
Und er verlobt sich doch
Franz fliegt
Ein apokalyptischer Reiter
Ablasshandel
Auf dem Hof
Das Eisen wird geschmiedet
Am Strang
Geheime Dokumente
Alfreds Kriegsgeheimnis
Es geschah im Nachbarhaus
Zwei Welten
Nicht ohne Fehl und Tadel
Evakuierung
Wenn es Nacht wird
Die Hörnchen des Belgiers
Alltag im Ausnahmezustand
Von Flamen und Fohlen
Schwester Schlichters Betriebsgeheimnis
Flucht vor der Wahrheit
Das Ende eines Glücklosen
Leiche im Keller
Bratkartoffelverhältnis
Endlich Frieden
Mitternachtsständchen
Prosit Neujahr!
Eine sogenannte Frau Fährendorf
Antrittsbesuch
Wir sind im Landtag
In guten wie in schlechten Tagen
Lass uns reden!
Willkommen auf dem Tackenhof
Die zwei Frauen des Heinrich Fährendorf
Schwesternliebe
Nie wieder Blümchenkaffee
Nichts als die Wahrheit
Lübke kommt
Ein gesegnetes Alter
Zeugin Adele Trauten
Eine Jahrhundertfeier
Epilog
Meine Tanten und ich
Dank
Leseprobe »Vielleicht hat das Leben Besseres vor«
Für Bernhard
Dieses Buch ist ein Roman, wenn auch einige seiner Charaktere erkennbare Vor- und Urbilder in der Realität haben, von denen das eine oder andere biografische Detail übernommen wurde. Dennoch sind es Kunstfiguren. Ihre Beschreibungen sind ebenso wie das Handlungsgeflecht, das sie bilden, und die Ereignisse und Situationen, die sich dabei ergeben, fiktiv.
Der 100. Geburtstag
Prolog
Er war dunkelgrau mit hellgrauer Maserung und sah aus wie Wolken an einem dieser undefinierten Sommertage, die man am Niederrhein so oft erlebte.
Katty beugte sich tiefer ins Innere des alten Schrankes, um den merkwürdigen Pappdeckel herauszuziehen.
»Au, verflixt!« Sie fluchte und steckte sich wütend den Finger in den Mund, saugte an der kleinen Wunde und schüttelte die Hand. Das alte Holz war porös, jetzt hatte sie einen Splitter in der Haut.
An der Rückwand war eine Vertiefung eingelassen, eine Art Geheimfach, wie man es früher in den Schränken gehabt hatte. Dieses Fach war ihr nie zuvor aufgefallen. Kein Wunder, dachte Katty, sie hatte sich diesen Schrank auch nie genau angesehen. Sie nestelte weiter an der gemaserten Oberfläche, und als die mit einem kleinen Ruck nachgab, fiel ihr ein alter Aktenordner entgegen.
Sie nahm ihn, pustete den Staub ab und öffnete den Deckel:
Im Namen des deutschen Volkes
Katty wusste sofort, was sie da in den Händen hielt. Sie taumelte rückwärts, fand mit ihrem Po das Bett, setzte sich und las.
Die Überschrift über dem Urteil war doppelt unterstrichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Katty war verwundert. Sie hatte immer gedacht, der Satz »Im Namen des Volkes« gehe nahtlos über in den Nachsatz »ergeht folgendes Urteil«. Sie hatte das schriftliche Urteil nie zu Gesicht bekommen. Den Ordner hielt sie zum ersten Mal in der Hand, und in ihr stritten Neugier und schlechtes Gewissen. Neugier, weil sie sich fragte, ob darin noch Informationen verborgen waren, von denen sie nichts wusste. Und das schlechte Gewissen, weil Heinrich sie auf dem Sterbebett gebeten hatte, den Ordner und alles, was zu dieser Geschichte gehörte, zu verbrennen und zu vergessen.
Da war er nun, der Aktenordner. Katty hatte ihn nie verbrannt. Sie hatte ihn nur vergessen. Als Heinrich sie gebeten hatte, den Ordner nach seinem Tod zu entsorgen, war sie zu entsetzt von der Vorstellung gewesen, dass er bald sterben könnte, und war deshalb nicht auf die Idee gekommen, zu fragen, wo der Ordner sich denn überhaupt befinde. Hier also. Tief im Schrank. Versteckt hinter alten Tischdecken.
Katty legte den Ordner neben sich auf das Bett. Ihr Herz klopfte heftig. Sie starrte auf das graue Etwas, nahm es erneut in die Hand und klappte es wieder auf. Mit dem Daumen fuhr sie an dem Papier entlang. Das Rascheln hörte sich alt an. Es ist alt, dachte Katty, mein Gott, das ist fast fünfzig Jahre her. Ich sollte das olle Ding einfach in den Müll schmeißen. Und doch wusste sie, dass sie es nicht tun würde. Auch wenn es alte Wunden aufrisse und die Scham wieder aufflammen ließe, sie würde dem Drang nicht widerstehen können und alles lesen. Aber nicht jetzt. Später, wenn sie etwas Zeit hätte. Nächste Woche vielleicht. Denn bis dahin gab es noch einiges zu tun. Katty war dabei gewesen, ihr Zimmer auf- und sogar auszuräumen. Ihre Schwester Adele würde am nächsten Tag zu Besuch kommen und einige Zeit bleiben. Vielleicht für immer, darüber würde zu reden sein. Aber erst einmal würde gefeiert, denn am kommenden Sonntag hatte Adele Geburtstag, nicht irgendeinen: den hundertsten Geburtstag.
Katty wollte ihrer Schwester das Zimmer zur Verfügung stellen, in dem sie selbst normalerweise schlief, da es ebenerdig lag und sie auf keinen Fall wollte, dass Adele jeden Abend die Treppen zu den anderen Schlafräumen hinaufklettern müsste, auch wenn sie dazu körperlich durchaus noch in der Lage gewesen wäre. Adele war schlank und drahtig und wenn man es nicht besser gewusst hätte, wäre sie als Achtzigjährige durchgegangen. Ungefähr so alt, wie Katty jetzt war. Und ich, fragte sie sich. Wie alt wirke ich wohl? Sie ging durch die geöffnete Tür ins angrenzende Badezimmer und blickte in den Spiegel. Ihr Haar war honigblond, sie färbte es regelmäßig. Sie hatte kaum Falten, das lag allerdings auch daran, dass sie ein bisschen zu mollig war. Aus den Siebzigerjahren hatte sie zudem ihre Lieblingsbrille behalten. Die war mit ihren quadratischen Gläsern enorm groß und wenn Katty Falten rund um Augen und Nasenwurzel gehabt hätte, wären die hinter dem dicken Horn eh nicht aufgefallen. Knapp sechzig, entschied sie und lächelte. Sie griff ihr Nageletui und holte die Pinzette heraus. Ein kleines Stückchen Holzsplitter steckte noch in ihrem Mittelfinger. Sie ritzte die Haut vorsichtig auf, um das Ende des Splitters besser greifen zu können. Dann entfernte sie den Holzspan und ging zurück ins Zimmer.
Sie putzte schon seit einer ganzen Weile alles im Schlafzimmer, was sie in den letzten Jahren vernachlässigt hatte. Dazu gehörte auch der alte Holzschrank. Den hatte sie nie benutzt und jetzt beschlossen, ihn von Grund auf zu reinigen und die Tischdecken, die darin waren, endlich auszusortieren. Man würde die wenigen, die noch brauchbar waren, zumindest reinigen müssen, sie stanken bestialisch nach Mottenkugeln. Das würde sogar eine hundertjährige Nase noch riechen, und Katty wollte ihrer großen Schwester diesmal so wenig Anlass zur Kritik wie möglich bieten. Sie wünschte sich, dass sowohl das Geburtstagsfest als auch die gemeinsamen Tage auf dem Hof harmonisch verliefen. Vielleicht würde sich Adele dann endlich nicht mehr dagegen wehren, bei ihr einzuziehen. Gut, dass Martha auch vor dem Fest anreiste, sie hatte schon immer einen guten Einfluss auf Adele gehabt. Merkwürdig, dachte Katty, ich würde nie auf die Idee kommen, Martha ebenerdig ein Zimmer zu räumen, dabei ist sie nur zwei Jahre jünger als Adele. Martha würde auf der ersten Etage schlafen und jeden Abend die schmale Treppe hinaufgehen müssen. Warum nicht, dachte Katty, sie kann’s ja noch gut.
Martha war völlig unkompliziert. Katty liebte sie uneingeschränkt und hatte sie gerne um sich. Das Verhältnis zu Adele war von jeher schwieriger gewesen. Natürlich liebte sie auch die älteste Schwester, aber irgendwie gerieten sie immer aneinander. Adele hatte Katty erzogen, und sie tat es bis heute. Sie maßregelte ihre jüngste Schwester gelegentlich, als sei sie ein ungehorsames Kind, das sich weigert, sein Zimmer aufzuräumen. Katty blickte auf den Staubwedel in ihrer Hand und musste lachen. »Brave Katty«, sagte sie laut und wischte über den alten Schreibtisch am Fenster. Ihr Blick fiel wieder auf den Ordner. Der muss raus aus Adeles Zimmer, beschloss sie, nahm die Akte, stapfte die Treppe hinauf in das Zimmer, in dem sie schlafen würde, und legte sie dort auf das Nachtkommödchen. Katty rümpfte die Nase. Der Aktenordner stank genauso wie alles andere im Schrank – nach Mottenkugeln. Katty zog einige der losen Blätter heraus und begann zu lesen:
»Die Klägerin behauptet, der Beklagte unterhalte intimen Umgang mit der Zeugin Trauten.«
Die Zeugin Trauten, das war sie, Katty Trauten. Sie hatte es gehasst, so genannt zu werden. Es hatte so verharmlosend geklungen. In Wahrheit war sie doch die eigentlich Beschuldigte gewesen.
Das Urteil war gespickt mit den unglaublichsten Geschichten, vierzehn Seiten lang. Über manche konnte Katty inzwischen lachen, andere trieben ihr die Röte ins Gesicht. Sie war als liederliches, schamloses Weib dargestellt, das eine Ehe auf perfide Art und Weise zerstört hatte. Dabei, so ließen die Anschuldigungen vermuten, hatte sie alles getan, um die Ehefrau, ihre einstige Schulfreundin, zu demütigen.
Was mussten sich die Richter gedacht haben, als sie diese pikanten Vorwürfe zu verhandeln hatten, zumal sie einen Mann betrafen, der im Land Nordrhein-Westfalen als christlich-demokratischer Landtagsabgeordneter Rang und Namen hatte? Katty blätterte weiter. Seitenlang nur Zeugenaussagen. Es waren bestimmt dreißig Freunde, Bekannte, Verwandte und Nachbarn angehört worden. Vier Jahre Scheidungskrieg waren in diesem Aktenordner festgehalten, für eine Ehe, die gerade einmal fünf Monate gedauert hatte.
Wie hatte es nur so weit kommen können? Katty war darüber auch nach all den Jahren noch fassungslos. Doch als sie sich zurückerinnerte, wurde ihr bewusst, dass alles mit Theodors Tod begonnen hatte.
9. März 1945
Gefallen auf dem Feld der Ehre
Sie sah den Brief. Und sie fand ihre Gefühle nicht. Er war tot, so stand es da. Einmal quer über dem Briefumschlag, in großen roten Buchstaben: Gefallen für Großdeutschland. In dem Umschlag befand sich seine gesammelte Feldpost, darunter Briefe, die sie selbst an ihn geschrieben hatte. Katty strich mit den Fingerkuppen über das raue Papier. Gab es Briefverkehr, von dem sie nicht gewusst hatte? Hatte er eine heimliche Liebe gehabt? Ein paar »Briefe an einen unbekannten Soldaten« befanden sich auch im Umschlag. Monatelang war in Schulen Propaganda gemacht worden, junge Mädchen sollten deutsche Soldaten aufmuntern, indem sie Briefe schrieben, immer adressiert an »einen unbekannten Soldaten«. Die Soldaten, die wenig eigene Post bekamen, wurden mit solchen Briefen von fremden Schulmädchen getröstet. Sie suchte weiter. Ein Brief von Theodors Vater fiel ihr in die Hände. Die langgliedrige Schrift mit den ausschweifenden Bogen nach oben und unten war unverkennbar. Sie verriet einen Mann, der gewohnt war, zu entscheiden, und der Befehle gab. Theodor war immer anders gewesen als sein Vater, sensibler. Die beiden hatten sich nie besonders gut verstanden. Vielleicht hätte er nicht in den Krieg ziehen müssen, dachte Katty. Er war der einzige Sohn eines bedeutenden Mannes. Hundertacht Morgen Land mussten bewirtschaftet werden, da hätte der erwachsene Sohn sicher bleiben können. Aber er wollte weg, er war fasziniert vom Krieg und von der Kameradschaft, und er konnte nicht mehr ertragen, was im Haus geschah. Wie sein Vater herrschte und alles und jeden für sich beanspruchte. Dazu gehörte auch sie selbst, wusste Katty und stöberte weiter in den verschmutzten Briefen. Nein, es gab keine Frau, niemanden, der ihm nähergestanden hatte als sie. Und trotzdem gelang es ihr nicht, zu weinen. Sie stellte Reflexionen an, so nüchtern konnte man das wohl bezeichnen. Sie erschrak darüber, suchte noch einmal, nach Trauer, nach Tränen, nach dem brennenden Kloß im Hals. Aber da war nichts. Sie dachte den Schmerz, doch es tat nicht weh. Nur ein erbarmungsloses Fliegen der Gedanken. Sie hatten keine Zeit, eine Beerdigung vorzubereiten. Gab es überhaupt etwas zu beerdigen? Er sei als Held gestorben, hatte der Goldfasan mitgeteilt. Der Mann machte dem Spottnamen wirklich alle Ehre. So könnte man auch im Karneval gehen, dachte sie. Heinrich liebte diesen Ausdruck für die Parteistreber. Er weigerte sich, sie ernst zu nehmen. Mit ihr hatte der Mann nicht gesprochen. Nur mit Heinrich. Sie hatte er keines Blickes gewürdigt. Aber wer war sie schon. Die Hauswirtschafterin. Mehr nicht. Dass sie den Jungen großgezogen hatte, ihn liebte wie ihr eigenes Kind – aber tat sie das überhaupt? Schließlich saß sie immer noch da und überlegte, statt zu weinen, plante, statt zu schluchzen.
Heinrich hatte dagestanden wie eine Eiche. Er war groß und überragte alle, deshalb bekam man leicht den Eindruck, er sei arrogant. Seine Augenbrauen waren gleichmäßig und dicht, der Kopf kahl, aber von makelloser Form. »Bitte?«, das war alles, was er gesagt hatte, als er den Mann in der lächerlich goldbehangenen Uniform in Empfang nahm. Heinrichs Stimme war hart und schneidend gewesen. Er war kein Freund der Partei. Von Anfang an nicht und jetzt erst recht nicht mehr. Krieg und Elend hatten sie gebracht, Deutschland hatte Land verloren. Das war für ihn unverzeihlich. Er war Bauer durch und durch, auf ewig der Scholle verbunden. Das war sein Lieblingsspruch. Theodor hatte ihm mit elf ein Holztäfelchen geschnitzt, auf dem dieses Lebensmotto stand, es hing über der Tür zum Wohnzimmer. Heinrichs Familie lebte seit 1636 auf dem Tackenhof in Wardt. Am Anfang war da wohl nicht viel mehr als eine Hütte gewesen, aber im Laufe der Jahrhunderte war ein wunderschöner Gutshof entstanden und niemals hätte ein Fährendorf auch nur einen Morgen Land verkauft oder aufgegeben. Heinrich Fährendorf war tiefgläubiger Katholik, Anstand und Ehre waren für ihn von enormer Bedeutung. Und dieses braune Gesindel war ehrlos und unanständig. Auch Katty liebte den Hof. Es war ein erhebendes Gefühl, wenn sie die kurze Allee auf das Haupthaus zulief. Sie mochte die niederrheinischen Herrenhäuser mit den klaren Strukturen und Proportionen. Die Eingangstür war leicht erhöht, deshalb konnte man abreisenden Gästen noch lange hinterherschauen. Und man hatte von dort einen guten Blick in den gepflegten Gemüsegarten. Rechts und links vom Eingang befanden sich je zwei Fenster, in der oberen Etage vier Sprossenfenster, das war symmetrisch und schön, fand sie. Die Stallungen gingen nach hinten hinaus und waren hufeisenförmig angelegt, was ungemein praktisch war. Bei Regen konnte man alle Tiere füttern, ohne auch nur einen Tropfen abzubekommen. Katty war Heinrichs Vorfahren sehr dankbar dafür. Sie hasste es, nass zu werden. Da Heinrich Fährendorf für seine Verbandstätigkeiten ständig unterwegs war, verwaltete sie längst den gesamten bäuerlichen Betrieb. Sie wies die Leute an, aber musste auch oft genug selbst die Mistgabel in die Hand nehmen. Das störte sie nicht. Sie war robust und glaubte fest daran, dass Schwielen an den Händen ein Gütezeichen waren. Heinrich sah das genauso. Und er schätzte Katty für ihre zupackende Art. Er machte keinen Hehl daraus, dass er sie den Haustöchtern, wie die jungen Auszubildenden auf dem Hof genannt wurden, vorzog. Katty hatte ihn in den ganzen Jahren, in denen sie bereits auf dem Hof war, niemals weinen sehen. Manchmal hatte sie gedacht, es sei vielleicht anatomisch unmöglich. »Vatti«, so hatte Theodor ihn immer genannt, dabei klang das A stumm, kurz und abgehackt und das T knallte wie eine Peitsche durch die Luft, insgeheim hatte sie die Bezeichnung übernommen. Offiziell blieb Heinrich natürlich »Herr Fährendorf«, aber für sie und Theodor war er Vatti. Vatti also hatte riesige Tränensäcke. Zusammen mit dem Halbrund seiner Augenbrauen bildeten die tiefen Ränder einen Kreis um seine Augen, und deshalb hatte Katty manchmal gedacht, die Tränen würden in die Tränensäcke abfließen wie in einen großen Eimer. So viel, dass sie über das Unterlid gequollen wären, um dann über die Wange zu laufen – so viel konnte ein Mann gar nicht weinen. Auch eben hatte er nicht geweint. Verärgert hatte er die Brauen zusammengezogen. Und Katty war nicht sicher gewesen, ob sich sein Unmut gegen den verstorbenen Sohn oder gegen den Mann von der NSDAP richtete. Der Funktionär war eingeschüchtert gewesen. Seine Goldknöpfe waren frisch poliert, sie funkelten geradezu. Er hatte offensichtlich Angst. Man ging nicht einfach so zu Heinrich Fährendorf und überbrachte eine schlechte Nachricht. Beim ersten »Bitte« zuckte er zusammen. Man sah, wie er sich Mut zusprach. Wie er die Schultern straffte, das Kinn nach vorne reckte. Er sog Luft durch die Nase ein, das Geräusch schien ihm Bedeutung zu verleihen. Dann holte er ein Schreiben hervor. »Sehr verehrter Herr Bauer Fährendorf«, verlas er, »nach Tagen bangen Wartens erhielt ich heute durch ein Schreiben des Internationalen Roten Kreuzes die bedauerliche Nachricht, dass Ihr Sohn Theodor, unser junger Leutnant Fährendorf, in Unkel für sein Vaterland auf dem Felde der Ehre gefallen ist.« Der Brief endete, wie üblich, mit »Heil Hitler«. »Mein Beileid«, hatte der Goldfasan noch gestammelt, dann war er hinausgerannt. Beinahe hatte er vergessen, den Brief dazulassen. Wahrscheinlich hatte er befürchtet, Vatti würde ihn höchstpersönlich mit seinen großen Händen in den Schwitzkasten nehmen und Wut und Enttäuschung an ihm auslassen.
Sie hatten allein im Flur gestanden, und Katty hatte nicht einen Moment das Bedürfnis verspürt, Vatti in den Arm zu nehmen oder zu trösten. Zugenickt hatte sie ihm. Eigentlich hatte sie nur kurz beide Augen mit Schwung zugemacht. Sie hatte Entschlossenheit zeigen wollen und dass sie wisse, was zu tun sei. Sie kannte sich ja aus mit dem Sterben. So viele geliebte Menschen hatte sie inzwischen zu Grabe getragen, dass sie manchmal fürchtete, es gebe so etwas wie eine Sterbe-Routine. Vielleicht musste sie deshalb nicht weinen. Vielleicht hatte sie einfach keine Tränen mehr übrig. Auch Vatti hatte schon genug Menschen beerdigt. Seine Eltern, seinen Bruder, seine erste Frau. Sie war kurz nach der Geburt des zweiten Kindes gestorben. Es wäre ein Mädchen gewesen. Aber die Kleine hatte wohl falsch herum im Bauch gelegen und der Geburtsvorgang quälend lange gedauert. Über Stunden hatte die arme Frau geschrien. Die Nachbarn erzählten noch heute mit einem Schaudern davon. Angeblich waren die Schreie nämlich im ganzen Dorf zu hören gewesen. Na ja, dachte Katty, die Leute hier reden halt viel.
Nach dem Tod seiner Frau hatte Heinrich Fährendorf Katty auf den Hof geholt, das war kurz vor Weihnachten 1934 gewesen. Sie sollte den Hausherrn und das Kind versorgen. Theodor war damals dreizehn, Katty war vierundzwanzig und fühlte sich sofort wie eine ältere Schwester für den Halbwaisen. Auch ihre Mutter war gestorben, als sie noch jung war. Sie hatte nur wenige Erinnerungen an sie, es waren ihre großen Schwestern, Adele und Martha, gewesen, die sie erzogen hatten, zu denen sie gelaufen war, wenn sie sich fürchtete oder wenn sie traurig war. Martha hatte für sie gesorgt und Adele sie Anstand und Moral gelehrt. Katty liebte die eine Schwester innig und der anderen stand sie dankbar und voller Respekt gegenüber. Im Grunde war es Adele zu verdanken, dass Katty auf den Tackenhof gekommen war. Sie hatte eine Verbindung zu Heinrich Fährendorf gehabt. Die besten Familien des Niederrheins hatten ihre Töchter bei ihm unterbringen wollen, schließlich war er nicht nur ein vermögender Bauer, er war auch Abgeordneter im Preußischen Landtag gewesen, ein Zentrumspolitiker. Doch als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren, hatte er die Politik an den Nagel gehängt.
Als sie vorhin gemeinsam im Flur gestanden hatten, hatte Katty für einen Moment das Gefühl gehabt, sie trauerten um den gemeinsamen Sohn. Aber sie hatten sich zusammengerissen, sich unter Kontrolle gehabt. Eine Weile hatten sie so dagestanden und geschwiegen, sich einfach nur angeschaut. Oder vielleicht hatte auch nur sie ihn angeschaut, dachte sie jetzt. Sie konnte sich nicht erinnern, dass da ein bestimmter Ausdruck in Heinrichs Gesicht gewesen wäre, er hatte wahrscheinlich einfach durch sie hindurchgesehen. Dann war der Moment vorbei gewesen. Er hatte gesagt, das Leben müsse weitergehen und sie solle endlich das Nötigste einpacken. Der Hof wurde evakuiert, sie mussten fliehen.
9. März 1945
Läuse für die Leber
Unentschlossen blickte Katty sich in ihrem Zimmer um. Was sollte sie einpacken? Alles, was sie besaß, oder nur ein paar Sachen für drei bis vier Tage? Der linke untere Niederrhein war erobert worden. Gestern hatten sie Xanten und Wardt eingenommen. Jetzt sind sie also hier, dachte Katty. Und nun?
Theodor hatten die Alliierten den Tod gebracht. Vor zwei Tagen hatten sie die Brücke von Remagen erobert, das war am Mittwoch gewesen. Noch in derselben Nacht mussten sie Unkel überrannt haben. Und Theodors Garnison hatte wahrscheinlich nichts entgegensetzen können. Theodor hatte in den letzten Wochen Angst gehabt. Vielleicht hatte er sein Ende gespürt. Er hatte Heinrich einen Brief geschrieben, und nachdem der ihn gelesen hatte, hatte er Katty in den Arm genommen und auf die Stirn geküsst. Anders als sonst hatte er ihr den Brief nicht gezeigt, und sie hatte nicht nach dem Inhalt gefragt. Sie nahm sich vor, das nachzuholen. Sie machte sich Sorgen um ihre Geschwister. Josef wohnte mit seiner Familie nicht weit entfernt im Nachbardorf Mörmter. Er packte sicher auch gerade die Koffer. Martha wohnte weiter nördlich in Rees, ebenfalls direkt am Rhein. Sie hatten sich vor vier Wochen zuletzt gesehen, kurz darauf war der Krieg in seiner ganzen Härte am Niederrhein angekommen. In Xanten und Wardt hatte es seit Mitte Februar heftige Gefechte gegeben. Genau zu Karneval hatten die Bomben der Kanadier Xanten fast dem Erdboden gleichgemacht. Ein Turm des Viktor-Doms war dabei eingestürzt. Gott sei Dank hatte gerade keine Messe stattgefunden. Xanten hatte sich inzwischen halbiert, vermutete Katty. Wegen der Nähe zur Weseler Rheinbrücke war der untere Niederrhein seit Wochen ein wichtiges Ziel für die Alliierten. Eigentlich war es ein Wunder, dass sie noch lebten, denn sogar bei ihnen, im kleinen Wardt, waren dreizehn Menschen gestorben. Nach allem, was rheinaufwärts schon passiert war, gab es am Niederrhein viele Gerüchte. Es hieß, die Wehrmacht wolle die Eisenbahnbrücke Wesel sprengen. Was sollte das noch bringen, fragte Katty sich, die Alliierten würden auch ohne die Brücken vorankommen. Ob das jetzt noch ein paar Tage länger dauerte oder nicht, was änderte das schon.
Adele wohnte auf der anderen Rheinseite in Duisburg. Sie war dort Rektorin an einem Mädchengymnasium. Eigentlich hätte sie am Wochenende zu Katty auf den Tackenhof kommen sollen, um mit ihr zu feiern, denn Katty war am Montag fünfunddreißig geworden. Aber an Feiern war nicht mehr zu denken.
Katty warf lustlos drei Wollröcke in ihren Koffer. Sollte sie wirklich den Hof verlassen, nur weil die Alliierten es anordneten? Die Bevölkerung wollen sie schützen, maulte sie, pah, wahrscheinlich wollen sie sich nur die Höfe unter den Nagel reißen. Uns schicken sie nach Bedburg-Hau, und dann können wir sehen, wo wir bleiben. Sie wusste natürlich, dass der Krieg längst verloren war, aber es machte ihr Angst, dass Ausländer plötzlich das Sagen hatten. Sie verstand nur wenige Brocken Englisch, und die vielen Bombennächte im Keller hatten ihr zugesetzt. Dieses durchdringende Zischen und kurz darauf das leichte Wackeln der Erde waren unerträglich gewesen. Manchmal hatte sie gedacht, das sei ihr Ende. Es wäre wenigstens ein schneller Tod gewesen, mehr, als anderen vergönnt war.
Sie hatte ihre Mutter sterben sehen. Ein halbes Jahr lang hatte sie sich gequält, bevor sie es schaffte, das Leben loszulassen. Die Ärzte hatten ihr nicht helfen können, von Anfang an nicht. Sie war plötzlich abgemagert, Schwindsucht sagten die Leute. Der Dorfarzt schaute ihr in die Augen und stellte fest, dass sie gelb waren. Die Leber sei krank, sagte er, sie müsse auf Eier und Käse verzichten; Alkohol sei ebenfalls schädlich. Die ganze Familie wusste, dass es daran nicht liegen konnte, denn die Mutter hatte nie Alkohol getrunken, und seit Monaten aß sie fast nur Brot, von allem anderen wurde ihr übel. Als ihr Zustand sich nach ein paar Wochen nicht besserte, riet ihr der Arzt, sie solle lebende Schafsläuse essen. Das Sekret, das die Insekten beim Sterben absonderten, könne die Leber heilen. Kattys Familie war nicht leichtgläubig. Ihr Vater las viel, alle Geschwister hatten gute Schulen besucht, ihre älteren Schwestern waren sogar Lehrerinnen, und man galt im Dorf als gebildet. Dieser Rat des Arztes erschien ihnen unsinnig und grenzte an Scharlatanerie, dennoch klammerte ihre Mutter sich an die Hoffnung. Sie betete viel. Täglich schleppte sie sich zwei Mal in die Kirche, kniete, so gut es ihre spitzen Knochen noch zuließen, und wenn sie nicht betete, aß sie Weißbrot mit Läusen.
Adele buk das Brot schon damals selbst. Sie war eine Künstlerin. Ihr Weißbrot war luftig, weich und wunderbar süß. Man musste die Scheiben sehr dick schneiden, damit sie nicht zerfielen. Kattys Mutter strengte sich an. Sie wollte gesund werden, wollte weiterleben. Auf das Weißbrot schmierte sie Butter, darin fing sie die Läuse ein. Sie schloss die Augen, biss zu, schluckte und würgte, um dann in sich hineinzuhorchen, ob die Läuse wohl ihre Arbeit taten.
Katty und ihre Geschwister sammelten täglich Schafsläuse ein. Es gab genug davon in Empel, und die Bauern hatten nichts dagegen, wenn die jungen Trautens ihre Tiere von dieser Last befreiten. Die älteren Geschwister legten die Schafe wie beim Scheren auf den Rücken und suchten an den Seiten nach den Läusen. Für Katty war das zu schwierig, sie setzte sich deshalb rittlings auf die Tiere und klaubte die Viecher von oben ab. Manchmal rannten die Schafe einfach los und galoppierten mit ihr durch die Wiese. Nach einer Weile, wenn die Schafe anfingen zu blöken, ließ sie sich hinunterfallen und gönnte ihnen den kleinen Triumph. Die Läuse wurden sorgfältig in einem Einmachglas gesammelt, in dem vorher saure Gurken eingekocht worden waren. Und vermutlich wurden die Insekten von der Restsäure, die noch darin war, sofort betäubt. Jedenfalls machten sie keine Anstalten, aus dem Glas wieder herauszugelangen.
Es war Frühjahr, als sie die ersten Läuse sammelten, und da die Mutter ihre Brote tapfer reinstopfte, nahm sie tatsächlich wieder zu. Die Familie schöpfte Hoffnung, vielleicht würde das merkwürdige Hausmittel tatsächlich wirken. Aber im Sommer verschlechterte sich ihr Zustand erneut. Die Mutter war nur noch Haut und Knochen, allein der Bauch war dick und aufgebläht. Der Darm arbeitete nicht mehr. Sie sah aus, als hätte sie lange Zeit draußen gearbeitet, denn ihre Haut war sonderbar gebräunt. Morgens, wenn die Haut durchblutet war, sah sie sehr gesund aus. Abends in fahlem Licht allerdings wirkte sie längst wie eine Leiche – in Wahrheit war sie nämlich quittegelb. Ihr Lachen, das Katty immer so sehr gemocht hatte, war eingefallen, und im Grunde waren ihre Gesichtsmuskeln nicht mehr stark genug, um die Mundwinkel ganz nach oben zu ziehen. Wenn sie nun lachte, sah es aus, als wäre sie mit offenem Mund im Sitzen eingeschlafen. Die Augen fielen zu, der Mund stand offen und das Glucksen aus der Kehle konnte man nur noch ahnen.
Eines Morgens wurde Katty von ihrem Vater geweckt, sie solle bitte schnell kommen, die Mutter sei verrückt geworden. Katty stand auf und sah ihre Mutter im Nachthemd an der verschlossenen Eingangstür rütteln, im rechten Arm einen alten Besenstiel, an den sie eine Kordel geknüpft hatte. Sie wolle in der Oude Maas angeln und schwimmen, beteuerte sie immer wieder, und man möge sie jetzt endlich gehen lassen. Sie sagte das alles auf Holländisch oder in einem sehr breiten Plattdeutsch, jedenfalls hatte sogar Katty Mühe, sie zu verstehen. Ihre Mutter kam aus Gennep, das lag 1869, als sie geboren wurde, außerhalb des Norddeutschen Bundes. Sie war Holländerin, Gennep gehörte zur Provinz Limburg. Direkt vor ihrer Haustür schlängelte sich ein alter Arm der Maas, in dem hatte ihre Mutter wohl als Kind immer gespielt, und da wollte sie jetzt hin, bepackt mit Angelrute und Eimerchen. Kattys Mutter war wach, aber sie sah ihre Familie nicht. Lästige Hindernisse waren sie auf dem Weg in ihre Kindheit. Sie erkannte weder ihren Mann noch ihre jüngste Tochter, nur der Lieblingssohn Josef durfte sie anfassen. Allerdings nannte sie ihn Joop und glaubte, er sei ihr Bruder. Ihre Familie war darüber entsetzt und traurig, doch trotz allem war es auch komisch, wie die Mutter dastand, auf Holländisch schimpfte und verzweifelt versuchte, sich aus den Umarmungen zu befreien, um endlich die Gummistiefel anzuziehen. Sie wollte eben angeln. Irgendwann kam Josef auf die Idee, sie auf die Wiese hinauszulassen. Er nahm ihre »Angelrute«, führte die Mutter an eine große Kuhtränke und ließ sie gewähren.
Am nächsten Tag konnte sie sich an nichts erinnern. Sie war wach, sie erkannte ihre Familie und schüttelte ungläubig den Kopf, als Katty ihr davon erzählte, wie sie mit Josef in einem Kuhkübel geangelt hatte. Erst lachte ihre Mutter, dann ging die Erheiterung nahtlos in Schluchzen über. Sie hatte Angst und im Grunde wusste sie nicht, was sie mehr fürchtete: das Sterben oder das Verrücktwerden.
Der Angeltag war Vorbote eines Leberkomas gewesen, in das sie wenige Wochen später fiel. Sie erwachte nur noch ein einziges Mal aus diesem Tiefschlaf und schrie dabei vor Schmerzen. Als Katty zu ihr ging, um ihre Stirn mit einem feuchten Tuch zu tupfen und ihr über den Kopf zu streicheln, tobte die Mutter. Mit letzter Kraft nahm sie Kattys Arm und schubste ihn weg. Katty war fast dreizehn. Sie wusste, dass es eine Reaktion auf die Schmerzen sein musste, aber dieser Moment blieb ihr für immer bitter in Erinnerung. Es war die letzte Geste ihrer Mutter, die letzte Berührung, und die besagte: Geh weg.
Katty merkte, dass sie immer noch schlucken musste bei diesem Gedanken. Die Szene war mehr als zwanzig Jahre her und bis heute fragte sie sich, ob sie damals etwas falsch gemacht hatte und ob ihre Mutter sie wirklich genauso geliebt hatte wie die anderen Kinder.
Christine Trauten hatte nicht lange leiden müssen. In den Zwanzigerjahren, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, hatten viele Ärzte Heroin im Arzneischrank, auch der Dorfarzt. Nachdem seine Schafsläuse keine durchschlagende Wirkung gezeigt hatten, kam er mit einer Spritze. Die Gesichtszüge der Sterbenden entspannten sich, ihr Atem ging langsam und rasselnd. Das Schnarchen wurde immer schleppender, aber es gab keine Anzeichen von Agonie. Irgendwann atmete sie vielleicht noch einmal in der Minute, dann tat sie ihren letzten Atemzug. Man sah den Tod, bevor man ihn begreifen konnte. Das Leben wich aus ihrem Körper, die Farbe lief von oben aus ihr heraus, als hätte jemand an den Füßen einen Stöpsel gezogen. Die Familie hatte sich am Sterbebett versammelt. Keiner sagte etwas, alle blickten auf den Leichnam, der plötzlich nicht mehr im Mindesten an ihre Mutter erinnerte. Kattys Vater beugte sich nah über das Gesicht seiner Frau, um zu spüren, ob noch Luft aus ihrem Mund kam. Er drückte ihre Augen zu, küsste sie auf die Stirn und verließ den Raum. Die Kinder taten es ihm nach und folgten ihm ins Wohnzimmer.
Kattys Vater hatte Schnaps auf den Tisch gestellt, für sich und die erwachsenen Kinder, für Katty gab es Milch. Es war inzwischen elf Uhr abends, und sie saßen schweigend da. Als Katty zu weinen anfing, nahm Martha sie in den Arm, bis sie plötzlich ein Geräusch vernahmen: Aus dem Zimmer, in dem der Leichnam ihrer Mutter lag, hörte man ein kräftiges, gleichmäßiges Schnarchen. Sie wurden allesamt bleich. War die Mutter etwa wieder lebendig? Oder gar nicht tot gewesen? War sie vielleicht nur scheintot gewesen?
Katty gruselte sich bei dieser Vorstellung. Von der alten Tante Greta hatte man sich das erzählt. Sie war gestorben, in den Sarg gelegt worden und bei der Beerdigung wieder aufgewacht. Angeblich hatte sie die Erde auf den Sarg prasseln hören. Und dann hatte sie geschrien, völlig verzweifelt, bis die Sargträger, von Entsetzen gepeinigt, den Sarg wieder hochgeholt und geöffnet hatten. Tante Greta hatte wohl so furchtbar ausgesehen, dass man sie für eine Untote hielt. Ein echtes Gespenst. Der Pfarrer hatte Bibelverse gemurmelt, um den Leibhaftigen zu besänftigen, und währenddessen hatte es in der Trauergemeinde ein heilloses Durcheinander gegeben. Die arme Tante Greta sollte ihre Wiederauferstehung nicht lange überleben. Ein paar Tage später hatte ihr Herz endgültig versagt.
Diese Geschichte hatte Katty verfolgt. Jeden Abend vor dem Einschlafen hatte sie Angst gehabt, man könnte sie für tot halten und vergraben. Deshalb hatte sie über Monate hinweg einen Brief mit ins Bett genommen, auf dem klipp und klar stand: »Ich bin nicht tot. Weckt mich. Und wenn ich nicht aufwache, stellt mich mindestens fünf Tage vor die Tür. Ich will erst beerdigt werden, wenn ich ganz bestimmt verstorben bin.«
Aber an diesem Abend ging es nicht um irgendwelche Schauermärchen, nicht um irgendeine alte Tante Greta. Es ging um ihre Mutter. Hatten sie sie einfach aufgegeben, obwohl sie noch lebte? Als sie sich aus der Starre lösen konnten, liefen sie ins Nebenzimmer.
Was sie da sahen, trieb ihnen die Tränen in die Augen. Einer der Jagdhunde hatte sich ins Zimmer geschlichen. Niemand hatte ihn beachtet, und so lag er nun neben dem geliebten Frauchen auf dem Rücken, hatte alle viere in die Luft gestreckt und schnarchte laut. In diesem Moment ergossen sich Monate der Sorge, der Hoffnung, der Angst und Trauer in schallendes Gelächter. Sie hatten sich die Bäuche gehalten vor Lachen, dann war es wieder ein Weinen gewesen. Ihre Körper waren von den verschiedenen Emotionen durchgeschüttelt worden, bis Katty irgendwann in Marthas Armen eingeschlafen war.
Dem Tod wohnte etwas Absurdes inne, so schien es Katty seitdem. Irgendetwas, das den Hinterbliebenen ein wehmütiges Lachen ließ. Wie sollte man sonst auch weiterleben? Katty versuchte, die Erinnerung an ihre Mutter abzuschütteln. Sie wollte sich auf Theodor konzentrieren und ging hinüber in sein Zimmer. Auf dem Schreibtisch stand eine gerahmte Fotografie, die kurz vor dem Krieg aufgenommen worden war. Katty streichelte sein Gesicht. Er hatte die schönen runden Augen seines Vaters, ein wenig pausbäckig war er immer noch, und er hatte einen übergroßen Mund, der das restliche Gesicht überstrahlte. Wenn er lachte, sprach oder aß, wenn sein Mund in Bewegung war, sah man nur noch diese riesigen lebenshungrigen Lippen. Waren die nun so fahl, wie die Lippen ihrer Mutter binnen Sekunden geworden waren?
Katty stellte sich vor, wie Theodor dalag, bleich, nichts mehr von den roten Wangen eines Kindes. Mit diesem Bild kamen endlich die Tränen. Sie weinte, und der Schmerz in der Kehle fühlte sich richtig an.
Der 100. Geburtstag – Donnerstag
Endlich zu dritt
»Mein Gott, seht ihr alt aus. Pöhöhö.« Martha lachte ihr ploppendes Lachen, während sie aus dem Taxi stieg, und amüsierte sich königlich über ihre kleine Unverschämtheit. Die war nämlich gleich doppelt komisch, dachte Katty. Erstens war ihre ältere Schwester selbst fast achtundneunzig Jahre alt, und zweitens war sie so gut wie blind.
»Was hat sie gesagt?«, war Adeles krächzende Stimme hinter ihr zu vernehmen. In dem dichten Kiesbett der Einfahrt rutschte Adele bei jedem Schritt weg und kam nicht so schnell hinterher, wie es ihr lieb gewesen wäre.
»Sie findet, dass wir alt aussehen«, wiederholte Katty sehr laut, woraufhin Martha erneut losploppte. Adele reagierte nicht. Sie hatte vermutlich keine Lust, noch einmal nachzufragen, um einer lästigen Hörgerätediskussion keine neue Nahrung zu geben.
Seit mindestens zehn Jahren bearbeitete Katty ihre Schwester, sie solle sich endlich so ein Ding besorgen, weil sie keine Lust hatte, ständig zu schreien. »Jetzt bin ich schon so alt, da fange ich mit dem Unsinn auch nicht mehr an«, bekam sie stets zur Antwort.
Martha konnte wie immer nicht aufhören mit der Neckerei.
»Tja, Katty, da hast du dir was eingebrockt mit deinen Schwestern. Die eine blind, die andere taub, da lass uns heute Abend mal schön Skat kloppen.«
Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis Martha ihr Portemonnaie aus der Handtasche hervorgekramt hatte und es dem Taxifahrer reichte.
»Nehmen Sie sich, was Sie brauchen, junger Mann. Wenn ich kein Geld mehr habe, kann es mir meine Schwester wenigstens nicht aus der Tasche ziehen.«
»Ich habe dich sowieso nur zum Spülen eingeladen«, gab Katty schelmisch zurück. Mit Schwung ergriff sie Marthas Koffer und marschierte voran. Sie war überglücklich, dass Martha da war. Ihre Schwester war ein Ausbund an guter Laune, der sich niemand entziehen konnte. Nicht einmal Adele. Martha würde Kattys Verbündete sein bei der heiklen Mission, die vor ihr lag.
Für gewöhnlich wohnte Martha in Theodors ehemaligem Zimmer, wenn sie auf dem Tackenhof zu Besuch war. Das Kinderzimmer, wie es bis heute genannt wurde, war ihr Lieblingszimmer, weil es sehr weit vom Wohnzimmer entfernt und dadurch schön ruhig war. Es gab in dem alten Bauernhaus viele Räume, und in den Siebzigerjahren hatte Katty alle Zimmer renovieren lassen, um auf dem Hof eine kleine Pension zu betreiben. Sie war meist ausgebucht, denn das nahe gelegene Xanten galt als Touristenattraktion und Katty rühmte sich, das beste Frühstück weit und breit zu machen. Es gab Eier und Speck, außerdem das leckerste Weißbrot, das man am unteren Niederrhein finden konnte. Abends saß sie in der Regel noch lange mit ihren Gästen zusammen, und die mochten nicht nur Kattys Geschichten, sondern auch die familiäre Atmosphäre. Seit ihrem Achtzigsten hatte Katty das Pensionsgeschäft allerdings deutlich eingeschränkt. Im Grunde kamen nur noch die alten Stammgäste. Einige von ihnen, wie Piet, der Belgier, waren über die Jahre zu Freunden geworden. Er würde im Laufe der Woche zur Feier anreisen. »Isch liebe euch lustige alte Mädche«, sagte Piet immer in seinem deutsch-flämischen Singsang. Piet war um die fünfzig, ganz genau wusste das keiner, hatte oben schütteres und hinten viel zu langes Haar. Er lief am liebsten in Lederhose und weißem Hemd herum und trank zu viel. Nichts in seinem Gesicht passte zueinander, die Augen standen zu eng beieinander, die Nase war zu groß und der Mund schief. Dazu hatte er Segelohren, an denen man nicht einmal aus Höflichkeit vorbeigucken konnte. Aber, und das zählte, er war ein treuer Gast und hatte das Herz am rechten Fleck. Und so wollte er es sich nicht nehmen lassen, Adele zum Hundertsten das zu schenken, was er für das Beste an sich hielt: seine Stimme. Piet war Alleinunterhalter, er und sein Tastophon brachten Säle zum Kochen – behauptete er jedenfalls. Und als er Katty mit sich vor Begeisterung überschlagender Stimme von seinem Geschenk erzählte, hatte sie es nicht übers Herz gebracht, ihn abzuwimmeln. Das Problem würde man später lösen, dachte sie, während sie Marthas Koffer ins Haus trug. Außerdem gehört Piet fast zur Familie, da wird Adele wohl mal ein Auge zudrücken können, redete sie sich ein und ahnte doch, dass Piets Musik mit Adeles Musikgeschmack nicht das Geringste zu tun hatte.
Der Tackenhof war, solange Katty sich erinnern konnte, immer ein offenes Haus gewesen. Diese Tradition hatte sie auch nach Heinrichs Tod beibehalten. Sie liebte es, bis tief in die Nacht zu diskutieren, vor allem mit den Bauern aus der Nachbarschaft über Landwirtschaft oder Politik. Wenn sie Nichten und Neffen zu Besuch hatte, konnte sie sich bis zum Kontrollverlust ereifern. An solchen Abenden gab es viel fettes Essen und ordentlich Schnaps, dann wurde lange geschlafen und am nächsten Morgen spät gefrühstückt. Trotz ihrer vierundachtzig Jahre konnte Katty immer noch gut mithalten, fand sie. »Ich kann die Bauern immer noch unter den Tisch trinken!« Das war ihr Standardspruch, wenn jemand sie fragte, wie es ihr gehe. Nur wenn Adele bei ihr war, und das war in letzter Zeit häufiger der Fall gewesen, war das alles nicht möglich. In ihrem Alter schlief sie schlecht, und wenn sie nachts aufstand und die Gesellschaft noch im völlig überhitzten Wohnzimmer vorfand, machte sie Katty Vorwürfe. Das sei schlechtes Benehmen, so etwas gehöre sich nicht. Die Gäste hatten dann ihrerseits ein schlechtes Gewissen, wer störte schon gerne eine Hundertjährige. Katty fürchtete sich davor, dass die Ruhe auf dem Hof ein Dauerzustand werden könnte, falls Adele bei ihr einzog. Aber das war eigentlich unumgänglich. Katty wollte dringend einen Moment mit Martha allein sein, um sich zu besprechen, und fragte daher:
»Adele, machst du uns schon mal einen Kaffee? Dann wird er wenigstens schön stark. Ich helfe Martha schnell beim Auspacken, und danach setzen wir uns in den Garten.«
»Kannst du für mich bitte noch einen Kessel mit Wasser auf den Herd stellen?«, rief Martha auf halber Treppe in die Küche hinunter. »Bei deinem Kaffee schlägt mein altes Herz Flickflack.«
»Du als ehemalige Sportlehrerin solltest das doch eigentlich gut finden«, neckte Katty. »Komm, ich habe dir dein Zimmer schon hergerichtet.« Sie zog Martha hinein und schloss die Tür.
»Es ist schon wieder etwas passiert. Wir müssen handeln.« Katty hoffte, dass Martha mit ihrem Humor bei Adele mehr Erfolg hätte. Ihr selbst fiel es schwer, die große Schwester von etwas zu überzeugen, was sie eigentlich beide nicht wollten und doch längst hätte sein müssen: Adele sollte ihre kleine Wohnung in Xanten aufgeben, die Unfälle häuften sich.
»Diesmal ist sie gestürzt. Und sie kann sich nicht erinnern, was passiert ist.«
»Hat sie sich etwas getan?«
»Nein, aber Doktor Duscher sagt, sie muss einen Schutzengel gehabt haben, sie hätte sich alle Knochen brechen können. Er vermutet, dass ihr schwindlig geworden ist. Ihr Kreislauf war mal wieder schuld. Und da ist sie umgekippt.«
»Oh Gott, macht sie seitdem etwa noch stärkeren Kaffee?«, fragte Martha mit gespieltem Entsetzen.
»Du bist unmöglich«, feixte Katty, »ganz ehrlich, wenn José sie nicht gefunden hätte, hätte sie dort womöglich tagelang gelegen.«
»José hat sie gefunden? Unser aller Josélein?«
Katty wusste, dass Martha José mochte, dennoch war die gemeinsame Schwägerin immer wieder Ziel ihrer Sticheleien. Und waren es bei Martha eher liebevolle Neckereien, so bekam die arme José von Adele oftmals regelrechten Spott zu spüren. Manchmal tat sie Katty richtig leid. José und Adele lebten in Xanten nur wenige Häuser voneinander entfernt. Sie konnten nicht ohneeinander, aber auch nicht miteinander. Sie stritten wie die Kesselflicker. José fühlte sich von Adele bevormundet, was im Übrigen tatsächlich der Fall war, dachte Katty, der es ja ähnlich ging. Eigentlich kümmerte Adele sich ein wenig um die lebensuntüchtige José und erinnerte sie an Termine oder bezahlte diskret die kleinen Rechnungen, die José in der benachbarten Bäckerei anschreiben ließ. Da José davon aber natürlich nichts mitbekam, hielt sie es ihrerseits für eine gute Tat, dass sie als die wesentlich Jüngere Adele so häufig Gesellschaft leistete, und erwartete dafür Dankbarkeit. Dieses beiderseitige Missverständnis endete regelmäßig in grässlichem Gezänk.
»Gott sei Dank war José mal wieder richtig wütend auf Adele. Die beiden hatten sich am Vortag gestritten. Und als José bei Adele an die Tür geklopft hat, hörte sie nur ein Stöhnen. Da dachte sie wohl, Adele würde die Tür aus Trotz nicht öffnen, und hat im Flur getobt.«
Martha schien nur mit Mühe ein Lachen zu unterdrücken bei der Vorstellung, dass ihre Schwägerin wild und unerbittlich gegen die Tür schlug.
»Hoffentlich ist die Perücke nicht verrutscht«, entfuhr es ihr und nun musste auch Katty lachen.
»Nein, jetzt sei mal ernst! Das hätte wirklich übel enden können. Die Nachbarn haben mich angerufen, damit ich mit dem Schlüssel komme. Ständig passiert so etwas. Habe ich die Sache mit der Herdplatte erzählt?«
»Nicht so laut, Katty«, unterbrach Martha sie schnell, »nicht dass sie glaubt, wir würden uns gegen sie verbünden.«
»Du hast recht. Aber sie muss ihre Wohnung jetzt wirklich aufgeben, es ist zu gefährlich, wenn sie weiterhin allein lebt. Und hier ist es allemal besser als in einem Altersheim«, sagte Katty, auch um sich selbst zu versichern, dass ihre Entscheidung richtig war. Martha antwortete nicht sofort.
»Meinst du, sie wird hier auf dem Hof leben wollen?«, fragte sie schließlich skeptisch.
»Ja, Herrgott, warum denn nicht. Sie ist doch auch über die Jahre immer bei uns zu Besuch gewesen.«
»Das ist doch etwas anderes, Katty. Ich kann dir aus eigener Erfahrung versichern: Je älter du wirst, umso mehr drängt sich die Vergangenheit wieder in dein Leben, selbst wenn sie zwischendurch vergessen war. Das wirst du noch feststellen, du junger Hüpfer«, Martha lachte kurz und wurde dann wieder ernst. »Sie wird in seinem Haus nicht sterben wollen. Kannst du das nicht verstehen?«
»Es ist mein Haus. Heinrich ist seit fünfundzwanzig Jahren tot. Außerdem gibt es keine andere Möglichkeit. Oder willst du sie etwa zu dir und den Kindern holen?«
»Nach Düsseldorf? Wer pflegt denn dann wen? Also gut, wir werden mit ihr reden. Ich werde ihr schon verständlich machen, dass sie hier besser dran ist als in Xanten. Aber lass mich erst mal ankommen. Ich muss ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wir reden später, in Ordnung?«
»Wie lange bleibst du denn eigentlich?«
»Mal schauen, ich habe in den nächsten Wochen keine Termine. Oder soll ich auch ganz dableiben?«
»Ich hätte nichts dagegen«, Katty gab ihrer Schwester einen Kuss auf die Stirn. »So, und jetzt pack aus und komm danach herunter.«
Der 100. Geburtstag – Donnerstag
Franz und die Trautens
»Ich bin vielleicht taub, aber tumb bin ich nicht«, brummte Adele ihren Schwestern hinterher. Sie wusste, dass die beiden oben über sie redeten und dass Katty ihr nur deshalb das Kaffeekochen überlassen hatte, damit sie außer Hörweite war. Sonst mochten sie ihren Kaffee ja auch nicht.
So, das haben sie jetzt davon, dachte Adele und gab noch einen Extralöffel Kaffeepulver in die Filtertüte. Vermutlich würde Katty Martha eine völlig übertriebene Version dieses kleinen Missgeschicks neulich erzählen. Es war doch im Grunde gar nichts passiert. Eine lächerliche Kleinigkeit.
Sie stellte die Kaffeemaschine an und wartete einen Moment, bis sie das vertraute Brodeln hörte, dann verließ sie die Küche und ging die wenigen Meter bis in das Schlafzimmer, das Katty für sie vorbereitet hatte. Sie war bereits am Vortag angekommen, ihr kleiner Koffer war ausgepackt. Sie glättete die Tagesdecke, setzte sich auf das Bett und wusste nicht so recht, was sie tun sollte. Es stank nach Muff und Staub in diesem Zimmer. Und nach Mottenkugeln, dachte sie, widerlich, Katty könnte wenigstens lüften, bevor ich komme. Da sie gerade ohnehin nicht gut auf die kleine Schwester zu sprechen war, war Adele froh, einen Grund für Kritik gefunden zu haben. Sie stand auf, ging zum Fenster und öffnete es. Ihr Blick verlor sich in dem großen Garten. Er war umsäumt von haushohen Lebensbäumen. Wie groß die jetzt waren, damals waren sie allenfalls schulterhoch gewesen. Achtzig Jahre war es her, dass sie dort gesessen hatte. In Gedanken sah sie Katty als kleines Kind über den Rasen laufen. Es war für sie beide das erste Mal gewesen, dass sie den Tackenhof betreten hatten, etwa ein halbes Jahr zuvor hatte sie Franz kennengelernt.
Adele war gerade zwanzig geworden, sie würde diesen Tag nie vergessen. Sie hatte die Koffer für eine ihrer Schwestern gepackt, die erste, die aus der großen Familiengemeinschaft auszog. Adele war ein bisschen neidisch gewesen. Sie erinnerte sich, wie sehr sie sich nach Selbstständigkeit gesehnt hatte und dass sie endlich ein eigenes Leben hatte führen, der Enge zu Hause hatte entfliehen wollen. Wehmütig dachte sie an ihren Vater.
Er hatte damals ebenfalls voller Euphorie in diesem Garten gesessen. Nicht zuletzt, damit er stolz auf sie sein konnte, hatte sie sich auch in schwierigen Situationen durchgeboxt und niemals aufgegeben. Sie hatte die Mittelschule besucht, war aufs Gymnasium gewechselt und hatte das Abitur geschafft. Manche Lehrer hatten sie dazu ermuntert und ihr gesagt, wie ungewöhnlich und wichtig das für sie als einfaches Bauernmädchen sei. Andere hatten versucht, sie davon abzuhalten. »Wozu?«, hatten sie gesagt. »Du wirst ohnehin bald heiraten. Dafür brauchst du kein Abitur.« Doch denen hatte sie es gezeigt. Sie war wissbegierig, hatte ein gutes Gedächtnis, und sie liebte es, zu lesen und zu lernen. Das Einzige, was ihr damals Sorgen bereitet hatte, war das Geld. Sie kostete ihren Vater Geld, statt welches zu verdienen, und war damit auch noch Vorbild für Martha gewesen, die ihrer großen Schwester in der Schule nachgeeifert hatte. Ihr Vater hatte sie beide in ihrem Wunsch nach Bildung unterstützt, obwohl er es sich nicht leisten konnte. Der kleine Hof, auf dem sie lebten, musste dreizehn Menschen ernähren, und ihr Vater war völlig überschuldet gewesen.
Richtig modern war er, dachte Adele, als sie jetzt am Fenster stand, ungewöhnlich für jemanden, der noch vor der Gründung des Kaiserreichs geboren worden war. Jeder andere hätte seine ältesten Töchter möglichst schnell verheiratet, egal mit wem, damit sie aus dem Haus waren. Nicht so Ludwig Trauten. Adele lächelte. Übertriebene Moralvorstellungen waren Ludwig Trauten fremd gewesen, Epikurs Lehre gefiel ihm, und er machte sich eine eigene Mischung aus der griechischen und katholischen Lehre. Seiner Ansicht nach hatte jeder das Recht, im Diesseits nach Glück zu streben, aber nur so sehr, dass man gegebenenfalls auch in einem katholischen Jenseits nicht komplett anecken würde.
Politisch gesehen wäre er heute sicher das, was man linksliberal nannte, überlegte Adele. Wenn das Katty wüsste, griente sie, die Diskussion möchte ich gerne hören. Katty war streng konservativ und ihrer Meinung nach war jeder, der nicht die CDU wählte, suspekt, verdächtig, im Grunde ein Terrorist. Ob sie für ihren eigenen Vater da eine Ausnahme machen würde? Damals war Katty noch zu klein gewesen, um sich mit ihm auseinanderzusetzen. Sie selbst und Martha hingegen hatten zu Hause immer viel diskutiert. Ludwig Trauten war schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Anhänger der Deutschen Freisinnigen Partei gewesen, die sich rund um den Grafen Schenk von Stauffenberg gegründet hatte. Adele wunderte sich, dass ihr das alles in diesem Moment einfiel, aber es lag wohl daran, dass sich im Juli das berühmte Hitler-Attentat zum fünfzigsten Mal jährte und der Name deshalb in den Medien war. Es waren zwei verschiedene Grafen von Stauffenberg, der Parteigründer und der Hitler-Attentäter, aber verwandt waren sie doch mit Sicherheit gewesen, überlegte sie. Den Versuch, Hitler zu töten, hatte Ludwig Trauten schon nicht mehr erlebt, aber er hätte ihn vermutlich gutgeheißen. Er war im Grunde seines Herzens revolutionär gewesen. Er hatte von Bürgerrechten und Meinungsfreiheit geschwärmt, davon im Dorf allerdings niemanden begeistern können. Die Menschen am Niederrhein waren streng katholisch, eingeschüchtert von einem lieben Gott, der sehr genau vorschrieb, wie das Glück auf Erden zu sein hatte. Und alle machten mit, der sonntägliche Kirchgang war Pflicht. Sie waren damals auch einmal in der Woche zum Gottesdienst gegangen, heute hatte Adele das auf festliche Zeremonien und die Christmette eingeschränkt. Einen Vorteil muss das Alter ja haben, sagte sie sich, wenigstens hat man immer eine gute Ausrede. Damals hatten sie die Kirche vor allem ihrer Mutter zuliebe besucht, wobei ihr Vater es sich nicht hatte nehmen lassen, im Anschluss über die Predigt, die Bibel und die katholische Kirche zu sprechen und deren Lehre zu hinterfragen. Adeles Mutter war darüber stets missmutig und der Sonntagnachmittag alles andere als ein Ruhetag in der Familie Trauten gewesen. Ludwigs Ideen und Vorstellungen von der Welt mussten ihr ketzerisch vorgekommen sein, im Grunde hatte sie wohl Angst, dass Gott sie eines Tages für diesen Hochmut bestrafen würde. Doch Ludwig hatte seine Kinder dazu erzogen, Fragen zu stellen und zu diskutieren, und in Adele und Martha den Wunsch geweckt, zu lernen und zu lehren.
Adele hatte gerade die Ausbildung zur Volksschullehrerin beendet, als sie Franz das erste Mal begegnete. Es war Kirmes in Rees, dem nächstgelegenen größeren Ort. Die Reeser waren im August 1914 in Feierlaune, denn knapp eine Woche zuvor hatte Deutschland Russland den Krieg erklärt, und es herrschte eine nationale Rauflust. Die älteren Männer im Festzelt konnten sich noch an die Schlacht von Sedan erinnern, sie erzählten mit glühenden Wangen davon und behaupteten, das Deutsche Reich könne Frankreich ungespitzt in den Boden rammen.
Die Kirmesbesucher waren in diesem Jahr also besonders ausgelassen. Adele war jung, sie war nicht verlobt, aber mittlerweile sprach für sie nichts mehr dagegen, einen Mann zu finden. Und da stand er. Sie wusste vom ersten Moment an, dass sie genau diesen wollte.
Franz war groß und schlank, ähnlich wie Adele. Sie war 1,75 Meter groß, damit überragte sie alle ihre Freundinnen um mindestens einen halben Kopf. Sie schaute ihn scheu an, wie er dastand, so leger an die Theke des Festzeltes gelehnt. Er hatte sich fein gemacht, im schwarzen Anzug, sein braunes Haar war kurz geschnitten, und er wirkte unglaublich selbstbewusst. Er lächelte sie an, sie blickte zu Boden. Dann begann die Tanzveranstaltung, und es dauerte nicht lange, bis Franz zu Adeles Vater ging und fragte, ob er seine Tochter auffordern dürfe. Es war ein Walzer, und er schien endlos zu dauern. Adele war nicht besonders geschickt auf dem Parkett, und angesichts dieses galanten jungen Mannes kam sie sich vor wie ein Trampel. Zwar trat sie ihm nicht auf den Füßen herum, aber irgendwie waren ihre Knie ständig im Weg, ihre Schritte waren nicht elegant genug, und sie hatte das Gefühl, dass sie in der Linksdrehung zu langsam war. Sie schämte sich. Als der Walzer zu Ende war, schaffte sie es gerade noch, sich artig zu bedanken, dann lief sie zurück an den Tisch ihrer Familie. Sie hätte heulen können.
Franz war all das wohl nicht aufgefallen. Vielleicht hatte er auch einfach dem Schnaps schon kräftig zugesprochen, jedenfalls kam er nach einer Weile erneut an ihren Tisch und fragte, ob er Adele besuchen dürfe.
Franz lebte zwanzig Kilometer entfernt in Wardt, und als er einige Wochen später das erste Mal mit dem Fahrrad auf ihren Hof gefahren kam, wäre Adele gerne erneut im Erdboden versunken. Alles war klein und eng, sie waren arm und das sah man an jeder Ecke. Das Haus hatte im unteren Geschoss keinen Fußboden, sondern stand auf blankem Lehm. Sie hatten weder einen Salon, in dem sie mit Franz hätte sitzen können, noch irgendeinen anderen Raum, in dem man ungestört sein konnte. Also saßen die jungen Leute in der Küche, die kleineren Kinder liefen um sie herum, kreischten vor Vergnügen, und Josef, der damals sechs Jahre alt war, wollte unbedingt mit Franz Ball spielen. Es war entmutigend. Doch wider Erwarten schien es Franz zu gefallen. Bei ihm zu Hause sei es sehr still, erklärte er.
Und so legte Adele ihre Hemmungen ab, und die beiden verliebten sich. Adele dachte gern an diesen Moment zurück, alles war so unbeschwert gewesen. Bis wir hierherkamen, dachte sie und schloss energisch das Fenster. Ihr war ein bisschen schwindlig geworden. Sie wusste nicht, ob das an ihrem niedrigen Blutdruck lag oder daran, dass die alten Gefühle wieder lebendig wurden.
Sie merkte, wie sich ihr der Magen umdrehte. Es fühlte sich an wie damals, gut ein halbes Jahr nachdem sie Franz kennengelernt hatte. Er hatte ihre Zukunft planen und sie seiner Familie vorstellen wollen. Und Adele war schlecht gewesen vor Aufregung.
5. April 1915
Das Schweigen der Fährendorfs
Der Frühling kam 1915 früher als gewöhnlich. Und so war es ein besonders warmer Tag Anfang April, als Adele sich mit ihren Eltern und der kleinen Katty für den wichtigen Besuch auf dem Tackenhof zurechtmachte.
Es war Ostermontag und Katty, die gerade fünf Jahre alt geworden war, hatte im Garten nach Ostereiern suchen dürfen. Wie verrückt war die Kleine über den Rasen getollt, hatte hinter jede Pusteblume geschaut und vor Freude mit ihren kurzen Beinchen fest aufgetrampelt, wenn sie wieder ein Ei gefunden hatte. Eier gab es im Hause Trauten genug, sie hatten schließlich Hühner. Alles andere war Mangelware.
Deshalb hatten sie auch kein vernünftiges Gastgeschenk für Familie Fährendorf, was Adele seit Tagen beschäftigte, und so hatte sie Katty wenigstens noch ein paar Blumen pflücken lassen. Katty war die Einzige der Geschwister, die mitfahren würde. Alle anderen blieben unter Marthas Obhut zu Hause, was vor allem die Jungs ärgerte, die gerne mit Franz Ball gespielt hätten. Nun hatte Katty einen Narzissenstrauß gepflückt, und der sah gar nicht mal so schlecht aus, fand Adele. Zusammen mit dem selbst gebrannten Schnaps, den Adeles Vater unter den Arm geklemmt hatte, musste es reichen.
Ludwig Trauten spannte den alten Wallach Neptun vor den Wagen, Neptun ließ es sich stoisch gefallen. Dennoch hatte Adele Mitleid mit dem alten Tier. Bei der Hitze würde er sie weit ziehen müssen. »Na wenigstens bekommst du bei den Fährendorfs guten Hafer, das verspreche ich dir«, tröstete sie das Pferd. Und das wieherte, als hätte es verstanden.
Jedes Tier auf dem Hof trug den Namen einer Figur aus der römischen oder griechischen Mythologie. Der Hahn krähte unter dem Namen Apollo und die Sauen hießen Alekto, Megaira und Tisiphone, wie die Furien. Adele hatte von ihrem Vater die Liebe zu den alten Göttern, Halbgöttern und deren Fehlbarkeit übernommen. Immer und immer wieder hatte er seinen Kindern die alten Geschichten vorgelesen. Selbst die kleine Katty kannte sich im Olymp schon besser aus als in Empel, vermutete Adele.
Sie blickte prüfend auf ihre Familie. Ludwig Trauten war groß und dick. Er hatte trotz seiner fast fünfzig Jahre noch volles Haar, das sich kräuselte und das er deshalb unter einem runden Hut versteckte. Dazu trug er einen grauen Anzug aus grober Wolle, und selbst wenn man nicht genau hinschaute, sah man, dass dieser an den Ärmeln etwas fadenscheinig war. Ihre Mutter hatte etwas Aristokratisches. Sie war wie Adele sehr groß und beinahe dürr. Die langen, vorne geknöpften Kleider standen ihr hervorragend. Trotz ihrer ohnehin schlanken Taille bestand sie darauf, ein Korsett zu tragen, und mit dem Schleierhut wirkte sie tatsächlich edel. Bis auf die Hände. Die grobe Hornhaut verriet sie als Bäuerin, und auch ihr Gesicht war unter dem Schleier sonnengegerbt wie das einer Arbeiterin. Adele fragte sich, ob Franz’ Mutter auch auf dem Feld arbeitete. Wohl nicht, vermutete sie und bereitete sich darauf vor, eine Frau von nobler Blässe kennenzulernen. Sie hatte kein gutes Gefühl.
Adele hatte sich von ihrem Lehrerinnengehalt feinen grauen Stoff geleistet und daraus ein eng anliegendes Kostüm geschneidert. Der Rock war lang und reichte bis zum Knöchel, die Jacke besaß moderne kleine Polster an den Schultern. Auf ein Korsett verzichtete sie selbstverständlich, sie fand die Dinger grässlich. Warum sollte sie sich den Körper auf fünfundfünfzig Zentimeter einschnüren lassen, wenn der doch eigentlich mindestens fünfundsechzig Zentimeter breit sein wollte? Wer hatte etwas davon, wenn sie ständig nach Luft rang, ihr übel wurde und sie drohte in Ohnmacht zu fallen? Viele ihrer Freundinnen dachten wie sie. So ein Korsett war etwas für alte Weiber, die viele Kinder bekommen hatten. Eigentlich nicht einmal das, es war ein überflüssiges Ding, das Frauen zu körperlicher Schwäche verdammte.