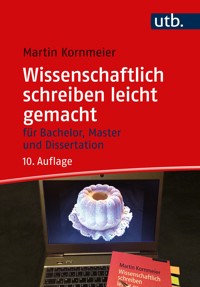
17,99 €
Mehr erfahren.
Wie gelingt es, ein wissenschaftliches Werk auf die erforderlichen Qualitätskriterien auszurichten und gleichzeitig lesefreundlich zu schreiben? Prägnant, anschaulich und mit vielen Beispielen zu Inhalt und Stil erklärt dieses Lehrbuch, wie man erfolgreich und verständlich schreibt: • Warum benötigt eine wissenschaftliche Arbeit ein präzise formuliertes Thema? Eine Forschungsfrage? Definitionen und Hypothesen? Einen Theorieteil? • Welche Literatur ist zu bevorzugen? Wie bewertet man deren Qualität? • Wie soll die Arbeit gegliedert werden? • Wie argumentiert man wissenschaftlich? • Wie wird man rechtzeitig fertig? • Wie meistert man „Schreibkrisen“? • Wie entwickelt man einen Schreibstil, der beim Lesen Spaß macht? Die ultimative Arbeitshilfe für erfolgreiches und besseres Schreiben in Studium und Wissenschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
[1]utb 3154
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink • Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht • Göttingen – Böhlau • Wien • Köln
Verlag Barbara Budrich • Opladen • Toronto
facultas • Wien
Haupt Verlag • Bern
Verlag Julius Klinkhardt • Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck • Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag • Tübingen Psychiatrie Verlag • Köln
Ernst Reinhardt Verlag • München
transcript Verlag • Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer • Stuttgart
UVK Verlag • München
Waxmann • Münster • New York
wbv Publikation • Bielefeld
Wochenschau Verlag • Frankfurt am Main
[3]Martin Kornmeier
Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht
für Bachelor, Master und Dissertation
10., aktualisierte und ergänzte Auflage
Haupt Verlag
[4]Prof. Dr. Martin Kornmeier: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim sowie an der ESSEC/Cergy-Pontoise. 2002 Promotion zum Dr. rer. pol. an der Technischen Universität Dresden. Seit 2002 Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim; Leiter des englischsprachigen Double degree-Programms „International Business“; zahlreiche Publikationen in Wissenschaftstheorie/wissenschaftliches Arbeiten sowie in International, Intercultural und Domestic Marketing/Management.
10. Auflage 2024
9. Auflage 2021
8. Auflage: 2018
7. Auflage: 2016
6. Auflage: 2013
5. Auflage: 2012
4. Auflage: 2011
3. Auflage: 2010
2. Auflage: 2009
1. Auflage: 2008
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
http://dnb.dnb.de
UTB-Bandnr.: 3154
ISBN 978-3-8252-6207-5 (Buch)
ISBN 978-3-8463-6207-5 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © 2024 Haupt Bern
Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Umschlagabbildung (Gugelhupf): Hildegard und Walter Kornmeier
Einbandgestaltung: Siegel Konzeption Stuttgart nach einem Konzept von Atelier Reichert, Stuttgart
Satz: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen
www.haupt.ch
[5]„Das ist ein häßliches Gebrechen, wenn Menschen wie die Bücher sprechen. Doch reich und fruchtbar sind für jeden die Bücher, die wie Menschen reden.“
(Oskar Blumenthal, 1852–1917)
Vorwort zur 10. Auflage
[6]Liebe Leserinnen und Leser,
im September 2008 erschien Auflage 1 von „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“. Dass dieses Buch – gewachsen mit den Bedürfnissen des Marktes, den veränderten Rahmenbedingungen (z. B. KI / ChatGPT) sowie den kritischen Hinweisen, Anmerkungen und Tipps der Leserinnen und Leser – 15 Jahre später noch immer auf dem Markt ist und die Auflage mittlerweile die 0 hinter der 1 trägt, freut mich natürlich sehr. Der Haupt Verlag und ich hätten damals nicht in den kühnsten Träumen mit diesem Erfolg gerechnet.
Indes belegt die wachsende Zahl an Auflagen, dass das Thema, welches mir mit WSLG ganz besonders am Herzen liegt, offenbar noch immer wichtig ist: das Schreiben besserer wissenschaftlicher Texte. Ermessen lässt sich dies auch am Zuwachs einschlägiger Publikationen zu diesem Thema.
2026 wird mein „Baby von 2008“ dann volljährig und so wird mir WSLG auch in den nächsten Jahren und darüber hinaus noch sehr wichtig sein – zu sehr ist mir das wissenschaftliche Schreiben ans Herz gewachsen. Noch immer bin ich hochmotiviert, um Anmerkungen / kritische Hinweise der Leserinnen und Leser oder auch erforderliche Neuerungen aufzugreifen und in WSLG einzuarbeiten. Dies gilt selbstverständlich auch für die 10. Auflage, in welcher Sie neben Aktualisierungen nunmehr bspw. auch ausführliche Erläuterungen
• zum Umgang mit ChatGPT,
• zu geschlechtsneutralen Formulierungen sowie
• zur Zitierweise bei Rechtsvorschriften und Gerichtsentscheidungen finden.
Für die langjährige erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte ich zunächst und insbesondere Herrn Matthias Haupt danken sowie dessen Nachfolgerin in der Geschäftsleitung, Frau Patrizia Haupt. Mein nicht minder großer Dank richtet sich gleichermaßen an Frau Elisabeth Homberger, Herrn Dr. Martin Lind und Herrn Frank Heins, Haupt-Verlag, sowie an das gesamte Team von UTB, das seit vielen Jahren gleichfalls ein starker, verlässlicher, vertrauensvoller Wegbegleiter ist.
[7]Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich weiterhin viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten und Veröffentlichen ihrer wissenschaftlichen Texte. Bitte sparen Sie auch künftig nicht mit Kritik, Hinweisen, Ideen. Ich freue mich über jedes Feedback.
Nun aber genug der Vorrede:
Backen wir‘s an!
Mannheim, im Dezember 2023
Prof. Dr. Martin Kornmeier
Vorwort zur 8. Auflage
[8]Als im September 2008 die 1. Ausgabe dieses Buches veröffentlicht wurde, hatte ich natürlich gehofft, dass die von mir ins Auge gefasste Zielgruppe das Werk lesen und wertschätzen würde – und der eine oder andere es sogar kauft. Angesichts der sehr ambitioniert festgesetzten Anzahl an gedruckten Exemplaren hatten der Verlag und ich für die 2. Auflage einen Zeithorizont von zwei Jahren im Blick. Dass dieser Zeitraum auf ein halbes Jahr schrumpfen würde, hat uns alle überrascht.
Diese Passage – der eine oder andere Leser mag es bemerkt haben – habe ich wortwörtlich meinem Vorwort zur 2. Auflage entnommen. Ergänzen möchte ich an dieser Stelle: Dass sich WSLG – „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ – auf dem Markt der Literatur für wissenschaftliches Arbeiten selbst nach 10 Jahren als derart vital erweist, macht mich froh und dankbar – v. a. weil dieses Buch offenbar auch heute noch vielen Studierenden hilft, das wissenschaftliche Arbeiten zu erlernen.
Dankbar bin ich auch allen Wegbegleitern, die mich in der zurückliegenden Dekade auf unterschiedliche Weise unterstützt und damit zum Erfolg des Dauerbrenners beigetragen haben. Namentlich danken möchte ich
• meinem ehemaligen Deutschlehrer, Herrn Schuldekan a. D. StD i. R. Hanspeter Schwenninger, Neuried-Müllen, der das Manuskript zur 1. Auflage gelesen hatte und mich darin bestärkte und ermutigte, WSLG überhaupt auf den Markt zu bringen;
• Herrn Prof. Dr. Rainer Beedgen, ehemaliger Prorektor der Dualen Hochschule Mannheim, sowie Herrn Prof. Michael Scharr, Mitglied des Vorstands der SV SparkassenVersicherung AG;
• Herrn Wolfgang Manekeller sowie Herrn Prof. h. c. Wolf Schneider, die hierzulande zu DEN Sprachlehrern und -kritikern zählen und die mit ihren Sachbüchern, darunter zahlreiche Standardwerke, seit Jahrzehnten zu den renommiertesten „Sprachpflegern“ gehören. Ihre Anregungen, Anmerkungen und Vorschläge hatte ich bereits für frühere Auflagen dankbar und gerne aufgegriffen;
• Herrn Dr. phil. Manuel Bachmann sowie Herrn Jens Stahlkopf, die beim Haupt Verlag „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ in den ersten Jahren betreut hatten und damit ebenfalls zum langfristigen Erfolg dieses Buches beigetragen haben.
[9]Was wäre dieses Buch ohne ein Team, mit dem man jederzeit sehr gerne und professionell zusammenarbeitet?
Für die stets vertrauensvolle, konstruktive und angenehme Zusammenarbeit danke ich sehr herzlich
• dem Verlagsleiter des Haupt Verlags, Herrn Matthias Haupt, sowie seiner Verlagsmannschaft, v. a. Frau Elisabeth Homberger, Herrn Frank Heins sowie Herrn Dr. Martin Lind;
• UTB in Stuttgart, insbesondere Frau Susanne Ziegler und Frau Heike Schmidt sowie dem gesamten UTB-Team.
Was wäre dieses Buch ohne seine Leser?
Mein herzlicher Dank richtet sich selbstverständlich auch und gerade an die Leserinnen und Leser von WSLG, insbesondere an all jene, die sich in der Vergangenheit zum Buch geäußert haben – per Telefon, per E-Mail, über den Haupt Verlag, UTB oder z. B. per Bewertung bei Amazon. Für die zahlreichen Hinweise zum Inhalt, für das lobende und auch das kritische Wort der Leser sowie für deren generelles Feedback bin ich in hohem Maße dankbar, lässt sich an diesem Engagement doch gut ablesen, dass WSLG „lebt“. Außerdem waren nahezu alle Hinweise glücklicherweise stets dergestalt, dass sie mich darin bestärkten, das Buch immer wieder zu überarbeiten, zu verbessern sowie den Veränderungen und Neuerungen der Zeit anzupassen. Dies gilt in gleicher Weise für die jetzt vorliegende 8. Auflage; denn nach nunmehr 10 Jahren und 7 Auflagen hat auch an WSLG der „Zahn der Zeit“ genagt. Ich bin deshalb dem Haupt Verlag, insbesondere Herrn Matthias Haupt, sehr dankbar, dass er meine Idee eines umfassenden Facelift aufgegriffen und das Layout dem Zeitgeist und den Anforderungen des heutigen Lese- und Lernverhaltens angepasst hat.
Und so hoffe ich, dass die Leser von heute die Veränderungen in WSLG goutieren. Falls nicht, gilt auch heute noch wie „damals“ 2008: Sparen Sie bitte nicht mit Kritik! Sollten Sie Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen zum neuen Design, aber selbstverständlich auch zum Inhalt haben, so schreiben Sie mir bitte. Ich bin für alle Hinweise sehr dankbar, bspw. auch für jenen von Carlo L., der mir vor einiger Zeit schrieb, dass er in „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ lediglich eine Sache schmerzlich vermissen würde: die „Anfeuerung vom Trainer“ sowie den „obligatorischen Klapps auf den Hintern“! Das Ganze dann verpackt in ein Schlusswort! Nun gut: Ein Schlusswort soll’s nicht werden, aber zumindest eine
[10]Merkliste mit „Trainingstipps“:
1. Wissenschaftliche Arbeiten sind kein Hexenwerk. Und auch kein Teufelszeug!
2. Mit etwas Übung kann auch jeder Studierende eine wissenschaftliche Arbeit erfolgreich abschließen.
3. Halten Sie sich an die in diesem Buch beschriebenen Grundregeln des wissenschaftlichen Arbeitens.
4. Achten Sie auf die Form. Das ist der unumstößliche Pfeiler für eine erfolgreiche Arbeit. Die „conditio sine qua non“.
5.Substantielle Literatur ist das Fundament für eine erfolgreiche Arbeit. Achten Sie also darauf, dass Sie hinreichend viel Zeit in die Recherche hochwertiger Quellen investieren.
6. Präsentieren Sie alle Gedanken so, dass Ihre Leser Ihren Überlegungen, Ihrer Argumentation, Ihren logisch aufgebauten Entscheidungen problemlos folgen können – und zwar ALLE Leser.
7. Lassen Sie sich von niemandem kirre machen. Wenn Sie die Regeln und Grundsätze für Form, Stil und Inhalt beachten und das wissenschaftliche Schreiben üben, üben, üben, dann kann im Grunde nichts schiefgehen.
Wie sagte doch einst Christian Streich, Trainer des SC Freiburg:
„Am beschde machsch de Fernseher aus, schausch Tabell’ nit an. Bringt eh alles nix. Spielsch’! Übsch’!“
Stimmt!
Also: Legen Sie los! Üben Sie! Schreiben Sie!
Martin Kornmeier
Mannheim, im Juli 2018
Vorwort zur 2. Auflage
[11]Als im September 2008 die 1. Ausgabe dieses Buches veröffentlicht wurde, hatte ich natürlich gehofft, dass die von mir ins Auge gefasste Zielgruppe das Werk lesen und wertschätzen würde – und der eine oder andere es sogar kauft. Angesichts der sehr ambitioniert festgesetzten Anzahl an gedruckten Exemplaren hatten der Verlag und ich für die 2. Auflage einen Zeithorizont von zwei Jahren im Blick. Dass dieser Zeitraum auf ein halbes Jahr schrumpfen würde, hat uns alle überrascht.
Ich empfinde große Freude und Dankbarkeit, dass „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ bereits jetzt Platz in vielen Bücherregalen gefunden hat. Sehr froh bin ich über die fast ausnahmslos positive Reaktion auf den Erstling, auch wenn mich – und dies ist KEIN „fishing for compliments“! – Kritik gleichermaßen interessiert und anspornt; denn letztlich sind es Verbesserungsvorschläge und sonstige Anmerkungen, die dazu beitragen, die Qualität eines Buches anzuheben. Auch aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle auf die Webseite
www.utb-mehr-wissen.de
hinweisen; dort finden Sie ein Forum, in welchem die Leser meines Buches Kritik üben, Verbesserungen vorschlagen, Beispiele einstellen können usw.
Allen, die sich – in welcher Form auch immer – zum Buch geäußert haben, danke ich sehr herzlich, namentlich Wolfgang Manekeller. Er zählt hierzulande zu den renommiertesten „Sprachpflegern“ (u. a. fünffacher Dudenbuchautor) und ist seit Jahrzehnten im Dienst der deutschen Sprache unterwegs. Für seine Anregungen und Anmerkungen, die ich aufgegriffen und in die Neuauflage eingearbeitet habe, bin ich ihm ebenso dankbar wie für seinen (ganz wundervoll geschriebenen) Brief.
Danken möchte ich auch Herrn Ass. Prof. Dr. Werner F. J. Stangl, Institut für Pädagogik und Psychologie an der Johannes Kepler Universität Linz. Im September 2008 machte mich Herr Stangl darauf aufmerksam, dass er bereits 1997 in einem seiner Arbeitsblätter das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit mit Kuchenbacken verglichen hatte. Mein anschließendes Studium der betreffenden Webseite1 ergab, dass wir das Thema – trotz derselben Analogie – vollkommen unterschiedlich angepackt haben.
„Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ basiert auf dem „Drama mit dem Gugelhupf “ – einer Story, die ich im August 2007 konzipierte und niederschrieb. [12]Denn angesichts der eher „trockenen und spröden“ Materie war mir bereits zu Beginn meines Projekts klar: Das Thema „wissenschaftlich arbeiten bzw. schreiben“ ist wenig „sexy“, weshalb man es interessanter und spannender darstellen muss, als dies in vielen Standardlehrbüchern der Fall ist. Die Analogie „Backen → wissenschaftlich schreiben“ fand ich dabei sehr hilfreich – wenn auch nicht gerade „revolutionär“.2
Herzlich gedankt sei all jenen, die auf unterschiedliche Weise zum Erfolg dieses Lehrbuchs beigetragen haben.
• Danken möchte ich zunächst Herrn Prof. Dr. Rainer Beedgen, Prorektor der Dualen Hochschule Mannheim, sowie Herrn Prof. Michael Scharr, Mitglied des Vorstands der SV SparkassenVersicherung AG, dass die ÖVA-Stiftung – Wissenschafts- und Kulturförderung an der Dualen Hochschule Mannheim die 1. Auflage mit einem nennenswerten Geldbetrag unterstützt hatte. So war es möglich, dieses Buch im September 2008 zu einem für jedermann erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen.
• Ein sehr herzlicher Dank geht an Herrn Schuldekan StD Hanspeter Schwenninger, Neuried-Müllen, der das Manuskript zur 1. Auflage gelesen hat (Gäbe es in Deutschland nur Lehrer seines Kalibers, müssten wir uns hierzulande vor den zukünftigen Ergebnissen der PISA-Studien nicht fürchten!).
• Nicht vergessen möchte ich den Haupt Verlag, Bern, sowie das UTB-Team in Stuttgart; beide arbeiten sehr professionell und haben am Erfolg dieses Werkes gleichfalls einen nicht unerheblichen Anteil. Fruchtbare Zusammenarbeit zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass man Meinung, Erfahrung und Vorschläge der anderen Partei(en) respektiert und wertschätzt – letztlich zum Wohle des Gesamtprojekts. Bei unserer Kooperation ist dies uneingeschränkt der Fall. Hierfür danke ich insbesondere Frau Katrin Burr (Dozentenbetreuung; UTB), Frau Susanne Ziegler (Presse; UTB) und Frau Heike Schmidt (Administration utbmehr-wissen.de). Ein ebenso herzlicher Dank geht an Herrn Jens Stahlkopf vom Haupt Verlag. Die Zusammenarbeit mit ihm ist ebenso vertrauensvoll, konstruktiv und angenehm wie mit Herrn Dr. phil. Manuel Bachmann (MBA), der „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ bis zum Erscheinen der 1. Auflage betreut hat.
Noch ein letzter Hinweis:
Falls Sie das Buch, welches Sie gerade in Ihren Händen halten, gekauft haben sollten, dann kann ich Ihnen an dieser Stelle endlich verraten, dass Sie selbstverständlich [13]auf einen ganz billigen Marketing-Trick hereingefallen sind! Wer Ihnen weismachen will, dass das Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit „leicht gemacht“ sei, betreibt natürlich pure Effekthascherei. Denn wenn Sie „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ aufmerksam lesen und sich allein die Anforderungen an den Inhalt oder die vielen und vielfältigen Empfehlungen zur Sprache vor Augen führen, werden Sie zwangsläufig erkennen:
Wissenschaftlich zu arbeiten ist ein äußerst hoher Anspruch; trotz Buch ist – und bleibt – das Schreiben eines wissenschaftlichen Werks harte Arbeit. Leider!
Aber: Könnte es tatsächlich anders sein? Wohl kaum; denn wenn es leicht wäre, könnte es jeder! Und worin bestünde dann die Herausforderung? Zugegeben: Ein „erleichtert“ im Titel wäre vielleicht prägnanter gewesen – oder: „Wissenschaftlich schreiben transparent / verständlich / begreifbar gemacht“; aber das klingt halt eben holpriger und weniger schmissig als der jetzige Buchtitel.
Dennoch kann ich Sie beruhigen: Wenn Sie mit diesem Werk Ihre Reise in die Wissenschaft antreten, werden Sie Schritt für Schritt erfahren, wie Sie arbeiten sollten, damit am Ende ein schmackhafter Gugelhupf auf Ihrem Kaffeetisch steht!
So. Nun aber will ich Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ich wäre glücklich, wenn sich meine Freude beim Verfassen von „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ u. a. in Ihrer Lesedauer widerspiegelte. Übrigens: Mein Ziel ist es NICHT, Sie zu perfekten Autoren wissenschaftlicher Arbeiten zu machen. Es genügt, wenn Sie dem Slogan einer großen deutschen Handelskette folgen und versuchen, „jeden Tag ein bisschen besser“ zu werden. Wolfgang Manekeller – altersweise und erfahren – formulierte dies in seinem Brief folgendermaßen: „Für ein bisschen fröhliche, nachsichtige Aufklärung ist für uns noch eine Menge Platz. […] Wir machen ja alle Fehler (Perfektion ist inhuman): Es geht darum, vom Dauertäter zum Gelegenheitstäter zu werden.“
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Schmökern oder Durcharbeiten des Buches sowie viele Gelegenheiten und immer größeren Erfolg beim Anfertigen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit!
Mannheim, im März 2009
Martin Kornmeier
Ach ja: Zögern Sie nicht, das Gugelhupfrezept anzuwenden. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Es lohnt sich!
[14]Niemand ist frei von Schwächen:
Haben Sie Fehler gefunden (Inhalt, Stil, Form)?
Kritik ist Ansporn:
Haben Sie Hinweise / Anregungen, die helfen, die Qualität des Buches zu verbessern?
Praxisbezug ist wichtig:
Haben Sie weitere konkrete Beispiele aus Seminar-, Studien-, Diplom-, Bachelor-oder Masterarbeiten? Stilblüten? Floskeln? Phrasen? Satz- oder Wortmonster?
Folgende Webseite führt Sie direkt zum Titel:
www.utb-shop.de/9783825250843
Hier haben Sie die Möglichkeit, das Buch zu bewerten, Ihre Meinung abzugeben (Rubrik „Leserbewertungen“) oder Fragen zum Buch zu stellen (Rubrik „Produktfragen“).
Gerne können Sie mir Ihre Hinweise, Beispiele, kritischen Anmerkungen auch über [email protected] zukommen lassen.
Ich freue mich auf Ihre Zuschrift!
1http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/internet/arbeitsblaetterord/praesentationord/daknowhow.html
2 Wohl aus demselben Grund weist Kollege Stangl in seinem Arbeitsblatt darauf hin, dass sich auch ihm diese Analogie „geradezu aufgedrängt“ habe.
Inhalt
Vorwort: ein Backrezept?
Das Drama mit dem Gugelhupf
Der Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit (Teil I): SIE bestimmen, welchen Gugelhupf Sie servieren
Der Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit (Teil II): Verarbeiten Sie nur Zutaten, die man für einen Gugelhupf benötigt!
Der Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit (Teil III): Rühren Sie Ihre Zutaten richtig zusammen!
Der Stil wissenschaftlicher Arbeiten: Damit Ihr Gugelhupf gelingt, brauchen Sie das richtige Händchen
Die Form wissenschaftlicher Arbeiten: Damit Ihr Gugelhupf wie ein echter Gugelhupf aussieht
Halten Sie sich an die Backzeit!
Inhaltsverzeichnis
1 Vorwort: ein Backrezept?
2 Das Drama mit dem Gugelhupf
2.1 Thema Ihrer Bachelorarbeit: „Backen Sie einen Gugelhupf!“
2.2 Die vier Grundsätze von Bäcker Roth oder: „Wie man sich bei wissenschaftlichen Arbeiten korrekt verhält!“
2.3 „Scientific Googlehoopf“: Anforderungen und Qualitätskriterien einer wissenschaftlichen Arbeit
2.4 Jetzt ganz neu: „Gugelhupfrezept mit Backblockadenblocker!“
2.4.1 Piemont-Kirschen, Königsnüsse, Megaperls – und Schreibkrisen
2.4.2 „Schreibprobleme“ lösen – aber wie?
3 Der Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit (Teil I): SIE bestimmen, welchen Gugelhupf Sie servieren
3.1 Die Suche nach dem generellen Thema: Welchen Kuchen wollen Sie backen?
3.1.1 Hilfe bei der Themensuche
3.1.2 Was tun, wenn es Ihren Kuchen bereits gibt?
3.2 Die Suche nach der zentralen Forschungsfrage: Welches Rezept soll’s denn sein?
3.2.1 Beschreibung (Deskription)
3.2.2 Erklärung (Explikation)
3.2.3 Prognose
3.2.4 Gestaltung
3.2.5 Kritik (Bewertung) und Utopie
3.3 Formulieren Sie Ihr Thema möglichst präzise!
4 Der Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit (Teil II): Verarbeiten Sie nur Zutaten, die man für einen Gugelhupf benötigt!
4.1 Das Leid mit der Literatur
4.1.1 Qualität ist das beste Rezept
4.1.2 Die besten Zutaten finden: Strategien der Literaturrecherche
4.1.2.1 Methode der konzentrischen Kreise
4.1.2.2 Systematische Suche
4.1.2.3 Vorwärts gerichtete Suche
4.1.3 Kaufen Sie Ihre Zutaten nicht im nächstbesten Internetshop
4.2 Die Zutaten bereitlegen: Lesen und Exzerpieren von Texten
4.3 Nicht zu wenige und nicht zu viele Zutaten: Quantität der verarbeiteten Literatur
4.4 Geriebene Zitronenschale und ein paar Rosinen: Nicht nur die Literatur macht’s
5 Der Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit (Teil III): Rühren Sie Ihre Zutaten richtig zusammen!
5.1 Die Zutaten Schritt für Schritt dazugeben: Stellenwert der Gliederung
5.2 Die leidige „Einleitung“ (= 1. Kapitel)
5.3 „Grundlagen und Definitionen” (= 2. Kapitel)
5.3.1 Eigentliche Bedeutung von „Grundlagen und Definitionen“
5.3.2 Die Kurzgeschichte von der traurigen Definition mit ihren unendlich vielen Kindern
5.4 „Hauptteil”: Das Herzstück Ihrer Arbeit (= 3. Kapitel)
5.4.1 Die Zutaten stehen bereit – und nun?
5.4.2 Eigentliche Herausforderung: die Zutaten angemessen verarbeiten (= korrekter Umgang mit Hypothesen, Aussagen, Daten)
5.4.2.1 Hypothesen
5.4.2.2 Aussagen
5.4.3 Analyse empirischer Daten
5.4.3.1 Mehr als nur Häufigkeiten
5.4.3.2 Mit univariaten Verfahren in die eigentliche Analyse einsteigen
5.4.3.3 Mit bivariaten Analyseverfahren einfache Zusammenhänge entdecken
5.4.3.4 Klarheit im Datenwust: Multivariate Analyseverfahren
5.5 Der vernachlässigte „Schluss“ (= 4. Kapitel)
5.6 Die Zubereitung variieren: Mögliche Gliederungen einer wissenschaftlichen Arbeit
6 Der Stil wissenschaftlicher Arbeiten: Damit Ihr Gugelhupf gelingt, brauchen Sie das richtige Händchen
6.1 Sie backen – schreiben – für Leser!
6.2 Verwenden Sie die richtigen Wörter – und verwenden Sie die Wörter richtig!
6.2.1 Verben
6.2.1.1 Leisten Sie Verzicht auf Funktionsverben!
6.2.1.2 Achten Sie auf die „Stilhöhe“!
6.2.1.3 Reanimieren Sie tote Verben!
6.2.1.4 Doppelt quält besser: Pleonasmen und Verben mit unnötigen Vorsilben
6.2.1.5 Beizeiten das Tempus beherrschen
6.2.1.6 Hätte da was im Konjunktiv stehen müssen?
6.2.1.7 Sollten Passivsätze seitens des Autors vermieden werden?
6.2.1.8 Infinitive ad infinitum?
6.2.2 Substantive
6.2.2.1 Das Substantivaneinanderreihungsproblem …
6.2.2.2 … und das Problem der Aneinanderreihung von Substantiven
6.2.2.3 Ein konkretes Substantiv für einen konkreten Sachverhalt
6.2.2.4 Zu Ihrer Rückerinnerung ein Testversuch als Gratisgeschenk: keine pleonastischen Substantive!
6.2.2.5 (Wort-)Blähungen der besonderen Art
6.2.2.6 Geeignete Synonyme statt Wortwiederholungen
6.2.2.7 Männliche und / oder weibliche Ausdrucksform?
6.2.3 Adjektive
6.2.3.1 Misstrauen Sie Adjektiven!
6.2.3.2 Wählen Sie präzise Adjektive!
6.2.3.3 Sperren Sie schwarze Raben in die Vogelvoliere!
6.2.3.4 Adverb ≠ Adjektiv
6.2.3.5 Die maximalste Steigerungsstufe ist immer die optimalste! Oder etwa nicht?
6.2.3.6 Sie arbeiten nicht in der Kreativabteilung
6.2.4.1 Muss man kasuistisch auf ein Kompendium extraordinärer Termini rekurrieren?
6.2.4.2 Fremdwort ≠ Fachbegriff
6.2.4.3 Weitere coole Infos
6.2.5 Präpositionen
6.2.6 Hinweise zur Wortwahl
6.2.6.1 Vorsicht vor Dickmachern: Füll- und Flickwörter
6.2.6.2 Nicht im Boulevardstil, nicht salopp
6.2.6.3 Der Kontext Ihrer Wörter ist wichtig
6.2.6.4 Versenken Sie Wortdreimaster!
6.2.6.5 Ich, wir oder man?
6.2.6.6 Anthropomor… was?
6.3 Sätze
6.3.1 Generelle Hinweise zur Formulierung von Sätzen
6.3.2 In der Kürze liegt die Würze!
6.3.3 Keine „russischen Puppen“!
6.3.4 Achten Sie auf den Satzbau!
6.3.5 Zeichnen Sie (Sprach-)Bilder!
6.3.6 Redewendungen sollten Sie korrekt aufs „Trapez“ bringen!
6.3.7 War da was? Achten Sie auf Korrelationen!
6.4 Den Teig immer mal wieder probieren: Überarbeiten und korrigieren Sie Ihren Text gewissenhaft!
6.4.1 Machen Sie Ihre Arbeit zu einem eigenständigen Werk!
6.4.2 Stehlen Sie Ihren Lesern nicht die Zeit!
6.4.3 Lesen Sie den Inhalt Ihrer Arbeit laut vor!
6.4.4 Machen Sie den „Muttitest“!
7 Die Form wissenschaftlicher Arbeiten: Damit Ihr Gugelhupf wie ein echter Gugelhupf aussieht
7.1 Funktionen der Form
7.2 Stellenwert ausgewählter Formvorschriften
7.2.1 Rechtschreibung und Grammatik
7.2.2 Interpunktion: mehr als Punkt und Komma
7.2.2.1 Komma
7.2.2.2 Doppelpunkt
7.2.2.3 Gedankenstrich
7.2.2.4 Semikolon
7.2.3 Korrekte Zitierweise der verarbeiteten Literatur
7.2.3.1 Belegen der Literatur im Text
7.2.3.2 Ergänzende Hinweise zur korrekten Zitierweise
7.2.3.3 Angabe der Quellen im Literaturverzeichnis
7.2.4 Besonderheiten der Zitierweise bei Rechtsvorschriften und Gerichtsentscheidungen
7.2.4.1 Zitierweise bei Rechtsvorschriften
7.2.4.2 Zitierweise bei Gerichtsentscheidungen
7.2.4.3 Angabe der zitierten Quellen im Quellenverzeichnis
7.2.5 Abbildungen, Tabellen, Grafiken
7.2.5.1 Stellenwert von Schaubildern
7.2.5.2 Hinweise zur Gestaltung von Schaubildern
7.2.5.3 Schaubildtypen
7.2.5.4 Korrekte Quellenangabe bei Abbildungen, Tabellen usw
7.2.6 Mathematische Formeln und Gleichungen
7.2.7 Abkürzungen und Kurzwörter
7.2.7.1 Grü. f. d. bed. Eig. v. Abk
7.2.7.2 In wissenschaftlichen Texten erlaubte Abkürzungen
7.2.7.3 Abkürzung von Zahlwörtern und Einheiten
7.2.6.4 Abkürzungen und Kurzwörter: mit oder ohne Punkt?
7.2.8 Symbole
7.2.9 Zahlen
7.2.10 Kapitel, Absätze, Aufzählungen / Auflistungen, Hervorhebungen
8 Halten Sie sich an die Backzeit!
Literatur
Index
1
Vorwort: ein Backrezept?
[21]Darf man das? Ein Buch, das sich einem überaus bedeutsamen und ernsthaften Thema widmet, mit einem Rezept beginnen? Ja, man darf: Zum einen rechtfertigt bereits die Anleitung zum Backen dieses Kuchens den Buchpreis; Sie werden dies feststellen, wenn Sie das Rezept „in die Praxis umsetzen“. Zum anderen – und dies ist das Entscheidende – erfüllt das Backrezept in diesem Buch eine sehr wichtige Funktion: Zusammen mit dem „Drama mit dem Gugelhupf “ steckt es den Rahmen ab. Ursprünglich war deshalb der Titel „Wissenschaftlich schreiben nach dem Gugelhupf-Prinzip“ vorgesehen.
Am Beispiel Kuchenbacken erläutert „Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreiben sollte und warum dabei gewisse Anforderungen und Vorschriften zu erfüllen sind. Von der herkömmlichen, bisweilen schwer verdaulichen Literatur unterscheidet sich dieses Buch in vielerlei Hinsicht. Sein Schwerpunkt liegt NICHT bei jenen Themen, die häufig derart in die Breite und Länge gewalzt werden, dass der eigentliche Kern – das Schreiben (!) einer wissenschaftlichen Arbeit – mitunter kaum mehr sichtbar ist.
• Wer im Folgenden Vorschriften zu Form und Formatierung (z. B. Seitenränder) sucht, wird enttäuscht sein.
• Erwarten Sie auch keine nähere Information zum Unterschied zwischen Autorenkatalog, Schlagwort-, Signaturgruppen-, Interims- oder bspw. Zeitschriftenkatalog.
• Erläuterungen zu den diversen Bibliotheksverzeichnissen und Diensten des Internets werden Sie ebenfalls nicht finden.
• Greifen Sie auf andere einschlägige Werke zurück, wenn Sie sich über optimale Arbeitsbedingungen sowie über detaillierte Konzepte zu Projekt- und Zeitplanung wissenschaftlicher Arbeiten informieren wollen.
[22]Diese und viele weitere ähnlich gelagerte „Fragen und Probleme“ zur Form und zur generellen Herangehensweise an wissenschaftliche Studien dürften Sie aber auch ohne „Tipps“ und dicke Bücher weitgehend problemlos bewältigen. Ihnen allen traue ich nämlich eine gehörige Portion Grips zu – schließlich hat man Ihnen die (Fach-)Hochschulreife bescheinigt, oder!?
Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Vorurteile aus dem Weg räumen.
1. Wissenschaftler sind keine – pardon – Korinthenkacker, die in Ihrer Arbeit Formfehlerzählen! Die eigentliche Funktion der Form ist wesentlich tiefgründiger, als man gemeinhin glaubt, und reicht weit darüber hinaus, dem Durchschnittsstudenten seine Schwächen in Orthografie und Interpunktion vor Augen zu führen. Eine Arbeit ist grundsätzlich dann formal korrekt, wenn der Leser die gebotene Information leicht aufnehmen kann. Im Übrigen ist eine formal korrekte Arbeit eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für ein gutes wissenschaftliches Werk: Wer vorschriftgemäß und fehlerfrei zitiert, hat damit noch keinen Beweis für seine etwaige Qualität als Student oder angehender Wissenschaftler erbracht.
2. Wissenschaftliche Einrichtungen sind keine Außenstellen von Werbeagenturen und wissenschaftliches Schreiben ist nicht in erster Linie eine Frage der Kreativität. Gefragt ist vor allem analytisches Denken! Niemandem ist daran gelegen, dass Sie in Ihrer Arbeit ein „hippes“, brandaktuelles Forschungsthema bearbeiten, welches Sie mit Kreativitätstechniken aus der Taufe gehoben haben (Motto: „Ich habe kein Problem, also suche ich eines.“). Die Darstellung einschlägiger Methoden (z. B. Strukturbaum, Analogierad) ist deshalb überflüssig und wäre in diesem Buch fehl am Platz.
3. Kein Wissenschaftler würde allen Ernstes von Ihnen verlangen, dass Sie sich mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit um den nationalen Preis für Buchdesign bewerben: Wer Nonsens in eine außergewöhnlich schöne Hülle verpackt, wird damit den Nonsens nicht kaschieren können.
„Harry Potter“, „Tintenherz“, „Der kleine Eisbär“, „Winnie Puuh“, „Winnetou“ oder „Benjamin Blümchen“ sind nicht vergleichbar mit [23]„Erfolgsfaktoren der Geschäftsanbahnung im B2B“, „Einflussfaktoren auf die Wahl der Markteintrittsstrategie“ oder „Verfahren zur Bestimmung von Preis / Absatz-Funktionen“. Als wissenschaftlich Arbeitende(r) müssen Sie sich keine spannenden Geschichten ausdenken und auch keinen Roman verfassen. Nicht zuletzt aus diesem Grund benötigen Sie auch keine „Tipps und Tricks“ gegen „Schreibblockaden“ oder „Schreibkrisen“. Wer daran leidet, sollte besser professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, bevor er sich an eine wissenschaftliche Arbeit wagt. Allerdings: Was landläufig (oder zu Werbezwecken?) als „Schreibblockade“ oder „Schreibkrise“ bezeichnet wird, sind meist nur all die Probleme und Problemchen, die für das Schreiben eines wissenschaftlichen Werks durchaus typisch sind und – neudeutsch – häufiger auch in Gestalt von „Schreibproblemen“ auftreten. Wer es nämlich nicht gewohnt ist, regelmäßig wissenschaftlich zu arbeiten, findet plausiblerweise nicht immer gleich den richtigen Zugang zur Arbeit – bspw. aus Mangel an Erfahrung. Wer die folgenden Seiten aufmerksam liest, wird erkennen, dass v. a. derjenige an „Schreibproblemen“ leidet, der sein Handwerkszeug nicht beherrscht (z. B. weil er seine Forschungsfrage nicht hinreichend konkretisiert – und verstanden! – hat). Sie – die „Schreibprobleme“ – lassen sich im Wesentlichen dadurch lösen, dass man das erforderliche Rüstzeug erwirbt und Routine im Schreiben entwickelt. Wie Sie dabei vorgehen sollten, steht in diesem Buch.
• Warum benötigen wissenschaftliche Arbeiten eine Forschungsfrage? Und worin unterscheiden sich z. B. deskriptiver und explikativer Forschungsansatz?
• Wie sollte eine Gliederung aufgebaut sein? Und warum?
• Weshalb ist ein „Theorieteil“ erforderlich? Braucht man ihn auch dann, wenn man keine theoretische, sondern „nur“ eine praxisorientierte Arbeit schreibt? Unterscheiden sich diese beiden Typen wissenschaftlicher Arbeiten überhaupt?
•[24]Was ist mit „Stand der Forschung“ (= „State of the Art“) gemeint?
• Wozu benötigt man Definitionen? Hypothesen? Wie formuliert man sie?
• Warum ist Literatur so bedeutsam? Welche ist zu bevorzugen (z. B. Fachzeitschriften / Journals)? Wie bewertet man die Qualität der verschiedenen Literaturquellen?
• Was sind Aussagen? Welche Funktion haben sie?
• Warum erfordern wissenschaftliche Arbeiten einen bestimmten Stil (z. B. Argumentation, Schreibstil)?
• Wie gelingt es, eine wissenschaftliche Arbeit lesefreundlich zu schreiben?
• Welche Gründe sprechen dafür, bestimmte Formvorschriften einzuhalten?
All diese bedruckten Seiten verfehlen ihre Wirkung nicht, wenn Sie am Ende des Buches verstanden haben, dass Vorschriften zu Form, Stil und Inhalt nicht eingeführt wurden, um Ihnen das Leben möglichst schwer zu machen – im Gegenteil: Die vielfältigen Regeln und Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, Ihr Wissen möglichst klar und präzise mitzuteilen – nicht mehr und nicht weniger.
„Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht“ folgt einem handlungs- bzw. anwendungsorientierten Ansatz. Anhand einer Vielzahl konkreter Beispiele kann der Leser nachvollziehen, welche Möglichkeiten sich ihm bei der Gestaltung seiner wissenschaftlichen Arbeit bieten. Das Werk wendet sich an Studierende an allen Arten von Hochschulen und an Berufsakademien; auch Doktoranden finden viele Anregungen, z. B. zur Herangehensweise an umfangreichere Arbeiten und zum Schreibstil.
Die meisten der im Folgenden beschriebenen Beispiele stammen zwar aus den Wirtschaftswissenschaften; sie sind aber derart ausführlich dargelegt und allgemein verständlich, dass Vertreter aller Wissenschaften den Inhalt problemlos nachvollziehen und für sich nutzen können.
So, nun aber wird’s Zeit für das Rezept, mit welchem Sie garantiert einen exzellenten Gugelhupf backen werden. Sie werden sehen, es ist gar nicht so einfach, diesen schlichten Kuchen auf den Kaffeetisch zu zaubern. Man braucht Zeit, Geduld, die richtigen Zutaten und auch ein gutes Händchen für das „Zusammenmischen“.
[25]In diesem Sinn: Viel Spaß und Erfolg beim Anfertigen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit!
Sie „backen“ das schon!
Backrezept: der klassische Gugelhupf
[26]Die Zutaten
1 Pfund Mehl
1 Teelöffel Salz
½ Pfund Butter
6 Eier
100 g Zucker
1/8 l Milch
60 g Rosinen
35 g Hefe
Etwas geriebene Zitronenschale
Die Zubereitung
Ein wichtiger Hinweis vorweg: Es ist überaus bedeutsam, dass Sie alle Zutaten lange und gut verrühren. Nur dann wird Ihr Gugelhupf auch garantiert gelingen.
In einem ersten Schritt müssen Sie die Butter schaumig rühren. Anschließend geben Sie abwechselnd Zucker, Salz, Mehl und Eier darunter – und zwar unter stetem Rühren, bis Sie alle Zutaten verwendet haben. Nun die mit lauwarmer Milch aufgelöste Hefe sowie die Zitronenschale daruntermischen. Danach wird der Teig so lange geschlagen, bis er Blasen wirft; anschließend die gewaschenen und gebrühten Rosinen dazugeben.
Die Gugelhupfform mit Butter bestreichen, mit Mehl bestäuben und mit geschälten Mandeln auslegen. Anschließend den Teig einfüllen und die Form an einen warmen Platz stellen. Der Teig muss nun 1 bis 1 ½ Stunden „gehen“; danach den Gugelhupf bei mäßiger Hitze (ca. 140 bis 160° C) ca. 45 Minuten backen.
2
Das Drama mit dem Gugelhupf
2.1 Thema Ihrer Bachelorarbeit: „Backen Sie einen Gugelhupf!“
[27]Stellen Sie sich vor, Sie studieren „Bäckereiwesen“ und sollen eine Bachelorarbeit schreiben – Thema: „Backen Sie einen Gugelhupf “. Ihre Bearbeitungszeit beträgt drei Stunden; Sie gehen nach Hause und denken sich „Klar, Gugelhupf! Kein Thema! Kenn ich! Da gibt’s im Internet bestimmt „echt geile“ Rezepte. Und Zutaten hab ich ja auch zu Hause.“
Nach so viel Nachdenken setzen Sie sich erst einmal zehn Minuten aufs Sofa, um sich entspannt zurückzulehnen: „Gott sei Dank! Gugelhupf backen als Thema der Bachelorarbeit – und nicht etwa Berliner, Amerikaner, Kipferl oder ähnlich Kompliziertes. Hätte sonst echt voll schwierig werden können. Aber so! Wird echt voll easy!“ Nach zwanzig Minuten – Sie waren dann doch mal kurz eingenickt, was aber nicht weiter schlimm ist (geht ja dann doch alles ziemlich fix) – setzen Sie sich an Ihren Computer, um im Internet nach einem Rezept zu surfen.
Sie staunen nicht schlecht, als Sie feststellen, dass es nicht nur EIN Gugelhupfrezept gibt, sondern Hunderte! So finden Sie neben dem Elsässer Original u. a. das von der „Uroma überlieferte Rezept“ sowie den „Gugelhupf nach Großmutters Art“. Bereits Mozart scheint ein einzigartiges Rezept entwickelt zu haben; jedenfalls bietet man Ihnen das Rezept für einen „Mozart-Gugelhupf “ an. Neben einem Rezept für den Möhren-Gugelhupf stoßen Sie auf den Advent- und den Dominostein-Gugelhupf, der „schön weihnachtlich“ schmeckt. Wie wär’s mit einem Eierlikör-Gugelhupf – gerne auch in der Eierlikör-Mandel- oder Eierlikör-Schoko-Variante? Stutzig macht Sie der gerollte Quarkteig-Gugelhupf mit saftigem Teig und „variabler Füllung“ [28](ohne Ei!). Schließlich finden sich unter den Internetleckereien auch zahlreiche „deftige Gugelhupfs“:
• Glühwein-Gugelhupf,
• Pizza-Gugelhupf,
• Gugelhupf mit Bier,
• Schinken-Gugelhupf (zu Wein),
• Brez’n Gugelhupf.
Dann vielleicht doch lieber die „Lightversion vom Gugelhupf “? Kein Problem – alles da.
Nach kurzem Überlegen – die Zeit läuft – entscheiden Sie sich ganz spontan für den Klassiker. Der Betreuer hat ja nix von einer „Spezialversion“ erzählt. Und außerdem: Wenn schon all die Bäcker dieser Welt sich nicht einigen können, wie ein echter Gugelhupf aussehen und schmecken muss, kommt’s wohl bei Ihnen als kleinem, unbedarftem Studenten des Bäckereiwesens schon gar nicht so genau drauf an, sich mit all den Varianten auseinanderzusetzen – so sinnvoll oder sinnlos diese Gugelhupfrezepte auch sein mögen.
Sie eilen zum Vorratsschrank, um die Zutaten zusammenzustellen. Wie war das noch gleich?
• Ein Pfund Mehl? 500 Gramm – so viel!? Nun ja: 200 Gramm sind noch da. Muss reichen.
• 1 Teelöffel Salz? Massig da. Passt.
• ½ Pfund Butter. Butter? Nicht da; aber dafür hinreichend Margarine. Glück gehabt.
• 6 Eier? Jawohl. Haltbarkeitsdatum abgelaufen? Wurscht. Merkt der Korrektor ohnehin nicht.
• 100 g Zucker. Kandiszucker wird’s wohl auch tun. Sooo kleinlich wird der Betreuer der Bachelorarbeit ja wohl nicht sein.
• 1/8 l Milch? Heute morgen den Rest getrunken, aber die kann man sich ja vom WG-Nachbarn „leihen“.
• 35 g Hefe. Nicht da. Aber was sind schon 35 Gramm, da kann man mal locker drauf verzichten.
• 60 g Rosinen? Nö, Weintrauben tun’s auch.
• Etwas geriebene Zitronenschale? War da nicht noch irgendwo eine Mandarine von Weihnachten?
• Mandeln? Fehlanzeige. Ist aber ohnehin nur Schnickschnack, den Kuchen zu verzieren.
[29]In null Komma nix haben Sie alle Zutaten zusammengetragen – und atmen erst einmal tief durch. Die Zeit, die Sie durch das Einnicken auf dem Sofa verpennt haben, konnten Sie durch das Internet zumindest teilweise wettmachen. Und die Zutaten haben Sie ja auch alle parat. Logo!
So. Nun aber nix wie ran an die Buletten. Der Kuchen sollte nämlich möglichst ein bisschen früher fertig werden; denn schließlich wollen Sie heute mit Kommilitonen schon mal auf den zukünftigen Bachelor anstoßen. Und mit dickem Kopf backt’s sich schlecht.
Sie kippen also erst einmal alle Zutaten in die Schüssel. Zwar steht auf dem Rezept, dass es wichtig sei, Zucker, Mehl und Eier abwechselnd und unter ständigem Rühren unter die Butter zu geben; aber zum einen haben Sie’s eilig, zum anderen – so besagt ein altes Sprichwort – kommt im Magen ja sowieso alles zusammen. Und außerdem: Wichtig ist, wie der Kuchen am Schluss aussieht – und da haben Sie schon eine echt total tolle Idee, mit der Sie Ihren Betreuer echt voll total überraschen werden! Der kann dann einfach nur ’ne echt total gute Note drauf geben, es sei denn, der hat keine Ahnung von Desktop-Publishing – sorry: von modernem Kuchendesign.
Das Rühren des Teigs macht Ihnen dann doch etwas Mühe, da Sie keinen elektrischen Rührbesen besitzen. Um beim Verrühren mit dem Kochlöffel nicht allzu sehr ins Schwitzen zu geraten, brechen Sie den „Prozess“ nach gut einer Minute ab, da dann alles schon „ziemlich gut vermischt aussieht“. Nun geben Sie noch eine gehörige Portion Salz hinzu. War zwar nicht erforderlich, haben Sie aber hinreichend im Vorratsschrank. Warum also nicht!?
Damit der Gugelhupf auch als solcher erkennbar ist, sollte er (eigentlich) in einer typischen, hohen Kranzform (aus Metall oder Keramik mit einem „Kamin“ in der Mitte) gebacken werden; diese ähnelt der klassischen Puddingform und lässt den Teig gleichmäßig garen. Da Sie eine solche Form nicht besitzen („Ist voll teuer!“) und Ihren Betreuer ja ohnehin mit einem speziellen Äußeren überraschen wollen, beschließen Sie, einen Kontrapunkt zu setzen: Sie nehmen die Kastenform, die Ihnen Ihre Mutter zu Studienbeginn aus dem Altbestand überlassen hat. Das wird den Korrektor aber überraschen! Der vermutet bestimmt, dass Sie damit was ganz Besonderes ausdrücken wollen. Dass Sie gar keine passende Form haben, erkennt der im Leben nicht.
So. Nun den Gugelhupf noch kurz gehen lassen. Da Sie sich beim „Erstellen“ des Kuchens in der Zeit verschätzt haben, müssen [30]45 Minuten, in denen der Kuchen gehen kann, einfach reichen. Das Werk muss auf jeden Fall pünktlich fertig werden … Bachelor-Vorfeiern steht ja heute noch auf dem Programm!
Nach einer Dreiviertelstunde hat sich der Kuchen keinen Millimeter nach oben bewegt (wie auch – ohne Hefe!), weshalb Sie beschließen, Trick 17 anzuwenden: Sie lassen den Kuchen einfach etwas länger backen und drehen die Backtemperatur hoch! Die Hitze wird dem guten Stück schon Beine machen (he, he!). Als der Gugelhupf nach der vorgesehenen Backdauer noch immer nicht gegangen ist, werden Sie langsam unruhig und rufen – selbstverständlich rein prophylaktisch – Ihren Betreuer an: Er soll sich keine Sorgen machen. Sie haben alles im Griff – Sie wollen den Kuchen einfach etwas länger backen lassen, weil eben … künstlerische Freiheit. 15 Minuten später als ursprünglich vorgesehen holen Sie Ihr Meisterstück aus dem Ofen, aus dem es bereits gewaltig raucht. Allerdings hat die extra Hitze – das erkennen Sie auf den ersten Blick – nicht zu dem erhofften Resultat geführt. Angesichts der zahlreichen verkohlten Stellen beschließen Sie, den Titel Ihrer Arbeit leicht zu modifizieren: Sie verkaufen ihn einfach als „Dunklen Zwerg-Gugelhupf: Backresultat unter besonderer Berücksichtigung zusätzlicher Hitzezufuhr“.
Glücklich reichen Sie Ihr Werk nach drei Stunden und 15 Minuten bei Ihrem Betreuer ein. Dieser reibt sich verwundert die Augen, flucht (weil er sich an dem noch heißen Kuchen die Finger verbrennt), schneidet auf, probiert – und lässt Sie durchfallen. Die ganze Mühe – umsonst.
Was war schiefgelaufen?
[31]Abb. 1: Kuchen backen und wissenschaftliches Arbeiten: Gemeinsamkeiten
2.2 Die vier Grundsätze von Bäcker Roth oder: „Wie man sich bei wissenschaftlichen Arbeiten korrekt verhält!“
[33]Geben Sie bei Google doch mal „Grundsätze Bäckerei“ ein! Sie stoßen dann u. a. auf die Bäckerei Roth, die mit ihren Grundregeln exemplarisch für viele Vertreter ihrer Zunft steht:
• traditionelles Handwerk,
• voller Geschmack,
• natürliche Zutaten,
• ehrliche Deklaration.
Oder anders formuliert: Jene Bäcker, für die der Slogan „Erstklassiges Handwerk!“ mehr als nur eine Floskel ist, legen offenbar großen Wert auf
• STILvolle Backwaren mit exquisitem Geschmack durch traditionelles Handwerk,
• Backwaren mit INHALT (aufgrund hochwertiger Zutaten),
• EHRLICHKEIT!
Da wir Inhalt, Stil und auch Form wissenschaftlicher Arbeiten noch eingehend beleuchten werden, sei an dieser Stelle die besondere Bedeutung der Ehrlichkeit betont, denn: „Wissenschaft ist die Suche nach Wahrheit. Der redliche Umgang mit Daten, Fakten und geistigem Eigentum macht die Wissenschaft erst zur Wissenschaft. Die Redlichkeit in der Suche nach Wahrheit und in der Weitergabe von wissenschaftlicher Erkenntnis bildet das Fundament wissenschaftlichen Arbeitens“ (Albers u. a. 2012, S. 2).
Aus diesem Grund haben der Allgemeine Fakultätentag, die Fakultätentage sowie der Deutsche Hochschulverband 2012 in einem gemeinsamen Positionspapier Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten formuliert, die für Vertreter aller Wissenschaftsdisziplinen gelten sollen.
[34]Grundsätze wissenschaftlicher Arbeiten (Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation, Habilitationsschrift)
„1) Originalität und Eigenständigkeit
Originalität und Eigenständigkeit sind grundsätzlich die wichtigsten Qualitätskriterien jeder wissenschaftlichen Arbeit. Dabei werden an diese Kriterien je nachdem, welche Qualifikation mit der Arbeit nachgewiesen werden soll, gestufte, sich steigernde Anforderungen zu stellen sein. Die Güte einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit bemisst sich – insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften – aber auch nach der Fähigkeit des Autors, fremden Gedankengängen und Inhalten aus wissenschaftlichen Vorarbeiten vor dem Hintergrund eigener Erkenntnis einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Erst mit diesem mit Zitaten bzw. Verweisen belegten Vorgang macht sich ein Verfasser fremde Gedanken und Resultate legitimerweise zu Eigen. Insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften beweist sich Originalität und Eigenständigkeit im experimentellen Design, der kritischen Analyse und Wertung der Daten und der Fähigkeit, in differenzierender Weise erhobene Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext einzubinden.
2) Recherche und Zitation
Alle Qualifikationsarbeiten erfordern ein korrektes und sorgfältiges Recherchieren und Zitieren bzw. Verweisen. Durchgängig und unmissverständlich muss für den Leser erkennbar sein, was an fremdem geistigem Eigentum übernommen wurde. Was wörtlich und gedanklich entlehnt wird, muss deutlich erkennbar sein.
3) Einflüsse
In Qualifikationsarbeiten sollten stets alle (externen) Faktoren offen gelegt werden, die aus der Sicht eines objektiven Dritten dazu geeignet sind, Zweifel am Zustandekommen eines vollständig unabhängigen wissenschaftlichen Urteils zu nähren. Sinnvoll erscheint es auch, die Förderung eines Werkes durch Stipendien, Drittmittel oder wirtschaftliche Vorteile kenntlich zu machen.
[35]4) Zuschreibung von Aussagen
Zu den Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens gehört, dass der Autor sorgfältig darauf achtet, zitierten Autoren keine Aussagen zu unterstellen, die diese nicht oder nicht in der wiedergegebenen Form gemacht haben.
5) Übersetzungen
Wer fremdsprachliche Texte selbst übersetzt, hat dies unter Benennung der Originalquelle kenntlich zu machen. Gerade bei einer ‚sinngemäßen Übersetzung‘ ist darauf zu achten, dass dem übersetzten Autor kein Text unterstellt wird, den er mit diesem Inhalt nicht geäußert hat. Wer sich auf Übersetzungen Dritter stützt, hat dies kenntlich zu machen.
6) Fachspezifisches Allgemeinwissen
Das tradierte Allgemeinwissen einer Fachdisziplin muss nicht durch Zitierungen bzw. Verweise nachgewiesen werden. Was zu diesem Allgemeinwissen zählt, ist aus der Sicht der jeweiligen Fachdisziplin zu beurteilen. Im Zweifel obliegt eine Entscheidung der Institution, die die angestrebte Qualifikation bescheinigt.
7) Plagiate und Datenmanipulation
Das Plagiat, also die wörtliche und gedankliche Übernahme fremden geistigen Eigentums ohne entsprechende Kenntlichmachung, stellt einen Verstoß gegen die Regeln korrekten wissenschaftlichen Arbeitens dar. Gleiches gilt für die Manipulation von Daten. Plagiate und Datenmanipulationen sind im Regelfall prüfungsrelevante Täuschungsversuche.
8) Eigene Arbeiten und Texte
Die Übernahme eigener Arbeiten und Texte verstößt dann gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wenn diese Übernahme in einer Qualifikationsarbeit nicht belegt und zitiert wird. Prüfungsordnungen können die Wiederverwertung desselben oder ähnlichen Textes desselben Verfassers ausschließen. Dies gilt insbesondere für Dissertationen.
[36]9) ,Ghostwriting‘
Ein schwerwiegender Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ist das Zusammenwirken des Verfassers mit einem Dritten, der Texte oder Textteile zu einer Qualifikationsarbeit beisteuert, die der Autor mit dem Einverständnis des Ghostwriters als eigenen Text ausgibt.
10) Mehrere Autoren
Bei gemeinschaftlichen Qualifikationsarbeiten ist der eigene Anteil des jeweiligen Autors dem Leser gegenüber deutlich zu machen. Dies schließt aus, dass jemand Autor sein kann, der selbst keinen ins Gewicht fallenden Beitrag zu einer Qualifikationsarbeit geleistet hat. Ehrenautorschaften oder Autorschaften kraft einer hierarchisch übergeordneten Position ohne eigenen substantiellen Beitrag sind grundsätzlich wissenschaftliches Fehlverhalten.
11) Doppelte Verantwortung
Die Verantwortung für die Einhaltung der Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens trägt in erster Linie der Verfasser einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit. Aber auch den Betreuern und/oder den Prüfern kommt Verantwortung zu. Die Aufgabe der Betreuer ist es, den Prüflingen vor Beginn der Arbeit die Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens mitzuteilen und gegebenenfalls zu erläutern. Die Aufgabe der Betreuer und Prüfer ist es auch, Zweifeln an der Einhaltung der Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens bei einer Qualifikationsarbeit konsequent nachzugehen.“
Quelle: Albers u. a. (2012, S. 3-5).
Eine eingehende Betrachtung und Beschreibung dessen, was als wissenschaftliches Fehlverhalten gilt, finden Sie in der Handreichung „Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen“, welche die Hochschulrektorenkonferenz bereits am 6. Juli 1998 in ihrem 185. Plenum allen Mitgliedshochschulen empfohlen hat, „ggf. in modifizierter Form – möglichst bald zu übernehmen bzw. in Kraft zu setzen“ (Hochschulrektorenkonferenz 1998, S. 3).
[37]Was ist „Wissenschaftliches Fehlverhalten“?
„1. […] Als möglicherweise schwerwiegendes Fehlverhalten kommt insbesondere in Betracht:
a. Falschangaben
• das Erfinden von Daten;
• das Verfälschen von Daten, z. B.
– durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offenzulegen,
– durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung;
• unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen).
b. Verletzung geistigen Eigentums
• in bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze:
• die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat),
• die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachter (Ideendiebstahl),
• die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft,
• die Verfälschung des Inhalts,
• die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind.
c. Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis.
d. Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulieren von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines Experiments benötigt).
[38]e. Beseitigung von Primärdaten […], insofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird.
2. Eine Mitverantwortung für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus
• aktiver Beteiligung am Fehlverhalten anderer,
• Mitwissen um Fälschungen durch andere,
• Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen,
• grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.“
Quelle: Hochschulrektorenkonferenz (1998, S. 3f.).
Umgang mit ChatGPT
Seit dem 30. November 2022, als das US-amerikanische Unternehmen OpenAI die Software-Version GPT-3 öffentlich kostenfrei zugänglich machte, ist ChatGPT auch im Wissenschaftsbetrieb virulent (vgl. zum Folgenden insbes. Fischer 2023). Dabei handelt es sich um ein sog. neuronales Netzwerk, welches „eigene“ Texte generiert. Dies gelingt, indem der „Generative Pre-trained Transformer“ (= GPT) durch das „Füttern“ mit sehr großen Mengen an Texten trainiert wurde / wird und auf diese Weise „statistische Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von Wörtern innerhalb bestimmter Kontexte“ (Fischer 2023, o. S.) ermitteln kann.
Da dieses KI-Sprachmodell Texte generiert, liegt natürlich die Versuchung nahe, ChatGPT auch einzusetzen, um damit Referate, Hausarbeiten, Essays, Seminar-, Bachelor- oder andere wissenschaftliche Arbeiten – oder Teile davon – „schreiben zu lassen“ – was selbstverständlich NICHT zulässig ist. Dies wiederum bedeutet aber NICHT, dass Studierende von den vielfältigen Möglichkeiten von ChatGPT Abstand nehmen sollten. Als KI-Sprachmodell, welches die Information einer Vielzahl an Datenbanken abgleicht, kann ChatGPT bspw. dabei unterstützen (vgl. hierzu u. a. Fischer 2023):
•Gliederungen für wissenschaftliche Arbeiten zu konzipieren;
• die wesentlichen Aussagen eines Textes zusammenzufassen;
•Definitionen zu bestimmten Themen zu finden;
•Feedback zu eigenständig verfassten Texten einzuholen;
• …
[39]Allem Anschein nach kann ChatGPT – wissenschaftlich richtig und redlich eingesetzt – beim Erarbeiten wissenschaftlicher Texte also nützlich sein. Zwei Aspekte aber darf man bei aller „Euphorie“ keinesfalls außer Acht lassen.
1. Grenzen von ChatGPT
Da dieses KI-Werkzeug eine sehr große Menge an Informationen recherchiert und „verarbeitet“, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ChatGPT (vgl. hierzu u. a. Fischer 2023):
• auch auf Quellen zurückgreift, die veraltet oder nichtwissenschaftlich sind, so dass die bereitgestellten Informationenunvollständig oder gar fehlerhaft sein können;
• in seine Texte teilweise rechtlich geschützte Informationen einbindet – und damit eventuell Urheberrechte verletzt.
Da es nur frei zugängliche Informationen recherchiert, kann ChatGPT plausiblerweise jene Erkenntnisse nicht verarbeiten, die nicht zugänglich sind (z. B. bestimmte wissenschaftliche Studien aus Forschungseinrichtungen).
Noch gravierender ist, dass die Software u. U. auch sog. alternative Fakten recherchiert und als „wahr“ / korrekt bewertet. Bedeutsam ist überdies, dass Qualität und Quantität der Ergebnisse auch von der Formulierung der Fragen / Prompts abhängen.
2. Beachtung der Grundsätze wissenschaftlicher Arbeiten
Aufgrund der Eigenheiten von ChatGPT sowie seiner soeben dargelegten gravierenden Schwächen gewinnt die Beachtung der Grundsätze wissenschaftlicher Arbeiten eine besonders große Bedeutung. Ohne die zu Beginn dieses Kapitels erläuterten Prinzipien und Fehlverhaltensweisen zu wiederholen, sei an dieser Stelle lediglich exemplarisch auf einige Aspekte verwiesen:
• Sofern Sie z. B. ChatGPT zur Literaturrecherche einsetzen, müssen Sie die Qualität der so aufgespürten Quellen anschließend selbstverständlich z. B. auf deren Korrektheit, Relevanz, Verlässlichkeit usw. prüfen.
•[40]Es versteht sich außerdem von selbst, dass Sie etwaige Texte / Textfragmente von ChatGPT NICHT „einfach so“ übernehmen dürfen; dies verbietet bereits der Grundsatz 1 (= Originalität und Eigenständigkeit).
• Wenn Sie bei Textübersetzungen einschlägige Software / KI zur Unterstützung nutzen, müssen Sie die entsprechenden Texte anschließend auf Korrektheit prüfen und überarbeiten; denn die Verantwortung für die Korrektheit / Äquivalenz bspw. von Übersetzungen liegt selbstverständlich ausschließlich bei Ihnen.
• Sofern Sie Hilfsmittel wie ChatGPT (für Literaturrecherche) oder DeepL / Google Translate (für Übersetzungen) verwendet haben, müssen Sie dies in Ihrer Arbeit klar verdeutlichen und in der ehrenwörtlichen Erklärung angeben.
Einen Vorschlag für den Umgang mit Werkzeugen wie ChatGPT veröffentlichte vor einiger Zeit Prof. Dr. Christian Spannagel in seinen „Rules for Tools“.
Rules for Tools: Lösungsvorschlag von Prof. Dr. Christian Spannagel zum Umgang mit Werkzeugen wie ChatGPT
„1. Alle Medien und Werkzeuge sind erlaubt.
Sie dürfen sämtliche Medien (Texte, Videos, …) und Werkzeuge (Apps, Taschenrechner, …) in meiner Lehrveranstaltung verwenden, die Sie für sinnvoll halten. Dies gilt auch für KI-Werkzeuge wie ChatGPT, die zum Beispiel beim Generieren von Ideen und beim Verfassen von Texten sehr hilfreich sein können. Diese Hilfsmittel stehen Ihnen also in meiner Lehrveranstaltung genauso zur Verfügung wie jetzt im Alltag und später im Beruf. […]
2. Sie verantworten Ihre Arbeitsergebnisse.




























