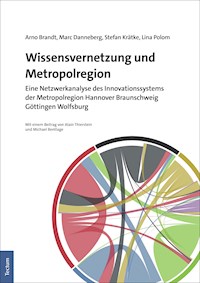
38,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Im wirtschaftlichen Strukturwandel hat sich eine wissensintensive Ökonomie durchgesetzt, die sich durch eine ausgeprägte Wissensvernetzung auszeichnet. Diese ermöglicht eine Optimierung von Kooperationsformen, ohne die Innovationsprozesse kaum noch denkbar sind. Ein wissensökonomisch fundierter Strategieansatz, der auf die Förderung von Wissensvernetzungen abstellt, setzt allerdings substanzielle Kenntnisse der Kooperationsverflechtungen voraus. Dazu bedarf es empirisch fundierter Netzwerkanalysen. Gerade die regionale Ebene ist als Plattform für diesen Austausch von Information und Wissen von zentraler Bedeutung. Als Beispiel wird daher die regionale Wissensvernetzung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg untersucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Wissensvernetzung und Metropolregion
Arno Brandt, Marc Danneberg, Stefan Krätke, Lina Polom
Wissensvernetzung und Metropolregion
Eine Netzwerkanalyse des Innovationssystems der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
Mit einem Beitrag von Alain Thierstein und Michael Bentlage
Unter Mitarbeit von Johannes Krüger
Tectum Verlag
Unterstützt und gefördert durch:
Arno Brandt, Marc Danneberg, Stefan Krätke, Lina Polom
Wissensvernetzung und Metropolregion
Eine Netzwerkanalyse des Innovationssystems der MetropolregionHannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
© Tectum – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2021
ePub 978-3-8288-7388-9
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Werk unter der ISBN 978-3-8288-4397-4 im Tectum Verlag erschienen.)
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Der Übergang zur wissensbasierten Ökonomie
1.2 Metropolregionen als Knotenpunkte der wissensbasierten Ökonomie
1.3 Metropolregionen in Deutschland und ihre Funktionen
1.4 Die Innovationsfunktion der Metropolregion
1.5 Das regionale Innovationssystem
2 Zur Methode der Netzwerkanalyse
2.1 Die Netzwerkanalyse in der Wissensvernetzung
2.2 Kompetenzfelder und Indikatorik
3 Kooperationsnetzwerke im internationalen, überregionalen und regionalen Maßstab
3.1 Überregionale und internationale Kooperationsbeziehungen
3.2 Vernetzungen innerhalb der Metropolregion
3.2.1 Kompetenzfeld Mobilitätswirtschaft
3.2.2 Kompetenzfeld Produktionstechnik
3.2.3 Kompetenzfeld Life Science
3.2.4 Kompetenzfeld IuK-Wirtschaft
3.2.5 Kompetenzfeld Energiewirtschaft
3.2.6 Kompetenzfeld Kreativwirtschaft
4 Vertiefende Analyse der Kompetenzfelder in der Metropolregion
4.1 Regionale Verteilung der Netzakteure in der Metropolregion
4.2 Überregionale Verbindungen der Netzakteure
4.3 Altersstruktur der Netzwerkakteure
4.4 Größe der betrieblichen Netzwerkakteure
4.5 Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
4.6 Unternehmensausgründungen
4.7 Die Rolle der Intermediäre
4.8 Schnittstellen zwischen den Kompetenzfeldern
4.9 Das Zukunftsthema Elektromobilität
5 Längsschnittanalyse
6 Strategische Handlungsempfehlungen für eine Politik der Wissensvernetzung in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg
6.1 Kompetenzfeld Life Science
6.2 Kompetenzfeld Mobilitätswirtschaft
6.3 Kompetenzfeld Produktionstechnik
6.4 Kompetenzfeld IuK-Wirtschaft
6.5 Kompetenzfeld Energiewirtschaft
6.6 Kompetenzfeld Kreativwirtschaft
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Tabellen
Literatur
Wissensnetzwerke verändern ihre Strukturen. Untersuchung von wissensintensiven Unternehmen und Forschungseinrichtungen (Alain Thierstein, Michael Bentlage)
1 Einleitung und Hypothesen
2 Methode
3 Ergebnisse
4 Schlussfolgerungen
5 Literatur
Anhang
Methodische Vorgehensweise
Konzeption und Vorbereitung der Studie
Durchführung der Datenerhebung
Autorenverzeichnis
Vorwort
In den zurückliegenden Jahren haben sich in den westlichen Ökonomien zunehmend die Strukturen einer wissensbasierten Wirtschaft herausgebildet, deren konstitutives Element die Vernetzungen von wissensintensiven Unternehmen untereinander und zu Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen ist. Das „Internet der Dinge“ und die „Industrie 4.0“ sind gegenwärtig Treiber dieser Entwicklung und werden das Ausmaß der Wissensvernetzung noch weiter beschleunigen. Wissensvernetzungen sind heute integraler Bestandteil von Innovationssystemen und damit für den wirtschaftlichen Erfolg von Regionen von zentraler Bedeutung. Wissensvernetzungen ermöglichen innovative Netzwerke, deren Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden spezifisches Wissen und Kompetenzen einspeisen, ohne die ein Innovationsprozess kaum noch denkbar ist. Innovationen sind in der Regel hoch arbeitsteilige Prozesse geworden, an denen die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen unterschiedlicher Unternehmen und zumeist auch zahlreiche Hochschulinstitute und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie andere Institutionen teilhaben.
Für die regionalwirtschaftliche Entwicklung im Zeitalter der wissensintensiven Ökonomie stellt die Wissensvernetzung daher einen entscheidenden Parameter dar, deren konkrete Ausprägung und Dynamik vor allem von der Gestaltungskompetenz der regionalen Akteure und den politischen Weichenstellungen auf den übergeordneten Ebenen der Gebietskörperschaften abhängt. Daher müssen die Strategiefähigkeit der regionalen Akteure gestärkt und entsprechende Handlungsansätze zur Gestaltung von Wissensvernetzungen thematisiert werden. Ein wissensökonomisch fundierter Strategieansatz setzt aber substanzielle Kenntnisse der Kooperationsverflechtungen in den einzelnen Regionen voraus und damit strategische Informationen, die den Handlungskorridor der regionalen Akteure erweitern können.
Die regionale Ebene ist nach wie vor eine wichtige Plattform für den Austausch von Information und Wissen sowie zur Generierung von Lernprozessen. Metropolitanen Verdichtungsregionen wie der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg kommt in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zu. In den Metropolregionen sind spezifische Agglomerationsvorteile vorzufinden, die sich positiv auf die Entstehung von Innovationen auswirken. Dazu gehören das große Angebot hoch qualifizierter Arbeitskräfte, der dichte Besatz mit universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, betriebliche Forschungs- und Entwicklungszentren, spezialisierte Dienstleistungsunternehmen, leistungsfähige Intermediäre und die räumliche Nähe von Akteuren, die Face-to-face-Kontakte und somit den Wissensaustausch begünstigt. Diese Raumkonstellationen lassen sich daher auch als metropolitane Innovationssysteme interpretieren.
Vor diesem Hintergrund hat die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg in den zurückliegenden Jahren der Wissensvernetzung eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Bereits im Jahr 2007 wurde eine Studie zur Wissensvernetzung in der Metropolregion in Auftrag gegeben, die im Jahr 2015 noch einmal aktualisiert wurde. Nunmehr liegen die Ergebnisse der neuen Studie in überarbeiteter Form vor, die im Tectum Verlag veröffentlicht werden. Neben der Unterstützung der Geschäftsführung der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg wurde diese Publikation nur durch die großzügige Förderung durch Die Allgemeine Arbeitgebervereinigung Hannover und Umgebung e.V. (AGV), dem Verband der Metallindustriellen Niedersachsen e.V. und der Wolfsburg AG ermöglicht. Unterstützung erhielt das Projekt auch von Hannover Impuls GmbH und der GWG Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen sowie vielen anderen Wirtschaftsförderungen und politischen Entscheidungsträgern in der Metropolregion. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch die vielen wissenschaftlichen Akteure, die erheblich zum starken Rücklauf der Befragungen beigetragen haben. Diesen Akteuren gilt unser besonderer Dank. In diesen Dank einbezogen ist auch die CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, die ihre Kompetenzen für die Erarbeitung der Netzwerkanalyse bereitgestellt hat, und das Land Niedersachsen wegen der großzügigen Bezuschussung dieses Projektes.
Dank gilt auch Professor Dr. Alain Thierstein und Dr. Michael Bentlage, die auf der Basis der in der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg erhobenen Daten einen eigenständigen Beitrag zur Netzwerkanalyse verfasst haben.
Dr. Arno Brandt
1 Einleitung
1.1 Der Übergang zur wissensbasierten Ökonomie
Die entwickelten Industrieländer sind heute durch eine zunehmend wissensintensivere Wirtschaft geprägt, die mittlerweile alle Sektoren der Wirtschaft erfasst. Dieser Strukturwandel wird durch die fortschreitende Digitalisierung der Wirtschaft zusätzlich befördert (Brandt 2019, Brandt 2015). Auf Basis der hoch entwickelten Informations- und Kommunikationstechnologien ist eine wissensbasierte Ökonomie entstanden, die vor allem bei den wissensintensiven Dienstleistungen und Industrien ein dynamisches Beschäftigungswachstum aufweist. Produkt- und Technologielebenszyklen werden zunehmend kürzer und wirtschaftliches Wachstum beruht maßgeblich auf der Generierung von neuem Wissen und Innovationen. Die wissensbasierte Ökonomie ist jedoch kein homogener Wirtschaftssektor. Vielmehr beschreibt sie ein breites Spektrum unterschiedlicher Aktivitäten, deren gemeinsame Merkmale intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und eine wachsende Bedeutung von Informationsgütern oder -dienstleistungen in den jeweiligen Wertschöpfungsketten sind (vgl. Strambach 2011; Kujath, Zillmer 2010; Kujath 2005)1.
Die wissensbasierte Ökonomie ist eine „people-driven-economy“, die auf die Gewinnung hoch qualifizierter Arbeitskräfte angewiesen ist. Wissen und Kreativität sind ihre wichtigsten Motoren und werden durch Investitionen in Humankapital sowie durch Lernen bestimmt. Aus- und Weiterbildungsprozessen kommt im Zuge eines „lebenslangen Lernens“ eine wachsende Bedeutung zu (Stiglitz 2015). Steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie die öffentliche und private Bildung gelten dabei als Investitionen in Wissen und signalisieren den Bedeutungsgewinn der Wissensarbeit (Infobox).
Mit der zunehmenden Rolle des Wissens als wichtigste Ressource einer innovationsgetriebenen Wirtschaftsentwicklung gewinnt für die Unternehmen auch die Zusammenarbeit in formellen und informellen Netzwerken bzw. Forschungskooperationen an Bedeutung. Netzwerke bzw. Kooperationen repräsentieren spezifische Organisationsformen zwischen Markt und Hierarchie, die unter bestimmten Voraussetzungen in besonderer Weise geeignet sind, den Wissensaustausch zu befördern. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Preismechanismus (Markt) und der Anweisungsmechanismus (Hierarchie) nicht funktionieren bzw. zu suboptimalen Ergebnissen führen, so dass sich die Kooperation als institutionelle Zwischenform als überlegen erweist. Diesen Zusammenhang begründet Walter Powells als einer der Begründer der ökonomischen Netzwerktheorie mit spezifischen Vorteilen der Kooperation bzw. Netzwerkaktivität als eigenständigem Koordinierungsmechanismus zwischen Markt und Hierarchie: „In netzwerkartigen Formen der Ressourcenallokation finden Transaktionen weder durch diskrete Tauschprozesse noch durch administrative Anweisungen statt, sondern innerhalb von Netzwerken von Individuen, die in wechselseitige, sich gegenseitig bevorzugende und unterstützende Handlungszusammenhänge involviert sind. Netzwerke können sehr komplex sein: sie beinhalten weder die expliziten Kriterien des Marktes noch den üblichen Paternalismus von Hierarchien. Eine grundlegende Annahme bei Netzwerkbeziehungen ist, dass einzelne Parteien von den Ressourcen der anderen abhängig sind, und dass durch die Kombination von Ressourcen Vorteile erzielt werden können“ (Powell 1996, S. 224). Die Kooperation bzw. Netzwerkaktivität sind vor allem deshalb als Koordinationsmechanismus für den Austausch von Wissen prädestiniert, weil Wissen ein immaterielles Gut ist und sich zu weiten Teilen dem Preis- und Anweisungsmechanismus entzieht. Stattdessen ist der Transfer von Wissen in besonderer Weise auf Vertrauen, Reziprozität und Reputation gegründet, die für die Funktionsweise von Kooperations- bzw. Netzwerkbeziehungen von zentraler Bedeutung sind (Strambach 2011, Sukowski 2002; Genosko 1999).
INFOBOX
Wissensintensive Wirtschaft in Deutschland
Der Anteil der Beschäftigten in Deutschland, die über einen Fachhochschul- oder Hochschulabschluss verfügen, ist zwischen 2009 und 2016 von 12,6% auf 16,8% angewachsen. Positiv verlief auch die Entwicklung beim FuE-Personal. Gegenüber 2008 ist in Deutschland die Zahl der Forscher und Entwickler bis 2016 um knapp 22 Prozent auf fast 405.000 gewachsen. Während die Anzahl der Beschäftigten im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland insgesamt zwischen 2009 und 2015 um 4,7 Prozent gestiegen ist, erhöhte sich die Anzahl des in Forschung und Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigten Personals im gleichen Zeitraum um 17,9 Prozent. Auch das Feld der wissensintensiven Wirtschaftszweige verzeichnete in den vergangenen Jahren ein messbares Wachstum. Von 2009 bis 2016 ist die Beschäftigung der Wissensintensiven Dienstleistungen und des wissensintensiven Verarbeitenden Gewerbes um 14,5% gewachsen und damit in etwa so stark wie die Beschäftigungsentwicklung insgesamt. Darunter haben sich die Wissensintensiven Dienstleistungen (+18,1 %) deutlich positiver entwickelt als das Wissensintensive Verarbeitende Gewerbe (+8,1%). Der Anteil dieser Wirtschaftszweige an der Beschäftigung insgesamt beträgt 2016 knapp ein Drittel (31,1%).
Quelle: IAB, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Der Wissensaustausch wird nicht zuletzt durch die fortschreitende Digitalisierung erleichtert. Digitale Netze können nur kodifiziertes Wissen (explizites Wissen) übertragen, d.h. Wissen, das in verbaler oder schriftlicher Form (auch Grafiken, Blaupausen, Algorithmen etc.) festgehalten wird und personenunabhängig transferiert werden kann. Die Digitalisierung führt aber auch zur Aufwertung der nicht kodifizierbaren und damit technisch nicht substituierbaren Wissensformen. Kodifiziertes Wissen setzt einen Fundus von kontextuellem Hintergrund- und praktischem Umsetzungswissen voraus, das auch als implizites Wissen oder „Tacit knowledge“ bezeichnet wird (Polanyi 1985).
Unter implizitem Wissen „wird das kontext- und situationsabhängige, schwer zu kommunizierende Hintergrundwissen verstanden. Es umfasst Erfahrungen, Routinen und latente Praktiken und ist in Personen und Organisationen gebunden“ (Maier, Tödtling, Trippl 2006, S. 112). Tacit knowledge ist daher definitionsgemäß nicht kodifizierbar und kann nicht schriftlich niedergelegt werden (Audretsch, Feldman 2003, S. 6; Hellbrecht 2004, S. 424; Genosko 1999, S. 38). Folglich ist das implizite Wissen schwer kommunizierbar, formalisierbar und teilbar, so dass es weitgehend nur „face to face“ weitergegeben werden kann (Brökel 2016, Brandt 2014; Strambach 2011; Franz 2002). Dies erschwert die Diffusion des impliziten Wissens über größere Distanzen hinaus (Stiglitz 1999, S. 4ff.). Räumliche Nähe ist eine wesentliche Voraussetzung für die Vermittlung von implizitem Wissen. Auch im Zeitalter moderner IuK-Technologien besteht damit eine fortdauernde Relevanz von Face-to-face- Kommunikation und räumlicher Nähe2. Dies bedeutet auch, dass den regionsspezifischen Wissensbeständen trotz einer globalisierten Informationsflut auch weiterhin eine zentrale Bedeutung für die Regionalentwicklung zukommt (vgl. Siebel 2015; Brandt 2014; Krätke 2002; Genosko 1999).
Eine Erweiterung hat das Konzept der räumlichen Nähe durch das Konzept der relationalen Nähe gefunden, wobei Nähe dabei umfassend, d.h. neben räumlicher Nähe auch als kognitive, gesellschaftliche, organisatorische und institutionelle Nähe betrachtet wird (Thierstein, Wiese 2011, Barthelt, Glückler 2012; Lüthi et al. 2013, Boschma 2005). Unter „relationaler Nähe“ werden insbesondere die Ähnlichkeiten unterschiedlicher Regionen in Hinblick auf ihre gemeinsam geteilten Verhaltensnormen, kulturellen Gepflogenheiten, ihr gegenseitiges Vertrauen, ihr Zugehörigkeitsgefühl und ihre Kooperationsressourcen verstanden (Belderbos et al. 2012). Relationale Nähe spielt für den überregionalen Transfer von Wissensspillovern eine bedeutende Rolle, steht aber nicht in einem Gegensatz zur räumlichen Nähe. Wissen wird „erst im Austausch zwischen Menschen geschaffen, welche sich sowohl räumlich als auch in Netzwerken nahe und vertraut sind und zu diesem Austausch auch bereit sowie in der Lage sind: Räumliche und relationale Nähe spielen sich je nach Technologie- und Handlungsfeld gegenseitig und komplementär in die Hände“ (Thierstein, Wiese 2011, S. 129).
Implizites Wissen und explizites Wissen schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern bedingen einander; sie verhalten sich nicht substitutiv sondern komplementär zueinander (Tsoukas 2003; Gust-Bardon 2012). Welches Gewicht den beiden Wissensarten jeweils zukommt, ist a priori nicht eindeutig zu beantworten und hängt z.T. von technologie- und branchen- sowie lebenszyklusspezifischen Konstellationen ab. Aus innovationsökonomischer Sicht lässt sich die These begründen, dass mit dem zunehmenden Austausch von explizitem Wissen die Bedeutung von Hintergrund- und Erfahrungswissen (Tacit knowledge) eher zunimmt: die Einführung neuen Wissens setzt ein breites praktisches Erfahrungswissen und damit Know how (im Unterschied zu Know what) voraus. Das explizite Wissen repräsentiert dabei, wie es Joseph Stiglitz formuliert, „nur die Spitze des Eisbergs“ (Stiglitz 1999).
An die besondere Bedeutung von Tacit knowledge knüpft César Hidalgo in seiner Netzwerktheorie an (Hidalgo 2016). Im Rahmen seines theoretischen Ansatzes liefert Hidalgo eine systematische Begründung für den wirtschaftlichen Erfolg von Volks- und Regionalwirtschaften im Kontext von Wissensnetzwerken: Da die Produktion komplexer Produkte immer eine Kombination von explizitem Wissen und Know-how verkörpert, setzt diese den Zugang zu implizitem Wissen voraus (Ebenda, S. 116). Erfolgreiches Wirtschaften basiert damit auf der Fähigkeit, Wissen und insbesondere Know-how zu akkumulieren. Die Menge von Wissen und Know-how, die auf individueller Ebene angehäuft werden kann, ist aber begrenzt, was eine Akkumulation auf kollektiver Ebene erforderlich macht und zur Bildung einer Unternehmung führt. Dieser Akkumulationsprozess erreicht unweigerlich einen kritischen Punkt, ab dem auch die Grenzen einer Unternehmung überschritten werden und weiteres Wissen und Know-how nur noch in Unternehmensnetzwerken angehäuft werden können: „Das krasse Missverhältnis zwischen den riesigen Mengen an Wissen und Know-how, die zur Erschaffung der Hightech-Wunder dieser Welt benötigt werden, und der begrenzten Know-how-Speicherkapazität von Unternehmen erklärt warum wir (…) Firmennetze benötigen, um komplexe Produkte herzustellen.“ (Hidalgo 2016, S. 134)
Die Ausweitung von Wissensnetzwerken bzw. von innovationsorientierten Kooperationen stellt eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für die Entwicklung einer dynamischen Wirtschaft dar. Dafür ist es von zentraler Bedeutung, wie die Gesamtstruktur des Beziehungsgeflechts beschaffen ist und an welcher strukturellen Position die jeweiligen Organisationen im Beziehungsgeflecht zu verorten sind (Brökel 2016). Netzwerke können z.B. sehr unterschiedliche Dichten und Stabilitäten aufweisen, mehr oder minder geschlossen oder offen sein und auch in räumlicher Hinsicht (regional, überregional, international) unterschiedlich verortet und strukturiert sein. Vertiefende Einblicke in diese strukturellen Eigenschaften von Wissensnetzwerken erlaubt die Netzwerkanalyse, die in diesem Buch als zentrale Analysemethode eingesetzt wird (siehe Kapitel 3–5). Die konkreten Eigenschaften von Netzwerken können, ausgehend von den analytischen Erkenntnissen, Ausgangspunkt für regionalwirtschaftliche Gestaltungsansätze sein. Wissens-, Netzwerk- und Clustermanagement, Wissensvernetzung und Strategieansätze, die auf die Förderung von lernenden Regionen abstellen, gewinnen in diesem Zusammenhang an Relevanz (siehe Kapitel 6).
Aus innovationsökonomischer Perspektive handelt es sich bei den Wissensnetzwerken um eine Form der Übertragung von Wissensspillover3 (Fritsch 2012, Brökel 2016). „Wissensspillover werden in diesem Kontext als nicht-marktlich abgegoltene Wissenstransfers zwischen Organisationen aufgefasst, die einen positiven Effekt auf die Wissensgenerierung der wissensempfangenen Organisationen haben“ (Brökel 2016, S. 44). Sie sind ein typisches Beispiel für die Existenz positiver externer Effekte, die bei der Erklärung von Wachstumsimpulsen in dynamischen Regionen eine wesentliche Rolle spielen. Dabei wird in der Regionalökonomie zwischen Lokalisationsvorteilen und Urbanisierungsvorteilen unterschieden. Erstere stellen auf intraindustrielle Externalitäten ab, die aus der räumlichen Konzentration von spezifischen Branchen bzw. Wertschöpfungsketten erwachsen (Cluster). Die Vorteile resultieren aus der Verfügbarkeit eines Arbeitskräftepools, spezialisierten Zulieferverflechtungen und Dienstleistern sowie Wissensspillover. Urbanisierungsvorteile beziehen sich auf die Größe des Marktes und die damit verbundene Diversität von qualifizierten Arbeitskräften, Branchen und sonstigen Institutionen (z.B. Forschungseinrichtungen). Gerade in der Diversität urbaner Standortqualitäten liegt ein hohes Innovationspotenzial begründet. Auch in diesem Fall profitieren die Unternehmungen von Wissensspillover, deren Inhalt aber Wissen ist, welches außerhalb ihres gewöhnlichen Aktivitätsraumes existiert (Brökel 2016, S. 46).
Für das regionale Innovationssystem ist der Wissensaustausch innerhalb der Wirtschaft und zwischen der Wirtschaft und der Wissenschaft (Wissensspillover) von zentraler Bedeutung. Wissenschaftliche Studien lassen den Schluss zu, dass ein hohes Innovationspotenzial insbesondere an den Schnittstellen und Überlappungsbereichen unterschiedlicher, aber auch verwandter Kompetenzfelder („related variety“) (Frenken et al. 2007) zu verorten ist. Relatedvariety oder technologische Verbundenheit beschreibt in diesem Zusammenhang das Vorhandensein von Unternehmen in Branchen, welche über verschiedene, aber dennoch ähnliche Kompetenzen verfügen und daher einen relativ engen Bezug zueinander aufweisen (Brachert und Titze 2012: 210). Diese Verbundenheit zwischen verwandten bzw. komplementären Branchen schafft besonders günstige Voraussetzungen für den Wissenstransfer (EU Kommission 2012). Eine Strategie der verwandten Diversifizierung geht daher von der Erkenntnis aus, dass sich Wissen primär dort überträgt, wo Regionen mit unterschiedlichen Branchen ausgestattet sind, die aber aufgrund ihrer gemeinsamen Wissensbasis miteinander eng verbunden sind (Boschma 2008, S. 13). Gerade an den Rändern bzw. Übergängen von Kompetenzfeldern werden weitaus bedeutendere Innovationen hervorgebracht als in ihren Kernen (Menzel 2012, S. 61f.). An den Rändern bzw. Überlappungsbereichen von unterschiedlichen Netzwerken bzw. Clustern können die regionalen Akteure aufgrund ihrer besonderen innovativen Potenziale eine wichtige Rolle im Rahmen der Weiterentwicklung des regionalen Innovationssystems spielen. Auch in diesem Zusammenhang kann eine Netzwerkanalyse konstruktive Hinweise liefern, wo entsprechende Schnittstellen und Überlappungsbereiche räumlich zu verorten sind.
Der theoretischen Erklärung für einen Zusammenhang zwischen technologischer Verbundenheit und ökonomischem Erfolg liegt die Annahme zugrunde, dass Innovationssprünge in vielen Fällen auf eine (Neu)-Kombination von Kompetenzen verschiedener Wirtschaftsakteure zurückzuführen sind.
Empirisch ist es außerordentlich schwierig, den Wissensaustausch, der innerhalb der Netzwerke stattfindet, direkt zu messen. Paul Krugman hat darauf verwiesen, dass Wissensflüsse unsichtbar sind und sie keine Spuren hinterlassen, die man gegebenenfalls messen könnte (Krugman 1991, S. 53). Auch wenn in empirischen Studien gezeigt werden kann, dass durch den Austausch von Wissen und Ideen immer wieder Lernen ermöglicht wird und damit neues Wissen entsteht, ist es schwer zu bestimmen, welche der am Wissensaustausch beteiligten Parteien den größeren Nutzen davon trägt. Die Aneignung von Wissen im Kontext von Wissensnetzwerken hängt nicht zuletzt auch von der Absorptionskapazität der an den Kooperationsverflechtungen beteiligten Akteuren ab (Krätke 2011, S. 101). Wissenstransfer ist kein linearer Vorgang, sondern erfordert sowohl einen permanenten Prozess der Interaktion zwischen den Akteuren als auch die entsprechenden Verarbeitungskapazitäten, um sich fremdes Wissen produktiv aneignen zu können. Krätke plädiert daher auch dafür, dass die Rede vom Wissenstransfer oder von den Wissensflüssen mehr als Metapher „for an interaction of considerable complexity“ verstanden werden sollte (Krätke 2011).
1.2 Metropolregionen als Knotenpunkte der wissensbasierten Ökonomie
Die für die wissensbasierte Ökonomie bedeutenden Wirtschaftsbereiche konzentrieren sich vornehmlich in urbanen Agglomerationsräumen (vgl. Läpple 2016; Bentlage, Thierstein, Lüthi 2014; Thierstein, Wiese 2011; Krätke 2011; Thierstein et al. 2006)4. Autoren wie Kujath, Siebel und Krätke sehen die Metropolregionen zu den bevorzugten Standorten der Wissensarbeit aufsteigen. Denn in einer wissensbasierten Ökonomie sind es gerade die großstädtischen Regionen und Agglomerationen, die die bedeutsamen Standorte darstellen (Kujath 2005, Siebel 2015; Läpple 2014; Krätke 2013; Krätke 2007; Helbrecht 2005, Eickelpasch 2017). Dabei richtet sich der Fokus immer weniger auf die urbanen Metropolen im engeren Sinne, sondern zunehmend auf ein breiter angelegtes funktionales Verständnis des urbanen Raums als Metropolregion. Die Metropolregionen, bestehend aus großstädtischen Zentren und dem damit eng verflochtenem Umland, gelten als die Knotenpunkte der wissensbasierten Ökonomie. „Gleichzeitig zeigt sich in diesen Regionen eine Regionalisierung des Städtischen. Nicht mehr einzelne Städte, sondern Stadtregionen sind die räumliche Maßstabsebene, auf der sich mehr und mehr räumliche Entwicklungsprozesse abspielen“ (Münter et al. 2016, S. 10).
Metropolregionen sind prädestinierte Orte einer wissensbasierten Ökonomie, weil sie zum einen über eine große Akteursdichte und über die Diversität verfügen, aus denen sich regionale Wissensnetzwerke und regionale Kontexte des Lernens entwickeln. „Zum anderen tragen die Ressourcen eines differenzierten Arbeitsmarktes mit spezialisierten Wissensarbeitern zu der Entwicklung bei, aber auch die Kommunikations- und Personentransportinfrastrukturen: Flughäfen, Bahnanschlüsse, Telekommunikationsnetze sowie eine breite Palette von Angeboten wie Messen. Dies alles macht Metropolregionen zu großen Informationsmarktplätzen, zu Kreuzungen des Informations- und Wissensaustausches“ (Kilper, Kujath 2006). Neben der räumlichen und institutionellen Nähe der Akteure untereinander sowie der Verfügbarkeit impliziten Wissens trägt zu dieser Einschätzung auch die Reduktion von Risiken durch die in den urbanen Räumen vorhandene höhere Kommunikationsdichte bei (vgl. Bentlage, Thierstein, Lüthi 2014; Krätke 2005, Läpple 2003). Mit ihren besonderen Raumqualitäten und ihrer kritischen Masse verfügen die deutschen Metropolregionen zudem über günstige Voraussetzungen, um auch in einem europäischen Kontext wahrgenommen zu werden und entsprechend agieren zu können.
Die in einer Metropolregion vorhandene große Akteursdichte und -vielfalt ermöglicht vielfältige persönliche Kontakte, wodurch enge regionale Kommunikationsnetze und damit die Entstehung regionaler Wissenskontexte und Lernprozesse begünstigt werden (vgl. Kujath 2005). Metropolregionen bieten zudem eine hohe Dichte und Diversität von Wissensressourcen. Diese Verdichtung stellt das ideale Umfeld für eine Wissensvernetzung dar. Den Metropolregionen gelingt es darüber hinaus am ehesten, eine Kopplung von regionalen und internationalen Ressourcen zu erreichen (Krätke 2007). Die räumliche Größe schafft zudem Verbundeffekte, die eine bessere Arbeitsteilung und größere Ausstrahlungskraft ermöglicht. Die vorhandene Dichte bedingt zudem eine räumliche Nähe, die für den Austausch von implizitem Wissen und für die Anbahnung von Kooperationen besonders vorteilhaft ist.
Metropolregionen stellen einen hochwertigen Ressourcenpool in Hinblick auf qualifizierte Arbeitskräfte, Zuliefermärkte und eine gut ausgestattete Kommunikations- und Transportinfrastruktur dar. Als Knoten globaler Wissensnetzwerke bieten sie die erforderlichen Standortqualitäten für hochwertige Dienstleistungen wie Forschung und Entwicklung oder die Informations-, Medien- und Kreativindustrien (vgl. Bentlage, Thierstein 2013; Thierstein, Wiese 2011; Kujath 2005; Krätke 2002). Gerade bei den wissensintensiven Wirtschaftsaktivitäten lassen sich Konzentrationen auf einige wenige Standorte in Deutschland empirisch nachweisen (vgl. Bentlage, Thierstein, Lüthi 2014). Metropolregionen und große Städte repräsentieren die Standortzentren für neue wissensbasierte Wertschöpfungsketten sowie innovationsstarke Produktionscluster in wissensintensiven Industrien (IuK, Medientechnik, Biotechnologie, Medizintechnik etc.). Für den Zusammenhang zwischen Wissensgenerierung, Innovation, und Regionalentwicklung ist dabei entscheidend, dass den Netzwerken und Clustern im Sinne von regional vernetzten Ensembles von spezialisierten Unternehmen eine „kollektive Effizienz“ zugeschrieben wird, die aus Unternehmens-externen Skalenvorteilen der Produktion und aus Transaktionskostenersparnissen infolge räumlicher und kultureller Nähe der zusammenwirkenden Unternehmen hervorgeht (Krätke 2001).





























