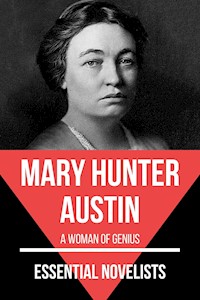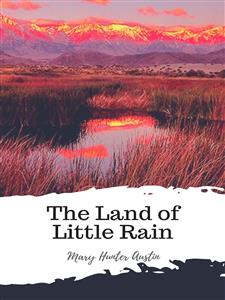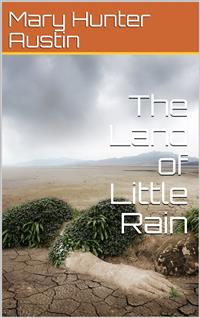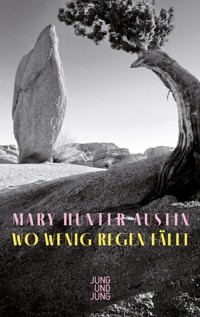
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mehr als ein Jahrzehnt erkundete Mary Hunter Austin das Gebiet, das sie, nach seinem indianischen Namen, »Land of Little Rain« nannte und dem sie schließlich ihr erstes Buch widmete – geschrieben hat sie es in einem Monat, wie sie sagte. 1903 erstmals erschienen, hat es bis heute nichts von seiner Faszination und Leuchtkraft verloren. Reiseerzählung, Landschaftsbeschreibung, Memoir, ethnografischer Bericht – das Buch hat zahlreiche Facetten, ist aber vor allem ein literarisches Dokument der Liebe zu einem Land im Südwesten der USA, das heute die Mojave-Wüste und den Death-Valley-Nationalpark umfasst. Austins Blick ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die Flora und Fauna dieses Gebiets und der Wertschätzung für die Menschen, denen sie dort begegnete: Schoschonen und Paiute, Einwanderer aus Mexiko oder China, Schäfer, Minenarbeiter und Goldsucher. Er verrät nicht nur eine gewinnende Empathie und eine einzigartige poetische Sensibilität, sondern auch den Eigensinn und die Unbeirrbarkeit einer Autorin, die mit einem Werk von mehr als 30 Büchern und zahllosen Artikeln zu den frühen Umweltaktivistinnen und Frauenrechtlerinnen Amerikas zählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Land of Little Rain« 1903
© 2023 Jung und Jung, Salzburg
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-195-7
MARY HUNTER AUSTIN
Wo wenig Regen fällt
aus dem Amerikanischenübersetzt und herausgegebenvon Alexander Pechmann
Für Eve1,die den Gescheiterten Trost spendet
Vorwort
Ich bekenne, dass ich eine große Vorliebe dafür habe, wie Indianer Namen vergeben: Jeder wird nach den Eigenschaften benannt, die ihn für den Namensgeber am besten charakterisieren. So mag einer »Mächtiger Jäger« oder »Der sich vor Bären fürchtet« sein, je nachdem, ob er von Freund oder Feind gerufen wird, und »Narbengesicht« unter jenen, die ihn nur vom Sehen kennen. Keine andere Methode entspricht wohl so gut den verschiedenen Wesensarten, die uns innewohnen, und wenn Sie mir darin zustimmen, werden Sie verstehen, warum so wenige der hier erwähnten Namen mit den Bezeichnungen im Atlas übereinstimmen. Denn falls ich einen See liebe, der unter dem Namen seines Entdeckers bekannt ist, ihn aber wegen der dicht wachsenden Kiefern ins Herz schließe, die er an seinen Ufern nährt, dann finden Sie ihn in meinem Bericht so beschrieben. Doch sollten die Indianer vor mir dort gewesen sein, sollen Sie ihren Namen erfahren; er passt immer ausgezeichnet und verdankt sich nicht der armseligen Sehnsucht der Menschen, nie vergessen zu werden.
Dennoch gibt es bestimmte Gipfel, Canyons und Lichtungen, die sich allem entziehen, was Worte erfassen können, und die einen gewissen Ruhm besitzen, wie Menschen von hoher Abstammung, denen wir keine vertraulichen Namen geben. Unter ihrer Führung könnten Sie mein Land erreichen und viel von dem, was hier geschrieben steht, finden oder auch nicht finden, das hängt von Ihnen ab. Und mehr: Die Erde gibt ihr Bestes nicht schamlos jedem Neuankömmling preis, sondern behält für jeden eine süße, einmalige Vertraulichkeit zurück. Aber sollten Sie nicht alles so vorfinden, wie ich es beschreibe, halten Sie mich deswegen nicht für weniger verlässlich oder sich selbst für weniger klug. Es gibt eine Art Täuschung, die in Herzensangelegenheiten erlaubt ist, so wie man beispielsweise sagt, »Ich kenne jemanden, der …«, und dabei die teuerste Erfahrung preisgibt, ohne sie zu verraten. Und mir liegt nichts daran, Sie zu köstlichen Orten zu führen, für die Sie weniger zärtlich empfinden als ich. Durch diese Art der Namensgebung bleibe ich also dem Land treu und erweitere meinen Grundbesitz um ein sehr großes Territorium, auf das niemand mehr Anspruch hat.
Das Land, wo Sie das Beschriebene sehen und berühren können, liegt zwischen den hohen Sierras südlich von Yosemite – erstreckt sich südöstlich über eine riesige Ansammlung unterbrochener Bergketten jenseits von Death Valley und unermesslich weit hinein in die Mojave-Wüste. Sie gelangen auf sein Gebiet, indem Sie mit der Postkutsche aus dem Süden anreisen, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, oder mit der Eisenbahn aus dem Norden auf der Overland Route2 und bei Reno aussteigen. Der beste Weg führt über die Sierra-Pässe, auf Reitwegen und Trampelpfaden, denn sehen heißt glauben. Doch zum wahren Herzen und Kern des Landes dringt man nicht in einem Monat Urlaub vor. Man muss Sommer und Winter mit dem Land verbringen und auf seine besonderen Ereignisse warten. Kiefern, die zwei bis drei Jahreszeiten benötigen, bis die Zapfen reif sind, Wurzeln, die sieben Jahre unter dem Sand liegen und auf Regen warten, Fichten, die fünfzig Jahre wachsen, ehe sie blühen – sie alle schließen keine oberflächlichen Bekanntschaften. Doch wenn Sie auf seinem Gebiet je bis zu der Stadt gelangen, die in einer Mulde am Fuß des Kearsarge liegt, gehen Sie nicht, ehe Sie an die Tür des braunen Hauses unter der Weide am Ende der Hauptstraße geklopft haben, denn dort werden Sie so viel Neues über das Land, seine Pfade und alles, was dort herumwandert, erfahren, wie es nur ein Liebhaber des Landes einem anderen vermitteln kann.
Wo wenig Regen fällt
Östlich der Sierras, südlich von Panamint und Amargosa, viele ungezählte Meilen südöstlich liegt das Land der Verlorenen Grenzen.
Ute, Paiute, Mojave und Schoschonen leben auf seinem Gebiet und so tief in seinem Herzen, wie ein Mensch zu gehen wagt. Nicht das Gesetz, das Land setzt die Grenze. Auf den Landkarten trägt es den Namen Wüste, doch die Bezeichnung der Indianer ist die bessere. Wüste ist ein ungenauer Begriff, um Land zu kennzeichnen, das keine Menschen ernähren kann; ob sich das Land zu diesem Zweck urbar machen lässt, ist nicht bewiesen. Niemals ist es ohne Leben, wie trocken die Luft und wie lebensfeindlich der Boden auch sein mag.
Dies ist die Natur jenes Landes. Es gibt Berge, rund, stumpf, verbrannt, aus dem Chaos herausgepresst, chromgelb und zinnoberrot bemalt, bis zur Schneelinie aufragend. Zwischen den Bergen liegen hochlandartige Ebenen voll unerträglichem Sonnenglanz oder schmale Täler im blauen Dunst. Die Oberfläche der Berge ist gestreift von verwehter Asche und schwarzen, witterungsbeständigen Lavaflüssen. Nach Regenschauern sammelt sich Wasser in den Mulden der kleinen, unzugänglichen Täler und hinterlässt nach dem Verdunsten harte, trockene Flächen reiner Verödung, die von Einheimischen trockene Seen genannt werden. Wo die Berge steil und die Regenfälle stark sind, werden diese Becken nie ganz trocken, aber dunkel und bitter, umrahmt vom Beschlag alkalischer Ablagerungen. Eine dünne Kruste davon liegt entlang des Marschlandes über der Gegend mit Pflanzenwachstum, die weder schön noch frisch aussieht. In den breiten Einöden, die dem Wind ausgesetzt sind, bildet der verwehte Sand Hügel um kleine Sträucher, und zwischen ihnen zeigt der Boden Salzadern. Die Formen der Berge sind hier eher vom Wind als von Wasser geschaffen, wobei die heftigen Stürme ihnen manchmal Narben schlagen, die viele Jahre lang sichtbar bleiben. In all den Wüstenrändern des Westens gibt es Versuche, den berühmten, schrecklichen Grand Canyon im Kleinen nachzubilden, auf den man am Ende stößt, wenn man lang genug durch dieses Land wandert.
Da dies hier Bergland ist, würde man erwarten, Quellen vorzufinden, aber sie sind recht unzuverlässig; denn findet man eine, erweist sie sich oft als brackig und unbekömmlich oder das langsame Tröpfeln in einen durstigen Boden treibt einen zum Wahnsinn. Hier findet man die heiße Senke des Death Valley oder hochwogende Landstriche, wo immer ein Hauch Frost in der Luft liegt. Hier gibt es lang anhaltende starke Winde und atemlose Kalmen auf den schiefen Tafelländern, wo Staubteufel tanzen, in den weiten, blassen Himmel hinaufwirbeln. Hier gibt es keinen Regen, wenn die ganze Erde danach schreit, oder kurze Regengüsse, gewaltige Wolkenbrüche. Ein Land der verlorenen Flüsse, mit wenig darin, was man lieben könnte; aber auch ein Land, in das man unweigerlich zurückkommen muss, wenn man es einmal besucht hat. Wäre dem nicht so, gäbe es wenig darüber zu erzählen.
Dies ist das Land der drei Jahreszeiten. Von Juni bis November liegt es heiß, still und unerträglich da, geplagt von heftigen Unwettern, die keine Linderung bringen; dann, bis April, frostig, reglos, trinkt es seinen spärlichen Regen und seinen noch spärlicheren Schnee; von April bis zum Sommer wiederum blühend, strahlend und verführerisch. Diese Monate sind nur Annäherungen; regenschwere Luft mag früher oder später durch die Schleuse des Colorado River vom Golf heraufziehen, und das Land bestimmt seine Jahreszeiten nach dem Regen.
Die Wüstenpflanzen beschämen uns mit ihren fröhlichen Anpassungen an die saisonalen Beschränkungen. Ihre einzige Pflicht besteht darin, zu blühen und Früchte zu tragen, und sie tun es dürftig oder in tropischem Überschwang, wie es der Regen zulässt. Im Bericht der Death Valley Expedition steht, dass nach einem Jahr mit ausgiebigen Regenfällen in der Wüste von Colorado ein zehn Fuß hohes Exemplar Amarant gefunden wurde. Ein Jahr darauf wuchs dieselbe Pflanze am selben Ort während der Dürre vier Zoll hoch. Es ist zu hoffen, dass das Land ähnliche Qualitäten in seinen menschlichen Sprösslingen hervorbringt, sodass sie sich nicht als »Hänflinge«, sondern als durchsetzungsfähig erweisen. Die Wüstenpflanze erreicht selten die volle Größe ihrer Gattung. Extreme Trockenheit und extreme Höhe haben gleichermaßen Kleinwuchs zur Folge, sodass wir in den hohen Sierras und im Death Valley kleinwüchsige Exemplare verwandter Gattungen finden, die unter durchschnittlichen Temperaturen eine hübsche Größe erreichen. Wüstenpflanzen sind sehr geschickt darin, Verdunstung zu verhindern, sie drehen ihre Blätter mit dem Rand gegen die Sonne, lassen seidige Haare wachsen und sondern klebrigen Harz ab. Der Wind zerrt mit seiner großen Reichweite ständig an ihnen und hilft. Er häuft Dünen um ihre stämmigen Stengel, umarmend und schützend, und über den Dünen, die wie beim Mesquite dreimal so hoch wie ein Mensch sein können, gedeihen die blühenden Zweige und tragen Früchte.
Es gibt viele Gebiete in der Wüste, wo trinkbares Wasser wenige Fuß tief unter der Oberfläche liegt, worauf der Mesquite und das Tropfengras (Sporobolus airoides) hinweisen. Diese Nähe unverhoffter Hilfe macht den Tod in der Wüste so tragisch. Man erzählt, dass der endgültige Zusammenbruch jener unglückseligen Gruppe, die dem Death Valley seinen abschreckenden Namen verlieh, in einer Gegend geschah, wo untiefe Quellen sie gerettet haben könnten. Aber wie hätten sie das wissen können? Mit der richtigen Ausrüstung ist es möglich, die unheimliche Senke sicher zu durchqueren, doch jedes Jahr fordert sie Todesopfer und man findet dort verdorrte Mumien, von denen keine Spur und keine Erinnerung zeugt. Den eigenen Durst zu unterschätzen, an einem bestimmten Punkt falsch abzubiegen, eine ausgetrocknete Quelle zu finden, wo man nach fließendem Wasser suchte – in keinem dieser Fälle kann man etwas tun.
Entlang von Quellen und unterirdischen Wasserläufen stößt man mit Erstaunen auf wasserliebende Pflanzen, die auf feuchtem Boden weit verbreitet sind, doch die echte Wüste bringt ihre eigenen Arten hervor, jede in ihrem ureigenen Lebensraum. Der Winkel des Abhangs, die Front eines Berges, die Zusammensetzung des Bodens bestimmen die Pflanze. Nach Süden blickende Berge sind fast kahl, und die ersten Bäume stehen hier tausend Fuß höher. Canyons, die ostwärts und westwärts verlaufen, haben eine kahle und eine bewachsene Wand. Rings um trockene Seen und Marschen wächst das Gras gleichmäßig und ordentlich. Die meisten Gattungen haben genau definierte Bereiche, wo sie wachsen, die besten Fingerzeige, die das stumme Land dem Reisenden hinsichtlich seiner Position geben kann.
Sollten Sie daran zweifeln, beachten Sie, dass die Wüste mit dem Kreosotestrauch beginnt. Dieses unsterbliche Gebüsch wächst bis hinab ins Death Valley und hinauf bis zur unteren Baumgrenze. Es duftet und hat eine heilende Wirkung, wie schon der Name vermuten lässt, gleicht einer Rute und hat glänzendes, durchbrochenes Laub. Sein kräftiges Grün ist eine Augenweide in einer Wildnis aus grauen und grünlichen Sträuchern. Im Frühling sondert es Harz ab, das die Indianer dieser Gegend mit Felsstaub mischen, um damit Spitzen an Pfeilen zu befestigen. Seien Sie sicher, dass Indianer keine Eigenschaft irgendeiner Pflanze ungenutzt lassen!
Nichts, was die Wüste hervorbringt, bringt sie besser zum Ausdruck als die unglückseligen Gewächse der Yuccapalmen. Gemarterte, dünne Wälder davon stelzen trostlos über die hohen Tafelländer, besonders in dem dreieckigen Streifen, der sich ostwärts vom Treffpunkt der Sierras und der Berge an der Küste ausbreitet, wo die Ersteren zum südlichen Ende des San Joaquin Valley schwenken. Die Yucca strotzt vor bajonettartig spitzen mattgrünen Blättern, die mit dem Alter struppig werden, bestückt mit Rispen aus stinkenden grünlichen Blüten an den Spitzen. Nach dem Absterben, ein langsamer Prozess, bleibt das geisterhaft hohle Netzwerk seines Holzskeletts zurück, das nicht genug Kraft aufbringt, um zu verrotten, und im Mondlicht furchterregend aussieht. Bevor die Yucca erblüht, während ihre Blüte noch eine milchweiße, kegelförmige Knospe vom Format eines kleinen Kohlkopfs voll süßem Saft ist, drehen die Indianer sie geschickt aus ihrem messerscharfen Gehege und braten sie als Leckerbissen.
Deswegen sieht man in den von Menschen besiedelten Gegenden die jungen Pflanzen der Yucca arborensis eher selten. Andere Yuccas, Kakteen, kleine Kräuter, tausend Sorten, findet man, wenn man von den Küstengebirgen ostwärts reist. Weder ist der Boden zu wenig nahrhaft noch gibt es zu wenige Pflanzenarten, um die Kargheit der Vegetation in der Wüste zu erklären, aber jede Pflanze benötigt einfach mehr Raum. So viel Erde muss beansprucht werden, um so viel Feuchtigkeit zu gewinnen. Der wahre Kampf ums Überleben, das echte Gehirn der Pflanze waltet unterirdisch; darüber ist Platz für ein kräftiges, perfektes Wachstum. Im Death Valley, angeblich das Herz der Ödnis, gibt es fast zweihundert identifizierte Arten.
Über der unteren Baumgrenze, die auch die Schneegrenze ist, sieht man, von der Sonne plötzlich ans Licht gebracht, ausgedehnte Flächen mit Pinien, Wacholder, dessen Zweige fast bis zum Boden reichen, Flieder und Salbei sowie einzelne Weißkiefern.
Selbstbefruchtende oder windbefruchtete Pflanzen sind keineswegs besonders dominant, aber die Notwendigkeit und die Spuren von Insekten sind überall zu erkennen. Wo es Samen und Insekten gibt, sind auch Vögel und kleine Säugetiere nicht weit, und wo diese leben, erscheinen bald auch die schleichenden, scharfzahnigen Arten, die ihnen auflauern. Egal, wie weit Sie es wagen, ins Herz eines einsamen Landes vorzudringen, Leben und Tod werden stets vor Ihnen da sein. Bunte Eidechsen schlüpfen aus Felsspalten und wieder hinein, schnappen auf weiß glühendem Sand nach Luft. Vögel, sogar Kolibris, nisten in Kakteenfeldern; Spechte schließen Freundschaft mit dämonischen Yuccas; aus der kahlen, baumlosen Einöde schallt der Nachtgesang der Nachtigall. Ist es Sommer und die Sonne schon untergegangen, hört man den Ruf einer Eule in ihrer Höhle. Seltsame, pelzige, übermütige Dinger flitzen über die freien Flächen oder sitzen reglos in den Kommandotürmen des Kreosote. Der Dichter mag »all die Vögel ohne Gewehr benannt«3 haben, nicht aber das elfenfüßige, bodenlebende, verstohlene, kleine Volk der regenlosen Regionen. Es gibt zu viele Geschöpfe, und sie sind zu schnell; Sie würden nicht glauben, wie viele, ohne ihre Fußspuren im Sand gesehen zu haben. Fast alle sind Nachtarbeiter, denen die Tage zu heiß und zu grell sind. Inmitten der Wüste, wo kein Vieh weidet, gibt es keine Aasvögel, aber wenn Sie weit in diese Richtung gehen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich im Schatten ihrer angewinkelten Flügel wiederfinden. Nichts, das so groß ist wie ein Mensch, kann in dieses Land unbeobachtet vordringen, und die Geier wissen nur zu gut, wie es mit Eindringlingen verfährt. Es gibt genug Hinweise darauf zu entdecken, wie das Land seinen Bewohnern neue Verhaltensweisen aufzwingt. Das rasch stärker werdende Sonnenlicht am Ende des Frühlings überholt die Vögel beim Nisten und bewirkt eine Umkehrung ihres gewöhnlichen Brutverhaltens. Es wird nötig, die Eier eher kühl als warm zu halten. In einem heißen, stickigen Frühling in Little Antelope hatte ich Gelegenheit, öfter an dem Nest eines Feldlerchenpaares vorbeizugehen, das sich unglücklich im Schatten einer sehr dünnen Pflanze befand. Ich habe die Lerchen nie sitzend vorgefunden, außer bei Einbruch der Nacht, doch zu Mittag standen sie matt vor dem Nest, schier ohnmächtig, mit kläglich geöffneten Schnäbeln, zwischen ihrem Schatz und der Sonne. Manchmal spendeten beide gemeinsam mit ausgebreiteten und halb erhobenen Schwingen ein kleines Fleckchen Schatten, bei einer Temperatur, die mich schließlich dazu brachte, ihnen aus Mitgefühl ein Stück Leinwand als dauerhaften Schutz aufzuspannen. In jenem Landstrich gab es einen Zaun, der eine Viehweide umschloss, und entlang seiner auf fünfzehn Meilen Länge eingeschlagenen Pfähle konnte man sicher sein, in jedem Schattenstreifen ein oder zwei Vögel zu finden; manchmal Spatz neben Falke, mit hängenden Flügeln und offenen Schnäbeln, matt in der weißen Waffenruhe des Mittags.
Auch wenn man anfangs geneigt ist, sich zu wundern, wie es kommt, dass das einsamste Land, das Gott je erschaffen hat, so viele Bewohner zählt, was sie hier machen und warum sie bleiben, wundert man sich nicht mehr so sehr, nachdem man hier gelebt hat. Kein anderes als dieses weite braune Land zieht einen so sehr in Bann. Die Regenbogenberge, die zarten bläulichen Nebel, die leuchtende Strahlkraft des Frühlings haben den Zauber des Lotos. Sie spielen dem Zeitgefühl Streiche, sodass ein Siedler, der immerzu plant fortzuziehen, gar nicht merkt, dass er geblieben ist. Menschen, die hier gelebt haben, Bergleute und Viehzüchter, werden Ihnen dasselbe sagen, nicht so eloquent, aber nachdrücklich; sie verfluchen das Land und kommen zurück. Zum einen gibt es hier die herrlichste, sauberste Luft auf Gottes Erden. Irgendwann wird die Welt das begreifen, und die kleinen Oasen auf den windigen Berggipfeln werden ihren kränklichen, unter Fernweh leidenden Horden eine heilsame Zuflucht bieten. Zum anderen gibt es dort das Versprechen von großen Reichtümern an Bodenschätzen und Erzen, die weniger rentabel sind, da sie so weit entfernt von Wasser und guten Arbeitsbedingungen liegen, doch die Menschen sind davon wie behext und versucht, das Unmögliche zu wagen.
Sie sollten Salty Williams erzählen hören, wie er einmal achtzehn bis zwanzig Maultiergespanne vom Boraxsumpf zur Mojave trieb, über neunzig Meilen, den Planwagen voller Wasserfässer. An heißen Tagen wurden die Maultiere vor Durst so verrückt, dass das Klappern des Wassereimers sie zu einem entsetzlichen, qualvollen Gebrüll veranlasste und sich ihre Geschirrgurte verwickelten, während Salty auf dem Kutschbock saß, die Sonne in seinen müden Augen brannte und er mit gleichmütiger Stimme beschwichtigende Flüche ausstieß, bis das Geschrei aus schierer Erschöpfung verstummte. An dieser Straße lag eine Reihe flacher Gräber; aus jeder neuen Gruppe Kulis, die man im Sommer hierherbrachte, starben ein oder zwei. Doch als er seinen Gehilfen verlor, den ohne Vorwarnung in der Mittagspause der Schlag traf, gab Salty auf; er sagte, es sei »zu verdammt heiß«. Den Gehilfen begrub er unter Steinen, damit ihn die Kojoten nicht wieder ausbuddelten, und sieben Jahre später las ich die Inschrift auf der Tafel aus Kiefernholz, die noch wie neu und nicht verwittert war.
Doch davor, als ich mit der Mojave-Postkutsche herfuhr, traf ich Salty noch einmal; er war auf dem Weg nach Indian Wells. Sein Gesicht braun gebrannt und gerötet wie der Erntemond, blickte er vom Kutschbock durch den goldenen Staub herab auf seine achtzehn Maultiere. Das Land hatte ihn gerufen.
Das greifbare Gefühl des Geheimnisvollen in der Wüstenluft bringt Legenden hervor, meist über verlorene Schätze. Irgendwo innerhalb seiner öden Grenzen liegt, wenn man den Berichten Glauben schenkt, ein mit Goldklumpen übersäter Berg; ein von jungfräulichen Silberadern durchzogener; ein altes, lehmiges Flussbett, wo Indianer Erde aushoben, um Kochtöpfe zu fertigen, und beim Töpfern Unmengen an Körnchen reinen Goldes einarbeiteten. Alte Bergleute, die am Rand der Wüste umherwandern, verwittert wie die gelbbraunen Berge selbst, können Ihnen solche Geschichten überzeugend erzählen. Nach einem kurzen Aufenthalt in diesem Land werden Sie sie um ihretwillen glauben. Vielleicht ist es sogar besser, von der kleinen gehörnten Wüstenschlange gebissen zu werden, die sich seitwärts bewegt und zuschnappt, ohne sich zusammenzurollen, als der Legende über eine verlorene Mine zu verfallen.
Und doch – und doch – liegt es nicht vielleicht daran, dass man Erwartungen gerecht werden möchte, wenn man beim Schreiben über Verlassenheit einen tragischen Ton anschlägt? Je mehr man sich davon wünscht, desto mehr bekommt man und verliert darüber viel Erfreuliches. In dem Land, das am Fuß des Osthangs der Sierras beginnt und sich über immer niedrigere Berge Richtung Great Basin erstreckt, ist es möglich, mit großer Lust zu leben, den Kreislauf zu stärken und herrliche Freuden zu genießen und bei seinen täglichen Verrichtungen ein Gebiet zu durchqueren, das einem Küstenstaat am Atlantik gleichkommt, und dies völlig gefahrlos und, für unsere Verhältnisse, ohne besondere Schwierigkeiten. Wie auch immer, es waren keine Menschen, die nur in die Wüste gingen, um darüber zu schreiben, die den sagenhaften Hassayampa River4 erfunden haben, dessen Wasser, einmal getrunken, die Fähigkeit verleiht, Fakten nicht nur als nackte Fakten zu betrachten, sondern als etwas, das in allen Farben der Märchen strahlt. Ich, die ich auf meinen zwei mal sieben Jahre dauernden Wanderungen davon getrunken haben muss, bin mir sicher, dass es sich lohnt.
Denn für jeden Tribut, den die Wüste von einem Menschen einfordert, gibt es Entschädigung, tiefen Atem, tiefen Schlaf und die Gesellschaft der Sterne. In den Ruhepausen der Nacht wird einem mit Nachdruck wieder bewusst, dass die Chaldäer5 ein Wüstenvolk waren. Es ist schwer, sich dem Gefühl der Überlegenheit zu entziehen, wenn die Sterne an einem weiten, klaren Himmel unverdeckt auf- und untergehen. Sie sehen groß und nah und pulsierend aus; als bewegten sie sich in Erfüllung eines erhabenen Dienstes, der keine Erklärung erfordert. Indem sie zu ihren Plätzen am Firmament aufsteigen, bilden sie das gleichgültige Gitterwerk für die armselige Erde. Wer dort liegt und es betrachtet, ist ihm so gleichgültig wie der magere Kojote, der etwas entfernt von Ihnen im Gestrüpp steht und heult und heult.
Die Wasserwege des Ceriso
Am Ende der trockenen Jahreszeit sind die Wasserwege des Ceriso zu einem weißen Band im flach liegenden Gras geschrumpft, erstrecken sich blass und fächerförmig bis zu den Heimstätten der Taschenratten und Erdmännchen und Eichhörnchen. Doch so blass sie für ein menschliches Auge auch sein mögen, für das pelzige und gefiederte Volk, das an ihnen entlangwandert, sind sie ausreichend erkennbar. Auf Augenhöhe einer Ratte oder eines Eichhörnchens erkennt man, was für uns ebenso gut breite und gewundene Straßen sein könnten, würden sie durch dichte Plantagen führen, deren Bäume dreimal so hoch sind wie ein Mensch. Es braucht nichts als ein schmales Band aus kahlem Boden, um einen Mäusepfad im Wald der Gräser zu schaffen. Dem kleinen Volk sind Wasserläufe wie Landstraßen und Gerüche wie Wegweiser.
Offenbar ist Menschengröße die ungeeignetste aller Größen, um Wege zu untersuchen. Besser man steigt den Hang eines hohen Berges hinauf, den Vorsprung des Black Mountain etwa, blickt zurück und hinab über die Vertiefung des Ceriso. Seltsam, wie lange der Boden den Abdruck beständigen Tretens behält, selbst nachdem Gras darüber gewachsen ist. Vor zwanzig Jahren schuf ein kurzer Aufschwung des Bergbaus am Black Mountain einen Kutschenpfad über den Ceriso, doch die parallelen Linien der Radspuren erkennt man aus der Höhe dunkel und deutlich. Zu Fuß im Ceriso sucht man vergeblich nach irgendeiner Spur davon. So sind alle Wege, welche die wilden Tiere nutzen, um zur Lone-Tree-Quelle hinabzusteigen, aus dieser Höhe, die der Höhe der Falken entspricht, als weiße Linien zu sehen.
Zu den besten Zeiten führt der Ceriso wenig Wasser, und das wenige ist brackig und riecht übel, doch an einem einsamen Wacholderstrauch, wo der Rand des Ceriso zu tieferem Land abzweigt, findet man ein ständiges Rinnsal frischen Süßwassers inmitten von üppigem Gras und Wasserkresse. In der Trockenzeit muss man einen Tag wandern, bis man auf Wasser stößt. Östlich des Fußes des Black Mountain und auch nördlich und südlich davon sind zahllose Höhlen von Nagetieren wie Ratten und Eichhörnchen. Unter dem Salbei sieht man die flachen Kaninchenbauten, und an den trockenen Ufern des Schwemmlandes sowie zwischen den verstreuten Brocken aus schwarzem Gestein liegen die Verstecke von Luchs, Fuchs und Kojote.
Der Kojote ist unser eigentlicher Wasserhexer, der beim kleinsten Fleck feuchter Erde so lange schnüffelt und buddelt, bis er das unsichtbare Wasser aus dem Boden befreit hat. Viele Wasserlöcher sind nicht mehr als das, aufgespürt von dem schlanken Streuner der Berge, an Orten, wo nicht einmal ein Indianer danach suchen würde.
Viele kluge und eifrige Leute sind der Meinung, dass das Bergvolk die zehn Monate zwischen Ende und Anfang der Winterregenzeit ohne Wasser auskommt; doch ein echter Faulenzer, der Tage und Nächte an den Wasserwegen verbringt, würde das nicht unterschreiben. Wie gesagt, die Wege beginnen weit hinten am Ceriso, undeutlich, und münden als breite, weiße, festgetretene Pfade im Abfluss der Quelle. Und warum sollte es Wege geben, wenn niemand in diese Richtung wandert?