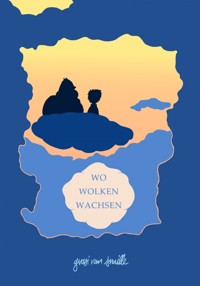
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Könntest du widerstehen, wenn du eine Wolke sehen würdest, die so dicht über den Feldern schwebt, dass du glaubst, sie anfassen zu können, wenn du nur den Arm nach ihr ausstreckst? Toni kann das nicht und landet prompt in einer Welt fernab seiner Heimat. Dort trifft er auf die merkwürdigen Bewohner der Wolkenwelt – allen voran auf Primo, der schnell zu Tonis bestem Freund wird. Er findet die Antwort auf die Frage, warum Gorillas Schneckenhäuser tragen und warum das Zippelmobil Zippelmobil heißt. Er hört Geschichten über Geschichten, während seine eigene mit jedem Schritt in der fremden Welt abenteuerlicher wird. Er erlebt, wie die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Wolkenwelt deren Existenz in Gefahr bringt, und dass nicht alle Bewohner gutes im Sinn haben. Wo Wolken wachsen ist eine Geschichte für Leserinnen und Leser ab neun Jahren über Freundschaft und Zusammenhalt, über die Überwindung von Gegensätzen und darüber, wie wichtig es ist, die Schönheit der Welt, hier wie dort, zu bewahren. Und natürlich über Spaghetti-Eis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es war einmal einer dieser Tage, an denen die Wolken so dicht über dem Erdboden zu schweben scheinen, dass man glaubt, sie anfassen zu können.
Und an genau diesem Tag konnte es ein neunjähriger Junge kaum noch erwarten, sich endlich vom Rücksitz des Autos zu befreien, in dem er nun schon viel zu lange festsaß. Die Ursache dieses bedauernswerten Zustands war die Entscheidung seiner Mutter gewesen, den kompletten Samstagvor- und Nachmittag mit Einkäufen für den siebzigsten Geburtstag seiner Großmutter zu verbringen. Dass er deswegen schon um acht Uhr morgens hatte aufstehen müssen, war ein Grund für seine schlechte Laune; das unfreiwillige Anprobieren von Hosen und Hemden für die große Feier war ein weiterer. Und da die offen zur Schau getragene Abneigung gegenüber all diesen Dingen von seiner Mutter geflissentlich ignoriert worden war, sah er nun keine Notwendigkeit, seine schlechte Laune vor ihr zu verbergen.
Nicht, dass er es auf die typisch quengelige Art und Weise tat, die Neunjährigen hin und wieder zu eigen ist. Er hatte stattdessen beschlossen, sein Unbehagen über den misslichen Tag schweigend und in Form eines gequälten Gesichtsausdrucks kundzutun. Dieser Ausdruck blieb auch seiner Mutter nicht verborgen, die, obwohl sie sich auf die Straße konzentrierte, nicht umhin kam, sein missmutiges Gesicht im Rückspiegel zu registrieren.
»Komm schon Toni, jetzt mach nicht so ein gequältes Gesicht. So schlimm war es nun wirklich nicht. Und außerdem hast du jetzt einen schicken neuen Anzug.«
Tonis Meinung über den Anzug war hingegen eine etwas andere.
»Schrecklich ist das Ding«, grummelte er seiner Mutter zurück, und der Ton seiner Antwort gab ihr zu verstehen, dass sie seine durch die Suche nach diesem schrecklichen Kleidungsstück verursachte Laune noch den Rest des Tages zu ertragen hatte. Quasi als Strafe für die erlittene Qual, durch alle möglichen Geschäfte geschleift zu werden, nur um im Letzten einen Anzug zu finden, der genauso schrecklich wie all die anderen war, die er zuvor hatte anprobieren müssen. Um diese Absicht zu unterstreichen, blickte Toni noch gelangweilter, als er es ohnehin schon war, in Richtung der Felder, die gerade an ihnen vorbeizogen.
Es war gerade Herbst. Eigentlich mochte Toni diese Jahreszeit. Er liebte es, mit seinem Fahrrad durch die Felder zu rasen und die heruntergefallenen Blätter aufzuwirbeln, die die Feldwege wie bunte Flicken bedeckten. Oder sich, wenn der Wind besonders stark blies, den Böen entgegenzulehnen. Am allermeisten liebte es Toni jedoch, wenn er auf seinem Bett sitzen und den prasselnden Regen von seinem Fenster im sechsten Stock aus beobachten konnte – am besten mit einer heißen Tasse Kakao in den Händen.
Wenn er so da saß – oft stundenlang – und der Regen, dicht wie ein Vorhang, alles zu umschließen schien, träumte er von Abenteuern in Welten, die nur er kannte, und in denen alles anders war, als in der oft so langweiligen Welt um ihn herum. Erwachte er schließlich aus diesen Tagträumen, war er oftmals enttäuscht, weil alles, was er dort erlebt hatte, offensichtlich nur in seiner Vorstellung existierte – so echt es sich auch manchmal anfühlte.
An diesem Samstag war es jedoch nicht besonders regnerisch und es wehte nur ein leichter Wind. Der Himmel hatte sich in ein blasses Blau gehüllt und hing voller Wolken; keine dunklen Regenwolken, sondern freundliche, gemütlich dahintreibende Wolken, die sich von Zeit zu Zeit zu kleinen Wolkenhügeln, hier und da sogar zu kleinen Wolkengebirgen zusammenschlossen, und die keinen Zweifel daran ließen, dass ihnen das hektische Treiben unter ihnen vollkommen egal war. In Gedanken vertieft, blickte Toni durch die Scheibe des Autofensters und seine schlechte Laune verflog langsam aber sicher wie die behäbig vorüberziehenden Wolken über ihm. Ihre Trägheit wirkte geradezu ansteckend und Toni entfuhr ein Gähnen.
Gleich würde er in seinem Zimmer sein und könnte endlich wieder …
Plötzlich stockte ihm der Atem. Er hatte etwas entdeckt, das seinen Blick magisch auf sich zog, ja regelrecht fesselte. Es war einer dieser Momente, in denen alles, aber auch alles um einen herum zu verschwimmen scheint, weil man einzig und allein Augen für eine ganz bestimmte Sache hat. In Tonis Fall war dies eine Wolke. Eine Wolke, die wie aus dem Nichts in seinem Blickfeld erschienen war. Mit dem Rahmen seiner Brille stieß er an die Autoscheibe, als er seine Stirn an deren kühle Oberfläche drückte, um seine Entdeckung besser bestaunen zu können.
Toni war sofort klar, dass diese Wolke keine normale Wolke sein konnte Keine der Wolken, die weit oben und unerreichbar am Himmel hingen. Die Wolke, die seinen Blick gefangen hielt, schwebte direkt über dem Feld, an dem sie gerade vorbeifuhren. Und sie schwebte so niedrig über dem Erdboden, dass Toni glaubte, nur aus dem Auto aussteigen zu müssen, um sie anfassen zu können. Sie sah dabei auch nicht wie die nebeligen Wolkenberge am Himmel über ihm aus, sondern eher wie ein großer Klumpen besonders weicher Knete, der allerdings so leicht und empfindlich wirkte, dass Toni befürchtete, ihn beim nächsten Windstoß aus den Augen zu verlieren. Dass er die Wolke dann tatsächlich aus den Augen verlor, lag an seiner Mutter, die auf einmal wieder energisch das Gaspedal trat, da es auch sie nach dem anstrengenden Tag nach Hause zog. So verschwand die Wolke aus seinen Augen, was jedoch nicht bedeutete, dass sie auch aus seinen Gedanken verschwunden war.
Toni war gefangen von ihrem Anblick und hatte nur einen Wunsch: so schnell wie möglich zu den Feldern zurückzukehren, um sie noch einmal sehen zu können. Er wollte unbedingt herausfinden, ob er sie tatsächlich mit bloßen Händen würde anfassen können. Und ob sie sich wie Watte anfühlte oder doch eher wie Wasserdampf. Oder gar wie Pulverschnee? Und wonach sie wohl schmeckte? Kurzum, er konnte ab diesem Moment an nichts anderes mehr denken. Er war so sehr in seine Gedanken an die Wolke vertieft, dass er nicht bemerkte, wie sie in die Straße einfuhren, in der er mit seiner Mutter wohnte. Auch bemerkte er den dicken Dennis nicht, der, als er Toni im Auto erkannte, sofort anfing gemeine Grimassen zu schneiden, indem er Tonis Brille mit seinen Fingern nachformte, und damit seinem liebsten Hobby nachging, das darin bestand, Toni das Leben schwer zu machen, wo und wann es ihm nur möglich war. Weil Toni nämlich der kleinste Junge seines Alters in der Nachbarschaft war und auch keine Geschwister hatte, die ihn hätten beschützen können, war er ein stetes Ziel von Dennis' Drang, andere Kinder zu piesacken. Wenn es nur ging, vermied Toni deshalb, Dennis und den Jungs in seinem Schlepptau über den Weg zu laufen. Blöderweise führte dies dazu, dass er oftmals alleine war.
Dieser Umstand war ihm in diesem Moment allerdings genauso egal, wie die von Dennis am laufenden Band produzierten Grimassen. Als das Auto seiner Mutter zum Stehen kam, stand sein Entschluss fest: Er musste zurück zu der Wolke. Unbedingt. Und so bald wie möglich. Er würde warten bis es Nacht geworden und seine Mutter eingeschlafen war, um dann aus der Wohnung zu schleichen und zu den Feldern mit der Wolke zurückzukehren. Er hätte natürlich auch gleich die Wohnung verlassen können, doch sah es seine Mutter nicht gerne, wenn er sich noch allzu spät draußen herumtrieb. Und mittlerweile wurde es schon recht früh dunkel. Außerdem war da ja noch Dennis, dem er unter keinen Umständen in die Arme laufen wollte. Zu versuchen, seiner Mutter die Begeisterung, die die Wolke in ihm ausgelöst hatte, zu erklären, war sinnlos – sie hätte nicht verstanden, was jemand an einer Wolke nur so atemberaubend finden konnte. Aber seine Mutter hatte die Wolke ja offensichtlich auch nicht gesehen, sonst würde sie nicht derart unberührt in die Wohnung zurückschlendern können, wie sie es gerade tat.
Er konnte auch nicht bis zum nächsten Tag warten. Seine Angst war zu groß, dass die Wolke bis dahin schon zu einen anderen Ort weitergezogen sein könnte; wenn sie es nicht schon längst getan hatte. Daran wollte Toni aber gar nicht erst denken. Den Rest des Abends gab er sich alle Mühe, seinen Plan geheim zu halten und keinen Verdacht zu erwecken. Leicht fiel ihm das nicht, denn er war so aufgeregt wie schon lange nicht mehr. Letztendlich gelang es ihm jedoch auch deshalb, weil seine Mutter mit zig anderen Dingen beschäftigt war.
Als es schließlich dunkel wurde, saß Toni wie hypnotisiert auf seinem Bett. Er hatte befürchtet, zu müde zu sein, wenn es endlich so weit war. Diese Angst erwies sich allerdings als unbegründet, da seine Aufregung nicht im Geringsten abgenommen hatte. Er lauschte angestrengt, ob aus dem Schlafzimmer seiner Mutter noch Geräusche zu vernehmen waren. Immer wieder wurde er dabei von Gedanken an die Wolke abgelenkt. Als sich dann für eine längere Zeit nichts mehr in den Räumen außerhalb seines Zimmers geregt hatte, und Toni davon ausgehen konnte, dass seine Mutter endlich eingeschlafen war, machte er sich daran, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Er stand, so leise er nur konnte, von seinem Bett auf und schlich zu dem Stuhl an seinem Schreibtisch. Die Existenz des Tischs konnte man freilich nur erahnen, da er, seit Toni ihn besaß, nicht einmal aufgeräumt worden war.
Wie in Zeitlupe zog er sich die Sachen, die er am Tag getragen hatte, über seinen Schlafanzug – er vermutete nämlich, dass es draußen mittlerweile recht kalt geworden sein musste. Immer wieder hielt er inne, um zu hören, ob sich wirklich nichts mehr in der Wohnung regte. Dann schlich er aus seinem Zimmer, wobei er bereits mehrere Minuten brauchte, um nur die Tür zu öffnen, und sie, ohne größere Geräusche zu verursachen, wieder hinter sich zu schließen. An der Wohnungstür angekommen (der Weg dorthin hatte ebenfalls einige Minuten in Anspruch genommen), machte Toni sich daran, auch diese zu öffnen. Als er sich endlich auf der anderen Seite der Tür, also im Treppenhaus, befand, stand er vor der größten Herausforderung, die sich ihm in dieser Nacht bisher gestellt hatte. Nämlich die schwere Eingangstür der Wohnung geräuschlos zuzuziehen.
Mit der Geduld und Präzision eines Uhrmachers bewegte er die Tür ins Schloss. Der erste Teil seines Plans war somit erfolgreich abgeschlossen. Von diesem Erfolg in seinem Willen gestärkt, schlich er das Treppenhaus hinab, um sich dann nahezu lautlos aus dem Gebäude zu stehlen. Den Ersatzschlüssel, den seine Mutter erfolglos unter Taschentuchpackungen, Batterien und Büroklammern in einer Dose auf dem Schuhschränkchen im Flur vor ihm versteckt hielt, steckte er in einen Spalt unterhalb des Betonpodests vor der Eingangstür des Hochhauses – seine Mutter mitten in der Nacht aus dem Bett zu klingeln, war schließlich keine besonders gute Idee. Toni war zufrieden mit sich: Wenn man nicht wusste, wo genau der Schlüssel platziert war, konnte man ihn nicht erkennen. Doch Zeit, sein Werk noch länger zu bewundern, hatte er nicht. Es galt schließlich, eine Wolke zu finden.
Als Toni den Bürgersteig erreicht hatte, beschleunigte er seinen Schritt. Er hatte sich entschieden, nicht mit dem Fahrrad zu fahren. Erstens hätte ihn die Fahrradleuchte schnell verraten. Denn welcher Erwachsene würde beim Anblick eines Neunjährigen, der mitten in der Nacht mit dem Fahrrad durch die Felder fuhr, nicht stutzig werden? Zweitens waren die Felder nicht weit von Tonis Wohngebiet entfernt. Würde er sich beeilen, hätte er die Stelle, an der er die Wolke gesehen hatte, in höchstens zwanzig Minuten erreicht.
Und wie er sich beeilte. Sobald Toni das benachbarte Hochhaus passiert hatte, ging sein Schleichen in ein Laufen über, das wiederum zu einem Rennen wurde, nachdem er die sauber aufgereihten Garagen des Viertels erreicht hatte. Teils war seine Eile verursacht durch die Vorfreude, die Wolke endlich zu erreichen, teils weil er Angst hatte, dass die Wolke sich gerade in diesen Minuten zu irgendeinem Ort davonmachte, an dem er sie niemals wiederfinden würde. Am Rande des Wohngebiets angekommen, entschied er, dass es wohl das Klügste sein würde, sich abseits der Straße zu halten, da – obwohl es mittlerweile tiefste Nacht und stockdunkel war – immer noch das eine oder andere Auto durch die Gegend fuhr.
Wäre in diesem Moment, aus welchen unwahrscheinlichen Gründen auch immer, ein zufällig des Nachts umherwandernder Spaziergänger vorbeigekommen, hätte er einen kleinen Schatten in Richtung der Baumreihe huschen sehen, die den Beginn der Felder markierte. Allerdings nur, wenn er ausgesprochen gute Augen gehabt und nicht gerade in irgendeine andere Richtung geblickt hätte. Da sich aber die wenigsten Menschen mitten in der Nacht auf Spaziergänge zwischen Landstraßen und Feldern begeben, wurde Toni von keiner Menschenseele bemerkt. Als er das erste Feld, an das sich in Richtung der großen Stadt unzählige weitere anschlossen, erreicht hatte, atmete er erleichtert auf. Während er das Feld betrat, drang das Rauschen eines in einiger Entfernung vorbeifahrenden Autos an sein Ohr.
Der Boden war trocken und fest, und Toni kam gut voran. Hin und wieder schreckten ihn Geräusche auf. Mal war es ein Käuzchen, das in der Ferne kauzige Dinge in die Nacht hinausschrie, mal ein Rascheln oder ein Knacksen aus den Sträuchern, an denen er vorbeieilte. Jedes dieser unheimlichen Geräusche veranlasste ihn, sein ohnehin schon ordentliches Tempo noch weiter zu beschleunigen. Und so war er, als er nach etwas mehr als einer Viertelstunde das Feld erreicht hatte, von dem er meinte, dass es das Richtige sein müsste, vollkommen außer Atem. Er musste sich nach dieser (für jemanden der im Sportunterricht immer als Letzter durchs Ziel lief) beachtlichen Leistung erst einmal hinsetzen. Er war so erschöpft, dass er sich direkt auf dem Boden ausbreitete und alle viere von sich streckte. So lag er da und versuchte die Luft, mit der er während seines Laufs so verschwenderisch umgegangen war, wieder zurück in seine Lungen zu befördern. Nach einiger Zeit beruhigte sich sein Atem und sein Pulsschlag verlangsamte sich. Toni richtete sich auf und klopfte sich die Erde von Pullover und Hose. Bedächtigen Schritts machte er sich daran, die Wolke aufzuspüren.
Er war sich sicher, auf dem richtigen Feld zu sein, doch konnte er die Wolke nirgends erblicken. Er lief auf und ab, und langsam aber sicher wuchs seine Befürchtung, dass er vielleicht etwas zu optimistisch an die Sache herangegangen war. Als er das Feld komplett abgelaufen hatte, machte sich Resignation in ihm breit. Er war einfach zu naiv gewesen – natürlich konnte sich die Wolke nicht mehr am selben Ort wie vor mehreren Stunden befinden. Zu allem Unglück fing er auch noch an zu frieren, denn auf der offenen Fläche der Felder war es windig. Er überlegte, ob es nicht doch vielleicht sinnvoller wäre, zurück nach Hause zu gehen – die Wahrscheinlichkeit, die Wolke tatsächlich noch aufzuspüren, erschien ihm in diesem Moment äußerst gering.
Mit einem Mal schlug seine Resignation in Trotz um, und er beschloss, notfalls alle Felder in der Umgebung abzusuchen und nicht eher zu ruhen, bis er die Wolke gefunden hatte. Er ahnte, dass er es sein Leben lang bereuen würde, wenn er jetzt nicht weitersuchte. Vielleicht war sie durch den starken Wind ja lediglich ein paar Felder weiter geweht worden. Er würde also einfach die Felder entlanglaufen und dabei den Vorsprung aufholen müssen, den die Wolke dank des Windes und seines untätigen Auf-dem-Bett-Sitzens gewonnen hatte.
Als er das fünfte oder sechste Feld erreicht hatte, stoppte Toni. Er war sich nicht sofort sicher, aber es war ihm, als ob er etwas hoch oben in den Bäumen, die am Rand der Felder standen, gesehen hätte. Etwas, das wie ein helles, flauschiges Kissen aussah. Er schob sich die Brille zurecht und tatsächlich! Sein Herz begann zu rasen und er konnte vor lauter Aufregung kaum an sich halten. Da war sie! Die Wolke hatte sich wohl in den Ästen eines Kirschbaums verfangen. Am Baum angekommen, blieb er mit offenem Mund stehen. Noch nie hatte er etwas derart Faszinierendes gesehen. Diese Wolke war keine normale Wolke, das war nun sicher. Selbst in der Dunkelheit der Nacht konnte man erkennen, dass sie etwas ganz Besonderes war; weit mehr als eine Ansammlung von Wassertröpfchen. Und obwohl sie sich in einer Notlage zu befinden schien, war jede ihrer kaum wahrnehmbaren Bewegungen von Anmut und Eleganz erfüllt.
Vom Boden aus konnte Toni sie nicht erreichen, da sie sich weit oben in der Baumkrone verfangen hatte. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, machte er sich deshalb daran, den Baumstamm emporzuklettern. Er hatte Glück. Denn zum einen war der Baum im Vergleich zu den übrigen Bäumen nicht besonders hoch, zum anderen war er etwas windschief und hatte knorrige Auswüchse auf seinem Stamm, die es Toni ermöglichten, an ihm hinaufzukraxeln. Er erreichte einen Ast aus der Baumkrone, auf den er sich mit einem kräftigen Ruck ziehen konnte. Vorsichtig robbte er, mit dem Bauch auf dem dicken Ast liegend, weiter in Richtung der Wolke. Normalerweise war er derjenige, der sich vor solcherlei Mutproben immer drückte, doch in diesem Moment war ihm jegliche Angst fremd. Er hatte nur noch die Wolke im Sinn und hätte noch wesentlich wagemutigere Dinge getan, um sie zu erreichen.
Als er in Reichweite der Wolke gelangt war, streckte er seinen Arm nach ihr aus. Doch innerhalb von Sekundenbruchteilen hatte er ihn, wie von einer Wespe gestochen, auch schon wieder zurückgezogen.
Denn was ihm in seinen Gedanken so natürlich vorgekommen war – dass man die Wolke anfassen und befühlen konnte wie ein Wattekissen – erschreckte ihn in der Realität zutiefst. Was er da gefühlt hatte, ließ sich mit nichts vergleichen, das ihm bekannt war. Weder mit dem weichsten Kissen, auf dem er je geschlafen, noch mit der luftigsten und süßesten Zuckerwatte, die er je gekostet hatte. Diese Wolke fühlte sich einfach wundervoll an. So weich, dass er sich in sie wie in eine warme Decke einwickeln wollte. So leicht und luftig, dass er sich wünschte, auf ihr durch die Lüfte zu schweben.
Als er den ersten Schrecken überwunden hatte, versuchte er, dem wunderbaren Geschöpf noch etwas näher zu kommen, und bewegte sich auf dem Ast weiter nach vorne. Der Ast begann sich nun leicht nach unten zu biegen und Toni fing unweigerlich zu zittern an, da er befürchten musste, dass ihn der Ast nicht mehr allzu lange würde tragen können. Als er die Stelle erreicht hatte, an der es ihm möglich war, die Wolke mit beiden Händen zu packen, löste er seine Hände von dem Ast und versuchte sein Gleichgewicht zu halten, indem er seine Oberschenkel fest an die Rinde des Astes presste. Er griff entschlossen zu und konnte sich mit beiden Händen an der Wolke festhalten.
In diesem Moment ertönte ein lautes Krachen und der Ast beschloss, sich vom Rest des Baumes zu trennen. Toni klammerte sich panisch an der flauschigen Wolkenmasse fest und zog sich unter größter Anstrengung auf die Oberseite der Wolke, die ihn zu seinem Erstaunen ohne Mühe trug. Ungläubig und voller Erleichterung über seine Rettung schloss er die Augen und holte tief Luft. Er betastete die Wolke und alles andere schien in diesem Moment in weite Ferne zu rücken. Möglicherweise lag dies auch daran, dass die Wolke langsam und fast unmerklich in die Luft emporstieg. Durch das Abbrechen des Astes hatte Toni sie aus den Fängen des Baumes befreit.
Als Toni seine Augen wieder öffnete und nach unten blickte, traf es ihn wie ein Blitz. Denn obwohl sie ihm ein ungeahntes Gefühl der Sicherheit verlieh, konnte die Wolke ihn nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie im Begriff war, sich mehr und mehr von der Erdoberfläche zu entfernen. Stetig bewegte sie sich in die Höhe und machte keine Anstalten, die Flughöhe wieder zu verringern. Zu allem Unglück beschleunigte sich der Auftrieb der Wolke unaufhaltsam. Toni klammerte sich verzweifelt an ihr fest. Da er nicht wusste, wie er der Wolke Einhalt gebieten konnte, presste er seine Augen zusammen und begann, sein nächtliches Abenteuer aufs Tiefste zu bereuen.
Die Geschwindigkeit der Wolke nahm immer weiter zu und Toni wurde vom gleichen ungeliebten Gefühl erfüllt, das er noch allzu gut von seiner ersten und ganz bestimmt auch letzten Achterbahnfahrt kannte, zu der ihn seine Mutter vor gut einem Jahr überredet hatte. Ihm wurde schlecht. Alles um ihn herum schien zu verschwimmen. Die pure Angst überkam ihn und er begann, lauthals zu schreien, während die Wolke unaufhörlich beschleunigte und schließlich wie eine Rakete in die Höhe schoss.
Dann plötzlich – nach einer gefühlten Ewigkeit – stoppte die Wolke abrupt. Toni klammerte sich, immer noch zitternd vor Angst und mit fest geschlossenen Augen, an der Wolke fest. Er schaute nach unten und bemerkte plötzlich, dass er kopfüber an der Unterseite der Wolke hing. Er drehte seinen Kopf in die Richtung, die eben noch Oben gewesen war, und erblickte eine grüne Wiese unter sich. Es war taghell.
Das Eintreten all dieser absolut merkwürdigen Umstände war dann doch etwas zu viel für einen Neunjährigen, dessen bescheidener Wunsch doch eigentlich gewesen war, eine harmlos aussehende Wolke mit den bloßen Händen anfassen zu können. Als Folge der Verwirrung löste sich sein verkrampfter Griff. Toni verlor den Halt und fiel mit einem Schreckensschrei von der Wolke. Er schlug auf dem weichen Boden auf, wo er benommen liegen blieb.
Tonis Sturz wäre beinahe unbemerkt geblieben. Die Lichtung, auf der er lag, wurde im Allgemeinen nämlich so gut wie nie besucht. Zufälligerweise kam jedoch an diesem Tag, er hatte gerade die Mittagszeit erreicht, eine auf den ersten Blick etwas plumpe und für den unvorbereiteten Betrachter doch sehr merkwürdig anmutende Gestalt an genau dieser Stelle tief im Wald vorbei. Jene Gestalt hatte einen Schrei aus Richtung des Ortes vernommen, an dem sich die Wege von Toni und der Wolke so plötzlich getrennt hatten. Da sie, ähnlich wie Toni (was sie freilich noch nicht wissen konnte), über keine größeren Mengen an Mut verfügte, versuchte sie sich so leise wie nur möglich an die Lichtung heranzuschleichen. Denn ebenso wie Toni war sie äußerst neugierig, was hin und wieder dazu führte, dass sie ihre Angst einfach ignorierte.
Als sich diese Gestalt nun, zwischen Angst und Neugierde hin- und hergerissen, der Lichtung genähert hatte, ohne auch nur einen Mucks von sich zu geben (was bei der nicht gerade geringen Körperfülle als Kunststück bezeichnet werden konnte), sah sie voller Verwunderung etwas, das ihr noch nie unter die Augen gekommen war. Etwas nämlich, das ihr in gewisser Hinsicht glich: zwei Arme, zwei Beine, ein Bauch, ein Kopf. Allerdings war es wesentlich mickriger und es fehlten ihm – von dem merkwürdig wuchernden roten Unkraut auf dem Kopf einmal abgesehen – die Haare auf dem Körper. Stattdessen trug es fremdartige Kleider am Leib, die wohl den Mangel an Körperbehaarung ausgleichen sollten.
Die Gestalt in ihrem Versteck war verwirrt. War dieses Etwas gefährlich? Oder war es harmlos und einfach von einem Baum gefallen? Brauchte es nun Hilfe? Würde dieses Etwas ihn anfallen, vielleicht sogar fressen, wenn er sich daran machte, ihm zu helfen? So viele Fragen auf einmal überforderten dieses friedfertige Geschöpf, das normalerweise nicht gezwungen war, solch schwerwiegende Probleme zu lösen, sondern ein recht entspanntes Leben führte. Am Ende siegte jedoch die Hilfsbereitschaft (und ein wenig auch die Neugierde), und das Wesen verließ sein sicheres Versteck. Es näherte sich mit vorsichtigen Schritten und pochendem Herzen dem noch immer benommenen Toni.
Der kam in genau jenen Sekunden wieder zu sich. Es war ihm, als würde er aus einem tiefen Schlaf erwachen. Sein Kopf schmerzte. Er hatte die Augen noch geschlossen und alles, was er wahrnahm, kam ihm unwirklich vor. Er fühlte den weichen Boden unter sich und spürte einen milden Lufthauch. Da schoss es ihm durch den Kopf: Er konnte nicht mehr auf dem Feld liegen, auf dem er die Wolke gefunden hatte! Dort war weder der Boden so weich, noch die Luft so mild und angenehm gewesen. Dieser Gedanke erschütterte Toni zutiefst und er beschloss, seine Augen vorerst nicht zu öffnen. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als zuhause in seinem warmen Bett zu liegen, anstatt hier auf diesem fremden Boden. Und wo bitte war ›hier‹ denn überhaupt? Nicht einmal das wusste er. Natürlich war ihm klar, dass ihm das Schließen der Augen bei der Beantwortung der Frage nach seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort nicht behilflich sein konnte. Über kurz oder lang würde er sich der Realität stellen und sie öffnen müssen.
Er begann vorsichtig zu blinzeln und wurde umgehend von einigen Sonnenstrahlen geblendet. Warum war es helllichter Tag? Wie lange hatte er hier wohl schon gelegen? Vom Tageslicht der Sicht beraubt, konnte er kaum etwas erkennen. Alles schien verschwommen. Er blinzelte erneut und sein Blick schärfte sich ein wenig. Er nahm die Umrisse von etwas wahr, das sich vom Hellblau des Himmels deutlich abhob. Es war dunkel. Ein dunkler, unförmiger Klotz. Er blinzelte ein weiteres Mal. Und nun sah er in aller Klarheit, was da stand und über ihn gebeugt war. Es war ein Gorilla. Ein riesiger Gorilla. Ein riesiger Gorilla, der ihn neugierig musterte. Ein Gorilla!
In diesem Moment trafen sich die Blicke Tonis und des Gorillas. Und für diesen einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Keiner der beiden bewegte sich auch nur einen Millimeter. Als beiden bewusst wurde, dass sie vom jeweils anderen bemerkt worden waren, stießen sie lang anhaltende, grelle Schreie aus und rannten so schnell sie nur konnten.
Das Wesen, das sich als Gorilla entpuppt hatte, rannte angsterfüllt und panisch zu der Stelle am Rande der Lichtung zurück, von der aus es zu Tonis Absturzstelle geschlichen war.
Toni rannte einfach in die entgegengesetzte Richtung; nur weg von diesem riesigen, haarigen Riesenaffen. In Sekundenschnelle war er aufgesprungen und hatte sich nicht mehr nach seinem Finder umgedreht. So hatte er auch nicht bemerkt, dass dieser ebenso panisch wie er selbst geflüchtet war, und seinen Kopf nun unter einem Gegenstand versteckte, der auf den ersten Blick wie ein großer, runder Stein aussah. Toni hingegen wählte, als er die Gewissheit hatte, nicht mehr verfolgt zu werden, ebenfalls einen großen Stein als Versteck – allerdings bezog er hinter diesem Stellung und nicht darunter.
Außer Atem, dafür aber geschützt, beäugten sich die beiden so unterschiedlichen Wesen aus sicherer Entfernung und überlegten angestrengt, wie sie heil aus dieser brenzligen Situation herauskommen konnten. Weitere Sekunden vergingen, die den beiden allerdings wie Stunden vorkamen. Plötzlich ergriff der Gorilla (er wusste selbst nicht warum) das Wort und beendete mit aufgeregter Stimme die spannungsgeladene Stille.
»Gib dir keine Mühe, du bekommst mich hier nicht! Wenn ich will, kann ich ewig hier drin bleiben! Also verschwinde!«
»Du kannst sprechen?«, entgegnete Toni überrascht.
Er war verwirrt. Niemals hätte er erwartet, dass sich ein derart mächtiges Tier vor ihm fürchten würde. Noch viel weniger hätte er allerdings erwartet, von diesem auch noch angesprochen zu werden. Der Gorilla hingegen war über die merkwürdige Frage nicht weniger überrascht. Warum zum Bananenbaum sollte er nicht sprechen können? Abgesehen davon, dass er es durch seine Worte ja bereits bewiesen hatte. Viel wichtiger als die Beantwortung der merkwürdigen Frage dieses noch viel merkwürdigeren Wesens erschien ihm momentan aber die Frage, ob er sich in Gefahr befand, von diesem angegriffen zu werden.
»Du willst mir also nichts tun?«, antwortete er, ohne freilich auf Tonis Frage einzugehen (die Antwort hatte er ja bereits erbracht).
»Was?« Toni war mehr als verdutzt. »Wie sollte ich dir denn etwas antun können? Du bist mindestens … zehn Mal größer als ich – und du bist ein Gorilla!«
Das leuchtete dem Gorilla ein, auch wenn es ihm ein wenig übertrieben erschien, dass er zehn Mal so groß wie diese Gestalt hinter dem Felsbrocken sein sollte. Dreimal so groß war er vielleicht, viermal bestenfalls. Und da jene Gestalt auf ihn einen doch recht freundlichen, aber was noch viel wichtiger war, harmlosen Eindruck machte, hob er seinen Schutz etwas an, um ein klein wenig unter ihm hervorzulugen.
Auch Toni beruhigte sich und befand, dass es an der Zeit war, sich einander vorzustellen – jetzt, da beide Seiten davon überzeugt waren, von der jeweils anderen weder verspeist, noch auf eine andere Art und Weise bedroht zu werden.
»Ich bin Toni. Und du? Wie heißt du?«
»Primo. Ich bin Primo.« Primo kroch nun komplett aus seinem Versteck hervor, um vorsichtig auf Toni zuzugehen. Dieser verließ seinen schützenden Stein und tat das Gleiche. Sie trafen sich ungefähr an der Stelle, an der Toni die schmerzhafte Bekanntschaft mit dem grasgrünen Boden der Lichtung gemacht hatte, und reichten einander die Hände.
»Hallo Primo. Schön dich kennenzulernen«, antwortete ihm Toni, als seine Hand komplett in Primos riesiger Pranke verschwand. Ein Lächeln machte sich auf Primos gutmütigen Gesicht breit.
Endlich konnte Toni die Frage stellen, die ihn schon die ganze Zeit quälte. »Kannst du mir helfen? Ich weiß nämlich nicht, wo ich hier gelandet bin.«
Primo schaute ihn verdutzt an. »Na ja, du bist hier im großen Wald. Ganz in der Nähe von dem stinkenden Tümpel mit den vielen Stechmücken.« An Tonis Blick erkannte er, dass dies nicht die gewünschte Antwort war.
»Und … gibt es außer dem stinkenden Tümpel noch irgendetwas in der Nähe? Eine Stadt zum Beispiel?«
Primos Blick hellte sich auf, denn er hatte von einer Stadt außerhalb des Waldes gehört.
»Wir sollten zu meiner Familie gehen. Mein Bruder hat mir einmal von einer Stadt erzählt. Er könnte uns bestimmt sagen, wo sie ist. Nur fragen können wir ihn leider nicht, denn mein Bruder, er … er ist nicht mehr da. Vielleicht kann dir aber mein Vater helfen. Er weiß nämlich über alles Mögliche Bescheid. Vielleicht auch über diese Stadt.
Ich sage dir aber gleich, dass es keine gute Idee ist, die Bäume zu verlassen. Man sagt, dass sich finstere Gestalten da draußen herumtreiben, die unvorsichtigen Wanderern an den Pelz wollen.« Und mit flüsternder Stimme fügte er hinzu, »außerdem soll dort ein schreckliches Monster hausen!«
Ein Monster – na toll! Anscheinend war Tonis Absturz auf den Boden des Waldes erst der Anfang eines riesengroßen Schlamassels gewesen. Ein Schlamassel, den er seiner verflixten Neugierde zu verdanken hatte. Trotzdem konnte Toni nun hoffen herauszufinden, wo er denn überhaupt abgestürzt war. Er war sich sicher, dass er sich nicht mehr in der Nähe seines Zuhauses befinden konnte. Ob er sich noch auf der Erde oder gar in einer völlig fremden Welt befand, konnte er momentan beim besten Willen nicht beantworten. Vielleicht würde ihm Primos Vater ja tatsächlich weiterhelfen können. Im Moment war ihm jede noch so kleine Information willkommen.
»Na gut, lass uns losgehen. Ist es weit von hier?«
»Hm, das kommt darauf an, was du unter weit verstehst. Ich denke, einen Tag werden wir schon brauchen.«
Einen Tag? Toni verzog sein Gesicht vor Schreck. Ihm wurde nun das erste Mal bewusst, dass er das Verschwinden aus der Wohnung vor seiner Mutter nicht würde geheim halten können. Er würde einen Heidenärger bekommen, sobald er zurückgekehrt war – wenn er denn überhaupt zurückkehrte. Im Moment wusste er ja noch nicht einmal, wo er genau war. Primo bemerkte Tonis hilflosen Gesichtsausdruck und bot ihm Hilfe an.
»Wenn du nicht mehr kannst, kann ich dich ja tragen.« Er zeigte dabei auf das merkwürdige Ding, unter dem er versucht hatte, sich vor Toni zu verstecken, denn er deutete Tonis besorgten Gesichtsausdruck als Angst vor dem bevorstehenden Marsch durch den Wald. Sofort war Tonis Aufmerksamkeit auf dieses Ding gerichtet, das wie ein überdimensionales Schneckenhaus aussah. Primo zog sich dieses Häuschen wie einen Rucksack auf – es waren nämlich zwei Seile daran befestigt, die es auf Primos breiten Rücken fixierten.
»Was ist das denn eigentlich? Ein Schneckenhaus?«
»Was ist denn ein Schneckenhaus?«, fragte Primo erstaunt. »Das Ding hier habe ich aus der Wüste.«
»Aus der Wüste?«
»Am besten erzähle ich dir die Geschichte, während wir zu meiner Familie gehen. Einverstanden?«
Und so machten sich die beiden auf den Weg zu Primos Familie. Sie verließen die Lichtung und hatten schnell einen schmalen Pfad erreicht, der weiter in den Wald hineinführte. Sie folgten ihm und schlenderten in gemächlichem Tempo nebeneinander her, während Primo begann, die Geschichte der Entdeckung seines Schneckenhauses zu erzählen. Tonis Neugierde hatte seine Sorgen mittlerweile etwas verdrängt und so lauschte er gespannt Primos Worten.
»Weißt du, ich habe den Wald eigentlich noch nie wirklich verlassen. Aber ich habe mich schon oft gefragt, was da, wo er aufhört, wohl sein könnte. Ich hatte zwar schon einige Geschichten gehört – darüber, dass es da draußen noch ganz andere Gegenden gibt, in denen ganz andere Wesen als hier leben. Aber mit meinen eigenen Augen hatte ich noch nie etwas anderes als den Wald gesehen. Vor einiger Zeit habe ich mir dann vorgenommen, so lange zu laufen, bis ich das Ende des Waldes erreicht hätte.
Ich lief los. Einfach so. Ich lief und lief und lief. Fast fünf Tage lief ich ununterbrochen. Immer geradeaus. Und dann, irgendwann, begannen die Bäume anders auszusehen. Es wuchsen dort auch weniger Pflanzen als hier und die Luft war viel wärmer. Der Boden, auf dem ich lief, wurde immer weicher und bald war kein einziger Baum mehr zu sehen. Ich hatte eine riesige Wüste erreicht.
Mein Bruder hat mir einmal erzählt, dass er außerhalb des Waldes eine richtige Stadt gesehen hätte. Und einen Fluss. Und Berge. Und grüne Wiesen. Und ich, was hatte ich entdeckt? Eine Wüste! Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass sich meine Begeisterung in Grenzen hielt.« Toni nickte Primo zu, der ganz in seine Geschichte vertieft war.
»Na ja, ich war natürlich etwas enttäuscht und wollte mich schon wieder auf die Heimreise machen, als ich«, Primo holte tief Luft, um die Wichtigkeit seiner folgenden Worte zu unterstreichen, »als ich auf einmal dieses Ding hier fand. Zuerst dachte ich, es wäre ein Stein. Doch dann sah ich diese merkwürdigen kreisförmigen Linien darauf.« Primo klopfte gegen das Schneckenhaus, das auf seinem Rücken munter hin- und herwippte, während er fortfuhr.
»Es war fast komplett mit Sand bedeckt, also buddelte ich es aus. Ich wusste nicht, was es war, aber ich wusste, dass ich es mitnehmen musste. Ich schleppte es den ganzen Weg zurück zu meiner Familie. Mein Vater meinte dann, dass wilde Wesen aus der Wüste in solchen Dingern leben würden, und dass so ein Monster meines verloren haben musste. Ich habe natürlich eine Riesenangst bekommen. Denn was wäre, wenn das Monster zurückkommen würde, um sich seinen Besitz zurückzuholen? Trotzdem behielt ich es. Ich konnte mich einfach nicht davon trennen, verstehst du? Schau doch nur, wie schön es ist.« Primo streichelte das Schneckenhaus liebevoll mit seiner Pranke.
»Und vor allem ist es ein tolles Versteck«, fügte er leise, fast schon flüsternd hinzu. »Weißt du, wenn ich ganz allein hier draußen bin und es dunkel wird, habe ich manchmal ein ganz klein wenig Angst. Dann ziehe ich das Ding hier einfach über mich drüber und fühle mich gleich viel sicherer.
Mit meinem Bruder zusammen habe ich diese Seile daran befestigt. Und jetzt kann ich es überall hin mitnehmen. Einfach auf meinem Rücken. Ist das nicht großartig?«
Toni war noch verwirrter als zuvor. Nicht nur, dass er immer noch nicht wusste, wo er war. Auch die Tatsache, dass dieser Gorilla sprechen konnte wie ein Mensch, war einfach unglaublich. Und warum Primo Angst vor allen möglichen Dingen hatte, wo er doch so groß und stark war, konnte sich Toni schon gar nicht erklären. Außerdem gab es hier anscheinend nicht nur freundliche, sprechende Gorillas, sondern auch riesige Wüstenschnecken. Und ob diese auch so freundlich waren wie Primo, das wollte Toni beim besten Willen nicht herausfinden.
Während Primo seine Geschichte weiter vortrug, musste Toni immer wieder an seine Mutter denken. Wenn sie aufwachen und sein Verschwinden bemerken würde – oh Gott! Sie würde sich schreckliche Sorgen um ihn machen. Verzweifelt würde sie nach ihm suchen und dabei wahrscheinlich keinen Stein auf dem anderen lassen. Vielleicht war sie sogar bereits wach, die Nacht war schließlich vorbei, und hatte schon stundenlang nach ihm gesucht. Wahrscheinlich hatte sie bereits alle Nachbarn gefragt, ob sie Toni irgendwo gesehen hätten. Und die Polizei hatte sie vermutlich auch schon verständigt. Die Polizei! Oh je, was hatte er nur angerichtet? Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn und sein Magen zog sich zusammen.
Auch wenn ihm Primos Gesellschaft im Moment alles andere als unangenehm war, so würde er doch jetzt jede Strafe seiner Mutter über sich ergehen lassen, wenn er im Gegenzug nur wieder in seinem warmen Bett liegen könnte. Die blöde Wolke sollte ihn einfach wieder aufsammeln und zurück nach Hause bringen.
Die Wolke! Auf einmal war sie wieder in seinem Kopf; so präsent wie im Auto, als er sie das erste Mal gesehen hatte. Er musste die Wolke wiederfinden! Als er auf der Lichtung aufgewacht war, hatte sich die Wolke ja bereits aus dem Staub gemacht. Und danach war er damit beschäftigt gewesen, sich mit Primo anzufreunden. Wenn er sie wiederfinden könnte, würde er vielleicht auf demselben Weg zurückkehren können, auf dem er hierher gekommen war – wenn auch hoffentlich etwas sanfter. Während Toni so vor sich hin grübelte, beendete Primo seine Geschichte und wartete auf Tonis Reaktion. Doch Toni reagierte nicht. Er musste herausbekommen, ob Primo über die Wolke Bescheid wusste.
»Weißt du, wo ich die Wolke finden kann, die mich hierher gebracht hat?«
»Eine Wolke soll dich hergebracht haben? Wie soll das denn bitte funktionieren?« Primo musterte Toni verblüfft. »So leicht bist du auch wieder nicht. Du willst dir wohl einen Spaß mit mir erlauben, oder?«
Toni schüttelte den Kopf. »Du hast Recht. Das alles muss sich für dich wirklich verrückt anhören. Am besten erzähle ich dir jetzt meine Geschichte.«
Und so erzählte Toni Primo die Geschichte seiner Ankunft von dem Moment an, als er die verhängnisvolle Wolke zum ersten Mal erblickte, bis zu dem Augenblick, an dem er und Primo sich begegneten. Der hörte ihm gebannt zu. Diese Geschichte über eine mysteriöse Wolke aus einer noch viel mysteriöseren Welt fesselte ihn ungemein, und nach und nach begann er, Tonis Worten Glauben zu schenken.
Als Toni am Ende seine Erzählung angelangt war, hatte Primo keinen Zweifel mehr an deren Wahrheitsgehalt. Und angesichts all der spannenden Dinge, die er da zu hören bekam, war er ungeheuer aufgeregt.
Ebenso wie Toni, der so sehr in seine Geschichte vertieft und darauf bedacht war, auch ja kein Detail auszulassen, hatte Primo nicht wahrgenommen, dass es um sie herum mittlerweile zu dämmern begonnen hatte. Nach dem Ende von Tonis Erzählung hatte er noch einige Zeit geschwiegen, denn seine Gedanken waren so sehr mit dem gerade Gehörten beschäftigt, dass er keinen klaren Satz hervorbringen konnte. Und das, obwohl er Toni am liebsten zwanzig Fragen auf einmal gestellt hätte. Er öffnete gerade seinen Mund, um wenigstens seine erste Frage loszuwerden, da zuckten er und Toni verschreckt zusammen. Der Ruf einer Eule, die irgendwo in der Nähe in einem Baum saß, war der Grund hierfür.
Mit einem Mal wurde ihnen bewusst, dass es im Wald bereits dunkel geworden war. Toni merkte nun auch, wie die Müdigkeit Besitz von ihm ergriffen hatte, und konnte ein Gähnen nicht zurückhalten. Ihm schmerzten die Füße vom Marsch durch das Gewirr des Waldes und er hätte sich gerne an Ort und Stelle auf den Waldboden gelegt, um bis zum nächsten Morgen durchzuschlafen. Vielleicht würde er ja einfach aufwachen und alles, was er hier erlebt hatte, würde sich als Traum herausstellen. Doch dafür fühlte es sich einfach zu echt an.
Primo bemerkte Tonis Gähnen und obwohl er jetzt am liebsten die ganze Nacht hindurch mit seinem neuen Freund geredet hätte, bot er ihm an, einen Schlafplatz zu suchen. Sie verließen den mit allerlei Wurzeln und Gestrüpp durchzogenen Weg und ließen sich an einer mit Moos bedeckten nieder. Da es noch relativ warm war, legten sie sich, ohne sich mit irgendetwas zuzudecken, flach auf den weichen Waldboden.
Toni rollte sich zusammen und schlief sofort ein. Primo hingegen lag, seine mächtigen Arme hinter dem ebenso mächtigen Kopf verschränkt, noch wach und blickte in den sternenklaren Nachthimmel. Noch einige Stunden dachte er über all die Dinge nach, die er an diesem Tag erlebt und gehört hatte, bis auch ihn schließlich der Schlaf übermannte.
Am nächsten Morgen wurde das ungleiche Gespann von den ersten Strahlen der aufgehenden Sonne geweckt. Toni öffnete die Augen. Er fühlte sich gut, denn der tiefe Schlaf der letzten Nacht hatte seine Erschöpfung vollständig vertrieben. Die warmen Sonnenstrahlen erwärmten sein Gesicht und die frische Morgenluft umwehte seine Nase. Er setzte sich auf und atmete sie tief in sich ein. Seine Sorgen um das leere Bett in seinem Zimmer waren verflogen. Insgeheim hatte sich in ihm der Drang nach Abenteuern in dieser fremden Welt breitgemacht und er konnte es kaum erwarten, noch mehr von ihr zu entdecken. Denn was würde da noch auf ihn warten, wenn ein sprechender Gorilla mit einem gigantischen Schneckenhaus auf dem Rücken erst der Anfang war? Primo war ebenfalls erwacht und setzte sich neben ihn. Beide sagten kein Wort und genossen die majestätische Stille, die sie umgab, und die nur durch hin und wieder hörbare Stimmen und Geräusche anderer Waldbewohner unterbrochen wurde, die sich jedoch ihren Blicken entzogen.
Nachdem Toni und Primo die Eindrücke ihrer Umgebung einige Zeit auf sich hatten wirken lassen, unterbrach Primo die Stille und ergriff das Wort.
»Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Ich denke, dass wir mein Zuhause gegen Nachmittag erreichen werden. Aber nur, wenn wir jetzt nicht anfangen herumzutrödeln.«
»Du hast Recht, lass uns gehen.« Toni streckte sich und erhob sich vom Boden. »Wo ist dein Bruder denn eigentlich? Hast du noch andere Geschwister?«
Toni hatte sich immer einen großen Bruder gewünscht. Jemanden mit dem er spielen konnte, wenn alle anderen Kinder ihn ignorierten, und der ihn beschützte, wenn sie wieder anfingen, ihn zu ärgern. Doch leider hatte sein Vater ihn und seine Mutter verlassen, bevor ihm dieser Wunsch erfüllt werden konnte. An ihn hatte Toni so gut wie keine Erinnerungen. Wie auch, wenn dieser sich nie bei ihm meldete. Oft schon hatte sich Toni vorgenommen, ihn zu suchen und zu fragen, warum er denn weggegangen war. Doch bekam er aus seiner Mutter keine Information über ihn heraus, und selbst wenn, hätte er sich wahrscheinlich nicht getraut, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Denn vielleicht hatte es ja auch an ihm gelegen, dass sein Vater sie verlassen hatte. Die anderen Kinder in seinem Wohngebiet mochten ihn ja schließlich auch nicht. Als er diese Befürchtung einmal seiner Mutter gebeichtet hatte, war diese sehr wütend geworden und hatte zu weinen angefangen. Sie hatte gar nicht mehr damit aufhören wollen. Seitdem zog es Toni vor, dieses Thema nicht mehr anzusprechen und sich vorerst damit abzufinden, dass er nun mal keinen Vater hatte.
»Ich habe noch einen zweiten Bruder. Freddie. Er wohnt noch zuhause – so wie ich. Leo ist mein älterer Bruder. Und wo er gerade ist? Ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß das. Wir haben nichts mehr von ihm gehört, seitdem er den Wald verlassen hat, um da draußen irgendwelche Abenteuer zu erleben. Wenn er wüsste, wie viele Sorgen sich unsere Mutter seit diesem Tag um ihn gemacht hat.« Primos Miene hatte sich verfinstert. »Aber ich hoffe, dass es ihm gut geht, wo auch immer er gerade ist.«
Bei diesen Worten musste Toni wieder an seine Mutter denken und daran, dass sie sich gerade wahrscheinlich genauso um ihn sorgte, wie Primos Mutter um Leo. Wahrscheinlich sogar noch viel mehr, denn seine Mutter wusste ja nicht einmal, dass er ausgezogen war, um Wolken hinterherzujagen.
Bedrückt trotteten die beiden den Waldweg entlang, als Toni auf einmal durch ein lautes Knurren aus seinen Gedanken gerissen wurde. Es war Primos Magen, der unverhohlen darauf hinwies, dass er sich zu leer fühlte. Und auch Toni verspürte plötzlich einen großen, nein, einen gigantischen Hunger. Beide hatten seit ihrer Begegnung nichts gegessen. Weder Toni noch Primo war dies aufgefallen, da sie mit so vielen anderen aufregenden Dingen beschäftigt gewesen waren. Aber jetzt war es definitiv an der Zeit für ein ausgiebiges Mahl. Doch wo sollte man hier im Wald auf die Schnelle etwas Essbares herbekommen? Toni schaute Primo fragend an. Der überlegte nicht lange, bat Toni kurz an Ort und Stelle zu warten und verschwand im Dickicht des Waldes. Toni lehnte sich mit dem Rücken gegen einen Baum und faltete die Hände vor seinem Bauch.
Lange musste er nicht warten, denn Primo kam nach nur wenigen Minuten wieder zurück. Er hatte sein Schneckenhaus bis zum Rand mit ungewöhnlich aussehenden bunten Früchten gefüllt. Als er seine Beute vor Toni ablud, kullerten die Früchte in alle Richtungen über den Boden. Gierig griffen die beiden nach ihnen und bissen ungestüm in sie hinein. Ein zufriedenes Grinsen machte sich auf ihren Gesichtern breit, denn die Früchte schmeckten einfach wunderbar. Sie hatten ungefähr die Größe von Honigmelonen und waren von einer dünnen, mal gelben, mal grünlichen Schale ummantelt, die man allerdings problemlos essen konnte. Das orangefarbene Fruchtfleisch selbst war fest, saftig und süß. In der Mitte befanden sich einige mandelgroße Kerne, die von den ausgehungerten Wanderern lustvoll durch die Gegend gespuckt wurden. Toni konnte nicht genug von diesen herrlichen Waldfrüchten bekommen und aß zwei von ihnen, ohne dabei auch nur im Geringsten auf seine Manieren zu achten. Was die Menge der von Primo verzehrten Früchte angeht, so hätte man wahrscheinlich nach der fünften aufhören müssen zu zählen, da nicht wirklich ersichtlich war, wie viele er auf einmal mit seinen riesigen Pranken aufsammelte, um sie sich in den Mund zu stopfen. Es bleibt nur festzuhalten, dass außer einem großen Haufen Kerne nichts von ihnen übrig blieb.
Mit nunmehr wieder gefüllten Mägen setzten die beiden ihre Reise fort. Toni war von der Größe des Waldes beeindruckt. Noch mehr beeindruckte ihn jedoch Primos Orientierungssinn. Er wusste immer, wo sie sich gerade befanden, selbst wenn sie die meist kaum erkennbaren Wege verließen und sich durch das dichte Unterholz schlagen mussten. Hier merkte Toni bald, dass er die falsche Kleidung für ein solches Unterfangen trug (was man ihm allerdings nur schwerlich vorwerfen konnte – er hatte ja schließlich nicht damit rechnen können, dass er sich, geführt von einem Gorilla, durch ein solches Dickicht würde kämpfen müssen). Aufgrund dieses Umstandes und der Tatsache, dass seine Beine doch ein wenig kürzer als die eines Gorillas waren, fiel er immer wieder hinter Primo zurück, weshalb dieser regelmäßig kleine Pausen einlegte, damit Toni zu ihm aufschließen konnte.
Nachdem sie eine ordentliche Strecke zurückgelegt hatten, war Toni erschöpft und ausgelaugt. Zwar marschierte er tapfer weiter, doch blieb es Primo nicht verborgen, dass er sich dabei quälte. Als er wieder einmal auf ihn warten musste, schlug er Toni vor, ihn in seinem Schneckenhaus zu tragen. Dies war möglich, da sich das zum Rucksack umfunktionierte Häuschen nach oben hin öffnete. Wahrscheinlich war der ursprüngliche Bewohner durch diese Öffnung in der Lage gewesen, seinen Kopf aus dem Schneckenhaus herauszustrecken. Primo ging in die Knie, so dass Toni bequem in das Gehäuse einsteigen konnte. Toni war erstaunt, wie mühelos Primo ihn tragen konnte.
Durch diese Maßnahme beschleunigte sich das Tempo der beiden merklich und die Freunde erreichten ihr Ziel zur Mittagszeit. Das rhythmische Auf und Ab auf Primos Rücken hatte Toni eine zusätzliche Portion Schlaf beschert. Er wachte erst wieder auf, als Primo seinen Schritt verlangsamte und vor dem Haus seiner Eltern zum Stehen kam.
Primos Zuhause schien eine Mischung aus Haus und Höhle zu sein, die man in den Hang eines mit Gras bewachsenen Hügels gebaut hatte. Der Teil, der aus dem Hang hervortrat, war rund und aus Lehm oder einem ähnlichen Baumaterial gefertigt. Er war mit kleinen, kreisförmigen Fensteröffnungen versehen und ungefähr in der Mitte der Außenwand befand sich eine halbkreisförmige Holztür. Das Dach war aus schlanken, in mehreren Schichten über einander angeordneten Baumstämmen hergestellt, die man jedoch kaum erkennen konnte, da sie über und über von einer dicken Moosschicht bedeckt waren.
Vor dem Höhlenhaus war ein kleiner Garten angelegt, der von einem nicht sehr stabil wirkenden Holzzaun umschlossen wurde. Hier baute Primos Familie offensichtlich Obst und Gemüse an, denn der Garten leuchtete förmlich in den Farben der teils befremdlich, teils vertraut wirkenden Pflanzen. Aus dem Dach ragte ein schmaler Schornstein heraus, der gemütlich vor sich hin rauchte.
Toni kratzte sich verwundert am Kopf. In dieser mickrigen Behausung sollte eine ganze Gorillafamilie Platz finden? Er bezweifelte, dass Primo überhaupt durch die niedrige Tür passen würde, geschweige denn, dass er in dieser Hütte aufrecht stehen konnte.
»Du Primo, bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind?«, fragte er vorsichtig. »Oder besteht deine Familie etwa aus Zwerggorillas?«
Primo schaute ihn zuerst verwundert an, begann dann aber zu Grinsen. Das Grinsen ging in ein Kichern, das Kichern in ein lautes Lachen über.
»Stimmt. Da ist etwas, das ich vergessen hatte zu erwähnen. Weil es für mich eben nichts Besonderes ist. Also, es ist so …«
Primo kam nicht dazu seinen Satz zu beenden, da er von der erfreuten Stimme seiner Mutter unterbrochen wurde, die durch das laute Lachen auf ihn aufmerksam geworden war und nun aus dem Haus gestürmt kam, um ihren Sohn zu begrüßen.
Doch wurde Tonis Verwirrung dadurch nicht etwa aufgelöst, sondern nur noch verstärkt. Aus dem Haus kam nämlich kein weiblicher Gorilla auf sie zugeeilt, sondern eine ältere Füchsin, die ebenso wie Primo auf ihren Hinterbeinen lief. Sie trug eine Schürze, wie Toni sie von seiner Großmutter kannte. Toni schüttelte den Kopf und kniff die Augen zusammen, um seinen Blick zu schärfen. Er hatte sich nicht getäuscht: Primos Mutter war tatsächlich eine Füchsin. Als sie ihren Sohn erreicht hatte, umarmte sie ihn herzlich, indem sie sich weit nach oben streckte, während sich Primo tief nach unten beugte. Hierdurch rutschte Toni etwas aus der Schale des Schneckenhauses hervor und musste sich an Primos Rücken festhalten, um nicht herauszufallen.
Erst jetzt bemerkte ihn Primos Mutter – Primos mächtiger Kopf hatte ihn zuvor vollständig verdeckt.
»Oh, ein Besucher!«, rief sie erfreut aus. »Hast du einen neuen Freund mitgebracht? Wie heißt er denn?«
»Das ist Toni. Toni, das ist meine Mutter.«
»Hallo Toni. Sehr erfreut. Ich bin Martha. Du schaust etwas verdattert aus der Wäsche, muss ich sagen. Na ja, das würde ich wahrscheinlich auch in deiner Situation.«
Dabei lachte sie ein so freundliches und ansteckendes Lachen, dass Toni nicht anders konnte, als sie umgehend in sein Herz zu schließen. »Aber jetzt kommt doch ins Haus. Dort können wir in Ruhe erzählen. Und ihr bekommt etwas zu essen. Ihr seid doch bestimmt hungrig, oder? Ich habe gerade etwas gekocht.«
Toni und Primo strahlten, als sie dieses Angebot vernahmen, denn erneut hatte sich ihr Hunger bei ihnen gemeldet. Vielleicht hatten sie auch nur Appetit, doch spielte das keine Rolle, da in diesem Moment keiner der beiden zu einem leckeren Essen hätte nein sagen können. Toni stieg aus dem Schneckenhaus und kletterte von Primos Rücken herab. Er folgte Primo und Martha in Richtung ihrer Behausung. Mit einem Mal erschien es Toni nicht mehr merkwürdig, dass Martha Primos Mutter sein sollte – so innig war ihre Beziehung zueinander.
Als sie das Haus erreicht hatten, öffnete Martha die Eingangstür und bat Toni einzutreten. Von der Tür aus führten drei schmale, aber dafür recht hohe Treppenstufen in den Wohnbereich des Hauses hinab, wodurch der Innenraum höher war, als er von außen wirkte. So konnte auch Primo aufrecht stehen. Wie es sich für einen Gorilla gehörte, stützte er sich nun beim Laufen auf den Knöcheln seiner Hände ab. Die Haustür musste er jedoch geduckt durchschreiten, was ihm aufgrund der jahrelangen Gewohnheit allerdings nichts auszumachen schien.
Ein großer, offener Kamin, der als Feuerstelle zum Kochen genutzt wurde, bildete die Rückwand des Wohnbereichs. An der Außenwand zur Linken war eine mit Stroh ausgelegte Stelle eingerichtet, an der die Familie offenbar (es standen dort nämlich noch mehrere hölzerne Schüsseln auf dem Boden) zu speisen pflegte. Als Sitzmöbel dienten einige knorrige Baumstämme und Holzklötze, die um das ausgebreitete Stroh herum lagen. Auf der rechten Seite, unter einem der Fenster, war ein rostiger Klappstuhl aufgestellt, der aus menschlichem Besitz zu stammen schien und Toni unweigerlich an die Campingstühle aus seiner Welt erinnerte. Unmittelbar links von der Feuerstelle führte ein Durchgang zu einer Art Höhle, die in den Hügel hineingegraben war. Toni vermutete, dass sich dort die Schlafplätze der Familie befanden. Es war im Haus relativ dunkel, da das prasselnde Feuer des Kamins die einzige Lichtquelle war und die beiden runden Fensteröffnungen in der Außenwand nur wenig Tageslicht in den tiefen Raum hinein ließen.
»Herzlich Willkommen!« Martha drängte Toni in Richtung des Essplatzes. »Die anderen sind gerade im Wald Feuerholz holen. Setzt euch doch schon mal hin. Ich bringe euch das Essen.«
Toni folgte dieser Aufforderung nur zu gerne. Er und Primo ließen sich auf der strohbedeckten Stelle nieder und lehnten sich entspannt an die dort liegenden Baumstämme. Martha stand am Kamin, in dem das Feuer munter vor sich hin loderte. Über dessen Flamme war an einer Kette ein großer Topf aus Gusseisen befestigt. In dem Topf köchelte das von Martha zubereitete Mittagsmahl, das sie gleichmäßig mit einem großen Holzlöffel umrührte.
Schon bald hielten sie zwei Holzschälchen samt -löffeln in den Händen, die mit einem Eintopf, der aus verschiedenen Gemüsesorten zu bestehen schien, gefüllt waren. Dazu stellte Martha eine Holzkaraffe mit klarem Wasser auf den Boden. Toni nahm einen Schluck direkt aus der Karaffe. Ein klarer, erfrischender Geschmack erfüllte seinen Mund und er fühlte sich auf einmal hellwach und ausgeruht. Da er einen gewaltigen Durst hatte, nahm er gleich noch ein paar weitere Schlücke. Das Schälchen in seinen Händen beäugte er hingegen skeptisch und zurückhaltend. Ein großer Freund von Eintöpfen war er nämlich noch nie gewesen. Und von Gemüse jeglicher Art schon gar nicht. Da er jedoch nicht unhöflich erscheinen wollte, versuchte er einen Bissen von Marthas Kreation. Und siehe da – sie schmeckte vorzüglich. Der Eintopf hatte einen ungewohnten und kräftigen Geschmack, war im Nachgeschmack aber leicht süßlich. Er schmeckte Toni so gut, dass er sogar noch einen Nachschlag zu sich nahm. Primo hatte von vornherein keine Skepsis gegenüber dem Essen seiner Mutter gezeigt und war deshalb auch schon bei der dritten Portion angelangt, als Toni gerade seine erste Schüssel geleert hatte. Martha konnte dies nicht in Bedrängnis bringen, denn sie war mit Primos Appetit vertraut, und hatte deswegen mit einer großen Menge an Eintopf vorgesorgt.
Gerade als beide fertig waren und sich satt und zufrieden zurücklehnten, wurde die Tür geöffnet und zwei weitere Füchse traten ein. Der jüngere der beiden entdeckte den unerwarteten Gast zuerst. Er trug einen bunt gestreiften Rollkragenpullover aus Wolle über seinem Fell und eine schwarze Hornbrille auf der Nase. Toni fragte sich, woher er diese Dinge wohl haben könnte. Schon als er von Martha vor dem Haus begrüßt worden war, hatte er sich insgeheim gefragt, warum eine Füchsin, die ja ein wärmendes Fell besaß, überhaupt Kleidung benötigte.
Der ältere, Primos Vater, der Toni noch nicht bemerkt hatte, trug ein einfaches graues Hemd, das an einigen Stellen schon abgenutzt und verschlissen war. Er hatte die viel zu langen Ärmel über die Ellbogen gekrempelt, was auf die gerade verrichtete Arbeit hindeutete. Auf seiner Schnauze saß ebenfalls eine Brille – ein dünnes Drahtgestell, das fast genauso mitgenommen wirkte wie das Hemd.
»Hallihallo! Da ist ja ein Gast. Wie schön! Das hatten wir schon lange nicht mehr.« Primos Bruder begrüßte Toni und beäugte ihn neugierig. »Und mit wem haben wir es hier zu tun?«
Primos Vater, dessen Aufmerksamkeit nun auch auf Toni gerichtet war, wartete, vorerst ohne etwas zu sagen, die Antwort ab.
»Das ist mein Freund Toni. Toni, das sind mein Bruder Freddie und mein Vater.«
»Hallo Toni. Ich bin Anton. Fühl dich wie zuhause.« Primos Vater trat an Toni, der sich mittlerweile schon längst wie zuhause fühlte, heran und klopfte ihm auf die Schulter. Freddie, Anton und Toni (der genau wie sein tierischer Gastgeber auf den Namen Anton getauft war) schüttelten sich die Hände.
»Vielen Dank«, antwortete Toni erfreut. »Ist das nicht ein witziger Zufall, dass wir denselben Namen haben?«
Anton und Freddie schauten ihn verwirrt an. Auch Primo runzelte die Stirn und hakte schließlich nach. »Aber du heißt doch Toni und nicht Anton, oder?«
»Ja schon. Beides. Eigentlich heiße ich auch Anton. Aber keiner nennt mich so. Alle nennen mich Toni.«
Als er es verstanden hatte, musste Primo lachen. »Na ja, so können wir euch wenigstens auseinanderhalten.«
»Und was machst du hier bei uns? Du siehst nicht so aus, als würdest du hier aus dem Wald kommen.« Anton der Fuchs setzte sich zu Anton dem Menschen auf den Boden. Auch Freddie gesellte sich zu ihnen und machte es sich auf einem der Baumstämme gemütlich (soweit man es sich auf einem harten Baumstamm eben gemütlich machen kann). Toni wartete noch bis Martha die leeren Schalen abgeräumt und sich zu ihnen gesetzt hatte. Dann begann er, der versammelten Familie die Geschichte von ihm, der Wolke und dem Aufeinandertreffen mit Primo vorzutragen.
Er fing mit jenem Augenblick an, als er die Wolke aus dem Auto heraus zum ersten Mal gesehen hatte. Toni konnte ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler sein – wenn man ihn nur ließ und er eine überschaubare Zuhörerschaft vor sich hatte. Er gab die Ereignisse des letzten Tages absolut detailgetreu wieder, wobei ihm Primo hin und wieder zur Seite sprang, wenn er in Gefahr geriet, kleine aber natürlich absolut wichtige Einzelheiten auszulassen. Die Begeisterung seiner Zuhörer, die sich durch ihre immer tiefer hängenden Kinnladen offenbarte, trieb Toni noch mehr an und so wurde es im Wald schon wieder langsam dunkel, als er zum Ende der Geschichte kam – dem Erreichen des eigentümlichen Fuchsbaus. Trotz der Länge und Ausführlichkeit von Tonis Erzählung war bei Martha, Anton und Freddie keine Langeweile aufgekommen, denn noch nie hatten sie derart verrückte und gleichzeitig spannende Dinge gehört.
Nachdem Toni schließlich alles erzählt hatte, was es zu erzählen gab, trat Schweigen in den Raum. Primos Familie war aufgeregt und sprachlos zugleich; ausgenommen Primo selbst, der mit Tonis Geschichte ja bereits vertraut war. Und so war er es auch, der das Schweigen schließlich beendete.
»Da gibt es etwas, das ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, Toni. Warum warst du eigentlich so erstaunt, als ich mit dir gesprochen habe? Können die Gorillas bei euch nicht sprechen? Oder gibt es …«
»Erzähl uns zuerst, wie es bei euch so aussieht! Gibt es dort auch Füchse wie uns?«, unterbrach ihn Freddie aufgeregt.
»Nein! Erzähl uns zuerst noch etwas mehr über diese Wolke!«, warf wiederum Anton ein, der nicht minder aufgeregt war.
Toni fühlte sich überfordert. Er wusste nicht, wem er zuerst antworten sollte. Zum Glück sprang ihm Martha zur Seite, die sich bis jetzt zurückgehalten hatte.
»Eins nach dem anderen! Ihr verwirrt den Armen ja nur. Primo hat zuerst gefragt, also soll seine Frage auch als erste beantwortet werden.«
»Ja, ja, in Ordnung«, antworteten Freddie und Anton gleichzeitig mit beleidigter Miene.
»Also, es ist so …« Toni holte tief Luft und fuhr fort. »Es gibt Gorillas bei uns. Und auch Füchse, um Freddies Frage zu beantworten. Und die leben auch in Wäldern, so ähnlich wie ihr hier. Aber sprechen können sie nicht. Deshalb, Primo, war ich so erstaunt, als du mich angesprochen hast.«
»Aber wie …? Sind die Füchse und Gorillas bei euch etwa alle stumm?«, wollte Freddie nun wissen.
»Nein, stumm sind sie nicht. Aber … aber sie geben nur Laute von sich. Sie knurren und jaulen. Aber sie können nicht sprechen.«
»Na, dann sprechen sie ja doch miteinander. Nur eben in einer anderen Sprache«, warf Martha daraufhin ein. »Ich weiß zwar nicht, warum wir dieselbe Sprache wie du sprechen. Aber nur, weil du sie nicht verstehen kannst, bedeutet das ja nicht, dass die Füchse bei euch nicht miteinander reden.«
Das leuchtete Toni ein und auf einmal war es ihm äußerst unangenehm, dass ihm diese offensichtliche Tatsache nicht selbst aufgefallen war.
»Aber sag mal Toni, wie könnt ihr Menschen euch denn dann mit den Gorillas und Füchsen unterhalten?« Primo kratzte sich irritiert am Kopf. »Stell dir mal vor, wir hätten nicht miteinander sprechen können. Wir wären ja niemals so gute Freunde geworden.«
»Ja … das stimmt.« Tonis Gesicht lief rot an wie eine Tomate. »Die Menschen bei uns verstehen sich auch meistens nicht so gut mit den Tieren.«
»Was meinst du damit?«, hakte Primo nach. »Habt ihr Streit mit ihnen? Auch mit den Gorillas?«
»Streit würde ich es nicht nennen …« Toni druckste herum, da es ihm vor Primos Familie peinlich war, wie man in seiner Welt mit den Tieren nur allzu oft umging. »Die Menschen bei uns … sie behandeln die Tiere … nicht gut. Meistens jedenfalls. Manche jagen sie. Und sperren sie ein.«
Toni hatte seinen Blick voller Scham zu Boden gesenkt und wagte es nicht, den anderen in die Augen zu blicken. Und das, obwohl er selbst noch nie einem Tier Leid zugefügt hatte.
»Aber warum denn das? Sperrt ihr sie ein, weil sie böse Dinge tun?«, fragte Primo weiter.
»Nein. Die Tiere haben uns nichts getan. Ich … ich kann dir auch nicht sagen, warum wir das tun«, antwortete ihm Toni mit trauriger Stimme und schaute Primo in die Augen. »Ich weiß es nicht.«
»Das ist ja traurig.« Primo war sichtlich geschockt und auch seiner Familie hatte es die Sprache verschlagen. »Aber weißt du was? Ich bin mir absolut sicher, dass du so etwas niemals tun würdest. Du bist mein Freund und du bist ein guter Mensch!«














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














