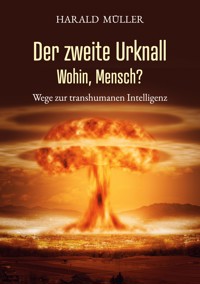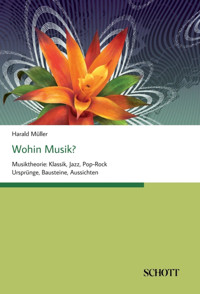
12,99 €
Mehr erfahren.
Musiktheorie und -Geschichte brauchen alle Musiker. Einige weniger, andere mehr. Hinderlich ist die Zerstückelung der Gebiete - Klassik, Jazz, Pop-Rock, Folklore - sodass manchmal der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird. Das Buch will dieses Hindernis überwinden, wenn nötig mit inhaltlich erweiterten oder auch mit neuen, immer in der Praxis verankerten Begriffen und Sichtweisen. Hunderte von Notenbeispielen veranschaulichen die Thesen. Der erste Teil, "Die Rhythmen", geht von den Grundlagen der rhythmischen Wahrnehmung aus und erläutert seine wichtigsten Bausteine in allen Musikstilen - Hemiolen, Triphasen, Polymetrie, binärer und ternärer Swing, irreguläre Unterteilungen u.a.m. Der zweite Teil, "Die Klänge", befasst sich mit den Tonhöhen, beginnend mit den einfachsten Strukturen - Rufterz, Tritonien und Tetratonien - über die Darstellung der pentatonischen Skalen, zu den tonalen, modalen, freitonalen und atonalen Skalen, Akkorden und Funktionen der Klassik, der Moderne und des Jazz und Pop-Rock. Der dritte Teil, "Wohin?" beschreibt den sozial-kulturellen Status der heute praktizierten Musikstile und bietet gedankliche Ansätze für mögliche Entwicklungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Müller – Wohin Musik?
Harald Müller
WOHIN MUSIK?
Klassik, Jazz, Pop-Rock Ursprünge, Bausteine, Aussichten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
978-3-95983-560-2 (Paperback)
978-3-95983-561-9 (Hardcover)
978-3-95983-584-8 (e-Book)
© 2018 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz
www.schott-buch.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck in jeder Form sowie die Wiedergabe durch Fernsehen, Rundfunk, Film, Bild- und Tonträger oder Benutzung für Vorträge, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags.
Umschlagmotiv: Lucia Müller und Harald Michael Müller
Printed in Germany
Inhalt
Vorwort
Erster Teil - Die Rhythmen
A.Zu den Ursprüngen des Rhythmus
A.1. Die Bausteine der ersten Ebene: Impuls und Bezugswert, der gefühlte Puls des Rhythmus
Rhythmus ist eine Form des Messens
A.2. Trainingsvorschläge – Impulse und Eieruhren
Gruppen von Impulsen
Die elektronische Eieruhr
A.3.Die Bezugswerte
B.Die zweite Ebene: Zählzeit, Takt, Metrum
B.1.Wie fügen sich die Bausteine des Rhythmus zueinander?
C.Die Taktarten
C.1.Einfache Takte
C.2. Gleichmäßig zusammengesetzte Takte
C.3. Ungleichmäßig zusammengesetzte Takte
C.4. Natürliche und künstliche Betonungen
C.5. Variable Takte, unregelmäßige Folgen von binären und ternären Zellen
C.6. Akzentäquivalente Takte. Deutsche und französische Auffassung von Zählzeit
C.7. Binäre und ternäre, »verlängerte Zählzeiten«. Messiaen und die Folklore-Rhythmen
Trainingsvorschlag
C.8. Ungleichmäßige Takte mit unterteilten Zählzeiten
D.Die Unterteilung der Notenwerte, Akzentevererbung
D.1. Reguläre Unterteilungen binärer Notenwerte
D.2. Reguläre Unterteilungen ternärer Notenwerte
D.3.Irreguläre Unterteilungen binärer und ternärer Notenwerte; deutsche und französische Orthografie
E.Akzentabhängige Elemente und Formeln
E.1.Synkopen, Pseudosynkopen
Trainingsvorschlag
E.2. Die Hemiole
E.3. Die Rolle der Pausen im Rhythmus
E.4.Contretemps
F.Dehnbare Rhythmen und Metren
F.1.Inegalité im Barock, Tonwiederholungen in der indischen Bollywood-Musik, Shuffle im Jazz, binärer und ternärer Swing, Backbeat
F.2. Barock
F.3. Bollywood
F.4.Jazz und Pop-Rock
Shuffle
Swing
Backbeat
Klassisch-romantische Interpretationen
Verspätete Anschläge der Melodiestimme
G.Doppelgleisige Rhythmen: Polymetrik
Trainingsvorschlag
G.1.Mechanismen der Polymetrie
Drei Bezugswerte gegen zwei / zwei Bezugswerte gegen drei
Triphasische Rhythmen
Swing-Triphasen
Vier Bezugswerte gegen drei / drei Bezugswerte gegen vier
H.Irreguläre Unterteilungen auf mehreren Zählzeiten
H.1.Der Algorithmus
Triole auf zwei Zählzeiten
Duole auf drei Zählzeiten
Quartole auf drei Zählzeiten
T riole auf vier Zählzeiten
Zwei Literaturbeispiele aus der Klassik
Quintole auf zwei Zählzeiten
Trainingsvorschlag
Quintole auf drei Zählzeiten
Quintole auf vier Zählzeiten
X-tolen auf Y Zählzeiten
I.Rhythmus sehen und verstehen
I.1.Visualisierung des Metrums – die Gruppierung der Notenwerte
Trainingsvorschläge
Die Arbeit mit binären rhythmischen Wörtern
Die Arbeit und das Training mit ternären rhythmischen Wörtern
Betonungseigenarten der ternären Wörter
J. Das Musikdiktat und die musikalische Intelligenz
Zweiter Teil – Die Klänge
K. Die Wurzeln
K.1. Präpentatonische Musik – die Oligochordien
Zwei Töne – die Bitonie
Drei Töne – die Tritonien
Vier Töne – die Tetratonien
K.2. Die pentatonischen Skalen
Hemitonische und anhemitonische, diatonische und chromatische Pentatoniken
Der Durchbruch zu den heptatonischen Skalen
L. Dreitausend Jahre dokumentierter Tonkunst – eine Kurzgeschichte
Heptatonik und der Tritonus – Diabolus in Musica
L.1. Das zehnte Jahrhundert n.Chr. – Die erste Revolution in der Musikgeschichte
L.2. 1600 – Die zweite Revolution in der Musikgeschichte
L.3. 1900 – Die dritte Revolution in der Musikgeschichte
M. Die Skalen
M.1. Die diatonischen Modi
Bausteine der diatonischen Modi
M.2. Wege zur Chromatik und Tonalität
M.3. Die Skalen der funktionstonalen Musik
M.4. Die chromatischen Heptatoniken
Tonale chromatische Skalen
Orient-Skalen
N. Akkorde und Funktionen
N.1. Modale und tonale Akkorde und Akkordverbindungen
Authentische und plagale Akkordverbindungen
Debussys Akkord-Quellen – die Obertöne
N.2. Strukturen und Funktionen der Akkorde
N.3. Sequenzen
Die Bausteine der Sequenzen – ein bisschen Mathematik
Kontrapunktisches Hightech: die Quintfallsequenz in doppeltem Kanon
Chromatische Sequenzen
Authentische, plagale und gemischte Sequenzen
O. Die Dissonanzen
O.1. Die Emanzipation der Dissonanz
Die Dreiklänge
Die Macht des Basstons
Dissonante Nebentöne
Die Vier- und Fünfklänge
Jazz-Dissonanzen und Blues
Die dritte Blue Note
Die Blues-Form
Die Blues-Skala
Die Akkord-Türme und das Outside-Spiel im Jazz
Die Skalentheorie
Modulation in Jazz und Pop
Freiheiten der Jazz-Orthografie
O.2. Blues-Übung
Trainingsvorschlag
P. Brücken zwischen den Strömungen: Die Dominanten
P.1. Hart verminderte Dominanten und Substitutdominanten
P.2. Der Flamenco und seine Akkorde
Q. Schritte über Grenzen
Q.1. Polymodale Musik
Q.2. Zusammenfassung: Was ist tonal, was ist modal?
Q.3. Synthetische Tonsysteme
Freitonale Strukturen
Radikal synthetisch: die Zwölftonmusik
Synthetisch non plus ultra: der Serialismus
R. Die Weltmusik und ihre Imperien
R.1. Die modale Weltkarte
R.2. Sowjetische Musik
S. 1950 – Beginn eines neuen Zeitalters
5.1. E-Musik
5.2. U-Musik
Jazz
Pop-Rock
Dritter Teil – Wohin?
Was bewegt die Musik in uns?
Wohin gehen Musik-Folklore, Volkslied und Volksmusik?
Wohin geht die E-Musik?
Wohin geht der J azz?
Wohin geht der Pop-Rock?
Was nun?
Index
Vorwort
In den letzten 120 Jahren hat sich eine enorme Vielfalt von Musikrichtungen entwickelt. Frühmoderne, Jazz, Avantgarde, Rock, Minimal Music, Disco, zeitgenössische Musik, Schlager, Free Jazz und andere mehr. All diese Richtungen verästeln sich in Unter-Richtungen und Varianten von Unter-Richtungen. Den vollen Durchblick hat wohl niemand. Stark vereinfacht gibt es die Stränge Ernste Musik (»E-Musik« – von Palestrina und früher über Mozart und Messiaen bis Ligeti, Pärt – und später) und Unterhaltungsmusik (»U-Musik« Jazz – ab ca. 1900, sowie Pop-Rock – nach ca. 1950).
Die Hörerschaft besiedelt diese Stränge zahlenmäßig unterschiedlich. In Europa stellen die Klassik-Fans vielleicht um die 5 Prozent der Musikliebhaber, woanders weniger. Jazz-Fans stellen in Nordamerika vielleicht um die 10 Prozent, woanders weniger. Pop-Rock-Fans bilden die überdeutliche Mehrheit der Musikkonsumenten, fast überall. Unbedingt zu erwähnen sind auch der Schlager, die Volksmusik und die Folklore, die naturgemäß regional verankert sind.
■ Echte Klassik-Fans schotten sich in ihrer Welt ziemlich stark ab und ignorieren oft andere Musikarten. Eventuell nehmen sie wohlwollend den Jazz wahr. Dem Pop-Rock begegnen sie bestenfalls mit Gelegenheitstoleranz.
■ Jazz-Fans sind der Klassik nicht abgeneigt, manchmal kommen sie sogar von dort. Pop-Rock ist für sie »Kommerz«. Als Profimusiker praktizieren sie den Pop oft aus finanziellen Gründen.
■ Pop-Rock-, Schlager- oder Volksmusik-Fans stellen sich keine Fragen. Sie geben sich der Musik hin, die sie glücklich macht.
■ Schwer einzuschätzen, wie viele »unechte« Fans es gibt, die in all diesen Musikarten Schönes für sich entdecken und lieben.
In den Grauzonen in und zwischen den Strängen passieren manchmal merkwürdige Dinge: Unerwartet viele Musikstudenten der E-Musik, die sich redlich und kompetent um ihren Beruf kümmern (Instrumentalspiel, dann Harmonielehre, Formenlehre, Gehörbildung etc.), kennen große Werke der Klassik nicht, weil ihre Hörerfahrungen meist auf das eigene Instrument beschränkt sind. Oft sind sie jedoch bestens über die Pop-Szene informiert, ohne sich dabei um die Satztechnik dieser Musik Gedanken zu machen.
■ Es gibt Musikliebhaber, die erkennen, dass ihnen der Zugang zur Klassik fehlt. Sie möchten in diesem Sinne etwas tun, und legen sich Konzert-Abos zu. Meist ist das nur ein Strohfeuer. Sie haben es versucht, doch das Aha-Erlebnis bleibt aus.
■ Musikkritiker rezensieren zuweilen in Zeitschriften über Konzerte, die sie nicht besucht haben; sie fragen einfach einen Bekannten, der bei der Aufführung war, was denn da so los war. Oder nicht einmal so viel: Sie saugen sich den Text der Kritik aus den Fingern. Und der Bericht wird gelesen und ernst genommen. Schwer zu glauben, aber es passiert, wenn auch selten.
■ Bei einer Aufnahmeprüfung für eine Musikhochschule mit streng geregelter Zensurenvergabe bekommt eine Violinistin von einem Prüfer die Note 1, von einem anderen die Note 4. Die Erklärungen dazu: (Note 1): »Mitreißendes Temperament«, (Note 4): »Hysterisch!«
Sehen wir das Positive daran: den außerordentlichen Facettenreichtum in der Wahrnehmung der Musik.
*
Die Musiktheorie der Klassik ist über Jahrhunderte gereift, sie ist das Rückgrat von ziemlich allem, was mit Musik zu tun hat und niedergeschrieben werden kann. Nur wenn es um das 20. Jahrhundert geht, wirkt sie manchmal unsicher und aufgesetzt, zumindest wenn sie versucht, entweder ihre bislang bewährten und fest etablierten Begriffe und Prinzipien mit der Brechstange anzuwenden, oder im Extremfall fast alles über Bord zu werfen (siehe Zwölftonmusik, Zufallsmusik), um Neues um jeden Preis durchzusetzen.
Der Kern der Jazz-Theorie ist und bleibt klassisch, aber auch mit eigenen Sichtweisen, Abwandlungen und mit neuen Begriffen.
Eine definierbare Pop-Rock Musiktheorie gibt es eigentlich nicht. Sie bedient sich der klassischen Musiklehre und einiger Jazz-Elemente. Das ist zum Teil verständlich, denn die Sprache des Pop-Rock ist meist einfacher als die der Klassik und des Jazz. Aber es ist auch bedauerlich, weil der Pop-Rock eigene, ausdrucksstarke Klangelemente hat, die im Jazz oder in der Klassik nicht oder seltener auftauchen – und die theoretisch nicht, oder nicht spezifisch beschrieben worden sind.
Um Erwartungen an eine mögliche Pop-Rock-Theorie zu bedienen, werden in diesem Buch die Bilder, die in diesem Sinne verwertbare Bausteine enthalten, mit der »Katzenpfote« ❖ markiert. Die gute Kenntnis dieser Bausteine ist noch keine Satzlehre, doch das Üben und das Betrachten der Umgebungstheorie kann dem Songwriter, dem Klassik-Musiker oder dem interessierten Hörer helfen, ein wenig Ordnung in die Fülle der Musikstile zu bringen.
Das Bild einer Zwei- oder Drei-Klassen-Musik dominiert den größten Teil des letzten Jahrhunderts, doch in den letzten Jahrzehnten hat in dieser Hinsicht ein Umdenken begonnen. Der Standort des Pop-Rock beginnt, von der Klasse der Anspruchsvollen nicht mehr als Schmuddelecke angesehen zu werden. Es vermehren sich die Lehrstätten, in denen ausdrücklich Pop-Rock unterrichtet wird.
Dieses Buch bringt einen Beitrag zu einem Grenzen überschreitenden Verständnis der Musikrichtungen. Schwerpunkt sind die Musiktechniken. Doch das allein reicht nicht. Um ihre Rolle und die möglichen Weiterentwicklungen erahnen zu können, müssen die Ursprünge und der Faktor Zeit mit einbezogen werden. Deshalb ist auch ein bisschen Musikgeschichte dabei. Und ganz viele Notenbeispiele, sonst riskieren die Wörter, sich zu inhaltsleeren Phrasen zusammenzufügen.
Auch das Soziale, in Zusammenhang mit der Informationsrevolution, muss im Blickfeld sein, sonst bleibt allzu oft eine gewisse Betriebsblindheit bestehen. Hunderttausende angehende Musiker wachsen in eine Welt hinein, deren kulturelle Gestalt sie mit offenen Augen und Ohren betrachten müssen, um ein klein wenig zu erahnen, wohin die Reise gehen könnte.
* *
Die Musikbeispiele sind oft vereinfacht, um der Aufmerksamkeit das Wesentliche zu bieten. Manchmal sind sie transponiert, um sperrige Orthografien zu vermeiden. Ziel ist es, auch Nicht-Pianisten ein unkompliziertes Hörerlebnis auf der Tastatur zu ermöglichen. Viele Beispiele sind nicht nach gedruckten Vorgaben, sondern aus dem Gedächtnis notiert oder von Tonträgern transkribiert. Abweichungen von den Partituren – insofern diese überhaupt existieren – sind unbedenklich, weil das Notenbeispiel das darstellt, was gehört wird. Schließlich ist die Musik, trotz unzähliger hochtheoretischer Abhandlungen, immer noch eine Kunst fürs Hören.
Auch aus diesem Grund ist es sehr empfehlenswert, die Tonbeispiele auf einem Tasteninstrument zu spielen und wann und wo immer möglich im Original anzuhören. YouTube ist da eine wahre Fundgrube.
Besonders detaillierte Analysen – etwa die Zerlegung unregelmäßiger Unterteilungen auf mehreren Zählzeiten, Sequenzen bei Mozart, harmonische Deutungen bei Jobim oder ähnliche Theorie-Monster können übersprungen werden – jedenfalls besser, als das Buch an die Wand zu schmeißen.
Zieladressen von Verweisen (»Bild …«) sind vornehmlich Notenbeispiele. Sind die Notenbeispiele nicht in unmittelbarer Nähe der gelesenen Stelle, lautet der Verweis »siehe Bild …« oder »siehe auch Bild …«.
Die Begriffe im Index sind nicht immer in der gleichen grammatikalischen Form wie im Text. Der Sinn eines Begriffs lässt sich so besser im Kontext darstellen, ohne den Index zu überfrachten. Ein Glossar würde den Papierkonsum unnötig steigern. Sinnvoller ist es, dem Index zu folgen, zumal neue Begriffe erscheinen, deren Definitionen nicht kurzgefasst werden können.
Der differenzierte Einsatz von Groß- oder Kleinbuchstaben und Anführungszeichen verdeutlicht, welcher musikalische Baustein gemeint ist. Zum Beispiel:
Cis-Dur, D-Moll
Cis-dur, D-moll
#C, Dm
»cis«, »d«
Die gängigen Bezeichnungen für Akkordelemente Grundton – Terz – Quint – Septime sind manchmal anfällig für Missverständnisse. Deshalb werden im Buch die Bezeichnungen Grundton – Terzton – Quintton – Septton verwendet. So weiß der Leser sofort, dass ein Akkordelement gemeint ist.
Erster Teil - Die Rhythmen