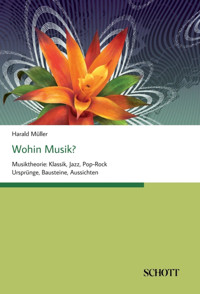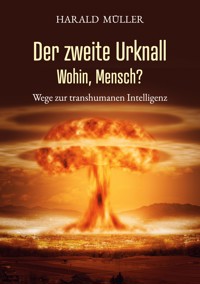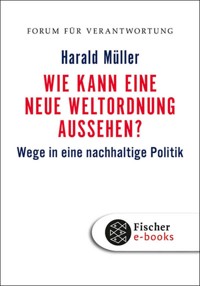Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Wirtschaftsstandort Deutschland brennt lichterloh. Die Industrie verlässt das Land in Scharen. Die einstige Nation der Innovationen, vom Buchdruck über die Chemie und den Maschinenbau bis zum Automobil, ist bei wichtigen Zukunftstechnologien wie Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz längst ins Hintertreffen geraten. Mit aufrüttelnder Klarheit benennen die Autoren die Gründe für den wirtschaftlichen Niedergang. Eine ideologisch geprägte Wirtschaftspolitik, die an der Realität vorbeigeht. Eine falsche Energiewende mit fatalen Folgen. Eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik angesichts des demographischen Wandels und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel. Eine ausufernde Bürokratie, die sich wie Mehltau über alle wirtschaftlichen Aktivitäten ausbreitet. Längst hat Deutschland einen wesentlichen Teil seiner wirtschaftspolitischen Gestaltungsfreiheit an die EU abgegeben - und die verfolgt eine toxische Agenda. Doch Harald Müller und Astrid Orthmann belassen es nicht bei der Kritik. Vielmehr zeigen sie Wege auf, wie sich Deutschland dem Niedergang entgegenstemmen und neue Kraft schöpfen kann. Auf 240 Seiten breiten sie einen wirtschaftspolitischen Plan für den dringend notwendigen Strukturwandel auf. Dabei spielt nicht nur die Politik eine maßgebliche Rolle, sondern es wird auch Punkt für Punkt aufgezeigt, welche Maßnahmen auf Seite der Unternehmen geboten sind, um eine Trendwende einzuleiten. Die beiden Autoren schreiben aus der Praxis. Harald Müller und Astrid Orthmann sind die Köpfe der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA), die seit über 25 Jahren Unternehmen beinahe jeder Firmengröße und Gewerkschaften über fast alle Branchen hinweg bei Projekten berät und begleitet. Dabei fungieren sie stets als neutrale Instanz zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Denn ein wirtschaftlich starkes Deutschland ist die Grundlage für Wohlstand, Demokratie und Zukunft für die gesamte Bevölkerung. Harald Müller und Astrid Orthmann behandeln Deutschland wie einen Sanierungsfall: Mit den richtigen Maßnahmen kann der Turnaround gelingen. Viel Zeit haben wir dafür allerdings nicht mehr: Packen wir's an!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Lebenslanges Lernen ist kein neuer Begriff, aber er war noch nie so aktuell wie in der heutigen Zeit.“
Astrid Orthmann
„Eine zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung bildet eine unentbehrliche Grundlage für Wirtschaft und Wohlstand.“
Harald Müller
„Oberste Priorität aller unserer Aktivitäten ist der Respekt und das verantwortliche Handeln gegenüber unseren Mitmenschen. Dieser Grundsatz beinhaltet Werte wie Integrität, Vertraulichkeit und Loyalität.“
Firmenphilosophie der Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA)
Inhalt
Vorwort
Professionell, zertifiziert und methodisch
Wirtschaftspolitische Linien und betriebliche Praxis
Ideologische Wirtschaftspolitik
Die Deindustrialisierung ist in vollem Gange
Subventionen sind das falsche Signal
Eine Ideologie-Politik braucht immer mehr Geld
Die deutsche Wirtschaftsstrategie ab 2024
Ganze Wirtschaftszweige wandern ab
Brückenstrompreis ist „regulatorische Irrfahrt“
Russisches Gas kommt über Drittländer
Nicht mehr beherrschbare Bürokratie
Verlagerung nach Polen, in die USA, die Schweiz
Financial Times: Auto-Unfall in Zeitlupe
Bei Schlüsseltechnologien abgehängt
Billionenmarkt Weltall: Die EU hinkt hinterher
Teure Energie mit fatalen Folgen
Energie und Wohlstand gehen Hand in Hand
Arbeitsplatzverluste im großen Stil vorhersehbar
Wunschdenken statt Realität
Primärenergie ist viel mehr als Elektrizität
Wir brauchen einen ausgewogenen Energiemix
Die Energiepolitik verfolgt die falsche Strategie
Die misslungene Energiewende
Die Wasserstoffstrategie ins Leere
Wasserstoff ist unerschöpflich aus menschlicher Sicht
Gefährlicher Hoffnungsträger
Schwierigkeiten beim Transport
Mangelnde Kapazitäten zur Wasserstoffherstellung
Politische Maßnahmen wie im Krieg
Gas ist umweltfreundlich
Die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas
Diesel ist umweltfreundlich
Streitfrage Kernkraftwerke
Organisierter Widerstand gegen die Kernkraft
Wie die EU Atomstrom grün machte
Die Sonne auf Erden
Atomkraftwerke wie am Fließband
Alle Energieprobleme der Menschheit lösen
Maßnahmen gegen Fachkräftemangel
Wir werden immer kränker
Das Damoklesschwert des demografischen Wandels
Fachkräftemangel häufig hausgemacht
Personalabteilungen ausgedünnt
Gezielte Aus- und Weiterbildung ist dringend
HR Business Partner statt Personalchefs
Bildungsinfrastrukturen für lebenslanges Lernen
Investitionen in Bildung rechnen sich
Qualifizierungsgeld: Eine gute Sache mit Bürokratie
Golden Workers
Mehr Frauen an die Arbeit
Arbeitsagentur: Vermittlung und Bildung trennen
„Azubi-BaföG“ gegen den Fachkräftemangel
Berufsausbildung hinkt hinterher
Softskills immer wichtiger
Burnout: Wenn die Belegschaft verheizt wird
Zeitdruck, Überstunden, Arbeitszeiten, Mobbing
Feierabend ist abgeschafft
Burnout in der Chefetage
Migration als Chance nutzen
Dreiklang: Bildung, Arbeit, Wohlstand
Das Bürokratiemonster lebt
Die EU-Kommission als europäische Regierung
Von der Vision zum Bürokratiemonster
EU: Weltmacht der Regulierung
Brüssel produziert Papier über Papier
CBAM betrifft weite Teile der deutschen Industrie
Hackerabwehr mit neuen Vorschriften
Der größte IT-GAU aller Zeiten – die EU ist schuld
Die Welt folgt den EU-Bürokraten… eher nicht
Der Mittelstand ist überfordert
ESG: Wir retten die Umwelt, die Menschen und alles
Keiner weiß, wie viele Gesetze es überhaupt gibt
Europa verfolgt eine toxische Agenda
Ausweg: Vereinfachung
Was die Politiker von Steve Jobs lernen können
Die Bierdeckel-Rechnung des Friedrich Merz
Die 25 Prozent-Regel des Paul Kirchhof
Bürokratieentlastungsgesetz: der kleine Wurf
Auf dem Weg zur Digikratie
Künstliche Intelligenz und die Folgen 141
Buchdruck, Elektrizität… Computer, Internet, KI
Digitale Disruption aller Orten
Alle Branchen werden betroffen sein
Viele Berufsbilder werden sich grundlegend ändern
Digitalisierung mit dramatischen Herausforderungen
Dringender Handlungsbedarf ist gegeben
Wandel der Arbeitsplatzkultur dringend notwendig
Zunehmende Flexibilisierung unerlässlich
KI und die Arbeitswelt der Zukunft
Verwüstungen auf dem Arbeitsmarkt
KI-Einzug hat eine historische Dimension
Die Roboter rücken an
Die EU begegnet der KI-Revolution – mit einem Amt
Rescaling – das Paradoxon
Autoindustrie und Chemie wandern ab
Das Menetekel mit Photovoltaik
Innovations-, Wettbewerbs- und Kostendruck
Nadelöhr ist die Ressource Mensch
Diffuse Klarheit über Künstliche Intelligenz
Politischer Plan für den Strukturwandel unerlässlich
Die Irrfahrt der Autoindustrie
Das Elend der Elektromobilität
Verheerende Öko- und Rohstoffbilanz
Stockende Batterieproduktion in Europa
Eine Milliarde Fahrzeuge verschrotten
Dieseldesaster und Klimakatastrophe
Das Ende der deutschen Dominanz beim Auto
E-Fuels sind tatsächlich eine Lösung
E-Fuels können fossile Kraftstoffe direkt ersetzen
Elektrisch fahren, herkömmlich tanken
Unboxing statt Industrie 4.0
Ideen für den Wohlstand von morgen
Zukunft Export
Gute Gründe für Optimismus
Eines der innovativsten Länder
Prof. Roslings rosige Welt
Einsicht als erster Schritt zur Besserung
Unternehmertum statt Bürokratie
Politischer Proporz behindert die Innovation
Innovationskraft der Wirtschaft nutzen
Neues Geschäftsmodell für Großprojekte
Nutzung der Atomkraft wie Eroberung des Alls
Digitalisierung, Gesundheitswesen, Satelliten
Eine Behörde gebärt eine „Gaga-Idee“
Das Wachstumsreförmchen
Deutschlands Zeit als industrielle Supermacht endet
Deutschland verliert Triple-A
Noch ist nicht alles verloren
Die Autoren
Harald Müller
Astrid Orthmann
Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA)
Diplomatic Council
Sachbücher im DC Verlag (Auszug)
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Globalisierung, Lieferengpässe, geopolitische Entwicklungen, Automatisierung, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, hohe Energiekosten, ein sich immer weiter verschärfender Fachkräftemangel… die Liste der Herausforderungen ist sehr lang, die Unternehmen und Institutionen zu einer kontinuierlichen Anpassung von Strukturen und Strategien an sich wandelnde Rahmenbedingungen zwingen. Entscheidend ist dabei der Faktor Mensch, denn jede Gestaltung von Veränderung ist auf die aktive Unterstützung der handelnden Menschen angewiesen – das gilt gleichermaßen für das Management wie für die Belegschaft.
Wir, die Autoren, haben vor mehr als 25 Jahren die Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA) gegründet, um Unternehmen zu beraten und aktiv zu unterstützen, für spezifische Situationen Lösungswege zu finden und diese gemeinsam anzugehen. Dabei liegt der Fokus auf Maßnahmen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung – denn bei allen technologischen Fortschritten oder anderen äußeren Einflüssen wie Energieknappheit stellt sich die Frage, wie ein Unternehmen damit umgeht – und dabei kommt es immer auf die „Ressource Mensch“ an.
Professionell, zertifiziert und methodisch
Die Basis für unseren professionellen, zertifizierten und methodisch vielfältigen Beratungsansatz ist der vertrauensvolle Umgang miteinander. Das Team der BWA zeichnet sich durch exzellente fachliche Qualifikationen und überdurchschnittliche Kommunikationsstärke aus – verbunden mit einem hohen Grad an Empathie. Die Fokussierung auf die individuellen Stärken des Einzelnen ist der Garant für messbaren und nachhaltigen Erfolg. Mit Hilfe der BWA haben bereits mehr als 10.000 Menschen eine neue berufliche Perspektive und hunderte von Unternehmen einen gangbaren Weg in eine gute Zukunft gefunden. In diesem Buch haben wir das in dieser Zeit aus zahlreichen Projekten gewonnene Know-how niedergeschrieben. In unzähligen Gesprächen mit Vorständen, Geschäftsführern, Personalverantwortlichen und anderen Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft und Gewerkschaft haben wir dabei immer wieder aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklung oder genauer gesagt Fehlentwicklungen diskutiert. Diese Gedanken und Analysen aus dem wirtschaftlichen Alltag haben ebenfalls Eingang in das vorliegende Werk gefunden.
Wirtschaftspolitische Linien und betriebliche Praxis
So ist ein Buch entstanden, das die großen wirtschaftspolitischen Linien und die betriebliche Praxis verbindet. Das Ergebnis ist an vielen Stellen ernüchternd. Aber nur eine ehrliche Analyse und schonungslose Benennung der Schwachpunkte kann eine Grundlage dafür sein, Fehlentwicklungen zu stoppen und die deutsche Wirtschaft und damit unser aller Wohlstand wieder in positive Sphären zu lenken. In diesem Sinne ist das vorliegende Buch als ein Kompass zu verstehen, der aus den Untiefen heraus den richtigen Weg in eine gute Zukunft weist.
Harald Müller, Astrid Orthmann
Geschäftsführer Bonner Wirtschafts-Akademie (BWA)
Ideologische Wirtschaftspolitik
Das Wachstum der Weltwirtschaft 2023: plus drei Prozent, und Deutschland: minus 0,3 Prozent – so der Internationale Währungsfonds (IWF). Manch einer mag sich an den European Song Contest im gleichen Jahr erinnert fühlen – Germany: zero Points, letzter Platz unter 22 Nationen.1
Deutschland steckt auf absehbare Zukunft in einer Rezession. Im Frühjahr 2024 korrigierten die führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland ihre Prognose drastisch nach unten. Hatten sie im Herbst des Vorjahres noch ein Wachstum von immerhin 1,3 Prozent für 2024 angenommen, so gingen sie ein halbes Jahr später nur noch von 0,1 Prozent aus.2 „Zwei verlorene Jahre“ nannte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) die Jahre 2022/23. Er fügte hinzu: „Auch wenn manche Weichen schon in der Zeit davor falsch gestellt wurden.“3
Tatsächlich hat sich die Stagnation schon lange abgezeichnet. Der Standort Deutschland leidet seit Jahren unter ökonomischer Auszehrung. In allen Rankings ist Deutschland abgerutscht. Die Steuerbelastung und die Energiepreise zählen zu den höchsten der Welt, die Arbeitskosten ebenso. Die Arbeitsproduktivität wächst kaum noch. Die Bildung befindet sich ebenso im Niedergang wie die Investitionen. Während Deutschland bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Weltraumfahrt oder Künstlicher Intelligenz weltweit kaum eine Rolle spielt, sollte die „grüne Transformation“ die Wende in der Wirtschaft bringen. Tatsächlich entpuppt sich die Energiewende als Weichenstellung in die falsche Richtung, nämlich nach unten. Dafür gibt es handfeste Gründe.
Bei den „grünen Produkten“ wie Wärmepumpen, E-Autos, Windrädern oder Solarzellen hat Deutschland überhaupt keine Führungsrolle inne. Es sind keine Innovationen made in Germany, die die Welt verändern könnten wie die Dampfmaschine oder der Verbrennungsmotor. Künstliche Intelligenz (und künftig vermutlich Quantencomputer) stellen derartige Basisinnovationen dar, aber damit hat Deutschland wenig am Hut.
Hingegen werden bei der „grünen Transformation“ funktionierende Güter, Gerätschaften, Maschinen und Infrastrukturen wie etwa Gasheizungen, Autos mit Verbrennungsmotor und Kernkraftwerke binnen kürzester Zeit für obsolet erklärt. Die dazugehörigen Wertschöpfungsketten und Arbeitsplätze gehen unwiederbringlich verloren. Bei der Energieversorgung des Landes wird darauf vertraut, dass die Sonne schon scheinen und der Wind wehen wird. Für Dunkelflauten werden notwendige, aber unproduktive Reservekapazitäten, etwa durch Gaskraftwerke, angelegt.
Am schlimmsten ist aber wohl, dass sich die Regierung anmaßt, bei technologischen Entwicklungen den Weg zu weisen. Statt mit Technologieoffenheit den Wettbewerb zu fördern, will der Staat festlegen, was technisch am besten ist. Soweit das nicht funktioniert, wird so lange mit Subventionen gesteuert, bis sich auch die unrentabelste Technik irgendwie lohnt. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, wenn von einer Ökodiktatur die Rede ist. Letztendlich muss man feststellen, dass unrealistische Zielvorgaben beim Umwelt- und Klimaschutz, CO2-Steuern und Emissionszertifikate, unsinnige technische Vorgaben und Unsicherheiten beim Einsatz neuer Technologien sowie immer weiter steigende Energiekosten eine Deindustrialisierung Deutschlands in Gang gesetzt haben, die sich weiter fortsetzt. Die Unternehmen und übrigens auch besonders fähige Arbeitskräfte wandern zusehends ins Ausland ab.
Die Preisgabe der deutschen Autoindustrie an die Konkurrenz aus den USA und China durch abenteuerlich-absurde gesetzliche Vorgaben, die Verteufelung des Verbrenners und die „Seligsprechung“ der Elektromobilität stehen exemplarisch für eine völlig verfehlte Industriepolitik. Die irrationale deutsche Energiepolitik schickt sich an, zur Schicksalsfrage unserer Nation zu werden.
Die Politik wird auf ein einziges Dogma ausgerichtet: Wir müssen die Klimaerwärmung bei 1,5 bis maximal zwei Grad Celsius begrenzen – und wenn das Deutschland gelingt, ist im Grunde die ganze Welt gerettet. Doch um Jim Skea, den Chef des Weltklimarates der Vereinten Nationen zu zitieren: „Die Welt wird nicht untergehen, wenn es um mehr als 1,5 Grad wärmer wird.“4
Die Einsicht, dass CO2 als Übeltäter reduziert werden muss, lässt sich leicht vermitteln – obgleich die Thematik deutlich vielschichtiger ist. Die radikale Strategie, den CO2-Ausstoß völlig zu verbieten, führt indes dazu, dass die deutsche Industrie ihre Weltgeltung verliert bzw. in andere Länder abwandert. Das bedeutet einen Verlust an Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen und letztendlich Wohlstand in Deutschland. Der missglückten Energiewende ist in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet, weil sie eine der wesentlichen Ursachen dafür darstellt, dass immer mehr Unternehmen Deutschland Lebewohl sagen.
Die Deindustrialisierung ist in vollem Gange
Die Deindustrialisierung Deutschlands ist in vollem Gange. Die Verunsicherung in weiten Teilen der Wirtschaft ist seit längerem derart hoch, dass Produktionsverlagerungen ins Ausland schon längst in großem Stil vorbereitet bzw. teilweise bereits durchgeführt wurden. Es geht bei vielen Unternehmen nicht mehr um die Frage ob, sondern nur noch um die Fragen wie und wie schnell.“
Tatsächlich hat unser Wohlstand schon lange zu schrumpfen begonnen, wie Studien nahelegen. Deutschland lebt bereits seit Jahren von seiner Substanz.5 Im Vergleich zu vielen anderen entwickelten Volkswirtschaften hat Deutschlands Kapitalstock in den vergangenen 20 Jahren erheblich an Qualität eingebüßt.6 Zum Kapitalstock eines Landes gehören Fabrikgebäude, Maschinen, Straßen und Schulen sowie alles, was man als geistiges Eigentum bezeichnet, also Forschung und Entwicklung, Software, Datenbanken und so weiter. Der Kapitalstock und die Arbeitskräfte bilden das Rückgrat jeder Volkswirtschaft. Je moderner der Kapitalstock, desto höher ist die Wertschöpfung je Beschäftigtem – und umgekehrt. In Deutschland wird der Kapitalstock allerdings seit vielen Jahren immer älter.
Eine Verjüngungskur ist nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. 2022 flossen aus Deutschland 121 Milliarden Euro mehr Direktinvestitionen ab als investiert wurden. Unter 46 Staaten rund um den Globus war das der stärkste Abfluss. Das fiel politisch nicht weiter auf, weil im Folgejahr, 2023, die größte Investition anstand, die je ein ausländisches Unternehmen in Deutschland getätigt hat: die Errichtung einer Halbleiterfabrik durch den US-Chipkonzern Intel in Magdeburg. Indes: Die Bundesregierung sagte zu, die Ansiedlung mit rund zehn Milliarden Euro an Subvention zu fördern – eine Rekordsumme. Die Rechnung „mit immer mehr Subventionen immer mehr Unternehmen dazu zu bewegen, sich in Deutschland anzusiedeln“ wird auf Dauer nicht aufgehen. Es war vielmehr ein besonders eklatantes Beispiel für eine dirigistische, staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik, die sich an politischen Interessen statt an marktwirtschaftlichen Mechanismen orientierte. Rechnen wir nach: Mit den zehn Milliarden Subventionsgeld plante Intel die Schaffung von 3.000 Jobs; damit kostete jeder Arbeitsplatz rund 3,3 Millionen Euro. Zudem hatte Intel offenbar einen langfristig außergewöhnlich niedrigen Strompreis ausgehandelt, um die für den Rest Deutschlands geltenden exorbitant hohen Energiekosten zu umgehen. Der Kanzler jubelte 2023 – „Mit dieser Investition schließen wir technologisch zur Weltspitze auf“ –, aber eine Weichenstellung für die Zukunft ist es nicht, internationale Konzerne auf Kosten der deutschen Steuerzahler ins Land zu locken.7 Wie sich Mitte 2024 herausstellte, hatte man mit Intel ohnehin versucht, einen Wackelkandidaten aus der Chipbranche ohne eine wirtschaftlich stabile Zukunftsvision nach Deutschland zu holen. Nach verheerenden Finanzzahlen kündigte Intel Massenentlassungen und einen massiven Sparkurs weltweit an. Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt suchte im Sommer 2024 verzweifelt nach einem „Plan B“, falls Intel das hochsubventionierte Investment absagen sollte.8
Das war politisch jedoch kaum noch von Belang, weil es zu dieser Zeit den Neubau der mit fünf Milliarden Euro ebenfalls hochsubventionierten Fertigungsstätte des taiwanesischen Chipkonzerns TSMC in Dresden zu feiern galt. Neben dem amtierenden Bundeskanzler fand sich auch die frisch gewählte alte und neue EU-Kommissionspräsidentin zum Spatenstich ein, um sogleich zu verkünden: „Aber das ist erst der Anfang. Die nächste EU-Kommission muss und wird eine Investitionskommission sein.“ Mit anderen Worten: noch mehr Steuergeld, um Konzerne aus aller Welt auf den „Alten Kontinent“ zu locken.
Wobei die fünf Milliarden Euro für TSMC zwar der Genehmigung durch die EU bedurften, aber gezahlt wurde das Geld von der Bundesrepublik Deutschland. Der Chiphersteller selbst legte übrigens lediglich 3,5 Milliarden Euro für den Bau seiner ersten Fertigungsstätte in Europa auf den Tisch, also 30 Prozent weniger als die staatliche Fördersumme. Produziert werden in Dresden im Übrigen keineswegs Chips der jüngsten Generation, sondern recht altbackene Mikrocontroller für Sensoren, Bremsen und andere Anwendungen, die insbesondere für die deutschen Automobil- und Maschinenbauer wichtig sind. 9 Immerhin sollen bei TSMC hierzulande im Laufe der Zeit rund 2.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, die, wenn man nachrechnet, mit 2,5 Millionen Euro pro Arbeitsplatz subventioniert werden. Doch obwohl die fünf Milliarden ausschließlich von Deutschland gezahlt werden, hat TSMC bereits angekündigt, Arbeitskräfte aus ganz Europa zu rekrutieren. Zudem sollen auch Ingenieure aus Taiwan eingeflogen werden.10
Doch gleichgültig, ob es um zehn Milliarden Euro für den maroden Halbleiterhersteller Intel oder „nur“ fünf Milliarden Euro für eine Altchipfabrik des Halbleiter-Überfliegers TSMC geht – die dahintersteckende Subventionspolitik ist grundlegend falsch. So monierte der Bundesrechnungshof 2024, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Leitlinien für Subventionen „(weiterhin) nicht beachtet“. Das Ministerium hatte zwischen 2019 und 2023 rund 23 Milliarden an „Stütze für die Wirtschaft“ ausgekehrt. Die Subventionen müssten auf „das unbedingt Notwendige“ zurückgeführt werden, mahnte der Bundesrechnungshof.11
Subventionen sind das falsche Signal
Das Konzept, Industriekonzernen nicht nur mit Milliardeninvestitionen unter die Arme zu greifen, sondern auch mit billigem Strom, dem sogenannten „Industriestrom“ auszuhelfen, ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen des wirtschaftlichen Unverstands. So erteilte der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums im Sommer 2023 der Idee eines staatlich subventionierten Industriestrompreises eine klare Absage: „In Zeiten knapper Finanzen und angesichts des notwendigen Kraftakts bei der Ausweitung der erneuerbaren Energien raten wir von der Einführung eines Industriestromtarifs ab.“ Bei einem künstlich nach unten gedrückten Strompreis für die Industrie drohten notwendige, strukturelle Anpassungsprozesse zu unterbleiben, kritisierte das Gremium.
Das war eine höfliche Umschreibung für ein verheerendes Szenario: Die privaten Haushalte und der Mittelstand zahlen mit hohen Energiekosten den Billigstrom für die großen Industriekonzerne. Die mittelständische Wirtschaft wäre also gezwungen, ihre großindustrielle Konkurrenz zu subventionieren. Das käme einem Generalangriff auf das Herz der deutschen Wirtschaft, dem Mittelstand, gleich. Es widerstrebt zudem jedwedem Gerechtigkeitsempfinden, wenn private Haushalte Strom zu hohen Kosten abnehmen müssen, während die Konzernwelt vom Billigstrom profitieren soll.
Eine Ideologie-Politik braucht immer mehr Geld
Subventionen für die Ansiedlung und die Energieversorgung von industriellen Großunternehmen sind vielmehr ein Signal dafür, dass Deutschland im Standortvergleich gegenüber anderen Staaten im Nachteil ist. Tatsächlich belegt die deutsche Industrie unter 36 OECD-Ländern nur Rang 20 bei der Produktivitätsentwicklung der vergangenen 15 Jahre. Vor allem hat Deutschland ein Kostenproblem. Die sehr hohen Energiepreise schrecken Investoren genauso ab wie die hohen Unternehmenssteuern. Gleichzeitig steigen die Lohnnebenkosten immer stärker und liegen inzwischen über der 40-Prozent-Schwelle. Eine Regierung, die scheinbar ideologisiert handelt, braucht eben immer mehr Geld, um die Folgen ihrer fehlgeleiteten Politik zu verdecken.
Um diesen ideologischen Irrweg zu verstehen, lohnt sich ein Blick in das Buch Das Kapital des Staates der italienisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato vom University College London, der „Hausökonomin“ des seit Dezember 2021 amtierenden ersten grünen Wirtschaftsministers Deutschlands, Robert Habeck.12 Er nennt sie „eine von sieben Frauen, die sein Leben verändert“ hätten. Getroffen hat er sie zum ersten Mal beim Weltwirtschaftsforum in Davos – noch bevor er Wirtschaftsminister wurde –, und war tief beeindruckt: „Ich hatte mich zuvor intensiv mit ihren Schriften beschäftigt und sie gehören zu den besten. Im direkten Gespräch war die Frau eine Macht, eine Autorität, die sie lachend, fragend und mit einer lockeren Selbstverständlichkeit herstellte.“ Seitdem muss Mariana Mazzucato als eine Art Kronzeugin für die Ideologie der Wirtschaftspolitik Deutschlands herhalten. Und die lässt sich wie folgt zusammenfassen:13
Der Staat ist der Pionier, der vorangeht; er schafft und gestaltet die Märkte. Um die grüne Revolution zu starten und gegen den Klimawandel anzugehen, brauchen wir einen aktiven Staat. Das staatliche Handeln soll den Mut der Unternehmen verstärken. Denn die Industrie wird sich durch das freie Spiel der Marktkräfte nicht entwickeln, weil Märkte Nachhaltigkeit nicht belohnen.
Wer so denkt, verkennt völlig den Kern des Unternehmertums, der von Gestaltungswillen, Risikofreude und Innovationskraft gekennzeichnet ist. Hingegen verortet die Denkschule Mazzucatos diese Eigenschaften in erster Linie beim Staat – und unterliegt damit einem fundamentalen Irrtum. Der deutsche Staatsapparat ist keineswegs ein Innovationstreiber, sondern ganz im Gegenteil ein bemerkenswert langsamer Nachzügler. Der nach wie vor geringe Digitalisierungsgrad der staatlichen Administration steht exemplarisch für die Behäbigkeit des Staates.14 Ein einziges Beispiel aus einer beinahe unendlich langen Liste des staatlichen Nachzüglertums: Die Bundestagsverwaltung beschloss im November 2023 die Abschaffung aller Faxgeräte bis Juni 2024.15 Kein Witz, sondern Realität in Deutschland. Eine Lachnummer, ausgerechnet diesem Staat Gestaltungswillen und Innovationskraft zuzuschreiben. Und weil das mit dem staatlichen Voranschreiten nicht funktioniert, hat die Politik den Weg der Verbote gefunden – denn die kann der Gesetzgeber sozusagen qua Amtes durchsetzen. Der staatliche Dirigismus versucht die Bürger und die Wirtschaft entlang der grünen Wir-müssendas-Klima-und-damit-die-Menschheit-retten-Ideologie durch immer mehr Verbote auf den vermeintlich „richtigen Weg“ zu bringen. Doch man muss sich nur die dem staatlichen Einfluss unterliegenden „Organisationen“ von der Bundeswehr bis zur Bundesbahn ansehen, um zu verstehen, dass der Staat keineswegs ein besonders guter Gestalter ist – ganz im Gegenteil. Nun können weder Bundeswehr noch Bundesbahn Deutschland den Rücken kehren – die Wirtschaft aber schon.
Inzwischen verlassen so viele deutsche Firmen aus Kostengründen den Heimatmarkt wie seit 15 Jahren nicht mehr, zeigte eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer aus dem Jahr 2023.16 Der Fachkräftemangel, eine überbordende Bürokratie und eine hohe Inflation gesellen sich zu den ausufernden Energiekosten, so dass am Ende ein „Quartett der Negativfaktoren“ für den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands sorgen könnte – wenn wir nicht gegensteuern.
Die deutsche Wirtschaftsstrategie ab 2024
Im Herbst 2023 stellte der amtierende Wirtschaftsminister die langerwartete Wirtschaftsstrategie für die Zukunft vor, also für 2024 und die Folgejahre. Tenor des rund 60-seitigen Strategiepapiers: „Wir wollen Deutschland als starken Industriestandort in seiner ganzer Vielfalt erhalten.“ Die Liste der dazu vorgesehenen Maßnahmen war lang: Schnellerer Ausbau erneuerbarer Energien, Bürokratieabbau, Abhilfe beim Fachkräftemangel durch leichtere Zuwanderung und längere Lebensarbeitszeit, Brückenstrompreis für energieintensive Branchen und die dauerhafte Etablierung von Förderprogrammen für die Industrie. Ebenso umfassend las sich die Liste, was alles in Deutschland erhalten bleiben soll. Kurz gesagt: nahezu alles – „vom Weltkonzern über die mittelständischen Hidden Champions bis zum Kleinbetrieb. Von der energieintensiven Grundstoffindustrie über den Maschinen- und Fahrzeugbau bis zur Raumfahrt.“
Das klang auf den ersten Blick gut, doch tatsächlich war es das (absehbare) Fundament einer staatlich regulierten Wirtschaft entlang folgender Maxime:
Wir geben den Kurs der Wirtschaft vor. Mit Steuermitteln sorgen wir dafür, dass die Wirtschaft dem von der Regierung gewünschten Kurs folgt. Das kostet, was es kostet. Wenn das Land dazu höhere Schulden machen muss, dann ist das eben so.
Immerhin: Es war ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland. Es wurde deutlich, dass bei allen Träumen von der Beinahe-über-Nacht-Umstellung auf regenerative Energieträger ökonomische Überlegungen auch künftig eine wesentliche Rolle spielen.
Allerdings regte die Bundesregierung zeitlich mit ihrer neuen Wirtschaftsstrategie auch eine „Reform der Schuldenbremse“ an. Mit anderen Worten: Das neue Wohlstandsprogramm soll mit einer weiteren Staatsverschuldung erkauft werden. Um das in Zahlen zu fassen: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen Ende 2022 mit rund 2.368 Milliarden Euro verschuldet – über 47 Milliarden Euro mehr als noch im Vorjahr. 20 Jahre zuvor, 2002, lag die Staatsverschuldung „nur“ bei 1.277 Milliarden Euro, also fast halb so wenig wie 2022.17 Dennoch stiegen die deutschen Staatschulden 2023 nochmals weiter an auf knapp 2.500 Milliarden Euro. Der Bund der Steuerzahler verdeutlicht diese Zahl wie folgt:18
Zur Veranschaulichung dieser Zahl dient folgendes Gedankenspiel: Ab sofort werden keine Schulden mehr aufgenommen und die öffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, neben allen anderen Ausgaben jeden Monat eine Milliarde Euro an Schulden zu tilgen. Mit dieser Verpflichtung würde es bis ins Jahr 2232 dauern, um den Schuldenberg der Bundesrepublik Deutschland vollständig abzutragen.
So anschaulich dieses Szenario, das mehr als 200 Jahre in die Zukunft reicht, sein mag, so wenig realistisch ist es. Wer kann sich schon ernsthaft vorstellen, dass Deutschland keine neuen Schulden mehr aufnimmt und jeden Monat auch noch eine Milliarde Euro an Schulden tilgt?
Ganze Wirtschaftszweige wandern ab
Nach Erkenntnissen der Bonner Wirtschafts-Akademie wandern ganze Wirtschaftszweige ins Ausland ab. Dazu zählen die chemische Industrie, die metallverarbeitende Industrie und die Automobilproduktion einschließlich der jeweiligen Zulieferernetze. Ein Beispiel: Die Chemiestandorte leben davon, dass sich rund um die Großindustrie ein ganzes Geflecht kleinerer Firmen angesiedelt hat. Geht der Große, folgen die Kleinen.
Bei Beratungsprojekten der BWA stellte sich immer wieder heraus, dass viele chemische Fertigungsanlagen nach der regelmäßigen Revision gar nicht mehr in Betrieb genommen wurden. Es ist wirtschaftlicher, die Anlagen stillstehen zu lassen, als sie mit völlig überhöhten Energiekosten zu betreiben.
Doch die Politik erkennt diese Zusammenhänge scheinbar gar nicht, sondern feiert sogar noch den Rückgang beim Verbrauch fossiler Energieträger, ohne zu bemerken, dass für diesen „Erfolg“ vorrangig stillgelegte Produktionskapazitäten ursächlich sind. Daher fällt es oftmals gar nicht weiter auf, wenn die Anlagen hierzulande abgebaut werden und im Ausland wieder in Betrieb gehen. Nur die Belegschaft merkt, was los ist, wenn Kündigungen ins Haus stehen.
Die Reifenproduktion in Deutschland steckt bereits in der Abwicklung. Für den Automobilsektor ist eine ähnliche Zukunft absehbar. Die politische Einbahnstraße in Richtung E-Mobilität hat ausländischen Autoherstellern vor allem aus China und den USA den Weg nach Deutschland geebnet und zugleich zu schweren Verwerfungen bei den heimischen Herstellern geführt.
Der Versuch, die Kaufentscheidungen der Verbraucher entlang politischer Leitlinien von Fördern und Verboten zu lenken, statt dies dem Spiel von Angebot und Nachfrage zu überlassen, muss als gescheitert eingestuft werden. Machen wir uns die Zusammenhänge klar: Die bisherige Politik hat zu einer nachhaltigen Verunsicherung bei den Automobilkunden geführt. Hieraus resultiert eine massive Kaufzurückhaltung, die wiederum starke Unsicherheiten auf der Herstellerseite bedingt. Die Autohersteller haben ihre Planungsbasis verloren und wissen nicht mehr, welche Stückzahlen sie in welchen Schichten überhaupt noch produzieren sollen, um nicht auf den Fahrzeugen sitzen zu bleiben. Angesichts der Bedeutung der Automobilindustrie für den Standort Deutschland ist diesem Thema ein eigenes Kapitel im vorliegenden Buch gewidmet.
Brückenstrompreis ist „regulatorische Irrfahrt“
Es sei darauf hingewiesen, dass weite Teile der deutschen Wirtschaft bis zu dreimal mehr für Strom zahlen als ihre internationale Konkurrenz. Die Politik musste handeln – und warf die Idee des Brückenstrompreises in den Diskussionsring.19 Doch der ist eine regulatorische Irrfahrt. Statt Investitionen in grüne Energien gezielt zu fördern, würden alle Energieformen mit der Gießkanne subventioniert. Besser wäre es, dem gewerkschaftlichen Vorschlag zu folgen, das Geld gezielt denjenigen Unternehmen zukommen zu lassen, die auf regenerative Energieformen umschwenken, um Mitnahmeeffekte zu reduzieren. Viele Firmen könnten nämlich den Brückenstrompreis nutzen, um sich damit die „Brücke ins Ausland“ finanzieren zu lassen. Motto: Die Unternehmen nehmen mit, was sie hierzulande bekommen können, während sie die Verlagerung etwa in die USA vorantreiben.
Die sogenannte Wasserstoffstrategie der Bundesregierung erfährt in weiten Teilen der Wirtschaft eine Abfuhr, haben die Autoren in zahlreichen Gesprächen auf Vorstandsebene festgestellt. Als die häufigsten Argumente hören sie: Wasserstoff hat ein dreimal so hohes Volumen wie Erdgas, lässt sich nur mit hohem Aufwand und daher mit hohen Kosten transportieren und die Explosionsgefahr ist viel zu hoch.
Offenbar geht ein Großteil der Industriemanager inzwischen davon aus, dass sich die Wasserstoffstrategie als eine ähnliche Luftnummer wie die grüne Energiewende entpuppen wird. Öl und Gas sind zwar politisch nicht en vogue, erscheinen jedoch vielen Führungskräften als die derzeit einzigen verlässlichen Energieträger für eine industrielle Produktion im großen Stil.
Russisches Gas kommt über Drittländer
Teile des produzierenden Gewerbes versuchen, die für sie existenzbedrohlich hohen Energiekosten durch den indirekten Import von russischem Öl und Gas zu umgehen. Der Umweg erfolgt häufig über die Schweiz: Die Eidgenossen beziehen Öl und Gas aus Russland, das anschließend nach Deutschland importiert wird. Die Zahlungen an die Schweiz für diese fossilen Energieträger erfolgen im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, sind also völlig legal. Es ist eine Verzweiflungstat der Unternehmen, um den unsäglich hohen Energiekosten zu entkommen und ihre Produktion der kläglichen Industriepolitik zum Trotz in Deutschland zu halten.
Indes erfolgt diese legale Form, das Energieembargo gegen Russland zu unterlaufen, auch über weitere Länder. Die Politik erhebt den moralischen Zeigefinger und überlässt die Wirtschaft dem verzweifelten Kampf, die industrielle Produktion und damit Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten. Das wird auf Dauer nicht gut gehen.
Nicht mehr beherrschbare Bürokratie
Neben den falschen Weichenstellungen in der Energiepolitik stellt die Bürokratie einen maßgeblichen Treiber für die Deindustrialisierung dar, wie in diesem Buch noch an anderer Stelle ausführlich dargelegt wird. Nehmen wir als ein konkretes Beispiel das im Raum stehende Verbot von Per- und Polyfluoralkylverbindungen (PFAS) aufgrund von Änderungen der Chemikalienverordnung REACH durch die EU-Kommission. REACH steht für „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals“, also „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. Demnach sind Hersteller und Importeure dazu verpflichtet, bei allen Chemikalien vor dem Inverkehrbringen durch eine Vielzahl von Informationen sozusagen zu beweisen, dass sie Menschen, Tiere und Umwelt nicht belasten.20
Das ist bei PFAS schwierig, denn sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch sehr stabil und heißen deshalb auch „Ewigkeitschemikalien“. Aufgrund ihrer Eigenschaften werden sie in zahlreichen Verbraucherprodukten eingesetzt, von Kosmetika über Kochgeschirr und Textilien, aber auch in der Industrie, etwa zur Halbleiterproduktion.
Durch ein Verbot wäre die Fertigung von Produkten, bei denen wasserabweichende Oberflächen eine wichtige Rolle spielen, von Autos bis Kleidung, in der EU drastisch erschwert. Es ist fraglich, ob der Bundesregierung überhaupt bewusst war, dass PFAS auch für die Chipproduktion benötigt wird, die sie mit Milliardensubventionen nach Deutschland geholt hat.
Im Frühsommer 2024 schien die EU-Kommission selbst zu merken, welche fatalen Folgen ein PFAS-Verbot hätte – es kündigte sich ein Rückzieher an.21 Doch angesichts des drohenden Verbots hatte der Mischkonzern 3M bereits Ende 2022 beschlossen, sein PFAS-Werk im bayerischen Altötting zu schließen.22 Das bedeutete das Ende der letzten deutschen Produktionsstätte für die „Ewigkeitschemikalien“. Betroffen sind nicht nur die 700 Arbeitsplätze in Altötting, vielmehr stehen mit dieser Entwicklung auch viele weitere Stellen, insbesondere in Produktionsbetrieben, die auf PFAS-Chemikalien zwingend angewiesen sind, im Feuer. Prompt schaltete sich die Politik ein, von der Bundesregierung bis zum Landrat vor Ort, um zu retten, was noch zu retten ist. Es wurde von politischer Seite sogar die Gründung einer neuen Stiftung ins Spiel gebracht, um den Standort zu retten. Indes, es war zu spät: 3M lehnte die „Chem-Bayern-Stiftung“ ab, es gab nichts mehr zu retten.
Verlagerung nach Polen, in die USA, die Schweiz
Eigentlich sollte Strom durch den Ausstieg aus der Atomenergie und den Ausbau von Sonnen- und Windenergie deutlich billiger werden. Doch genau dieses Versprechen der Bundesregierung, Deutschland auf bezahlbaren grünen Strom umzustellen, wird auf Jahre nicht erfüllbar sein. Das hat wohl auch das Bundeswirtschaftsministerium erkannt; 2023 wurde bekannt, dass man dort zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Strom in Deutschland für die nächsten 20 Jahre teuer bleiben wird.23
Die Unternehmen harren diese 20 Jahre natürlich nicht aus, sondern wandern ab. Das gilt umso mehr, als alternative Industriestandorte etwa in Polen oder in den USA verlockende Angebote machen. Man muss bedenken, dass beispielsweise Energie in den USA ein beinahe vernachlässigbarer Kostenfaktor ist.