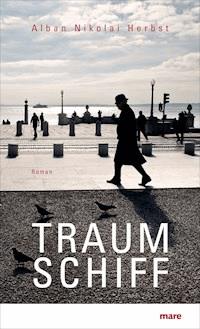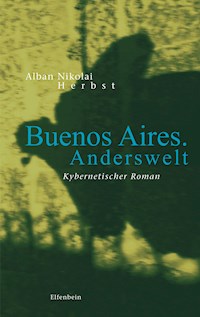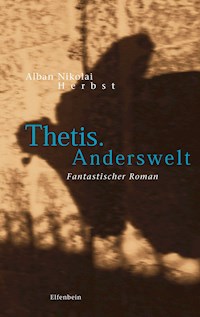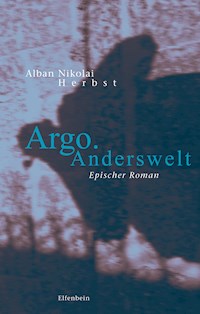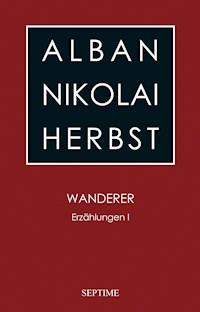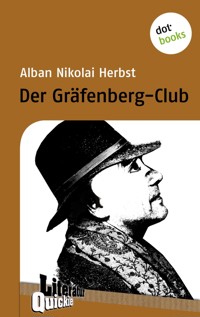19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alban Nikolai Herbsts Erzählungen und Novellen bestechen in ihrer klassisch-strengen Faktur und erzeugen in ihrer Intensität eine Ungeheuerlichkeit, die nicht mehr loslässt. Nirgendwo können Vielfalt und Entwicklung im Schaffen des musischen Autors deutlicher überblickt werden als in seiner Kurzprosa: wie früh Themen und Stilmittel angelegt sind, welche motivischen Zusammenhänge sich daraus ergeben, die wiederum zu den Jahrhundertromanen wie Wolpertinger oder das Blau und den Andersweltromanen Thetis, Buenos Aires und Argo führen. Die scharfe Beobachtung realistischen Alltagsgeschehens und der gleichermaßen unmerkliche wie kühne Übergang in die Phantastik zeichnen das Schreiben Alban Nikolai Herbsts aus – ebenso wie die hohe Musikalität seiner Sprache, deren Tonlagen vom Lyrischen bis ins Groteske reichen. Aus dem Vertrauten geraten Protagonist und Leserin immer wieder in die Falle geschlossener Welten, aus denen es kein Entrinnen gibt. Stärker als in den Romanen sind hier Einflussgeber zu erkennen und als solche oft auch ausgewiesen – Bonaventura, H. P. Lovecraft, F. M. Dostojewski, E. A. Poe, Thomas Mann, Arno Schmidt, Jorge Luis Borges, deren Erzähltechniken Herbst aufnimmt und auf seine unverkennbare Art verwandelt. Band 1, Wanderer, erschien bereits im Frühjahr und beinhaltetet die frühen Erzählungen von den Siebzigerjahren bis Ende der Neunzigerjahre.Wölfinnen, ist zweite Band der zweibändigen Ausgabe und versammelt alle Prosastücke des Meistererzählers seit der Jahrtausendwende.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1206
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Alma Picchiola
Spreetöchter
Bornholmer Hütte
Im Blick eines Mädchens von allenfalls zwölf
Lingerie
Die Richtigstellung
Main River
Cuban Island
Der Arndt-Komplex
Tokyoter Skizzen
Bericht an eine Lesestiftung
Klärchen
Friedas Laise Laube
Flügel
Ehre sei dem, der nicht stirbt
Auf Beethovens Meeresstille
Menschenjäger
Lena Ponce
Clara Grosz
Wie Undinen zurückkommen
Charlotte von Lusignan
Unter Geiern (Benn, gewendet)
Ein Sprengmeister
Gaudís Klinke
Die Rache der Chassée
Kathedrale
Die Unheil
Steine. Die Namen.
Studie in Endbraun
Gesaraland
Die Nichtgeborenen
Das BellepHattt
Zaide ohne Mozart
Hexenspiel
Der Schut
Die Fenster von Sainte Chapelle
Initiation
Isabella Maria Vergana
Unkaltes Herz
Anstelle eines Nachworts: Bemerkungen zum Arndt-Komplex
Zu den einzelnen Erzählungen
Ge|danken
Leseproben
Alban Nikolai Herbst - WANDERER
Lydia Steinbacher - SCHALENMENSCHEN
Markus Bundi - Alte Bande
Myriam Keil - Das Kind im Brunnen
Marlen Schachinger - Martiniloben
Peter Rosegger - Weltgift
Jürgen Bauer - Ein guter Mensch
Gudrun Büchler - Unter dem Apfelbaum
Gabriele Vasak - Den Dritten das Brot
Ute Cohen - Satans Spielfeld
Park Hyoung-su - Nana im Morgengrauen
José Luís Peixoto - Friedhof der Klaviere
© 2019, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Die in den Erzählungen verwendete Rechtschreibung
richtet sich nach dem Autor.
Lektorat: Elvira M. Gross
Umschlag: Jürgen Schütz
Alban Nikolai Herbst / Sämtliche Erzählungen
Band II - WÖLFINNEN
ISBN: 978-3-903061-70-5
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-83-0
Ebenfalls erschienen:
Band I – WANDERER
E-Book-ISBN:978-3-903061-69-9
Hardcover-ISBN:978-3-902711-81-6
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Alban Nikolai Herbst
wurde 1955 in Refrath, Nordrhein-Westfalen, geboren. Er publiziert seit 1981 und lebt seither – abgesehen von einem fünfjährigen Zwischenspiel als Aktien- und Devisenbroker – als freier Schriftsteller. Mit seinem 1000-seitigen Roman Wolpertinger oder Das Blau und der Anderswelt-Trilogie wurde er als Dichter der deutschen Postmoderne bekannt und erhielt u. a. den Grimmelshausen- sowie den Fantastik-Preis. Mit dem Verbotsprozess um seinen Roman Meere geriet Herbst nachdrücklich in die Skandalzeilen. Zuletzt erschienen der Gedichtzyklus Aeolia.Gesang und der Gedichtband Der Engel Ordnungen sowie die romantheoretischen Vorlesungen Kybernetischer Realismus, alle drei 2008.
Ebenfalls 2008 hat Ralf Schnell den exklusiv Herbst gewidmeten Horen-Band 231Panoramen der Anderswelt, Expeditionen ins Werk von Alban Nikolai Herbstherausgegeben. Der Autor arbeitet seit 1994 in Berlin und gibt in dem von Knallgrau in Wien gesponserten literarischen WeblogDie Dschungel.Anderswelt(http://albannikolaiherbst.twoday.net) nahezu täglich Einsicht in seine dort ständig weiterentwickelte Poetologie.
Mit der ErzählungLena Poncein PERSPEKTIVENWECHSEL No 1 erschien Alban Nikolai Herbst im Septime Verlag.2019 erscheinen seine gesammelten und neu editierten Erzählungen in 2 Bänden bei Septime.
Klappentext
Alban Nikolai Herbsts Erzählungen und Novellen bestechen in ihrer klassisch-strengen Faktur und erzeugen in ihrer Intensität eine Ungeheuerlichkeit, die nicht mehr loslässt. Nirgendwo können Vielfalt und Entwicklung im Schaffen des musischen Autors deutlicher überblickt werden als in seiner Kurzprosa: wie früh Themen und Stilmittel angelegt sind, welche motivischen Zusammenhänge sich daraus ergeben, die wiederum zu den Jahrhundertromanen wie Wolpertinger oder das Blau und den Andersweltromanen Thetis, Buenos Aires und Argo führen. Die scharfe Beobachtung realistischen Alltagsgeschehens und der gleichermaßen unmerkliche wie kühne Übergang in die Phantastik zeichnen das Schreiben Alban Nikolai Herbsts aus – ebenso wie die hohe Musikalität seiner Sprache, deren Tonlagen vom Lyrischen bis ins Groteske reichen. Aus dem Vertrauten geraten Protagonist und Leserin immer wieder in die Falle geschlossener Welten, aus denen es kein Entrinnen gibt. Stärker als in den Romanen sind hier Einflussgeber zu erkennen und als solche oft auch ausgewiesen – Bonaventura, H. P. Lovecraft, F. M. Dostojewski, E. A. Poe, Thomas Mann, Arno Schmidt, Jorge Luis Borges, deren Erzähltechniken Herbst aufnimmt und auf seine unverkennbare Art verwandelt. Band 1, Wanderer, erschien bereits im Frühjahr und beinhaltetet die frühen Erzählungen von den Siebzigerjahren bis Ende der Neunzigerjahre.Wölfinnen, ist zweite Band der zweibändigen Ausgabe und versammelt alle Prosastücke des Meistererzählers seit der Jahrtausendwende. »Womöglich ist das eine neue Form von Literatur.« DIE ZEIT»Von alles verschlingender Vielfalt, panoramisch, epochal und überhaupt.« NEUE ZÜRCHER ZEITUNG
Alban Nikolai Herbst
WÖLFINNEN
Erzählungen II
Ediert von Elvira M. Gross
Was macht das mit uns? Nur keinen falschen Ton! Alles
einwandfrei, sauber und schön. Ich hatte, wenn ich spielte, manchmal eine unbändige
Lust, wie ein Schwein zu spielen.
Heinrich Schiff bei Wolf Wondratschek
bitte erlaube mir ein ungewaschnes kind
Katharina Schultens
… den Zauber zu erschaffen, der nur entsteht,
wenn Zunder und Zartheit sich mischen.
Wolf Wondratschek
Und während ich der Angst auswich, wich ich der Hoffnung aus.
José Luís Peixoto
So hören sich Sätze an, die bergauf gehen.
Wolf Wondratschek
Die Strafe, die ich für mich selbst erwählte, ist zu wissen,
was danach geschah.
José Luís Peixoto
Wahrheit löst Verwirrung aus, die,
wenn sie anhält, überläuft zu den Lügen.
Wolf Wondratschek
so lass mich dennoch nicht allein
Katharina Schultens
Alma Picchiola
Giovanni Picchiola und Dr. Emmanuela Scàgheri vom Museo Centrale del Risorgimento hörten anläßlich eines nächtlichen Spaziergangs, der sie östlich am Forum entlang fast bis an den Palatin führte, aus dem Kolosseum eine Art gepreßtes Winseln. Das Gebäude war längst geschlossen. An eine Sinnestäuschung mochte das Paar nicht glauben, denn das Winseln wurde zunehmend kläglich. Weil sich in der gebotenen Eile kein Schließbefugter hätte auftreiben lassen, überkletterte Signore Picchiola das knapp brusthohe Gitter. Seine Gefährtin, nervös, wartete draußen.
Im Innern des Monumentes war es zwar nicht völlig dunkel, doch irritierten die Schatten, die das lichtbeflutete Mauerwerk in Schächte und zwischen massive Trümmer warf. Giovanni Picchiola mußte eine ganze Weile suchen, obwohl das Winseln deutlich blieb. Vielleicht weinte ein ausgesetzter Hund. Das nun wäre nichts von Bedeutung gewesen. Aber Picchiola, erzählte er später, habe wie seine Gefährtin eine Ahnung gehabt. Und fand schließlich, unter dem eingestürzten Fußboden im Schutt der Rund- und Hetzgänge, in einer Plastiktüte, um die ein Badelaken gewunden war, ein Kind.
Er brachte es heraus, die Scàgheri nahm es entgegen. Die beiden alarmierten die Carabinieri. Keine halbe Stunde später befand es sich, ein vielleicht halbjähriges Mädchen, in ärztlicher Obhut. Purer Zufall oder besondere Stärken seiner Konstitution hatten es nicht ersticken lassen. Die Behörden waren wochenlang erfolglos bemüht, seine Herkunft zu klären.
Heimplätze waren rar, weshalb Frau Scàgheri und Herr Picchiola erst eine Patenschaft für das Mädchen übernahmen, dann, nach ihrer Heirat, adoptierten sie es. Woraufhin die kleine Familie in eine geräumige Wohnung der Via dei Villini zog. Wenig später wurde das Kind auf den Namen Alma getauft.
Das Mädchen entwickelte sich überaus schnell, hatte allerdings als Kleinkind bereits eine Neigung auszureißen und blieb dann meist für drei oder vier Stunden verschwunden. Keiner erfuhr, wo sie sich so lange versteckt haben konnte. Das schon für sich war ein Rätsel. Zweimal allerdings waren die Umstände ihres Verschwindens außergewöhnlich, zumal die Eheleute überzeugt blieben, die Haustür keineswegs offengelassen, sondern sie, eben Almas »Macke« wegen, sogar abgeschlossen zu haben. Die Babysitterin schwor Stein und Bein, an der Tür nicht einmal gewesen zu sein. Dennoch lag das Kind am nächsten Morgen nicht im Bett und war auch nirgendwo sonst in der Wohnung zu finden. Man alarmierte die Carabinieri, konnte nur abwarten. Gegen zehn Uhr wurde die Dreieinhalbjährige am Bordstein der Via Torino gefunden, wo sie vergnügt mit einem abgerissenen Taubenfuß spielte. Eine Passantin hatte, geekelt, Alma davon abhalten wollen, sich die Extremität in den Mund zu stecken. Weil das Mädchen daraufhin anfing zu schreien, ja zu toben, brachte man es zur nächsten Wachstation.
Ein zweiter, nicht unähnlicher Vorfall begab sich anderthalb Jahre später. Dieses Mal entdeckte eine Gruppe englischer Touristen das allerdings diesmal äußerst verstörte und auch physisch arg mitgenommene Mädchen. Unter Kratzen und Beißen sträubte es sich, aus der Gosse der Via Cavour gehoben zu werden. Die Kleine wurde zu den Carabinieri mehr gezerrt als getragen. Ihr Körper war völlig unterkühlt und schien, aus den Schürfwunden an Knien und Händen zu schließen, einen Teil der doch beträchtlichen Strecke kriechend bewältigt zu haben. Auf späteres Befragen, was sie denn getan und wie sie überhaupt die abermals zugesperrte Wohnung habe verlassen können, reagierte Alma verstockt. Es brauchte ein paar Tage, bis sie sich wieder gelockert hatte. Dann aber schien sie ruhig zu werden. Bis zu ihrer Einschulung kam es zu weiteren Auffälligkeiten nicht mehr.
Allerdings tat Alma sich mit Gruppen schwer. Hatte sie sich zwar in einen Kindergarten weder einfinden können noch müssen, dem Schulzwang war sich zu fügen. Worauf das sonst sehr aufgeweckte Kind unter Konzentrationsschwierigkeiten zu leiden begann. Es entwickelte überdies einen entschieden sadistischen Hang. Wer dem Mädchen etwas fortnahm, im Spiel oder um es zu trietzen, mußte achthaben, nicht unmittelbar von ihm angefallen, nicht nur gekratzt, nein, auch gebissen zu werden. Sie schien keinerlei Gefühl für Verhältnismäßigkeiten zu entwickeln, bediente sich sogar kleiner Messer und einmal einer Stricknadel, die sie erschreckend sicher zu führen verstand. So wurde das Kind erst gemieden, dann verhetzt. Was es nur aggressiver machte, bis sich dem Elternbeirat kaum noch entgegnen ließ, der die Entfernung des Mädchens von der Schule betrieb. Es wurden sogar Stimmen laut, daß man Alma einsperren müsse. Und es lief das Gerücht um, es sei das Mädchen gar kein Mensch.
Die Picchiolas wußten sich nicht mehr zu helfen. Kein noch so liebevolles Gespräch zeigte bei dem Kind eine Wirkung. Imgrunde blieb keine Alternative, als es erst in psychotherapeutische, dann sehr bald psychiatrische Behandlung zu geben. Die schulische Ausbildung sollten fortan Privatlehrer besorgen.
Anfangs beruhigte sich Alma unter dem Einfluß der Sedativa auch. Doch dann immunisierte sich das Kind geradezu meßbar gegen die Wirkung der Medikamente. Kein halbes Jahr später verfiel Alma erneut spontanen, wenn auch flüchtigen Zuständen schärfster Angriffslust. Die hatte sie so wenig in der Gewalt, daß man das achtjährige Mädchen isolieren mußte. Dennoch indizierte das EEG keinerlei Abnormität, und auch die Hypothese, es handele sich um einen Fall von Gemütlosigkeit, hielt der Überprüfung nicht stand. Wohl verlegenheitshalber sprachen die Ärzte von einem seelischen Atavismus, der gelegentlich anzutreffen sei. Fortan lebte Alma hinter Drahtglas, weshalb sie gezwungen war, über eine Sprechanlage zu kommunizieren. Was sie oft tat. Denn sofern sie nicht gerade einen Raptus durchlitt, blieb sie hochgradig aufnahmefähig. Nicht nur waren ihre Sinne von geradezu seismografischer Empfindlichkeit, sondern auch das verbale Vermögen und sowieso ihr rapides Auffassungsvermögen waren derart ungewöhnlich, daß eine ganze Kohorte Spezialisten beigezogen und die intellektuelle Ausbildung noch intensiviert wurde. Sie tat dabei, so sah es zumindest aus, begeistert mit. Problematisch war nur, daß sich Alma zwar ihrer Paroxysmen, die sie körperlich ausgesprochen zermürbten, niemals entsann (mit ihren kräftigen, wenn auch sehr kleinen Zähnen konnte sie Decken zerreißen), andererseits aber zu wissen schien, daß mit ihr etwas nicht stimmte – und vielleicht sogar, was. Darüber sprach sie aber nicht, sondern vollzog etwas, das Dr. Magnani »bewußte Verdrängung« oder auch »Umleugung« nannte. Brachte jemand die Rede auf ihre »Zustände«, dann wandte Alma sich ab und schwieg. Es war, als ob sie sich schämte. Und indem ihr Schweigen überhandnahm, begann das Mädchen zu vereinsamen.
Die Jahre verstrichen. Wie sehr Alma den Besuchen ihrer Adoptiveltern auch entgegenfiebern mochte – alleine für sie schien das Mädchen wirklich Gefühle zu haben –, den Picchiolas wurde sie fremd. Es war ihnen vielleicht zu schwer geworden, das Leid dieses Mädchens hilflos mitansehn zu müssen. Jedenfalls kamen sie zunehmend selten, bis sich ihr Engagement auf die Obliegenheiten einer Rechtspflegeschaft reduziert hatte. Doch auch Ärzte und Pfleger, die schon aus Mitleid lange mit Alma sympathisiert hatten, wurden allmählich sachlich. Man hatte sich an sie gewöhnt. Sie war nichts Besonderes mehr, ihre Anfälle nervten. Zum Beispiel, wenn man es wagte, die ja so sehr junge Patientin in den Garten zu lassen, damit sie vielleicht wenn nicht Freundschaften, so doch Bekanntschaften machte. Aber entweder, sehr oft, fiel sie ihre Mitpatienten in plötzlichem Stimmungsumschwung an oder überkletterte in affenhafter Gelenkigkeit die Parkummauerung und konnte nur unter reichlichem Aufwand wieder eingefangen werden. Nach solchen Ausbrüchen war es für die Pfleger sogar riskant, ihr das Essen zu bringen.
Über die Zeit wuchs Alma zu einer zwar nicht unansehnlichen jungen Frau heran, doch war ihr Körper leicht entstellt: zu oft hatte sie sich bei ihren Anfällen und Ausbrüchen Verletzungen zugezogen. Ob es Freiheitssucht war, was sie so trieb, ob ein früher sexueller Instinkt – es war nicht zu sagen.
Das frühe Einsetzen der Menses, mit knappen elf Jahren, spannte, so formulierte es eine Therapeutin, um Alma eine nächste Haut: »Es ist, als verpuppte sie sich. Ich habe den Eindruck, sie wartet etwas ab, von dem sie selbst noch nichts weiß.« – Wie schnell auch immer, wie unstet und hochnervös sie gewesen sein mag, nun verfiel sie in stundenlanges Schweigen. Niemand ahnte auch nur, welche Imago daraus würde. Tag für Tag starrte sie vor sich hin, reagierte auch auf ihre Lehrer nicht. Aß nichts, nahm alarmierend ab. Man ersetzte die Neuroleptika durch Proteingaben. Dennoch blieb die junge Frau stumpf und unaufmerksam, riß allerdings nicht mehr aus.
Man päppelte sie künstlich wieder auf. IDPN war aber vermeidbar. Sie widersetzte sich nicht, schluckte, was ihr hingestellt wurde. Ergeben stand sie auf. Ergeben legte sie sich zu Bett. Ein Jahr völliger Anfallsfreiheit verstrich. Allmählich wurde Alma agiler. Bekam Appetit. Bat um Bücher. Man behielt das Mädchen noch weitere sechs Monate unter strenger Kontrolle, dann wurde es vorsichtig mit anderen Kranken zusammengebracht und also aus dem »Käfig«, wie die Zelle im Patienten- und Personalmund hieß, herausgelassen. Doch nicht nur die Rekonvaleszentin scheute Berührung, sondern ebenso jeder andere der Patienten – schon der Legenden wegen, die sich um »das Tier« gewoben hatten. Man ging einander gegenseitig aus dem Weg. Alma saß dann über Stunden im Park und studierte ihre Akte.
Die Phase der Normalisierung begann.
Zuerst wurde die Bindung zu den Picchiolas aufgefrischt. Die zeigten sich besten Willens, vielleicht, weil der Signora eigener Nachwuchs verwehrt war. Die frühere Herzlichkeit freilich stellte sich nicht wieder her. Doch immerhin, die Adoptiveltern versuchten es mit Geschenken, brachten Bücher mit vor allem, aber auch Süßigkeiten. Und als die Dreizehnjährige erstmals Freigang bekam, gab es ein kleines Fest zuhause. Es wirkte wie eine Wendung zum Guten. Denn tatsächlich, das Mädchen wurde nach so vielen Jahren aus der Klinik entlassen.
Auf dem Gymnasium zeigte sich, wie vorausschauend es gewesen war, dem Mädchen in der, so nannte sie ein Arzt, verschlossenen Zeit Privatlehrer an die Seite gestellt zu haben. Es gab keinen Moment, in dem Alma ihren Klassenkameraden nicht mindestens ebenbürtig war. Trotzdem ließ sich natürlich von »Heilung« nicht sprechen, allenfalls von Rekonvaleszenz. Das war allen Beteiligten bewußt. Sozial, nach wie vor, ließ Alma sich kaum integrieren. Wobei es Stimmen gab, dies aus der permanenten Isolation ihrer Kindheitsjahre zu erklären. Denn exogene Befunde gab es weiterhin nicht, abgesehen von Almas seismographischer Überempfindlichkeit: »Das Mädel kann Gerüche hören«, tat der Arzt den Umstand ab, »sowas machte auch Sie sonderbar.«
Alma fraß den Stoff, sie war hungrig, das gemäßigte Lerntempo der anderen langweilte sie. Manches Mal verließ sie einfach den Unterricht, wenn er für ihren Geschmack stockte. Es hagelte Ermahnungen, Klassenbucheinträge. Da ihr Körper nicht Reiz genug besaß, um wenigstens exotisch zu wirken, zudem sie ja so schwierig im Umgang war, blieben ihr auch die pubertären Sehnsüchte der Jungen verschlossen. Ihre Aufmerksamkeit zog sich abermals zurück. Wieder starrte sie bei Fragen störrisch zu Boden. Nicht selten ignorierte sie insgesamt den Stundenplan.
Einen Jungen gab es allerdings, Giulio, der an dem unzugänglichen Mädchen so sehr Gefallen fand, daß er sich Alma zu nähern und sogar, auf eine stille, sehr diskrete Weise, um sie zu werben begann. Von ihr angeschwiegen, erzählte er ihr seinen Tageslauf, erklärte ihr einige Sportarten, machte ihr Celentano und Alice Cooper bekannt, lud sie ins Kino ein. Natürlich ging sie nicht mit. Doch war er nicht von ihr abzubringen, versuchte unermüdlich, ihr wenigstens einen freundlichen Satz zu entlocken. Das ging so über ein Jahr. Dann – endlich – schien sie Vertrauen zu fassen, lächelte Giulio flüchtig an und wurde, fand er, wunderschön dabei. Man traf sich abends im Park des Monte Esquilinos, wohin es Alma zog. Er kam auch zum Essen zu den Eltern Picchiola. Die wußten indessen nicht, ob sie sich freuen sollten, denn während Alma weiblich erblühte, entfachte sich ihre Reizbarkeit aufs neue. Die junge Frau bekam etwas offensiv Halsstarriges, und wieder schlugen selbst gemütlichste Nachmittage in Attacken um. Es war ein ständiges Auf und Ab. Almas geistig hektische Motorik verschreckte sie alle. Wie von Albträumen schien Alma mitten am Tag von furchtbaren Halluzinationen heimgesucht zu werden. Manchmal schlug sie urplötzlich um sich. Oder lachte mitten in der Stunde hysterisch auf. Einzig Giulio vermochte es, ihre Fiebrigkeiten ein wenig zu dämpfen.
Dann, während einer ihren Quecksilbergeist lähmenden Chemiestunde, entledigte sie sich ihrer Kleidung und forderte den Freund auf, ein gleiches zu tun. Alle starrten sie an, auch die Lehrkraft. Keiner sagte etwas dazu. Giulio, sich vor den Klassenkameraden genierend, bat seine Freundin, doch zu Verstand zu kommen. Mit ungehaltenem Lachen lief sie splitternackt davon. Er hinterher. Aber auch für sportlichere Menschen als ihn war sie eine zu schnelle Läuferin. Trotz des Aufsehens, das sie verursachte, verlor er sie wenige Straßenzüge weiter aus den Augen. Spät nachts erst (er hatte bei den Picchiolas auf sie gewartet) kehrte sie zurück, Blessuren an Armen, Beinen, den Brüsten, am Rücken. Als Giulio sie ansprach, weinte sie nur.
Es war Zeit für eine Katastrophe.
Wenige Tage später fand man Giulio Damonti so sehr verstümmelt neben dem Arco di Costatino, daß es selbst den abgesottenen Gerichtsmediziner graute. Die Reiß- und Bißwunden stammten von, wenn auch ungewöhnlich kräftigen, so immerhin menschlichen Zähnen. Alma Picchiola war verschwunden und selbst mittels Rundfunk- und Fernsehdurchsagen und Fotografien in Zeitungen nicht aufzustöbern. Eine Zeitlang waren die Medien voll von der lupa di Roma. Dann war sie kein Thema mehr.
Aber im Frühling, zehn Monate später, wurden zwei Wachleute im Kolosseum auf eine junge Frau aufmerksam, die ein verschnürtes Bündel über die Absperrung in die Hetzgänge warf. Da einer der beiden glaubte, hier wolle sich jemand auf sehr italienische Weise seines Mülls entledigen, trat er auf sie zu, um sie zur Rede zu stellen. Seinem Instinkt hatte er es zu verdanken, daß ihre Zähne ihm nicht in die Kehle, sondern in seinen linken Unterarm schnappten. Ein von seinem und dem Schreien eines Kollegen aufgescheuchter Carabiniere soll durch einen gut gezielten Schuß in den Hinterkopf der Frau, es war Alma, ein noch größeres Blutbad verhindert haben.
Während einige sich um den verletzten Wachmann kümmerten, kletterte dessen Kollege in die Hetzgänge hinab und nahm das Bündel auf, in welches ein Säugling geschnürt war, der – jedenfalls nach offizieller Version – wenige Stunden später an inneren Blutungen starb. Er soll, zusammen mit dem Corpus seiner Mutter, eingeäschert worden sein.
Manche aber meinen, es sei, zu Frucht und Gedeih der Wissenschaft, das Geschöpf am Leben erhalten worden, in einem universitären Labor, einer gläsernen Zelle, videografisch viviseziert, eine junge Frau heute, ein junger Mann bereits, mit einem Blick, durch den Jahrhunderte ziehn, einsam wie keiner zuvor seines oder ihres Geschlechts und also in der schlimmsten wölfischen Schande.
Spreetöchter
Fantasiestück in Bernhard’s Manier
Warum kann ich mich an deinen sonderbaren fantastischen Blättern nicht satt sehen, du kecker Meister! – Warum kommen mir deine Gestalten, oft nur durch ein Paar kühne Striche angedeutet, nicht aus dem Sinn?
E.T.A. Hoffmann
Gestern abend traf ich meinen Freund Kohlmann, der zwar ein lebensfremder Spinner ist, aber ein liebenswerter und, wenn man sich auf ihn einläßt, amüsanter Mensch, wieder einmal in der Strandbar Mitte, weil ich noch eine der womöglich letzten Sommernächte dieses Jahres genießen mochte und vielleicht auch eine Bekanntschaft machen, derweil mich mein Freund unterhielte, wovon ich schon deswegen ausgehen konnte, weil ich ihn gut genug zu necken weiß, um ihn, den die gehässigen Kameraden seiner Schulzeit Meise nannten, weshalb er, aber nicht nur deshalb, auf Kameraden immer gepfiffen habe, in Hochform zu bringen. Zum Brennstoff dieser Hochform hatte ich für den Freund, dessen Neckname natürlich von Kohlmeise kommt, eine wahre Schwarte von Buch dabei, Götter & Helden, herausgegeben von einem ungewissen Hans W. Fischer, 1934, Berlin, wichtig für Meise ist aber das Jahr, während ich selbst, weil ich mich anzupassen verstehe, um einen Spitznamen immer herumgekommen bin, einen nickname, wie englisch mein Sohn sagt, der ein bisschen zu sehr den Mainstream vertritt, dem sich dagegen Meise wegen seiner Familiengeschichte, herkunfthalber, möchte ich sagen, genauso entschieden verweigert wie den übrigen Zeitläuften, um ein altes Wort zu benutzen, das heutzutage, glaube ich, nur noch von der ZEIT verwendet wird, und eben von Meise, der über die Geschichte, sagt er immer, keine Decke des Vergessens decken oder, um es, sagt er, präziser auszudrücken, den Glauben nicht mitmachen wolle, man müsse nur genügend pissen, um nämlich die Vergangenheit mit scharfem Strahl hinwegzupissen, worauf sie in den nächstbesten Abfluss rinnt, der in der Strandbar Mitte natürlich die Spree ist, die sie dann mit sich davonträgt. Also Meise und ich nahmen wieder unseren Stammplatz ein, einen der Tische direkt am gesandeten Fußgängerweg, der das Ensemble der unter dem weiten Berliner Himmel offenen Lokalität von dem Damm trennt, zu dessen Füßen die Tanzfläche ins Erdreich gestampft ist und immer weiter, von sämtlichen dort Tanzenden, hineingestampft wird, und den hinab wir schon früher gern saßen, wenn es auf dem damals noch aufgeschütteten Strandsand, der wirklich, wurde mir erzählt, von der Ostsee stammte, keinen freien Liegestuhl gab. Mit wir meine ich aber Gregor und mich, nicht Meise und mich, der auch damals schon zu unangepaßt war, um sich mit anderen am Boden niederzulassen, und das mit Erich Mühsam begründete – ausgerechnet mit Mühsam! – von dem er immer wieder die Anekdote erzählte, wie der sich nach der Revolution neunzehnachtzehn habe Besteck reichen lassen, während alle übrigen, um mit dem Proletariat Verbundenheit zu demonstrieren, allein mit den Fingern gegessen hätten; wer jedenfalls könne wissen, welcher Hund da auf den Damm, aber nicht der Zeitläufte wegen, sondern einfach, weil es ihn drückte, hingepißt habe – also beharrte er immer auf einem Stuhl und beharrt darauf noch heute oder doch wenigstens auf einem Steinsockel, während ich selbst Sessel vorziehen würde, die es dort aber weder früher gab noch heute gibt, anders als eben die Liegestühle, die, wenn wir hinkamen, fast immer schon belegt gewesen sind, was aber nicht der Grund dafür ist, daß es sie heute dort nicht mehr gibt. Das vielmehr liegt am Bebauungsplan, der auch so etwas, sagte gestern abend Meise und kam schon in Fahrt, Verhängnisvolles sei, also das Planen an sich und daß man es, ist abgestimmt und entschieden worden, um jeden Preis durchsetzt, auch wenn darüber ein fantasievoll-freies Strandbad kaputtgeht und, sagte Meise, clean wird; worum es tatsächlich geht, zeige allein dieses Wort schon. Jedenfalls sei ihm, Meise, das unbedingte Durchsetzen unabhängig von Schönheit und Sinn immer schon ein Dorn gewesen, also im Auge, dieser Irrtum von Planbarkeit, nannte es Meise, der geplante Mensch, höhnte er und hätte fast mit der flachen Hand derart auf den Tisch geschlagen, daß ich schon Gläser springen sah und sie scheppern hörte, wie denn sowieso die unbedingte Treue, rief er exaltiert, eines der größten Verhängnisse sei, die sich überhaupt denken ließen. Da hatte er in die mitgebrachte Schwarte noch gar nicht hineingesehen.
Natürlich sind heutzutage auch die Tische und Stühle, die nach der durchgesetzten Planbebauung statt der alten Liegestühle bereitstehen, immer schnell belegt, weshalb ich lieber früher als verabredet komme, so daß ich oft bis zu einer ganzen Stunde für mich allein meine Beobachtungen vor allem von Frauen anstellen kann, bevor Meise meist sehr verspätet eintrifft, der, während ich die öffentlichen Verkehrsmittel nutze, meist mit dem Auto herfährt, weshalb er, um einen Parkplatz zu finden, sowieso eine Viertel-, ja halbe Stunde zusätzlich braucht, womit er sich für seine Verzögerungen regelmäßig entschuldigt, die aber ein Teil seiner, meine ich, Überspanntheiten sind, denn er kommt grundsätzlich zu spät, auch ohne Auto, weil er, wie er mal ausgeführt hat, die Pünktlichkeit hasse, die den Deutschen nachgesagt werde. Doch wolle er auf keinen Fall den Eindruck vermitteln, sie an sich selbst als eine falsche Legende sozusagen zu überführen, denn das wäre erst recht eines dieser, so nannte er es gestern erneut, Mißverständnisse, um die, wer von Deutschland spreche, insgesamt nicht herumkomme. Wie so viele Philosophen hat Meise eine Meise, die sich bei ihm nicht nur in seiner Lebensfremdheit, sondern überdies, so daß selbst Unvorbereitete sofort gewarnt sind, auch in seiner Bekleidung ausdrückt, für die er stark gemusterte Hosen voll bunter Karos bevorzugt, zu denen seine Jacketts auch deshalb niemals passen, weil er zudem Hemden mit dicken farbqueren Streifen trägt, welche seinen besonderen Bauch, gerade weil er ansonsten ein gelehrtentypisch hagerer Mann ist, ganz besonders betonen; er trägt ihn wie einen Ausstulp, den er, wie ich den bisweilen fiebrigen Eindruck hatte, abnehmen, vor allem aber öffnen kann, um darin zu verstauen und drin zu verschließen, was ihm, Meise, nicht angenehm ist, wozu eben ganz sicher auch Götter & Helden, 1934, gehörten, seiner Familie wegen, ich sagte es schon, zumal die der Schwarte beigegebenen ausgesprochen rohen Strichzeichnungen, von einem anderen Hans, Sauerbruch mit Namen, die Dimensionen gerade dieses Bauches noch betonten, seine, sozusagen, ungeahnten Tiefen. Selbstverständlich nähme ich ihm, Meise, die Verspätungsneigung sowieso als politische Inszenierung nicht ab, sondern denke, daß es sich schlicht um einen Zug seines Charakters handelt und möglicherweise um professorale Zerstreutheit genauso, die freilich nicht ohne eine gewisse Nachlässigkeit gegenüber dem Freund ist, ein wenn auch nicht böswilliger, doch versponnener Tick, man könnte sogar Spleen dazu sagen, der ohnedies nicht geeignet wäre, Ausdruck einer bewußten politischen Provokation zu sein, die mit welchem Mißverständnis auch immer aufräumen wolle, in diesem Fall dem speziellen unserer wesenhaften Pünktlichkeit.
In diesem Moment nahmen am Nachbartisch zwei Freundinnen Platz, blutjungeFrauen, Mexikanerinnen vielleicht, vielleicht Argentinierinnen, jedenfalls romanischer Herkunft, vor allem aber derart schön, daß ich immerzu hingucken mußte und, als Meise plötzlich von Tragik sprach, was eine für ihn typische Übertreibung war, für die er sogar schon die Stimme hob, weil ihm jeder noch so banale Anlass ein dankbarer Grund für Dramatik ist, den Blickkontakt aufzunehmen versuchte, bis eine von beiden wirklich zurückguckte, was mich derart durchzuckte, daß ich die Augen senken mußte und gar nicht richtig mitbekam, wie es Meise fertig brachte, die mir nun tatsächlich eigene Pünktlichkeit, und Pünktlichkeit an sich, in eine an sämtlichen Haaren und Schöpfen, die in der Strandbar zugegen waren, herbeigezogene Verbindung mit den anderen von ihm so genannten Mißverständnissen zu bringen, zum Beispiel mit der deutschen Exaktheit oder dem, Sie lesen richtig, Sauerkraut, das, ereiferte er sich, als Choucroute doch mindestens ebenso Bestandteil der französischen Küche sei, ja, Boudin zu Choucroute sei geradezu eine besonders Pariser Spezialität, und überhaupt habe es sich bei Deutschland noch nie um eine Nation gehandelt, sondern um einen, das rief er für alle hörbar, wie um das Wort zu beschwören: Kulturraum!, den mit einer Nation zu verwechseln dem Allerfurchtbarsten den Boden vorbereitet habe, beziehungsweise ihn als Nation zu, sagte er, dekretieren. – All das zwischen den trinkenden Gästen, die teils amüsiert, manche aber auch gestört zu uns herübersahen, und zwischen den Flaneuren und den Besuchern des hölzernen Amphitheaters, das Volpone spielen wollte, von Shakespeares Konkurrenten Johnson, dem, also jenem, holte Meise ohne Übergang aus, Roland Emmerich mit Anonymous ein wirklich großartiges Denkmal gesetzt habe, eines, das sich zu einem Nationalbewußtsein besser geeignet hätte und, wäre der Dichter nicht leider ein Brite gewesen, immer noch eigne als ausgerechnet die Nibelungen, die doch nichts anderes seien als die rohe Verherrlichung von Gewalt, ein, sagte er, Thrillerstoff, der Recht dem schlimmsten Schläger gebe, sofern er außerdem noch Betrüger sei wie – es war mir überhaupt nicht recht, daß Meise, indem er immer noch lauter wurde, uns derart auffällig machte – »George W. Bush!« rief Meise, wobei mir schon der Zusammenhang nicht klar war, nicht der zu dem Altpräsidenten der USA, den, sagte Meise, Wagner schon deshalb nicht hätte entlasten können, wenn es einen solchen Bush zu seiner Zeit schon gegeben hätte, nämlich weil der Mann viel zu alt gewesen wäre, »viel zu wenig blond!« rief Meise, um sich für einen Siegfried zu eignen, und als ein möglicher Ludwig zu wenig phantastisch und von jämmerlichem Kunstverständnis, das, wo geschult, nicht ohne die, sagte Meise, Gnade auskommen könne, indessen er, Wagner, diesen selbst, Siegfried, so dumm gemacht habe, daß sich ihm nicht einmal der Betrug – noch gar, wie Hagen, Tückisches – eigentlich verübeln lasse; überhaupt sei die Begeisterung für Dummheit bei Wagner ganz allgemein, auch der Parsifal sei ja so eine dumme, eine un|er|träg|lich, betonte Meise, dumme Person, wie überhaupt alle Intellektuellen, soweit man diesen Begriff auf das Mittelalter schon anwenden dürfe, desavouiertwürden, zum Beispiel eben in der einzigen Person, die in dem Epos politisch denke, machtpolitisch selbstverständlich, zugleich aber in derÜbereinkunft mit der mittelalterlichen Moral, nämlich Hagen von Tronjes, was wiederum, dozierte Meise, ganz besondersHebbel deutlich mache in seiner psychologisch zwar ausgefeilten, aber insofern, das lasse sich nicht anders nennen, böse beschönigenden Dramatisierung des Stoffs, insofern sie die Renaissance um Machiavelli beraube, nämlich ins Mittelalter schon vorwegziehe, was zumal deshalb so heikel, als Hebbels Verse ganz vorzüglich, befand Meise, seien, wie auf der anderen Seite auch Wagners Musik, leider, da ihr bei allem Kitsch, den sie bediene, zumal dem falschen heldischen Dur, das stupende Genie nicht abzusprechen sei, aber er, Meise, wolle jetzt noch einen zweiten Mojito, ob ich ihm den bitte besorgte?
Meise hat fast nie Geld, indessen ich selbst mit dem Inhaber der Strandbar auf eine Weise geschäftlich verbunden bin, die mich dort zu freiem Konsum vielleicht nicht berechtigt, aber so hat es sich über die Jahre ergeben. Deshalb stand ich auf und brachte uns flüssigen Nachschub sowie eine Pizza, die in der Strandbar Mitte nicht nur sehr schmackhaft ist, sondern ihr Umfang verlangt danach, daß man sie teilt, weshalb wir beide, Meise und ich, nun erst einmal aßen, während es dämmerig und auch schon dunkel wurde. – Am Nebentisch die Frauen kicherten höchst amourös, wozu sich die Wellenbewegungen des Wassers auf der hellen, frisch sandgestrahlten Fassade des Bode-Museums so irrlichternd spiegelten, daß der surreale Eindruck entstand, es sei ein riesiges, aber hauchdünnes, womit ich nicht dünnwandiges meine, Aquarium davor geschoben oder, besser, eine transparente Leinwand vor dem Gebäude heruntergelassen, was mich götter- und heldenhalber an die Rheintöchter erinnerte, Spreetöchter, mußte ich denken, jedenfalls an Nixen, die aber, dozierte Meise weiter, doch mit so gefülltem Mund, daß mit seinem Speichel versetzte Nahrungsfetzchen auf die Schwarte spritzten, im Nibelungen-Original, anders als bei Wagner, so gut wie keine Rolle spielten, während Hebbel den Wasserfrauen, vielleicht um seiner Zeit, der Romantik, zu genügen, eine sehr viel deutlichere Rolle zuschreibe, wozu er sich, Meise, weniger deshalb über den enormen Bauch strich, um auf seine falstaffsche Anstrengung aufmerksam zu machen, etwa die genüßliche beginnende Verdauung, als vielmehr rhetorisch nachdrücklich zu wirken, denn nicht nur, fuhr er fort, wie wenn er den einen Gedankengang stumm mit dem anderen weitergedacht, das heldische D-Dur sei so falsch, sondern eben auch das wagnersche moll, weil gerade dieses ein Verhängnis genannt werden müsse, insofern es alle Tiefe dieser Musik, und aller Musik überhaupt, in sich berge, alles, um es zu wiederholen, Genie, in aber gerade dem das deutsche Verhängnis ja geruht habe, dessen Tragik eben die Tragik sei – »nicht geruht, nein!« brüllte er und schlug schon wieder fast auf den Tisch, »falsch!«, sondern es sei sein, sagte er, Eidotter gewesen, weil man für deutsch, rief er, gehalten oder ausgegeben habe, was abendländisch sei, Teil des – »um«, sagte er, »mich zu wiederholen:« – Kultur- und eben nicht Nationalraums, denn wäre Wagners Genie als ein abendländisches begriffen worden, als, wolle er sagen, europäisches, wäre es zu den ganzen Mißverständnissen gar nicht erst gekommen, wie eben auch Nietzsches Genie nicht nur mißbraucht worden sei, vor allem seine doch wirklich berechtigte Kritik am Christentum, sondern sich post, sagte Meise, mortem selbst dem übelsten Mißbrauch angedient habe, passend wie Beethoven und, wiewohl der Ungar gewesen, Liszt, ohne alle die uns die entsetzliche »Wagnerei« vollkommen erspart geblieben wäre, deren, jedenfalls für Deutschland, allerschlimmste Verfehlung eben nicht, wie dieser Philosoph gemeint habe, der Parsifal gewesen sei, sondern es seien eben die Nibelungen gewesen, was man sich, Meise stopfte Pizza nach, gar nicht genügend klarmachen könne, denn ohne Wagner hätten die Nibelungen niemals solch eine Bedeutung erlangt, weil es eben gerade Siegfrieds bei Wagner zugleich galoppierende wie von ihm zu Adel gelogene Dummheit sei, was ihn so, formulierte Meise, volkskompatibel gemacht über alle Betrügereien hinaus, die einem das Wohlwollen des Volkes aber erst garantierten, wie man bei Berlusconi sehen könne und »George«, rief Meise neuerlich aus, »W. Bush!«, den schon heute niemand mehr kenne, weil man nach wie vor der Meinung sei, uns habe Obama von dem erlöst, wiewohl auch der nichts andres als ein Barbarossa sei, nur daß er nicht im Kyffhäuser schlafe, in dem aber auch Barbarossa nie geschlafen habe, das sei die reinste Verfälschung gewesen, mittels derer man Friedrich II., den Staufer, da hinausgejagt habe, weil der, ein früher, ja vielleicht der erste überhaupt, Europäer, zum Deutschtum einfach nicht taugte und heute noch nicht taugen würde, nicht, ereiferte sich Meise, in einer Zeit, die sich neuerlich als schlimmstes Feindbild, ganz wie im Mittelalter, den Islam erkoren habe, uneingedenk dessen, daß man ihn selbst gestärkt und seinen Terrorismus mit der eigenen Payroll ernährt hat. »Heute schläft«, rief Meise, »im Kyffhäuser Amerika!«, was schon von daher eine ziemliche Verdrehung, insofern dieser Doppelkontinent ja nun mehr sei als die verhältnismäßig kleine USA; so auch sei von Anbeginn eine Ursache des Mißverständnisses Deutschland das sprachliche Konstrukt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewesen, schon das habe sich Hitler zunutze gemacht, das und die Nibelungen, wobei aus »Nation« ganz einfach Nationen geworden, vielleicht weil, Meises Stirn wurde dunkel, eben genau der Plural von »Nibelung« dazu verführt habe, zu dessen, also Alberichs, übrigens, sagte Meise, Sohn Richard Wagner den Tronjer machte, was logischerweise bedeuten mußte, daß Hagen den Siegfried für die gewaltsame Bemächtigung des Schatzes eben seiner Familie, der Nibelungen, bestraft habe, man müsse die Versionen nur einmal zusammendenken, um die ganze Ungeheuerlichkeit zu begreifen, insofern die Kraft zum Beispiel eines Mythos gerade in der Summe seiner Varianten und darin bestehe, daß sie einander widersprächen und trotzdem jede ihr Recht behalte; wer zum Beispiel wisse denn noch, daß Alberich eine Ableitung Oberons und damit französischen, und Meise, rufend, wiederholte es – »französischen!« – Ursprunges sei? »Auberon!«, rief er auf Französisch aus, schon sei man mittendrin im Krieg der Nationen, wiewohl Siegfried doch ein Niederländer gewesen, wen wundre es da noch, wenn die Deutschen ganz Europa niederrennen und, sagte Meise, einsacken wollten? Das falsche Nationalepos sollte zum wirklichen werden, denn wenn alles deutsch geworden wäre, und nur dann, hätte man mit Fug und Recht von einem solchen sprechen können, so daß die Nibelungen, insofern sie eines sein, beziehungsweise werden sollten, Hitlers Eroberungskrieg imgrunde schon im 19. Jahrhundert vorweggenommen hätten, wobei man gar nicht erst darauf hinweisen müsse, daß Wagners Implantierung des Antisemitismus in die Sage, indem er aus Mime und Alberich Karikaturen jüdischer Mitbürger gemacht habe, miese Kreaturen, sagte Meise, ein mindestens ebenso großes Mitunheil zu verschulden habe wie diese, wiederholte er und schauderte sichtlich, Dummheit, die es aber eben gewesen sei, was das Volk für die Nibelungen so aufnahmebereit gemacht habe, denn mit den Dummen habe es sich ja vollkommen zu Recht identifiziert, und mit den Schlägern sowieso, das einfache Volk, ein jedes selbstverständlich, auch in allen anderen Ländern, in Deutschland aber vor allem, weil es eben noch gar keines gab, sondern nur zersplitterte Fürstentümer, die der Wirtschaft hätten im Weg gestanden, weshalb sie überhaupt dieses Interesse an einem einzigen nationalen Deutschland gehabt habe, auch wenn das Volk, wie ein einziger Siegfried, umhergeschaut habe, ob man nicht jemanden totschlagen könne, die Juden sowieso, aber am besten die Franzosen, die ja nun wirklich, sagte Meise, eine eigene Nation gehabt hätten und haben, doch sei die Moral, die sich schließlich durchsetze, eben immer die des Siegers, da könne sie, man sehe das an – er schnob das Wort durch die Nase – Amerika, so unmoralisch sein, wie sie wolle, weshalb schon der Name – Siegfried – verhängnisvoll genug gewesen, weil es auf einen Sieg eben auch angekommen sei, wozu man aber erst einmal Krieg gebraucht habe, und weil es um Wirtschaftsvormacht gegangen sei, habe der verlorene Erste Weltkrieg geradezu notwendig in den Zweiten geführt, es hätte dafür, sagte Meise, eines Hitlers gar nicht bedurft, der aber zu seiner Machtergreifung die betrügerische Verfälschung des Kyffhäusermythos mit den Nibelungen verbunden habe, und mit der Johannes-Apokalypse, so daß schon von daher hätte bekannt sein müssen, in welch einen, mythologisch gesprochen, Untergang, real aber gesprochen in welches Gemetzel diese ihre Treue führte, die eine reine Sippentreue gewesen, eine, könne man sagen, Nationaltreue unabhängig von Recht oder Unrecht und Völkermord, die Treue hier zum, wolle er sagen, Niccolò Tronje oder Hagen Machiavelli, wie wieder dessen alleine zum Haus, dem er diente, und alleine dessen Übermacht eben auch sein Mord an Siegfried gedient habe, der schließlich nur deshalb Nibelungen genannten Gibichungen, weil sie sich deren Schatzes bemächtigt hätten, dessen sich zuvor bereits Siegfried, auch er schon mit rohster Gewalt, bemächtigt habe, indessen es Hagen aus politischen Gründen und nicht etwa, die Erbschaftsfrage beiseite, zur eigenen Wohlfahrt getan – schließlich habe er ihn versenkt, diesen Schatz, an der tiefsten Stelle des Rheins, damit eben niemand seiner habhaft werde, wie überhaupt dieser Tronjer der pure Machtpragmatiker gewesen sei, denn die Gibichungen waren alleine reich genug, um auch ohne das Rheingold weiterhin zu herrschen, und doch, und damit zugleich, Repräsentant der feudalen Moral, ein nahezu Vorbild jeder Weltmacht, jedenfalls, sagte Meise, bis zu dem Ruf an des König Etzels Hof, dieser Einladung zum, keifte Meise, »totalen Krieg!«, den man da wollte, und insofern ein jedes solches Imperium nahezu immer an der persönlichen Gier seiner Repräsentanten zugrundegehe, weil das Verderben bringende Rheingold nämlich nach wie vor am tiefen Grunde laure, auch wenn Tiefe kein Begriff sei, der heutzutage noch einen Wert bedeute; das sei aber, sagte Meise, nur eine Täuschung, eine, sagte er, Hinwegsehtäuschung – der typische, sagte er, Irrtum, dem jeder Realismus erliege, während ich selber meine, kein Zugwind bläst die Tiefe mehr hinter den Öfen hervor, zumal es Öfen gar nicht mehr gibt und also auch nicht eigentlich Brandherde, außer natürlich bei Meise, der nach wie vor mit Kohlen heizt und von der Oberfläche nichts versteht. Er aber nahm, von seiner Suada erschöpft, einen Strohhalmzug aus dem Mojito und schwieg.
Durch die stehende warmschwüle Sommerluft waberte weiter Sambamusik von der Tanzfläche den Damm herauf, und vor unserem Tisch bildete sich eine lange Schlange, wie sie allabendlich auf den Einlass ins Theater wartet. Es waren da hübsche Frauen darunter, freilich nicht so schöne wie die beiden Grazien am Nebentisch, aber Meise hat für sowas sowieso keinen Blick, dachte ich, der ich den meinen nach wie vor kaum abwenden konnte und es auch gar nicht wollte, während er immerhin den Mond ansah, der milchigvoll und leuchtend an die Spitze des Fernsehturms heranglitt und aus der Strandbar Mitte ein in 3D nachgefilmtes Gemälde Vincent van Goghs erstehen ließ, aber ich zweifelte dran, daß Meise es merkte, der vor lauter Exaltation keinen Sinn für die Sinnlichkeit hat, schon weil, sagte er einmal, die Konsequenz nichts, formulierte er gekünstelt, Diesiges erlaubt, das ihm indessen jetzt aufzufallen schien, weil er plötzlich, nachdem er seinen Blick vom Mond wieder abgezogen und sinnend auf das Buch gelegt hatte,Götter & Helden, 1934, vom Raunen sprach, das am deutschen Verhängnis ebenfalls seinen Anteil gehabt, das Raunen vom Volksganzen, sagte er, das ja nichts als der schüttere, so drückte er es aus, Versuch sei, dem Gefühl dazuzugehören einen Begriff zu geben, der es rechtfertige und für den man heute Community sage, Solidarität und Wir sind das Volk – alles, schimpfte er, unbegriffene Wörter für die Soße der Einheit, die sich einen Leitstier sucht, Obama zum Beispiel, dem man mit der Naivität von Kindern zugejubelt habe, weil er Erlösung, sagte er, von, rief er wieder, »George W. Bush!« versprochen und also als wiederneuer Vater, betonte Meise, aufgetreten sei, als aber scheinbar, sozusagen, antiautoritärer, den seine Kinder für unantastbar, ja schlimmer: unangetastet hielten, er sei ja nicht einmal richtig schwarz, wie sich ja überhaupt alle nach wie vor nach dem Kyffhäuser, sagte Meise, sehnten, auch wenn sie es nicht wüßten: nach einem Erlöser, der drin sitze, woran sich gar nichts geändert habe, an dieser Sehnsucht nach der Lenkung und danach, mit einzugehen in eine, sagte er, Große Verbindung, und da eben seien die Nibelungen die allerschlimmste Identifikationsvorlage gewesen, die sich überhaupt denken lasse, vor allem in der wagnerschen Verfälschung, denn wo das Original ausnahmsweise einmal sanft gewesen sei, nachgebend, wartend, er, Meise, meine Siegfrieds Minnen um Kriemhild, man müsse sich das einmal vorstellen, daß er während der ganzen Zeit, also während eines kompletten Jahres, die Angebetete nicht ein einziges Mal habe zu Gesicht bekommen, finde sich bei Wagner nichts anderes als ein »Ey ficken, Gutrune!« – genau so, kaum daß er nach Worms gekommen, schnippe er die Frau zu sich heran, obwohl es doch das vielleicht einzig Spannende an den Nibelungen sei, wie hier starke und überhaupt Frauen die Geschicke lenkten, das sei für ein Epos des Mittelalters mehr als ungewöhnlich, ja revolutionär, auch wenn es schließlich wieder nur um Haß und Gewalt und um Machterhalt gehe, um imperiale, sagte Meise, Hoheit, wie bei, rief er wieder aus, »George W. Bush!«, woran auch Hebbels Version der Tragödie nichts habe ändern können, im Gegenteil nenne sie das Tragische nur, dessen Fratze jedem kenntlich werde, der sich nur vorstelle, wie zwar nicht, rief Meise, »George W. Bush!«, doch Hermann Göring habe der Kesselschlacht von Stalingrad das Schlachten in Etzels Saal als Vorbild gedient, die reinste Glorifizierung, sagte Meise, nun aber wieder leise, der massenhaften Selbstvernichtung, siebenhunderttausend, flüsterte er, siebenhunderttausend Menschen seien da zugrunde gegangen, und auch das hätten die Nibelungen, indem sie Nationalepos wurden, den Deutschen längst vorherprophezeit, so daß man die, betonte Meise, Dummheit geradezu mit Händen greifen könne und daß der Fluch eben sie, der Nibelungen Fluch, gewesen, nämlich daß jeder, der des Ringes Eigentümer würde, daran zugrundegehen werde, ob Einzelner, ob Volk, ob eine ganze Kultur. Also, sagte Meise und meinte, schien es, sich selbst, fluche er der Liebe, und er knöpfte sein Hemd auf und öffnete seinen freigelegten Bauch. Dann grapschte er die Schwarte, Götter & Helden, 1934, vom Tisch, stopfte es hinein und zog sein Hemd wieder drüber. Dennoch konnte man weiterhin, da er es nicht zuknöpfte, seine geradezu äffische Behaarung sehen, ja, er sah jetzt aus wie ein wagnerscher Nibelung selbst, zumal er unversehens aufsprang und sich an den Nachbartisch zu den jungen Frauen wandte, deren eine er völlig selbstverständlich bei der Hand nahm, nachdem er ihr einen Kuss auf den Mund gegeben und sie ihn, ich war fassungslos, angelächelte hatte, bevor sie mit ihm zur Treppe davonging, die hinunter zu den Tanzenden führt. Da glomm der Mond wie eine Sonne auf, ich mußte die Lider zusammenpressen, und als ich die Augen wieder öffnete, stand das Bode-Museum wie ein Märchenschloß da. Über die S-Bahn-Brücke zwischen Alex und Insel glitt ein ICE mit modellbahnerleuchteten Fenstern. Wir aber, die sitzengebliebene Freundin und ich, und jeweils an unseren Tischen, sahen die beiden in der Menge verschwinden, hörten wenig später Meise, der offenbar das Tanzbein schwang, bis zu uns herauf lachen, und die andere Freundin, durch den Samba, lachte mit ihm, was sich in der Musik eigentümlich verdoppelte, Lautsprecherechos wahrscheinlich, so daß es ganz so klang, als ob uns die Spreetöchter foppten.
Bornholmer Hütte
für Gerd-Peter Eigner
»Ach je«, sagte Gortzheimer. »Ach je. Alles soll immer so schnell sein.« Über der Theke lief grün und weiß ein Fußballspiel mit schwarzen Punkten. Gortzheimer war ein leicht untersetzter Mann in den frühen Fünfzigern, der sich seit ein paar Monaten nur noch alle sechs Tage rasierte: Das halte frisch, behauptete er. Tatsächlich schien er von Woche zu Woche jünger zu werden, offenbar im selben Maß, in dem er sich weigerte, weiterhin Fahrpläne, Öffnungszeiten oder Vorstellungsdaten zu akzeptieren. »Ich mag mich nicht mehr einspannen lassen«, erklärte er mir beim Bier, »ich gehe ins Kino, wann es mir paßt.« So stand er nun nicht selten vor geschlossenen Türen und mußte nach einiger Zeit unverrichteter Vergnügungsdinge wieder abziehen. »Lieber das«, sagte er, »als in der Schlange zu stehen und meine Zeit von anderen vergeuden zu lassen.« Ob er nicht so sehr viel mehr Zeit verliere? Ich leckte mir Schaum von der Oberlippe. Man könne keine Zeit verlieren, erwiderte er ruhig, man könne sie nur gestohlen bekommen … Er lachte. Aber ich sah ihm an, wie unglücklich er tief in seinem Herzen war.
Es ging ihm, logischerweise, auch finanziell nicht mehr gut. Seine Einstellung zur Zeit hatte auf seinen Beruf übergegriffen, so war er ohne Arbeit seit fast einem Jahr. Und da er sich obendrein weigerte, amtliche Sprechzeiten zu akzeptieren, war er quasi mittellos, – wenn man den kleinen Monatsscheck seines mittlerweile greisen Vaters einmal beiseite läßt, der selbst nur ein geringes Ruhegeld bezog. Ich konnte mir gut vorstellen, mit welch gemischten Gefühlen der aufrechte Mann – er war, hatte mir Gortzheimer erzählt, Vorarbeiter gewesen und wegen eines schweren Wirbelsäulenvorfalls frühberentet worden – in seinem Altersheim saß und in den Momenten, in welchen er Verzweiflung zuließ, den Kopf schüttelte. Hätte der Junge doch nur was Handfestes gelernt! Doch er liebte seinen Sohn, auch wenn er dessen Ansichten mißbilligte, und unterstützte ihn also.
Ich möge, sagte Gortzheimer, nur nicht denken, ihm sei es egal. »Ich hab mich mit dem Alten nur gestritten, er ist ein Geschwindigkeitsfanatiker, schon immer gewesen, Herbst, Sie glauben nicht, wie mich das schon als Jungen gequält hat! ›Mach mal hin, Kerl!‹, ›Mär nicht so rum!‹« – Das habe, erzählte Gortzheimer, seine ganze Kindheit, seine ganze Jugend bestimmt. Und war sein Erwachsenenleben über wirksam geblieben. Gortzheimer war in der Werbung gelandet nach Studienabschluß, hatte zum creative team einer großen Agentur gehört … »Doch wissen Sie«, erzählte er mir gleich am Abend unserer ersten Begegnung, »ich saß an meinem Schreibtisch, die drei flachen Bildschirme vor mir, Entwürfe, Druckpapiere, ein paar Notizen wegen Conny’s Schokoriegeln … nein, nein, ich hatte den Slogan schon, es war wirklich nicht so, daß mir nichts mehr eingefallen wäre … aber mit einem Mal dieses Gefühl: Was machst du hier eigentlich? Ich hielt mitten in der Arbeit ein, stierte durch die Bildschirme, saß, saß und spürte, Herbst, spürte die Zeit.« Er atmete durch. Nahm einen Schluck; er konnte, wie ich selbst, unfaßbar viel trinken, nur wurde er halt jünger davon.
Und jetzt – es war unsere achte oder neunte Begegnung, wieder saßen wir in der »Bornholmer Hütte« gleich bei mir um die Ecke – jetzt also hob er den Blick, der fast klar wurde und sich auf irgend etwas an meiner Nasenwurzel konzentrierte, Gotzheimer brauchte dies vielleicht als Halt, ich meine, wir waren bereits beim sechsten Halben. Er starrte und schwieg.
»Ja?« fragte ich.
»Ich liebe die Zeit«, sagte er. »Sie ist das einzige, was ich gegen meinen Vater verwenden kann. Ich hab das viel zu spät begriffen. Ich muß wieder dahin zurück, wo ich erwachsen wurde.«
Endlich begriff ich. Deshalb wurde er jünger. Jetzt starrte ich ihn an. Aber er war schon wieder in sich zusammengesunken und wirkte traurig, allerdings auf beinahe kindliche Weise. Ich konnte mir mit einem Mal gut vorstellen, wie er mit fünfzehn ausgesehen hatte, ja, wie mit fünfzehn saß er nun vor mir: scheu und ein wenig unsicher, fast unschuldig, ganz naiv. Und ich hörte, wie aus dem Zimmer nebenan der Vater rief: »Tempo! Tempo! Meine Güte! Muß bei dir immer alles so langsam gehen!« Der Fernsehlautsprecher über der Theke grölte. Gortzheimer lächelte. Ich war ziemlich besoffen, als ich nach Hause ging.
Im Blick eines Mädchens von allenfalls zwölf
Kleine Poetik des Reisens I
Es war ein bescheidener, doch nicht elender Ort im harten Licht der Sonne, nur die Treppe einer Siedlung im Hang. Die Mauer rechts schon zerbröckelt – aufgerissen in das Nachbargrundstück hinein, das voller kleiner Schuttstücke lag, Plastikkonsolen und Scherben. Links eine mörtelnde Hauswand, durch die – von Wellblechstufen abgetrennt – ein enger Abgang führte, aus dem eine Palme schütter herauswuchs. Sie langte, die Treppe, hinab auf ein schmales Plateau, das den Hof gab. Ich konnte aber von ihm nicht mehr als den Auftritt erkennen – und einen bunten Ball, der da auf ihm lag. Den sah ich zuerst.
An der hinteren, schräg angesetzten Brüstung, einer Art Zaun, hingen zum Trocknen bunte Badelaken. Um den Ball standen mit einem Mal Kinder.
Mein Blick hob sich an, glitt über die terrassenartig hinunterfallenden Dächer der tiefer liegenden Häuschen und stieg über der unter ihnen ausgebreiteten Stadt zum buschbestandenen Berg auf und den nackten Fels drüber hoch. Da meinte ich, zugleich das Meer und die Kaimauer wahrzunehmen, an der fern, als strahlendweißes Versprechen, gut vertäut mein Schiff lag. Meine Imagination – ich will sie eine Hoffnung nennen – verschneidet Perspektiven. Sie verbindet Bilder, für die in unseren Augen real nicht gleichzeitig Raum ist. Das Schiff verwandelte Treppe und Hof in einen literarischen Ort.
Dabei war bloß Mittag, wie oft in den Tropen schwirrend und stehend zugleich. In den, aus dem flachen Zentrum des die Muschel Lands bis an die Bucht überdeckenden Port Louis, stieg das Rauschen eines unentwegten Verkehrs. – Ich ließ mein Aufnahmegerät laufen, weil ich es mitschneiden wollte – und Töne von über der Stadt aus dem Hang.
Schotter zu Füßen seiner trockenen Wiese.
Gelbes scharfes, röhrichtes Gras, spärlicher Buschbaum und oben die Trutz aus gehauenen Lavasteinen.
Direkt an der Straße ein kantiger, ebenso dunkel starrender Felsbruch.
Gegenüber Haus neben Haus und die unebne Treppe, hinunter zum Hof und dem Ball und den Kindern.
Manche Orte saugen uns ein, ganz, wie wir selber sie trinken, wir können auch von Vergeistigung sprechen. Wiewohl, mir mißfällt das Abstrakte daran. Eine Verstoffwechslung ist es viel mehr: Gerüche werden nicht Geist, weder Düfte noch Gestank. Doch lassen sie sich in das locker Gefügte einer Sentenz transformieren, das Schwebende gleichsam des Satzbaus oder die Schwere und Schärfe eines einzelnen Worts. – Wie blitzten die Blicke, mit denen Port Louis mich empfing! Allein das Wort »blitzten«!
Ich war wie so oft als einer der ersten von Bord gegangen.
Schon vor Jahren hatte mir ein Freund von Mauritius erzählt. So hatte ich den Bon chic der touristischen Hafenmeile eiligst durchquert und war in das Kleine Mumbai getaucht, seinen hellen, zwischen den farbigen, in der Hitze an Marktständen gleichsam chillenden und nur in direkter Meeresnähe, dortiger Brisen halber, wehenden, selten flatternden Tüchern stets zum Sprung bereiten Sex.
An Straßenecken auf fliegenden, am Boden ausgebreiteten Decken Massen gefälschten Markennippes. Naht eine Streife, werden sie im Nu an ihren vier Zipfeln zu Säcken verknotet, mit denen huschen die indischstämmigen Händler, Jungens bisweilen, davon, um im Schatten eines Durchgangs auf Entwarnung zu warten, der nicht nur vor Polizei schützt, sondern auch kühlt. Ein Pfiff indes, ein hergekollertes Steinchen, schon kehren die fliegenden Händler, aber lässig, zurück und rückverwandeln die Säcke zu ausgebreiteten Decken. Die Ware wird von filgranen Gesten bronzener Finger, deren Nägel schimmern wie Perlmutt, lockend neu drauf geordnet.
Ein Roti noch, rhez Deva, am Marché central –gehackte, mit Kurkuma und Turmeric gewürzte, in dünnes Fladenbrot gerollte Gemüse, die gelbe Fingerspitzen machen –, schon stieg ich, im Halbrund meines flanierenden Gangs, im Südwesten der Stadt in den Hang, der sie quasi ausebben läßt. – Dort bleibst du stehn, um zu lauschen.
Die Augen schließen, rein auf die Klänge konzentriert.
Tappen, Geraschel: Über den bröckelnden Abbruch dieser kurzen Treppe klettert dir ein Mädchen entgegen, zwölf Jahre mag es zählen oder, wohl eher, erst elf. Schon blickt die Kleine ihn an, den fremden, von der Ozeansonne bekupferten Weißen, betrachtet ihn fast ohne Scheu, ein bißchen spöttisch sogar und scheint doch nervös auf dem Sprung zu ihren Freundinnen wieder hinabgestiegen zu sein. Die schaun zu ihr hoch, halten sie achtsam im Blick. Wiederum deiner streichelt ihr sacht das Gesicht. Eine Liebkosung dem Wind gleich, den wir sommers am Abend erwarten. – Sie, ihrer Wirkung schon lange gewiß, läßt sie zu. Dann dreht sie sich weg, beinah abrupt, und kichernd prescht sie wieder davon. Dies ist literarischer Ort. Denn er wird bleiben, nicht materiell in der Welt, vielmehr als ein Nu aus Bewegung, die mit Erinnerung flirtet, bevor sie’s schon ist.
Dann gab’s ein Gelächter sehr kleiner Vögel, die ich zuvor nie gesehen, auch wenn ich sie wahrscheinlich schon gehört hatte, jedenfalls zuweilen, als ich unter der prallen Sonne im Hang stand, den Rekorder in Händen. Wahr nahm ich sie aber erst jetzt, da – aufs seltsamste vorübergehend – nicht ein einziges Auto mehr fuhr. Zwar hier oben war ohnedies kaum Verkehr, sonderlich mittags. Doch fällt das Geräusch eines Motors härter ins Ohr als unten im tosenden Ort. Man kann ja sogar den eigenen Schritt und das Knirschen von Pneus auf dem Schotter nicht wirklich unterscheiden – derart versunken im sich dehnenden Jäh.
Wie ich auf Mauritius, mag einst aus der Kasbah Paul Bowles auf sein gesamtes Tanger hinabgeschaut haben – es erschaut haben –, wie es auch mich einmal ergriff, aber da | längst wie Paris, fühlte ich, erschrieben, ja besetzt war, ohne daß selbst metropole Massen es für neue zeugende Augen jemals wieder verwischen könnten, selbst nicht im demografischen Handstreich nachgefolgter Geburtenwellen. Daß etwas zum literarischer Ort wird, geschieht als Besetzung doch selbst, ist Besatzheit und -nahme – weniger aber der Dichter, vielmehr ihrer Leser, auch solcher, die ihn real niemals sähen. Es ist ein aus Ferne vereinnahmten Ort, dem beinahe fremd ist, wer in ihm lebt. So daß ich erschrak. Gibt es einen Kolonialismus der Dichtung? Einen gar und aber der Unschuld wie meiner im Angesicht dieses Mädchens?
Mit diesen Gedanken schritt ich weiter, durchmaß sie ihn.
Wie sähe hier dann Gerechtigkeit aus? Kletterte wohl das mauritianische Kind gleich, da ich fast weg war, zur Straße noch einmal hinauf, um mir jetzt, dem Fremden, nachzuschauen und ihrerseits mich zu besetzen? Wer mocht ich am sehr späten Abend dann werden, wenn sie ihr Schlummer zu Schlaf trüg? Verbünd sich auch ihr, wie mein Blicken mir, mit dem Fremden das Eigene zu einem Duft, der so sehr vertraut ist, daß er zu uns | fast nicht mehr gehört? Denn sind nicht Gerüche das Tiefste, dessen wir je uns erinnern, und aber fassen’s nie ganz? »Doch ein Treppenhaus ahnt sich, Stiege, der Gummibaum, dort, da die Tür, eine selig vertraute. Der Duft eines nahen Bohnerwachses ganz sicher nicht deiner Geschichte, aus Vorzeit und Vorhängen, gelb leuchtenden, bauschenden in einem Wind, der dem Kind weht im Bettchen und der es nicht einschlafen läßt. Frettchen, sie jagen am Dachstuhl und jagen die Entchen, mit denen die Decke so putzig bestickt ist. Bevor eine Stimme kommt, tröstend, bevor sie Gesicht wird und hebt dich zu sich ganz heraus.«
Welch eine wundervolle Begegnung! – wenn ich nun selbst Fantasie würd, ihre, des Mädchens, der ich es ganz offenbar nicht erschreckt, sondern deutlich die Neugier ihres Geistes hatte erregt, nämlich wo sie noch ganz Physiologie ist, der Seele. Der ich nur noch folgte, die Grund dieses Zaubers nicht war. Sondern es waren das Treppchen unter der Sonne, der Hof und der Ball: indem und wie ich sie ansah. Das hatte das Mädchen heraufgelockt.
Nicht nur Geschöpfe, auch Orte verströmen Pheromone. Es sind Erinnerungsstoffe, was uns erfaßt und uns anzieht oder uns weg von sich stößt und was schließlich bestimmt, ob etwas literarischer Ort, ein poetischer, wird oder zum Ort einer Literatur, bloß ihrem Schauplatz. Hingegen, ob er Affaire bleibt oder lebenslang Liebe, bewirkt etwas andres, zum Beispiel ein wartendes Schiff – und ob er Kinder empfangen und austragen darf, die uns verändern, doch ihm auch das eigne Gesicht.
Der Duft dieses Mädchens? Ich weiß ihn schon nicht mehr.
Rasend fliegen die Bilder. Ich bin wieder hinabgestiegen, stehe auf der Royal Road, vor der Jummah Masjid, das heißt »große Moschee«, und China Town nahe. Dort gleichen die Eingangsbögen je zur zentralen Straße frappierend den Tori von Tokyo. Touristen gibt es auch hier kaum. Denn praktisch sehn sie nur Schmutz, nicht die Verheißung der Gleichzeitigkeit eines Straßenzugs von Fernost mitten in einem arabischen Indien. Wo auch mich, obwohl ich nicht gläubig, der Muezzin ruft. So trete ich ein ohne Scheu.
Ich schlüpf aus den Schuhen und nehm die zwei Stufen. Blaue Plastikmatten sind ornamental über den Boden gedeckt, die kleinen Teppiche erwartend, auf die sich die Betenden knien, die sie mitgebracht haben. Rechts hinter Säulen, die Durchgänge offen, sitzen Männer am Boden, vor sich die heiligen Schriften. Tatsächlich sind es noch Rollen. – Links ein Bassin voller Fische, japanischer Karpfen und anderer Arten, ebenso prall. Aus dem Beckenrahmen schauen die Wasserhähne wie Notre Dames Gargoyles; vor jedem im Boden verankert ein Hocker. Dort wasche auch ich mir die Füße, die Arme und Hände, tauch mein Gesicht in den See ihrer Höhlung. Die Reinigung schon ist Meditation.
Hinter dem Bassin, hinter weiteren Säulen, eine kleine Koranschule. Der Lehrer spricht vor, die Rute in der Rechten. Die Knaben, im Chor, sprechen nach. Wer unaufmerksam ist oder gar die Sure beschädigt, wird mit scharfem leisen Wort nach vorne gerufen, stellt sich mit dem Rücken zum Lehrer und erträgt den zischenden Hieb. Nur ein einziger Junge verzieht dabei das Gesicht, als niemand außer mir, einem Fremdem, es sieht, und setzt sich dann still in die Reihe zurück. Erneut muß ich an Tanger denken, Paul Bowles Paradies homoerotischer Lieben, auf die wie auch hier peinlich hohe Strafen stehen. – Ist wohl ihr Wert, nämlich beider, in der Libertinage gefallen?
Wert der Strafe? Sie, mehr als der Sünder, wertet die Sünde höher als er, macht sie geradezu kostbar. Dies das Geheimnis jeder Entgrenzung. Wir erfahren’s nur nicht mehr, wo anything goes. Der demokratischen Macht ist es als institutioneller nur recht, der gegenüber Protest selbst demokratisch gesittet. Das läßt sich im Fremden erfahren, dem der Wert noch nicht Markt ist und zu tief von uns unterschieden, um sich widerstandslos absorbieren zu lassen. Statt dessen spricht dauernd das Unvertraute ein und weist unsre Projektionen zurück, die wir für universale Übereinkommen halten. Unsere Haut ist dort dünner als hier, wiewohl wir als Fremde fremd eben sind, fremdselbstverständlich. So läßt man uns in maßvollem Rahmen gewähren. Wiederum wir schenken dem Andren ein wenig unsres fremden Blickens, erstatten ihm eine Objektivität, die ihm ansonsten im, wie uns selber daheim, nur Subjektiven verschwömme. Auf diese Weise werden wir einander zu literarischen Orten. Der fremde Blick amalgamiert mit dem Eignen. Projektion wirkt auch hier, doch als Spiegel, die zurücksehen können.
Das Eigene, um solch ein Ort zu werden, muß drum sehr viel stärker verfremdet werden, benötigt eine nahezu willentlich erzwungne Distanz. Hingegen der Reisende fast organisch auf sich und, »alt« gesprochen, »die Heimat« durchs Fremde als auf etwas Fernes zurücksehen kann, das ihm indes doch vertraut, und auf das Fremde als ein Nahes, das ihm unvertraut ist. Denn kommen Vertrauen und Nähe zusammen – also Verlaß – , sind sie gleichsam »von sich aus«, entsteht kein literarischer Ort, sondern es bleibt bei Orten der Literatur. Für einen literarischen Ort muß etwas fehlen, das wir erschaffen. Es füllt dann die Lücke, wie Luft in ein Vakuum strömt.
Lieblingsorte der Dichter waren nicht selten Hotels; ich kenne keins, das literarischer Ort hernach geworden; sie blieben wohl alle Orte der Literatur, heutzutage mehr der Filmhistorie – wie das kleine Café auf Montmartre, wo »Amélie« gedreht worden ist und nun die Touristen sich drängen: Sie quellen hinein, und sie knipsen. Hingegen der literarische Ort ist Montmartre ganz; selbst aus dem gentrifizierten Umbau schimmert noch Dichtung heraus, eine, deren Geschichte zum literarischen Ort ward, also der Raum nicht, sondern die Zeit. Wenn wir dort stehenbleiben nachts und, bebender Nüstern wie Tiere, wittern, spüren wir es, erspüren den Duft. Montmartre ist Mythos und nährt die Besucher als Mythos; sie gehen durch ihn, nicht die Straßen. Er säugt, indem sie ihn atmen, selbst die Bewohner, und stillt sie. So gibt es Montmartre denn gar nicht, nur noch das 18. Arrondissement. Montmartre zu suchen, ist nostalgische Archeologie, und was wir ausgraben können, gehört ins Museum oder zerfällt. Ein Totes, anders als das mauitianische Mädchen, schaut nicht zurück, ist als Spiegel erblindet. Deshalb gibt unser Blick auch