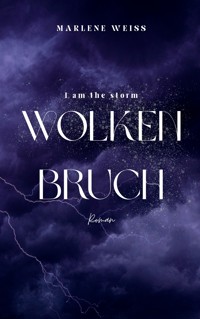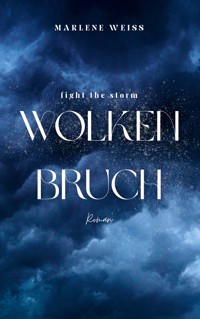
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wolkenbruch
- Sprache: Deutsch
Die Schneeflocken stechen wie Dornen in meinem Gesicht. Stöhnend versuche ich mich aufzurichten, aber meine Knie geben unter mir nach. Mir ist kalt. So unsagbar kalt. * Der schlimmste Fall ist eingetreten. Evelyn hat sich verraten. Sie hat vor aller Augen ihre Gabe benutzt, um Prinz Taylor das Leben zu retten. Nun ist sie auf der Flucht und muss den beschwerlichen Weg ins helle Schloss antreten. Dort ist sie nicht nur sicher vor dem dunklen König, sondern hat auch eine ernsthafte Chance, ihn zu bekämpfen. Auf der Reise muss sie ihre Gabe besser kennenlernen, um sich zu schützen, denn bis ins helle Schloss ist es ein weiter Weg. Zwischen Schneestürmen und Angriffen des dunklen Königs, versucht Evelyn stark zu bleiben. Doch wie viel kann sie noch ertragen? * Der zweite Teil der Wolkenbruch Trilogie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Playlist
WOLKENBRUCH II
Runaway – AURORA Atlantis – Paula Hartmann & Trettmann Surrender – Natalie Taylor A Little Death – The Neighbourhood Nothing Is As It Seems – Hidden Citizens (feat. Ruelle) Divenire – Ludovico Einaudi Touch – Sleeping At Last Run Boy Run – Woodkid
Calm her chaos, but never silence her storm.
K.Towne Jr.
Inhaltsverzeichnis
TEIL I: KÄLTE
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
TEIL II: REBELLIN
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
TEIL III: MIT LETZTER KRAFT
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
TEIL I KÄLTE
KAPITEL 1
Ich kann es hören.
Es durchfährt mich wie die Druckwelle einer Handgranate, die alles in Stücke reißt und nichts lebendig zurücklässt. Der Schmerz ist so brutal und so laut.
Ich kann hören, wie es mein Herz restlos in Stücke reißt. Und ich weiß auch, wieso es so wehtut. Nämlich, weil es sich richtig angefühlt hat. Weil es sich so verdammt richtig angefühlt hat, mit ihm zusammen zu sein.
Das Eintauchen ins Wasser dauert länger als der Fall selbst. Kaum durchbrechen meine Beine die Oberfläche des Flusses, spüre ich die unbändige stechende Kälte des Wassers und zucke zusammen. Meine Tränen vermischen sich mit dem Fluss und ich lasse es zu, dass mich die Schwerkraft nach unten zieht.
Ich weiß, dass der Sprung von der Brücke meine einzige Chance war, um zu überleben, denn ich habe mich verraten. Ich habe vor Harris und der ganzen Mannschaft meine Gabe benutzt, um Taylor zu schützen. Mein Magen krampft sich zusammen bei dem Gedanken an ihn. Und ich dachte, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben. Unser Streit vor der Fahrt zum Kampffeld war vollkommen unbedeutend, jetzt, da wir sowieso getrennt sind.
Ich bin solch eine Idiotin!
Kugeln durchdringen die Wasseroberfläche, aber das interessiert mich herzlich wenig, denn das Wasser schwächt ihre Geschwindigkeit ab und außerdem bin ich schon viel zu tief gesunken, als dass sie mich erreichen könnten. Abgesehen davon könnte mich das Wasser sofort heilen, sollte ich getroffen werden. Also verharre ich einfach in meiner Position und bewege mich nicht von der Stelle.
Es war so klar. So klar, dass ich mich eines Tages selbst verraten sollte. Nicht der dunkle König und auch nicht Prinz Taylor, dem ich so lange kein Vertrauen geschenkt habe, waren daran schuld, dass ich erwischt wurde, sondern ich.
Ich ganz allein.
Ich bin so wütend auf mich selbst, dass ich keinen klaren Gedanken fassen kann. Meine Kehle ist wie zugeschnürt, meine Fingernägel bohren sich in die Innenseiten meiner Handflächen und ich bin vollkommen unfähig mich zu bewegen. Salzige Tränen des Zorns verbinden sich mit dem süßen, rettenden Wasser des Flusses.
Plötzlich durchdringt etwas Größeres die Wasseroberfläche, etwas in der Größe eines Menschen. Jetzt werfen sie also schon Bodentruppen nach mir? Dass ich nicht lache. Doch da wird mir bewusst, was da gerade zu mir in den Fluss gefallen ist und mir stockt der Atem.
Es ist niemand geringeres als der Prinz des dunklen Königreiches, Sohn unseres Königs Richard und Kronprinz. Taylor.
Ich reiße die Augen auf und muss ein paar Mal blinzeln, um sicher zu gehen, dass ich mir nicht beim Sprung den Kopf angestoßen habe und jetzt halluziniere. Nein, tue ich nicht, denn da ist er, kaum drei Meter von mir entfernt. Ein ersticktes Lachen entweicht mir und ich schlage mir eine Hand vor den Mund.
In diesem Moment entdeckt er mich und selbst aus der Entfernung sehe ich seine unwahrscheinlich schönen Augen ganz klar. Seine Lippen verziehen sich zu einem schiefen Lächeln und ich kann mein Glück kaum fassen. So schnell es die Strömung zulässt, schwimme ich zu Taylor, umklammere seinen Körper und drücke ihn ganz fest an mich. Im eisigen Wasser spüre ich seine Wärme stärker denn je.
Er ist hier. Er ist hier!
Plötzlich plätschern wieder mehr Kugeln durch die Wasseroberfläche und ich ziehe Taylor lieber etwas tiefer hinab, damit uns keine davon trifft.
Ich kann es immer noch nicht fassen, dass er tatsächlich bei mir ist. Ich ziehe ihn zum Boden des Flussbettes und blicke nach oben. Das schwache Sonnenlicht flackert im Wasser und wird von vereinzelten Kugeln durchbrochen. Ich bin so fasziniert von diesem Anblick, dass ich erschrecke, als Taylor mich an der Schulter stupst. Irritiert blicke ich ihn an und frage ihn mit den Augen: Was ist los?
Er deutet sich an die Kehle und macht Bewegungen Richtung Oberfläche. Ach ja, sicher, wir brauchen ja Sauerstoff. Ich bin nicht überrascht, dass ich selbst länger als er unter Wasser bleiben kann, aber Taylor braucht Sauerstoff. Wieso er durch seine Gabe, die Luft zu kontrollieren, nicht auch länger hier unten bleiben kann, ist mir ein Rätsel, aber das ist im Moment nicht wichtig. Angestrengt suche ich nach einer Lösung unseres Problems.
Kurzentschlossen presse ich meinen Mund auf seinen und puste ihm meine überschüssige Luft in die Lungen. Einen Versuch ist es wert.
Als sich unsere Münder voneinander trennen, grinst mich Taylor frech an und zeigt einen Daumen nach oben. Ich bin so überglücklich, dass ich einen Moment unsere Situation vollkommen vergesse.
Wir warten noch einige Sekunden, bevor ich Taylors Hand drücke und ihm bedeute, dass wir unter die Brücke schwimmen werden. Er folgt mir. Als uns der Schatten der Brücke bedeckt, strecken wir vorsichtig die Köpfe aus dem Wasser. Zum Glück kann ich niemanden erkennen und wir waten langsam ans Ufer, weiterhin im schützenden Dunkel der Brücke. Ein Schuss. Kälte ergießt sich über meinen Rücken. Wer war das? Doch die Person, die die Kugel abgefeuert hat, scheint noch auf der Brücke zu stehen.
„VERDAMMTE ARSCHLÖCHER!“, brüllt Harris so laut über den Fluss, dass seine Stimme von der Ferne als Echo zurückgerufen wird. Trotz der ernsten Situation kann ich mir ein Grinsen nicht verkneifen und blicke mich zu Taylor um, der ebenfalls mit sich kämpft, nicht zu lachen.
„Harris, die schaffen es eh nicht weit. Lass uns gehen, wir können nichts mehr tun“, sagt jemand zu Harris, was man hier unten überraschend gut verstehen kann.
„Der Prinz ist da unten! Die Göre ist mir scheißegal, aber Richard dreht mir den Hals um, wenn ich seinen Sohn nicht wieder mitbringe!“ Ich ziehe die Augenbrauen hoch nach dieser Ansage.
„Die Wächter werden sie finden. Jetzt komm mit, oder willst du etwa durch den Fluss tauchen und nach ihnen suchen?“
Daraufhin sagt niemand mehr etwas und ich glaube schon, dass sie sich endlich von der Brücke entfernen, da brüllt Harris ein markerschütterndes „Scheiße!“ über den ganzen Fluss, bevor es erneut still wird. Ich blicke auf und suche den Rand der Brücke nach Bewegungen ab. Es ist niemand zu sehen.
Erleichtert atme ich aus.
Ich wende mich zu Taylor um und schließe ihn in die Arme.
„Du bist hier“, wispere ich den Tränen nahe und kralle mich in seiner Jacke fest. „Wieso?“
Sanft, aber bestimmt löst er uns voneinander und sieht mir in die Augen. „Evelyn, ich dachte, das hatten wir alles schon mal.“
Der Blick seiner wunderschönen grauen Augen hypnotisiert mich geradezu. „Ja ich weiß, aber-“
„Nichts aber.“ Er seufzt. „Ich wollte es nicht gleich sagen, weil ich Angst hatte, dass du anders oder schwächer empfindest als ich. Aber ich bin mir meiner Gefühle für dich sicher. Dich einige Wochen nicht sehen zu können, wenn du in deinen neuen Wohnsitz umziehst, hat mir nicht gepasst. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, dass ich dich niemals wieder hätte sehen können, wäre ich nicht mit dir gesprungen. Niemals wieder. Schon, wenn ich es ausspreche ... Vermutlich gehe ich damit ein Risiko ein, aber das ist okay, damit du endlich, verdammt noch mal, kapierst, wieso ich dir immer nachrenne, oder das Bedürfnis habe, dich zu beschützen.“ Er sieht mich noch durchdringender an und in meinem Bauch kribbelt es, weil ich ahne, was er mir gleich sagen wird.
„Ich liebe dich, Evelyn.“
Mein Atem stockt und ich bin einen Moment wie erstarrt. Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, was für ein Verhältnis Taylor und ich haben, ob wir von längerer Dauer sein sollten oder ob ich doch nur irgendjemand für ihn bin. Denn wieso sollte der vom Volk verehrte Prinz des dunklen Königreiches jemanden wie mich mögen?
Ich schlinge meine Arme um seinen Hals und ziehe ihn zu mir hinunter. „Ich liebe dich auch, Taylor.“
Er grinst schelmisch und schenkt mir einen Kuss, der mir den Atem raubt. „Ach und danke, dass du mir das Leben gerettet hast.“
Ich lache und winke ab, als wäre das eine Kleinigkeit. „Ach, nicht dafür.“
Wir lachen und küssen uns erneut hektisch. Mein Kopf ist immer noch durcheinander vom Kampf und mein Blut voller Adrenalin.
Ich streiche Taylor durch sein triefendes Haar und bemerke erst jetzt wieder, dass wir bis auf die Knochen durchweicht sind. Taylors Lippen sind eiskalt und er zittert leicht.
„Warte einen Moment, ich bringe das in Ordnung“, sage ich und trete einen Schritt zurück. Noch vor dem nächsten Wimpernschlag trockne ich unsere Körper und die flachen Rucksäcke mit meiner Gabe.
„Viel besser, danke“, er grinst. Ich betrachte einen Moment sein schönes Gesicht und würde gerne wieder zu ihm treten, aber die Gegenwart holt mich viel zu schnell ein. Es wird mir schwer ums Herz.
„Was ist mit deiner Schwester?“, will ich unsicher wissen. Grace bedeutet ihm die Welt, er liebt sie. Als ich sie das erste Mal richtig kennengelernt habe, war das auf dem Ball zu Ehren ihres siebzehnten Geburtstags. Dort wurde bekanntgegeben, dass ihre Gabe das Feuer ist. Sie ist so fröhlich und lebhaft und man muss sie einfach gernhaben.
„Grace?“ Er seufzt. „Als ich da oben war und vor der Entscheidung stand, ob ich dir folgen oder bei Harris bleiben soll, der wie am Spieß gebrüllt hat, da habe ich sehr wohl an Grace gedacht. Ich bin aber schnell zu dem Schluss gekommen, dass sie ohne mich zurechtkommt und ich nicht länger ihr Babysitter sein muss. Da bin ich lieber dein Babysitter.“
Er grinst mich frech an, was seine Augen zum Funkeln bringt.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. „Soso. Vernünftig genug, ein Babysitter zu sein, bist du aber leider nicht, nachdem du einer Flüchtigen ins Ungewisse gefolgt bist und ein Leben in Reichtum und jede Verantwortung zurückgelassen hast.“
„Autsch“, spielt Taylor und fasst sich an die Stelle über seinem Herzen. „Das war hart.“
„Ich bin froh, dass du da bist“, sage ich lächelnd und trete wieder zu ihm. „Ich dachte, ich hätte durch diesen Bruchteil einer Sekunde alles zerstört, das aus uns hätte werden können.“
„So schnell wirst du mich nicht los“, erwidert er und ich muss lachen.
„Danke, Taylor“, wispere ich und lehne mich gegen seine Brust. „Ich habe mich noch nie so allein und verzweifelt gefühlt, als ich vorhin ins Wasser eingetaucht bin. So kurz der Moment auch war.“
Er streicht mir behutsam über den Kopf und seine Berührung sagt mehr als tausend Worte.
„Du hast nicht zufällig einen Plan, was wir jetzt machen können?“, frage ich, während ich mich erneut von ihm löse.
„Lass uns erst einmal ein Feuer machen, vielleicht fällt uns ja etwas ein“, meint Taylor. Ich entscheide, dass das vorerst vernünftig klingt, und folge ihm.
Wir sammeln ein paar trockene Zweige zusammen und Taylor zaubert in Sekunden daraus ein Feuer. Ohne irgendetwas tatsächlich zu berühren, reibt er zwei Stücke Holz aneinander und lässt so einen Funken entstehen, der das Holz zum Brennen bringt.
„Du kannst ja viel mehr, als du mir damals am Strand gezeigt hast“, gestehe ich zerknirscht.
Er dreht sich grinsend zu mir um. „Dann wäre ja die ganze Spannung zerstört.“
Ich setze mich auf die Steine neben dem Feuer und wärme meine Hände an der Hitze der Flammen. „Also, irgendeine Idee, was wir machen könnten?“
Taylor setzt sich neben mich und blickt eine Weile schweigend ins Feuer. „Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung.“
Erschöpft lasse ich mich an seine Schulter sinken und schließe die Augen.
Wir sitzen einige Minuten schweigend da und starren in die Flammen. Wenn ich doch nur Zuhause bei meiner Familie sein könnte, bei Mary, Liz, Amira und den Kindern, bei Chris und Maya, Max und Noah und sogar Lawrence, den ich ja eigentlich gar nicht leiden kann. Und bei meinen Eltern.
Meinen Eltern…
Die Erkenntnis fällt mir wie Schuppen von den Augen, dass ich reflexartig aufspringe. Wie konnte ich nur so dumm sein und daran nicht denken? Wir haben einen Plan, den einzigen, der in unserer Situation Sinn macht, nämlich ins andere Königreich fliehen, zu meinen Eltern, und dort Schutz suchen.
„Was ist jetzt passiert?“, will Taylor wissen und blickt mit einer Mischung aus Neugier, Belustigung und ja, tatsächlich Sorge zu mir auf.
„Ich habe einen Plan!“
Taylor setzt sich sofort auf. „Dann lass mal hören.“
„Ich habe dir doch auf dem Ball erzählt, dass meine Eltern gar nicht tot sind, sondern geflohen, und zwar ins helle Königreich.“ Taylors Blick wird immer klarer, als er zu verstehen beginnt. „Sie sind König und Königin! Wenn wir es zu ihnen schaffen, haben wir endlich eine richtige Chance gegen deinen Vater.“
Taylors Mundwinkel heben sich. „Dann haben wir tatsächlich einen Plan.“
KAPITEL 2
Kaum eine Stunde später schmilzt die Sonne in den Horizont. Taylor und ich beschließen, unter der Brücke unser Nachtlager aufzuschlagen. Hier sind wir windgeschützt und bis die Wächter hier ankommen, dauert es noch eine ganze Weile. Dass wir endlich einen Plan haben, erleichtert mich und stimmt mich gleichzeitig aufgeregt.
Wenn wir es tatsächlich bis zum Schloss schaffen, werde ich zum ersten Mal meine Eltern treffen, und dieser Gedanke ist schon ziemlich aufregend. Es gibt so vieles, das ich ihnen erzählen möchte, das sich angestaut hat, seit ich klein war und so vieles, das ich sie fragen möchte. Ich weiß nicht mal, wie sie jetzt aussehen. Hoffentlich erkennen sie mich oder glauben mir wenigstens, dass ich ihre Tochter bin. Doch ich beschließe, dass es für solche Gedanken noch zu früh ist. Die kann ich mir noch stellen, wenn wir vor dem hellen Schloss stehen, aber jetzt würden sie mich nur verunsichern.
Dass uns bald die Wächter auf den Fersen sein werden, macht mich erneut nervös. Ich bin schon zweimal mutierten Menschen begegnet und beiden Erfahrungen bedarf es nicht unbedingt an Wiederholung. Abgesehen davon muss ich beinahe durchgehend an das Massaker im Dorf jenseits des Flusses denken. Auch ich habe heute getötet. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren, irgendwann habe ich die Anzahl aus den Augen verloren, aber ich weiß, dass diese Menschen nicht die letzten gewesen sind, die ihr Leben wegen mir lassen werden. Und das macht mir furchtbare Angst.
„Evy?“, reißt mich Taylor plötzlich aus meinen Gedanken. Erschrocken starre ich ihn an. Doch er hält mir nur eine der Wurzeln hin, die wir vorhin gesammelt haben, und mustert mich besorgt. Zerknirscht greife ich nach einer und beginne darauf herumzukauen, als wäre alles in bester Ordnung. Das zähe Stück hat die Konsistenz von einem Autoreifen, weshalb ich es schnell herunterwürge und mit einem Schluck aus meiner Wasserflasche nachspüle. Als Taylor mir noch eine Wurzel anbietet, lehne ich ab.
„Hast du eine Idee, wie wir morgen vorgehen?“
Taylor blickt vom Feuer auf und die Flammen spiegeln sich in seinen Augen. „Noch nicht wirklich, aber ich weiß von den Versammlungen, vor allem wegen des Angriffs auf das Dorf, dass es hier auf der hellen Seite noch irgendwo ein Dorf gibt, es ist aber einige Stunden entfernt. Dorthin würde ich gehen. Wir brauchen Ausrüstung, Munition, ein Zelt, solche Sachen. Spätestens in ein paar Tagen beginnt es zu schneien und ich habe nicht unbedingt vor, zu erfrieren.“
„Klingt sinnvoll. Weißt du, in welcher Richtung es liegt und wie lange wir laufen müssen?“
„Es liegt auf jeden Fall im Osten und ist, schätze ich mal, einen dreiviertelten Tagesmarsch entfernt. Wenn wir zügig laufen, sollten wir gegen Nachmittag dort sein … sofern wir uns nicht verlaufen.“
Ich nicke und erneut senkt sich Schweigen über uns.
Das winzige Feuer ist unsere einzige Lichtquelle. Der Mond wird verdeckt von dicken Wolken, was alles um uns herum düster und unheimlich wirken lässt. Direkt neben uns fließt der Fluss still dahin, dessen Wasser so dunkel und trüb, dass es aussieht wie dahingleitender Teer.
„Darf ich dich etwas fragen?“, bittet mich Taylor plötzlich und ich sehe ihn überrascht an.
„Sicher.“
„Sollte dir das Thema nicht gefallen, kannst du mich jederzeit bitten, still zu sein, aber ich würde es gerne verstehen.“ Im flackernden Feuerschein wirkt sein Gesichtsausdruck geheimnisvoll. Seine sturmgrauen Augen funkeln neugierig.
„Versuchs einfach“, antworte ich, ebenfalls neugierig, was ihn so interessiert.
„Du hast gesagt, dass deine Eltern dich verlassen haben und ins helle Königreich geflohen sind“, beginnt er und ich nicke, wohlwissend, was als nächstes folgt, und ich werde nicht enttäuscht. „Wieso haben sie dich nicht mitgenommen?“
Ich atme tief ein und senke meinen Blick auf das Lagerfeuer. „Weißt du, diese Frage habe ich mir früher oft gestellt. Ich dachte, dass sie mich vielleicht verlassen haben, weil sie mich nicht wollten und mit ihrer Flucht ein neues Leben anfangen konnten. Ich habe es nie verstanden, bis zu meinem letzten Geburtstag.“
Ich hebe den Blick zu seinem Gesicht, er hat die Augenbrauen zusammengezogen und lauscht mir gebannt. Vorher haben wir hauptsächlich über meine leichte Vergangenheit gesprochen, über meine Herkunft und Familie im Waisenhaus. Dieses Thema hat mich als ich jünger war innerlich aufgefressen. Ich konnte nicht verstehen, wieso sie mich hassten, was konnte ich als kleines Kind schließlich falsch gemacht haben?
„Und dann stellte sich heraus, dass sie ins helle Königreich geflohen sind, weil sie die letzten lebenden Nachfahren des hellen Königs sind.“
„Woher weißt du das?“
„Meine Mom hat mir einen Brief geschrieben, am Tag ihrer Abreise. Sie hat ihn in einer Schmuckschatulle versteckt, die mit einem Zahlencode gesichert war. Darin hat sie geschrieben, wie leid ihr das alles tut, dass sie mich haben glauben machen, dass ich ihnen egal bin.“
Ich spüre den Schmerz erneut in mir aufflammen, der mich früher an den Rand der Verzweiflung gebracht hat. Ich merke, wie meine Augen feucht werden, und senke schnell den Blick. Leise räuspere ich mich, bevor ich fortfahre. „Sie hat auch geschrieben, dass sie mich nicht mitgenommen haben, um zu verhindern, dass wir an der Grenze erwischt werden … und alle sterben.“
Taylor nickt und senkt ebenfalls den Blick.
Wir schweigen eine ganze Weile und sehen den Flammen bei der Arbeit zu.
Fröstelnd wache ich auf.
Wir ruhen auf dem Boden, spitze Steinchen bohren sich in meine Haut. Die Kälte kriecht von allen Seiten unter meine Klamotten und verursacht mir eine Gänsehaut. Selbst Taylor, der sich eng an mich geschmiegt hat, fühlt sich kalt an.
Langsam versuche ich, mich aus seiner Umarmung zu befreien, um aufzustehen. Das Feuer muss mitten in der Nacht ausgegangen sein, denn die Überreste glühen nicht einmal mehr. Ich schleiche zu unseren Rucksäcken, trinke einen Schluck aus meiner Feldflasche, während sich meine Sicht weiter klärt.
Zarte Nebelstreifen wabern über das Wasser. Die Sonne blitzt bereits hinter den Bäumen hervor und spiegelt sich auf der Wasseroberfläche des Flusses. Sie tanzt mit dem Nebel.
Wie magisch angezogen setze ich mich ans Ufer.
Meine Gedanken schweifen ab, zu Chris, Maya und Max. Was Harris meinen Freunden wohl erzählt haben mag? Die Wahrheit? Bestimmt nicht.
Er wird sicher irgendetwas verdreht haben, um Taylor und mich schlecht dastehen zu lassen. Mir fehlt Maya jetzt schon mit ihrer überdrehten, herzlichen Art, Max, der immer und überall alle zum Lachen bringt und Chris, der mich nur in den Arm nehmen muss und dann wird alles wieder gut.
Plötzlich muss ich an Kristen denken. Mir wird übel und es treibt mir Tränen in die Augen. Sie hat sich vor mich geworfen, hat eine Kugel für mich abgefangen und das alles nur, weil ich sie damals vor dem Sprung von der Klippe bewahrt habe. Ihr Gesicht taucht vor meinem inneren Auge auf und der Ausdruck darin, als das Leben langsam aus ihr erloschen ist. Ich zwinge die Tränen nieder, es hat sowieso keinen Sinn zu weinen.
Hinter mir höre ich ein Geräusch und fahre erschrocken herum. Taylor richtet sich gerade auf und klopft sich den Staub von den Kleidern. Erleichtert atme ich aus und schenke ihm ein Lächeln. Er lächelt zurück, was in mir eine angenehme Wärme ausbreitet, die die bösen Gedanken einen Moment aus meinem Kopf verbannt.
Ich richte meinen Blick wieder auf das ruhige Wasser hinaus und lasse mich von diesem Anblick einnehmen, bis sich Taylor einige Minuten später neben mich setzt. Wir reden nicht, sondern blicken nur auf den Fluss und den wunderschönen Wald jenseits davon.
„Ich würde gerne stundenlang hier sitzenbleiben“, flüstere ich in die Stille. Aus dem Augenwinkel sehe ich, dass Taylors Mund sich zu einem Lächeln verzieht. „Ich möchte hierbleiben und solange warten, bis die Sonne wieder untergeht.“ Ich sehe zu Taylor, der meinen Blick sofort erwidert.
„Ich weiß“, antwortet er, legt eine Hand um meinen Kopf und zieht mich zu einem Kuss auf die Stirn zu sich. Diese Geste, so schmerzlich kurz sie auch gewesen sein mag, lässt mich neue Energie schöpfen. Unsere Situation ist nicht gerade perfekt, aber solange Taylor bei mir ist, ist alles gut. Als sich seine Lippen von meiner Haut lösen, merke ich, dass ich sie bereits vermisse, und ziehe ihn zu mir herunter, um ihn zu küssen.
Ich presse meine Lippen auf seine und verliere meine verwirrten Gefühle irgendwo zwischen heißen Atemzügen und der hektischen Bewegung unserer Münder. Wie glücklich ich doch bin, dass er da ist. Sowohl die Bilder der Toten, die ich zu verantworten habe, als auch die Wächter, die höchstwahrscheinlich bereits auf uns gehetzt wurden, geistern mir im Kopf herum. Diese Bilder werden mich nie verlassen.
Als wir uns voneinander trennen, spüre ich, dass meine Wangen feucht sind. Taylor streicht vorsichtig mit dem Daumen darüber, was mich noch stärker zum Weinen bringt.
„Evy?“, flüstert Taylor ganz leise und streichelt weiter behutsam mein Gesicht.
„Ich habe Angst, Taylor“, gestehe ich leise.
Er sagt erst einmal nichts, sondern nimmt mich nur in den Arm. Seine Wärme tröstet mich, hüllt mich ein, wie eine weiche Decke. „Ich weiß“, antwortet er und küsst mich aufs Haar. „Ich weiß.“
Wir brechen auf. Der Rucksack auf meinem Rücken gibt mir wenigstens ein winziges Gefühl von Sicherheit, wie ein Anker, an den ich mich klammern kann.
Taylor weiß genau, wohin wir gehen müssen, er führt uns durch den Wald, als gäbe es keine leichtere Übung für ihn. Natürlich habe ich in meiner Abschlussprüfung auch den Weg durch den Wald gefunden und mich dabei an der Sonne orientiert, trotzdem bin ich froh, dass Taylor gerade das Steuer übernimmt. Auch, weil ich mich noch nicht ganz wiederhergestellt fühle nach dem Kampf gestern. Um Mittag herum machen wir eine kleine Pause. Wir sprechen kaum miteinander, nur wenn Taylor mit mir über den Weg redet, was eigentlich an einen Monolog grenzt, da ich mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt bin.
Irgendwann treffen wir auf eine Straße, was mich erleichtert aufatmen lässt. Wir sind auf dem richtigen Weg.
Wir folgen der Straße, gesäumt von dichtem dunkelgrünem Wald, weiter in Richtung Osten. Als wir von Weitem die Umrisse eines Dorfes erkennen können, falle ich Taylor um den Hals und küsse ihn stürmisch. Jeder Schritt, den wir machen, führt uns näher ans helle Schloss und weiter weg vom dunklen König und seinen Monstern. Am liebsten würde ich direkt losrennen, aber Taylor bremst mich aus, weil er meint, wir dürfen auf gar keinen Fall auffallen, was natürlich sinnvoller ist.
Das Dorf ist recht klein und besteht hauptsächlich aus Bauernhöfen. Wir werden von Leuten entdeckt, die gerade in ihren Gärten arbeiten und kurz zu uns aufblicken. Die Bauernhöfe entwickeln sich, je weiter wir uns dem Zentrum nähern, zu kleinen Häusern, bis wir auf einen Marktplatz treffen. Er muss das Herz des Dorfes sein. Wenn wir hier nicht fündig werden, dann wahrscheinlich nirgends.
Wir umrunden den Platz einmal und kommen dabei an einigen Bäckereien vorbei, die einen herrlichen Duft verbreiten. Schließlich, ich hätte schon fast den Mut aufgegeben, kommen wir an einem Laden vorbei, der Eddis Krimskrams-Laden heißt. An der Tür ist ein Schild angebracht, auf dem es heißt: Wenn es Eddi nicht hat, hat es keiner.
Eine kleine Glocke an der Tür kündigt unsere Anwesenheit an. Der Laden hat zwei Etagen, die obere befindet sich auf einer Art Empore, die man über eine Wendeltreppe erreichen kann. Überall stapeln sich Kisten, die bis oben hin vollgestopft sind mit Kram. Der Weg bis zur Theke in der Mitte des Raums erinnert an einen Trampelpfad, weil man nur von dort die dunklen Holzdielen erkennen kann.
„Hallo?“, rufe ich in den Raum, doch ich bekomme keine Antwort. Langsam bahnen sich Taylor und ich einen Weg zur Theke. Im selben Moment kommt ein Mann um die Ecke spaziert, der so klein ist, dass er hinter einem großen Berg Kartons verschwunden ist. Meiner Meinung nach passt er perfekt in diesen Laden. Er hat kahle graue Haare, einen bis zu den Schultern reichenden Bart und das freundlichste Lächeln, das ich je gesehen habe. Er trägt einen weinroten Cordanzug und ein blau meliertes Hemd.
„Guten Tag. Ich bin Eddi und das hier ist mein Krimskramsladen. Denken Sie an meine Worte: Wenn es Eddi nicht hat, hat es keiner. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?“
Taylor räuspert sich. „Wir haben eine etwas ausgefallene Einkaufsliste“, beginnt er. „Wir bräuchten als erstes einmal ein Zelt, Isomatten und Schlafsäcke. Haben Sie das da?“
„Aber sicher doch. Wie bereits gesagt: Wenn es Eddi nicht hat, hat es keiner!“ Der kleine Mann dreht sich hinter der Theke um und verschwindet in seinem Chaos aus Kartons.
Erleichtert drehe ich mich zu Taylor. „Das wäre geschafft, aber wie sollen wir das alles bezahlen?“
„Überlass mir das.“
„Meinst du, er hat den anderen Teil unserer Liste auch?“ Er weiß, was ich meine, nämlich die Munition, die wir sehr dringend brauchen werden.
„Kommt auf.“
Wenige Sekunden später kommt Eddi zurück, schwer beladen mit einem Sack, in dem sich bestimmt das Zelt befindet, und zwei weiteren kleineren Säcken. Er lässt sie auf die Theke plumpsen und strahlt uns an. Ich bin beeindruckt, dass er die Sachen so schnell in seiner Unordnung gefunden hat.
„Hier hätten wir das Zelt. Und Schlafsack und Isomatte je gemeinsam in dem kleineren Beutel. Darf es denn sonst noch etwas sein?“
„Ja“, antworte diesmal ich. „Wir brauchen warme Kleidung und Schuhe, am besten welche, die gut bei Schneefall sind.“
„Ausgezeichnet, folgen Sie mir bitte, damit wir die richtigen Größen auftreiben können.“ Eddi läuft einmal um seine Theke herum und die Treppe nach oben auf die Empore. Wir folgen ihm.
Meine Jacke ist dunkelbraun und dick gefüttert, was sie schön kuschelig macht. Taylor bekommt eine olivgrüne Jacke. Eddi bringt uns noch Stiefel, zwei warme Hosen und zwei Sets, bestehend aus Mütze, Schal, Socken und dicken Handschuhen. Außerdem einige warme Pullis und Shirts. Als wir alles beisammenhaben, packen wir die Sachen auf die Theke. Taylor verlangt noch einen Erste-Hilfe-Kasten, Duschgel, ein Feuerzeug, einen Kompass, eine Landkarte, Konservendosen mit Essen, zwei Töpfe und Löffel.
„Sonst noch einen Wunsch?“
Taylor und ich tauschen einen Blick, bevor er sich vorbeugt und leise fragt: „Wir brauchen dringend Munition für unsere Waffen. Haben Sie welche da?“
Eddis Blick verdunkelt sich. Ich sehe ihn uns schon lautstark hinauswerfen, doch zu meiner Erleichterung nickt er kurz. „Lasst mal sehen.“
Taylor zeigt ihm unsere Pistolen. Die Gewehre sind irgendwo zwischen Ende des Kampfs und dem Sprung von der Brücke verloren gegangen. Ich konnte ohnehin nicht wirklich damit umgehen. Eddi verschwindet für einen Moment und kommt mit der passenden Munition wieder zurück.
Wir packen alles ein, was erstaunlicherweise gut funktioniert. Wir überlassen Eddi unsere schusssicheren Westen und die alten Jacken und Schuhe, wofür er uns einen Nachlass anbietet.
Als Eddi uns seinen Preis nennt, zucke ich innerlich zusammen. So viel Geld kann Taylor niemals dabeihaben. Ich versuche ihn anzusehen, doch da zieht er bereits eine goldene Kette aus seinem Hemdausschnitt. Daran befestigt ist ein zierlicher, goldener Anhänger.
„Hier“, sagt Taylor und reicht Eddi seine Kette, der schon große Augen macht. „Es deckt unsere Einkäufe und ich würde Sie bitten, uns den Rest des Wertes in Geld auszuzahlen.“
Eddi nimmt den Klunker schluckend entgegen und starrt einen Moment zu lange darauf, bevor er Taylor wieder ansieht und nickt. Eilig stopft er sich das Gold in die Tasche und klappt seine Kasse auf, aus der er sofort händeweise Geld schaufelt und es Taylor in die Hände drückt.
„Vielen Dank für Ihre Hilfe“, antwortet Taylor und lächelt Eddi höflich zu, bevor er nach meiner Hand greift und mich aus dem Laden zieht.
„Das war der Wahnsinn, Taylor!“, lache ich, während wir über den Platz schlendern. „Hast du gesehen, wie groß seine Augen geworden sind, als er-“
Plötzlich schiebt mich Taylor unsanft in eine Gasse hinein, drückt mich gegen die Wand und legt mir eine Hand auf den Mund. Augenblicklich bin ich still und starre erschrocken in Taylors Gesicht. Mein Herz klopft wild.
Was ist los?
Seine sturmgrauen Augen sind scharf, als er vorsichtig um die Ecke späht. Sofort schnappt er sich wieder meine Hand und will mich wegziehen, tiefer in die Gasse hinein, aber ich schaffe es, mich loszureißen, um auch einen Blick um die Ecke erhaschen zu können. Es stört mich, dass er eine Beschützerhaltung eingenommen hat und mich anscheinend als zu schwach ansieht, als dass ich auch mitbekommen dürfte, was da hinten vor sich geht.
Als ich sehe, was Taylor gesehen hat, schnappe ich nach Luft. Ein dunkler Militärwagen mit getönten Scheiben fährt gerade vor und schwarz gekleidete Soldaten springen heraus. Sie sind Mutierte, dafür bestimmt, Elementarier zu jagen.
„Evelyn, na los doch, wir müssen hier weg!“, zischt mir Taylor zu und packt wieder meine Hand, um mich weiterzuziehen. Sie sind da, sie haben uns gefunden! Wir hätten nicht so viel Zeit unter der Brücke verschwenden sollen.
Die Wächter sind uns direkt auf den Fersen.
Mein Herz pocht so laut gegen meine Rippen, dass es schmerzt, und die Angst schnürt mir die Kehle zu. Ich habe schon mal gegen einen mutierten Wächter gekämpft und fast hätte er mich zerfleischt.
Ich renne Taylor hinterher, lasse mich blind durch die kalten, dunklen Gassen ziehen. Vor Angst kann ich nicht mehr klar denken. Plötzlich hält Taylor an, sodass ich in ihn hineinrenne und wir beinahe beide auf dem Pflaster landen. Noch bevor ich erkennen kann, was Taylor zum Stocken gebracht hat, macht er eine Drehung nach links in einen kleinen Schuppen hinein und schließt die Tür hinter uns.
Staubkörner wirbeln auf und tanzen vor meinen Augen herum.
Taylor zieht mich zu einer Plane, die über ein großes Gerät gespannt wurde, hebt sie einen Spalt an, damit ich darunter kriechen kann, und folgt mir. Meine Angst verleiht mir Flügel. Der Geruch nach Benzin sticht mir in der Nase, während ich versuche, meinen Atem zu beruhigen. Mein Herz überschlägt sich in meiner Brust und ich frage mich, ob die mutierten Monster es da draußen wohl hören können.
Plötzlich wird die Tür zum Schuppen mit solch einer Gewalt aufgerissen, dass sie krachend gegen die Wand knallt. Ich zucke zusammen. Als ich mich zu Taylor umsehe, legt er sich nur einen Finger auf die Lippen, doch ich erkenne auch in seinem Blick Angst. Schritte nähern sich uns. Ich drücke mir eine wie wild zitternde Hand auf den Mund und halte die Luft an. Mein Herz schlägt laut in meinen Ohren und ich bete zum Himmel, dass das, was da gerade vor unserer Plane herumschleicht, es nicht hören kann.
Wieder Schritte, diesmal jedoch deutlich näher. Meine Angst erreicht neue Höhen und so langsam geht mir die Luft aus. Auf einmal sehe ich, wie sich die Plane über meinem Kopf bewegt. Sie wird angehoben. Fast hätte ich vor lauter Furcht laut losgeschrien oder meine Gabe entfaltet oder schlichtweg in die Hose gemacht, doch im letzten Moment ruft eine Person von draußen: „Grigori! Na los doch, hier rüber!“
Ein Schnauben erklingt, das sich wie das eines wütenden Stiers anhört, doch Grigori stürmt nach draußen und lässt die Schuppentür hinter sich zuschlagen.
Ich warte noch ein paar Sekunden, bevor ich langsam die Luft ausatme, die ich die ganze Zeit über angehalten habe. „Verdammt, war das knapp“, zische ich erleichtert und suche Taylors Blick. Er greift nach meiner Hand und drückt sie bekräftigend.
Wir warten noch einen Moment ab, bevor wir uns aus unserem Versteck schleichen, spähen durch die Ritzen zwischen den Holzlatten des Schuppens, um zu erkennen, ob jemand davor herumschleicht. Als wir uns ein Zeichen geben, dass wir niemanden entdecken konnten, will ich direkt rausstürmen, doch Taylor hält mich zurück.
„Wir sind ein Team und wir schaffen es hier raus! Sobald wir am Wald sind, ist es vorbei. Wir schaffen das!“
Ich schenke ihm ein Lächeln. Taylor nimmt meine Hand und ich weiß sofort, was er vorhat, er macht uns unsichtbar. Ich nicke ihm kurz zu, bevor ich die Schuppentür öffne.
Wir schleichen durch die Gassen. Wir treffen auf keinen einzigen Wächter und auch wenn, könnte er uns nicht sehen. Diese Tatsache lindert die Angst in meinen Knochen leider kaum.
Als wir um die nächste Ecke biegen, sehe ich den Wald. Dunkelgrünes, rettendes Dickicht. Erleichterung erfasst uns und beschleunigt unsere Schritte. Wir sprinten über das letzte Stück Feld bis zum Wald, als plötzlich hinter uns eine Stimme durch einen Lautsprecher ertönt.
„Wir sind auf der Suche nach zwei Flüchtigen. Ihre Namen lauten Taylor und Evelyn und sollten sie nicht innerhalb der nächsten Sekunden hier auftauchen, schwöre ich, dass wir das gesamte Dorf abfackeln und keine Überlebenden zurücklassen werden!“
Die letzten Worte sind nur noch geschrien.
Zorn brennt in den Worten des Sprechers und überzieht meinen gesamten Körper mit einer Gänsehaut.
Abrupt bleibe ich stehen, sodass Taylor durch den Schwung unserer Bewegung meine Hand loslässt. Doch er wirbelt sofort zu mir herum und packt mich an den Schultern.
„Evelyn, wir dürfen darauf nicht hereinfallen. Das ist nur ein Trick, um uns zu kriegen, wir dürfen dem nicht nachgeben!“ Ein Sturm wirbelt in seinen Augen, durchzogen von Furcht und Entsetzen. „Ich weiß, dass du die Leute da unten retten willst, aber wir dürfen das nicht tun. Sie werden das bestimmt nicht durchziehen. Es würde nur einen Krieg mit dem hellen Königreich auf sich ziehen und das-“
Eine Explosion erschüttert das Dorf. Ich kann die Druckwelle bis hierher spüren und komme ins Straucheln. Flammen lodern über den Häusern auf und ein Keuchen entweicht mir.
„Nur ein kleiner Vorgeschmack!“, brüllt der Typ durch seine Lautsprecher.
Diese Mistkerle wollen tatsächlich alles abbrennen.
Ich wirble zu Taylor herum. „Es interessiert sie einen feuchten Dreck, ob das einen Krieg heraufbeschwört“, schreie ich ihn atemlos an. „Das helle Königreich ist bereits alle Wege dafür gegangen. Sie haben zuerst angegriffen. Deshalb ist es sicher, dass sie diese Leute nicht verschonen werden, auch, wenn es nur wegen uns geschieht!“
In Taylors Augen spielt sich ein Kampf ab, er ringt mit sich selbst, ob er mir folgen oder mich doch gewaltsam mit sich ziehen soll.
Ich nehme ihm die Entscheidung ab und renne wieder los.
Zurück in das Dorf.
KAPITEL 3
Auf halbem Weg greift Taylor nach meiner Hand und ich atme erleichtert auf.
Er ist bei mir.
Auch, wenn ich die Hülle, die uns beide unsichtbar macht, nicht spüren kann, so weiß ich doch, dass sie da ist und uns schützt. Zum Dank drücke ich Taylors Hand.
Wir nähern uns dem Feuer, das eindeutig auf dem Marktplatz gezündet wurde. Ich spähe um die Ecke, als ein Wächter in unsere Gasse biegt und beinahe in mich reingerannt wäre. Mein Herzschlag springt von einer Sekunde auf die nächste in luftige Höhen. Taylor fackelt nicht lange, schnappt sich den Mann von hinten, wofür er meine Hand loslassen muss, und sticht ihm ein Messer in den Nacken. Sein Opfer gleitet mit einem leisen Keuchen zu Boden.
„Da ist das Mädchen!“, schreit plötzlich jemand. Hitze steigt in mir auf, als ich herumwirble. Eine Kugel zischt nur um Haaresbreite an meinem Ohr vorbei, ich kann sie hören. Wäre ich dort gestanden, wo ich eben noch war, hätte sie mich im Hinterkopf getroffen.
Scheiße.
Innerhalb eines Wimpernschlags fertige ich mir einen Schild aus Eis, der den folgenden Kugelregen aufhält. Hektisch greife ich nach Taylors Hand und zerre ihn hinter meinen Schild.
Daraufhin zückt er aus seiner Jacke eine Pistole und beginnt, an meinem Schutzschild vorbei, auf die Männer auf dem Marktplatz zu feuern. Ich beobachte wie hypnotisiert, wie die Kugeln ihre Körper durchbohren, als ich es spüre. Es ist wie die Veränderung in der Luft vor einem Gewitter. Man kann es spüren, aber nicht beschreiben. Die feinen Härchen in meinem Nacken richten sich auf.
Auf dem Platz bricht Unruhe aus, ein allgemeines Keuchen und Schnauben. Die Wächter beginnen, sich zu verwandeln. Alle miteinander, alle gleichzeitig schlüpfen sie in ihre albtraumhaften Formen. Die Muskeln schwellen ihnen bis zum Platzen der Uniformen an, die Haut, die dabei aufreißt, gibt blutige Adern frei, wie die Flüsse auf einer Landkarte. Auch die Köpfe verwandeln sich, manche bilden gedrehte Hörner aus, die aus ihren Schädeln ragen. Und alle haben diese Augen, von einem so intensiven Rot, dass ich es bis hierher deutlich sehen kann. Keuchend taumle ich zurück und lasse dabei meinen Schild fallen.
Wir müssen weg. Sofort!
Die Wächter stürzen sich auf uns, brüllen animalisch, bevor sie auf uns zurasen. Wie erstarrt stehe ich da, die Erinnerung an meinen ersten Kampf mit einem Wächter lässt mich am Boden festfrieren. Blut und Eis.
„Lauf“, flüstert Taylor hinter mir, auch aus seiner Stimme höre ich die Furcht heraus. Ich will laufen, so schnell es geht verschwinden, aber meine Beine machen nicht mit. Wie gebannt starre ich auf die Wächter, die mit jeder Sekunde näherkommen.
„Lauf!“, schreit mich Taylor an und zerrt mich mit sich. Endlich bewegt sich mein Körper wieder und ich renne ihm hinterher. Wir rasen durch die Gasse, hinter uns höre ich das wilde Trampeln der Wächter. Adrenalin schießt mir durch die Adern und lässt mich immer schneller werden.
Wir schlittern um die nächste Ecke und lehnen uns keuchend an die Wand. Ich bekomme kaum noch Luft. Aber wir dürfen nicht zu lange warten, die Wächter müssen jeden Moment bei uns sein.
„Drei, … zwei, …“, zählt Taylor atemlos runter.
Auf „Eins“ treten wir gleichzeitig hinter der Wand hervor.
Meine Gabe kitzelt mir in den Fingerspitzen und ich lasse sie im selben Moment frei wie Taylor, der eine flirrende Schutzwand erschafft. Pure, reine Energie strömt durch meine Arme, die Hände, die Fingerspitzen und schließlich darüber hinaus. Feine Eisspeere fliegen durch die Luft und treffen genau zwischen die Augen unserer Angreifer. Bestimmt vier Stück kann ich auf diese Weise erledigen. Ich versuche nicht daran zu denken, dass ich schon wieder am Töten bin und konzentriere mich einfach immer auf den nächsten.
Plötzlich höre ich Taylor neben mir stöhnen und wirble sofort zu ihm herum. Ein Mann hat ihn an der Kehle gepackt und raubt ihm die Luft zum Atmen. Er hat noch seine menschliche Form und muss sich von hinten angeschlichen haben.
Dieser kurze Moment der Ablenkung genügt.
Ich werde zu Boden gerissen, mein Kopf schlägt hart auf dem Stein auf. Für einen Moment tanzen Sterne vor meinen Augen. Stöhnend ringe ich um Klarheit. „Hallo, Hübsche“, zischelt er plötzlich über mir und ich reiße erschrocken die Augen auf. Das, was vor der Verwandlung einmal ein Mund gewesen sein muss, gibt jetzt reihenweise spitze Zähne frei, die mir entgegenblitzen.
Traurigerweise ist das das Letzte, das mein Charmeur noch zu mir sagen kann, bevor ich ihm einen Speer in den Kopf ramme. Das anzügliche Grinsen hat sich zu einer Grimasse verzogen und ich wende schnell den Blick ab. Stöhnend rolle ich mich unter dem wuchtigen Körper hervor, unter dem sich bereits eine große Blutlache sammelt. Fassungslos starre ich darauf hinab.
Ich habe getötet, erneut.
Ständig muss ich töten. Immer wieder muss ich ihre leeren Augen sehen und ihr klebriges Blut an meinen Händen spüren. Wann hört das auf?
Heiße Tränen brennen mir in den Augen, doch ich zwinge sie nieder.
Jemand packt mich am Arm, es ist Taylor.
Anscheinend konnte er sich aus dem Würgegriff seines Angreifers befreien. „Los, komm!“, keucht er und greift erneut nach meiner Hand. Wir rennen los, auf den Wald zu. Wenigstens konnten wir die Bewohner dieser kleinen Stadt vor dem Großteil der Wächter schützen. Ich weiß nicht genau, wie viele noch übrig sind, aber es bleibt keine Zeit, um nachzusehen. Bestimmt sind schon weitere von ihnen unterwegs.
Spitzer Schmerz in meiner Seite.
Bevor ich verstehe, was vor sich geht, verliere ich den Boden unter den Füßen und werde durch die Luft geschleudert. Mein Kopf schlägt hart auf dem Boden auf. Zweimal ist eindeutig zu viel für einen Tag. Unkontrolliert rollt mein Körper weiter, bis ich im hohen Gras liegen bleibe.
Feuer. Es brennt wie Feuer in meiner Seite.
Schmerz, nur Schmerz, für etwas anderes bleiben keine Gedanken übrig. Sie zerfallen in der Hitze zu Asche. Ich röchle und schnappe panisch nach Luft. Es ist, als würde mein Körper nicht mehr richtig funktionieren.
Blinzelnd versuche ich etwas zu erkennen und langsam baut sich ein Bild vor meinen Augen auf. Ich sehe Taylor zwischen langen, trockenen Grashalmen hindurch mit zwei Wächtern kämpfen, er teleportiert sich hinter einen von ihnen und sticht ihm ein Messer in den Nacken, sticht nochmal zu und nochmal, bis das Monster zu Boden sinkt.
Der andere stürzt sich sofort wutentbrannt auf Taylor und versucht ihn mit seinen überdimensionalen Hörnern aufzuspie-ßen. Doch Taylor weicht ihm geschickt aus, wirbelt herum, packt das Tier bei den Hörnern und reißt dessen Kopf zu Boden. Ein lautes Knacken ertönt, das mir wie eine Druckwelle durch den Körper fährt.
Taylor klopft sich keuchend den Staub von den Kleidern und sieht sich nach mir um. Als er mich im hohen Gras entdeckt, rennt er sofort zu mir. Seine wunderschönen, sturmgrauen Augen weiten sich erschrocken, als er sich mir nähert. Er fällt vor mir auf die Knie. Ich höre ihn laut fluchen, bevor er vorsichtig meine Seite berührt. Einer der Wächter muss mich dort mit seinen Krallen erwischt haben.
„Verdammte Scheiße, Evelyn!“, keucht er und starrt mit bleichem Gesicht auf mich hinab.
„Wasser“, wispere ich kaum hörbar. Sofort ist Taylor wieder aufgesprungen. Er wuchtet sich den Rucksack vom Rücken und greift nach seiner Feldflasche. Ich sehe seine blutverschmierten Hände zittern, als er den Verschluss öffnet und vorsichtig Wassertropfen über meine Haut rieseln lässt.
Augenblicklich breitet sich eine angenehme Wärme in mir aus. Die Heilung setzt ein. Es dauert nur wenige Sekunden, dann kann ich mich schon wieder aufrichten. Taylor starrt mich mit einer Mischung aus Sorge, Erschrockenheit und Bewunderung an, bevor er mich schnell an sich drückt.
Erneut schwere Schritte nicht weit von uns. Eilig richte ich mich auf und versuche, ihre Position auszumachen. Zwei Wächter sind in unsere Richtung unterwegs. Verflucht!
Es geschieht alles so schnell, dass ich kaum mit den Augen hinterherkomme. Ein Baumstamm trifft beide gleichzeitig im Rücken und mäht ihre kräftigen Körper nieder.
Ich wirble zu Taylor herum. „Warst du das?“
Doch er schüttelt nur den Kopf, den Blick auf etwas in Richtung des Dorfs gerichtet.
Dort steht Eddi. Der kleine, grauhaarige Mann grinst uns durch seinen Bart schelmisch an. „Gern geschehen!“, ruft er uns zu und nickt in unsere Richtung.
„Und jetzt, verschwindet von hier!“
Seine Stimme klingt dabei weder harsch noch unfreundlich, aber bestimmt. Taylor und ich lassen uns diese Aufforderung nicht zweimal sagen, nicken unserem Retter zu und flüchten in den Wald.
Nachdem wir bestimmt zehn Minuten durch das Dickicht gerannt sind, halte ich abrupt an und stütze meine Hände auf den Knien ab. Keuchend und nach Luft ringend starre ich zu Boden. Taylor kommt zu mir zurück, er ist genauso außer Atem wie ich.
„Können wir … bitte … eine … Pause machen?“, keuche ich und stocke mehrmals, weil ich kaum Luft bekomme.
„Weißt du was?“, sagt er und lässt sich rücklings ins Moos fallen. „Ich denke, das ist gar keine so schlechte Idee.“
„Find ich gut“, antworte ich und setze mich neben ihn. Von der Seite meines Rucksacks schnappe ich mir die Feldfalsche und schütte das kühle Nass meine ausgetrocknete Kehle hinunter.
Eddi ist ein Elementarier. Es gibt tatsächlich Elementarier, die unter anderen Menschen leben, ein normales Leben führen und nicht entdeckt werden. Ich bewundere ihn sehr dafür. Hoffentlich hat er sich durch uns nicht zu sehr in Gefahr gebracht.
Nach einigen Minuten, in denen wir schweigend dagelegen sind, richte ich mich langsam ein Stück auf, um meine Wunde zu betrachten. Getrocknetes Blut klebt an dem braunen Stoff meiner neuen Winterjacke. Als ich sie auseinanderziehe, gibt sie frische, rosafarbene Haut frei. Allein die Flecken auf der Jacke beweisen, dass ich überhaupt verletzt wurde. Seufzend wende ich den Blick ab und begegne dem von Taylor. Er muss mich die ganze Zeit über beobachtet haben. Wir sehen uns einige Augenblicke schweigend an.
„Woran denkst du?“, wispere ich.
Er wendet den Kopf ab und ich sehe einen Muskel in seinem Kiefer zucken. „Ich habe nur daran gedacht, dass ich unglaublich froh bin, dass es dir gut geht.“
Auf meinem Gesicht entsteht ein Lächeln. „Dito.“
„Das in dem Dorf war nur der Vorgeschmack“, redet Taylor weiter. „Sie werden keine Mittel scheuen, um uns zu kriegen, und wir müssen weiterkämpfen.“ Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen und sein Mund ist nur noch ein schmaler Strich. Ich rutsche näher zu ihm und lehne mich an seine Schulter.
„Wir schaffen das. Wir können und wir werden es schaffen“, antworte ich.
„Sie werden es uns nicht leichtmachen, mein Vater kennt ein paar furchtbare Methoden, um Flüchtige zu fangen. Du wirst wieder töten müssen.“ Er dreht sein Gesicht zu mir und in seinen Augen sehe ich eine Sorge, die mich sofort wieder zu stören beginnt.
„Ich steh das schon durch“, antworte ich. Auch, wenn ich will, dass er mich ihm ebenbürtig sieht, bin ich doch gerührt davon, wie sehr er sich um mich sorgt.
Etwas Kaltes landet auf meiner Wange. Überrascht berühre ich die Stelle mit meinem Finger und fühle einen Tropfen Wasser. Ich richte den Blick gen Himmel und auf meinem Gesicht breitet sich augenblicklich ein Lächeln aus.
Aus dem schiefergrauen Himmel über uns fallen vereinzelte Schneeflocken hinab. Sie tanzen mit dem Wind. Es hat etwas Magisches an sich, wie elegant und leise sie zu Boden schweben und bereits vereinzelt auf dem Gras liegenbleiben. Ich richte mich auf. Meine Erschöpfung ist für einen Moment vergessen und ich fange mit dem Zeigefinger eine der kleinen Tänzerinnen auf. Einen bittersüßen, kurzen Moment bleibt sie auf meiner Haut liegen, bevor sie schmilzt und als Wassertropfen zu Boden rinnt.
Taylor taucht neben mir auf und nimmt meine Hand.
Ohne ein Wort zu sagen, legt er seine Finger an mein Gesicht und küsst mich sanft und federleicht auf den Mund.
„Ich verspreche dir, Evelyn: Ich werde alles tun, was ich kann, damit wir es schaffen. Alles. Für dich.“
Seine Berührungen sind warm, doch seine Worte lassen mich erschauern. Ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, er müsste nicht so viel für mich opfern. Ich wünschte…
Und wir küssen uns weiter, während der aufgebrochene Himmel winzige, kalte Schneeflöckchen auf unsere erhitzten Gesichter niederschweben lässt und sie schweigend die Erde um uns herum bedecken.
Nach einer Stunde Wanderung beginnt es bereits zu dämmern.
Wir bauen das Zelt auf und schaffen es noch, ein Feuer zu entzünden, bevor es endgültig finster wird. Taylor öffnet eine der Konservendosen und stellt sie über die Flammen. Er versucht ein Gespräch mit mir darüber zu führen, dass wir uns nicht nur von den Konserven ernähren dürfen, sondern auch nach Nahrung in der Umgebung suchen müssen. Ich nicke nur, weil ich zu erschöpft bin, um etwas anderes zu machen.
Es ist so angenehm, etwas Warmes im Magen zu haben, auch, weil es mit jeder Sekunde frostiger wird.
Wir sitzen Schulter an Schulter im Eingang unseres Zelts, vor uns prasselt das Feuer und leckt an dem trockenen Holz.
„Danke“, flüstere ich und kuschle mich enger an ihn.
„Warum?“
„Einfach, weil du da bist“, antworte ich und genieße den Kuss, den ich daraufhin auf meinem Haar spüre.
Am nächsten Morgen weckt mich die Kälte.
Ihre frostigen Finger kriechen unter meine Kleider und lassen mich erschauern, obwohl Taylor und ich eng umschlungen liegen. Ich habe keine Ahnung, wann wir gestern eingeschlafen sind, doch jetzt ist es bereits hell. Vorsichtig schlüpfe ich unter seinem Arm hindurch und öffne so leise wie möglich den Reißverschluss.
In der Nacht muss es erneut geschneit haben. Eine dünne Schicht Puderzucker bedeckt die Felder und Hügel, die ich durch die dunkelgrünen Bäume hindurch erkennen kann. Die Sonne steht schon recht hoch am Himmel, weshalb ich die Zeit auf ungefähr elf Uhr schätze. Der Kampf gestern hat uns beide ausgelaugt. Auch, wenn ich mit Taylor trainiert habe, so lange habe ich meine Gabe noch nie benutzt. Ich strecke mich gähnend und gehe ein paar Schritte, um den Schlaf aus meinem Verstand zu vertreiben.
Vögel zwitschern in den Baumkronen und meine Schuhe machen dieses bestimmte knirschende Geräusch auf dem Schnee, das ich immer schon geliebt habe. Als ich an einer großen Tanne vorbeikomme, bleibe ich stehen. Mary hat uns oft einen Tee aus frischen Tannenspitzen zubereitet, der sehr gesund ist. Zwar sind diese normalerweise erst im Mai an den Bäumen, aber ich schätze, dass es auch mit den älteren Trieben funktionieren wird. Ein bisschen Energie sollte uns nicht schaden.
Ich zupfe eine Handvoll ab und stapfe anschließend wieder zurück zum Zelt. Dort schnappe ich mir einen Topf und gieße ein bisschen Wasser hinein, das ich aus meiner Feldflasche nehme. Es ist so kalt, dass ich froh sein muss, dass es nicht gefroren ist. Anschließend gebe ich die Tannenspitzen dazu und bringe das Wasser zum Kochen. Der Reißverschluss des Zelts wird aufgezogen und Taylor taumelt schlaftrunken heraus.
„Morgen“, gähnt er und schlüpft in seine olivgrüne Jacke.
„Guten Morgen“, erwidere ich und muss über sein zerknittertes Gesicht grinsen.
„Was kochst du da?“, will er wissen und lässt sich neben mich auf den umgestürzten Baumstamm fallen.
„Ich mache einen Tee aus Tannennadeln. Wird sich zeigen, wie er schmeckt“, sage ich mit einem Blick auf die blasse Brühe vor mir.
Er schmeckt in Ordnung. Etwas Süße würde nicht schaden. Jedenfalls ist die Wärme angenehm und das ist doch schon mal was.
Nachdem wir gefrühstückt haben, packen wir das Zelt zusammen und machen uns auf den Weg.
Unsere Wanderung verläuft sehr schweigsam, während es über unseren Köpfen erneut zu schneien beginnt. Gegen Nachmittag entwickelt sich der sanfte Schneefall in einen Sturm. Kalte Flocken wehen mir in den Nacken und stechen mit der Zeit wie spitze Nadeln. Der Schnee fällt so dicht, dass ich kaum die Hand vor Augen sehen kann.
Irgendwann brechen wir unsere Reise ab und auch, wenn ich es nicht sage, bin ich heilfroh darüber. Fröstelnd und mit knurrenden Mägen verkriechen wir uns im Zelt. Ich schlüpfe mit allem, was ich anhabe, in meinen Schlafsack. Taylor macht es mir nach und ich höre über das Tosen des Windes hinweg seine Zähne aufeinanderschlagen.
„Was für eine denkbar ungünstige Zeit für eine Wanderung“, murmelt Taylor.
„Kannst du laut sagen“, stimme ich ihm zu. Er rutscht ganz nah an mich heran und ich bin so dankbar dafür, kann es ihm aber nicht mehr sagen, weil mir bereits die Augenlider zufallen und ich wegdrifte.
Als ich aufwache, ist Taylors Wärme neben mir verschwunden.
Zurück bleibt nur die Kälte.
Draußen muss es schon dunkel sein, weil ich kaum etwas erkennen kann. Ich strample den Schlafsack von mir und ziehe meinen Rucksack heran. In Rekordzeit wechsle ich meine kalt verschwitzten Klamotten gegen frische und klettere hinaus in die Kälte.
Taylor sitzt neben einem Feuer. Ich gehe die paar Schritte über den knirschenden Schnee und setze mich zu ihm auf ein Stück Plane, das er dort hingelegt hat. Er hält einen Stock, auf dem irgendein kleines Tier aufgespießt ist.
„Was ist das?“, will ich wissen.
„Ein Eichhörnchen. Ich habe vorhin ein paar Fallen gestellt und das hier erwischen können. Hast du Hunger?“
„Nein nein“, versuche ich es abzustreiten, woraufhin mein Magen unglücklich grummelt.
„Ach?“, fragt er grinsend und zieht mich mit seinem freien Arm zu sich. „Was war das dann gerade?“
„Das musst du dir eingebildet haben“, antworte ich lachend.
Das Eichhörnchen schmeckt zwar ein bisschen zäh und würzen kann man es hier draußen mit unseren Mitteln auch nicht, aber es macht uns beide satt und das ist die Hauptsache. Es bleibt am Ende sogar noch Fleisch übrig, das wir für die morgige Reise in unseren Rucksäcken verstauen.
Wir bleiben noch ein wenig wach, genießen das Gefühl eines vollen Magens und das wohlige Knistern des Feuers.
„Weißt du, unsere Geschichte ähnelt ein bisschen der von Romeo und Julia“, durchbricht Taylor auf einmal die Stille.
„Wem?“
„Sag bloß, du kennst die beiden nicht!“, ruft Taylor aufgebracht.
„Entschuldigen Sie bitte, Ihre belehrte Hoheit“, lache ich.
„Also schön, das war so: Romeos und Julias Eltern waren verfeindet, doch irgendwie, wie es das Schicksal so will, haben sich die beiden ineinander verliebt. Ich bin der Prinz des dunklen Königreiches, du die Prinzessin des hellen. Es ist ein wahnsinniger Zufall, dass wir beide zusammengefunden haben, findest du nicht?“
Ich denke einen Moment darüber nach und starre geradeaus. „Du hast Recht. Ich finde es allgemein verrückt, dass man überhaupt jemanden finden kann, den man liebt. Jemanden, der für einen von einer Brücke ins Ungewisse springt.“
Mein letzter Satz war nur noch geflüstert, aber er muss mich trotzdem verstanden haben.
Wir schweigen einen Moment und sehen dem flackernden Feuer zu, das den Schnee um sich herum weggeschmolzen hat und gespenstische Schatten auf die Umgebung wirft.
„Möchtest du noch das Ende der Geschichte von Romeo und Julia wissen?“
„Ja, erzähl.“
„Sie sterben am Ende.“
Ich verziehe das Gesicht und verpasse ihm einen Klaps gegen die Schulter.
„In diesem Punkt wird unsere Geschichte ihrer aber nicht ähneln, denn auf Sterben habe ich momentan gar keine Lust.“
Taylor lacht und ich stimme mit ein, auch wenn ich es absolut ernst meine.
Ich kann ihn nicht verlieren.
KAPITEL 4
Die nächsten Tage ziehen an mir vorbei.
Taylor leitet uns durch die verschneiten Wälder und ich bin froh, dass ich mir darüber nicht auch noch den Kopf zerbrechen muss. Überraschenderweise werden wir erstmal nicht mehr angegriffen, aber eine gemeine Stimme in meinem Hinterkopf erinnert mich stets daran, dass das wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.
Wir verlassen den Wald und wandern nun über offenes Gelände. Keine erfreuliche Entwicklung, weil man uns aus der Luft besser entdecken kann, aber wir haben keine andere Wahl.
Unser heutiges Lager stellen wir noch am frühen Nachmittag auf, direkt neben einem breiten Fluss.
„Lust, ein bisschen zu baden?“, fragt mich Taylor, als wir unsere Schlafsäcke im Zelt ausgebreitet haben und gerade den Reißverschluss des Eingangs schließen.
Ich lege den Kopf schief, unsicher, ob er das wirklich ernst meint.
„Im Fluss“, spricht er weiter und nickt in Richtung des Wassers. „Ich würde mich gerne mal wieder richtig waschen. Aber nur, wenn du mitmachst.“
„Findest du das nicht ein bisschen kalt?“, frage ich nicht gerade begeistert.
„Ach komm schon, Evy, das wird lustig!“
Er greift mich bei den Schultern und sein Lächeln erinnert mich an einen kleinen Jungen. Seine grauen Augen leuchten und ich kann einfach nicht anders als zuzustimmen angesichts seiner Begeisterung. Grinsend küsst er mich auf die Stirn und beginnt sich zu entkleiden. Mir wird heiß bei seinem Anblick und irgendwie bin ich froh, dass er seine Unterwäsche anbehält. Als er sein Shirt fallen lässt, gibt das den Blick auf definierte Bauchmuskeln frei.
„Na los, komm schon!“, fordert er mich auf, weil ich so gar keine Anstalten mache, mich zu bewegen. „Oder soll ich dir etwa helfen?“
Meine Wangen beginnen zu glühen bei dem Gedanken, er würde mir beim Ausziehen helfen, und ich winke schnell ab.
„Danke, ich glaube, ich schaff das schon.“ Eilig beginne ich meine Jacke aufzuknöpfen. Als ich sie neben mich auf einen Stein lege, damit sie vom Schnee im Gras nicht nass wird, spüre ich bereits die Kälte. Ich lege alle Kleidung bis auf meine Unterwäsche ab. Als ich kurz aufsehe, bemerke ich Taylors Blick auf mir ruhen, er gleitet ganz langsam über mich und ich fühle mich nackt, obwohl ich es gar nicht bin.
Mir wird erneut heiß, trotz der Kälte, was mich vollends verwirrt.
Langsam gehe ich auf ihn zu, der Schnee unter meinen Füßen schmilzt augenblicklich und die Kälte um mich herum ist irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Als ich vor ihm stehe, spüre ich die Hitze, die sein Körper ausstrahlt. „Du solltest mich nicht so anstarren“, raune ich ihm zu.
„Dasselbe könnte ich dir auch sagen“, kontert er und ich beiße mir auf die Lippen. Meine Wangen sind dem Verbrennen nah.
Taylor greift nach meiner Hand und zieht mich mit sich ins Wasser. Eigentlich sollte es eiskalt sein und auf meiner Haut eine Gänsehaut verursachen, doch das einzige, das mir eine Gänsehaut verursacht, ist Taylor. Er reicht mir das Duschgel und ich reibe mich damit ein, wasche Schweiß, Dreck und Gestank von mir.
Als ich fertig bin, fühle ich mich wie neu geboren, nur ein bisschen kalt. Fröstelnd wate ich zurück ans Ufer. Gerade auf halber Höhe angekommen, trifft mein Bein auf Widerstand. Ich verliere das Gleichgewicht und lande mit dem Gesicht voraus im eiskalten Wasser.
Keuchend und um mich schlagend tauche ich wieder auf. Neben mir lacht Taylor aus vollem Hals. Ich schnappe nach Luft. „Hast du mir etwa gerade ein Bein gestellt?“
Taylor kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen und hält sich den Bauch. „Tja. Was willst du jetzt tun?“
„Tatsächlich habe ich da so ein paar Ideen“, grinse ich. Ich weiß natürlich, dass ich gegen Taylor kaum eine körperliche Chance habe, deshalb muss ich wohl zu unfairen Mitteln greifen. Mit meiner Handbewegung bewegt sich das Wasser unter Taylor und sein Körper wird in die Luft gehoben. Bevor er daran denken kann, sich zu befreien, lasse ich ihn im hohen Bogen zurück in den Fluss platschen.
Lachend taucht sein Kopf wieder auf. „Na warte, das bekommst du zurück.“ Innerhalb von zwei Herzschlägen ist er zu mir zurückgeschwommen. Ich will gerade fliehen, doch er packt meine Beine und wirft mich über die Schulter. Ich lache kreischend und hämmere auf seinen Rücken ein.
„Lass mich runter, Taylor!“
Ich versuche, ernst zu klingen, weil mir diese luftige Höhe tatsächlich nicht geheuer ist, doch mein Lachen verhindert es. Er macht Anstalten, mich runterzulassen, hält dabei jedoch meine Beine weiterhin hoch, dass ich über dem Wasser baumle. Ein gekreischtes „Taylor!“ entweicht mir noch, bevor er meinen Kopf unter Wasser tunkt. Ich befreie mich aus seinem Griff und schaffe es durch meine Gabe, ihn zu Fall zu bringen, sodass er auf allen Vieren landet. Ich stoße einen triumphierenden Siegesschrei aus und stütze meinen Fuß auf seinem Rücken ab.
„Sieger!“, juble ich und stemme die Hände in die Hüften.
„Das wollen wir mal sehen“, ruft Taylor. Plötzlich verliere ich das Gleichgewicht und lande im seichten Wasser.
Taylors stellt sich über mich und reicht mir die Hand. „Gib dich geschlagen.“
Grinsend greife ich danach und noch bevor er realisieren kann, was ich vorhabe, ziehe ich ihn zu mir hinunter und er landet neben mir.
„Du solltest mich mittlerweile gut genug kennen, um zu wissen, dass ich niemals aufgebe“, rufe ich, wirble herum und stütze mich mit meinen Händen auf seiner Brust ab.
Mein Blick findet seinen und ich verliere mich einen Moment darin.