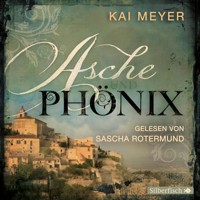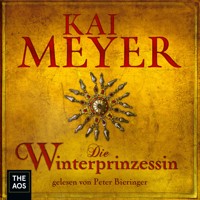8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Drachen bewahren den Schlüssel zur Rettung der Welt. Aber das Geheimnis ihrer Zuflucht wurde enthüllt. Nun sammeln sich die Heere im alten China zur letzten Schlacht. Kreaturen, aus Lava geboren, entsteigen den Tiefen der Berge. Riesen erklimmen von Süden her die Gipfel. Himmelskrieger in gewaltigen Luftschiffen nähern sich aus dem Norden. Inmitten des heraufziehenden Krieges verzweifelt Niccolo an seiner Liebe zu Mondkind. Die Drachen könnten das sterbende Mädchen heilen, doch das würde es zu einer tödlichen Gegnerin machen. Derweil stößt Nugua auf das Grab eines Wesens, das vor Äonen die Welt erschuf – und jetzt zur mächtigsten Waffe des Feindes wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolkenvolk
DRACHE UND DIAMANT
DIE WOLKENVOLK-TRILOGIE
BUCH DREI
KAI MEYER
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Text © by Kai Meyer
Korrektorat:
Michaela Retetzki, Samira Schweitzer & Elisabeth Kirchharz
Layout Ebook: Stephan Bellem
Buchsatz:
Elisabeth Kirchharz, Corinna Götte & Astrid Behrendt
Illustrationen: Shutterstock
Umschlag- und Farbschnittdesign: Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
Druck: Booksfactory
ISBN 978-3-69130-071-0
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining
im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Inhalt
Prolog
Ein Schwarm wilder Bücher
Am Abgrund
Vor dem Sturm
Abendstern
Mondkinds Schlaf
Die Juru
Das Herz des Riesen
Alte Feinde
Das Wrack
Gefecht auf dem Eis
Mukhtar Khan
Feiqing fliegt
Im Aetherlicht
Der Lavaquell
Drachenruf
Der Pakt
Jenseits der Gipfel
Der achte Xian
Der namenlose Drache
Zu spät
Xixati
Brennende Schiffe
Im Rauch
Das Erwachen
Der Horizont zerbricht
Felsbeben
Alles endet
Stürzende Schatten
Im Chaos
Allein
Aetherglut
Götterklingen
Die Liebenden
Der Weg in den Himmel
Die Rückkehr
Über Nebeln
Drachenpost
China
während der Qing-Dynastie
1761 n. Chr.
Prolog
Einst war die Dunkelheit hier vollkommen. In den Tiefen der Berge, Tausende Meter unter Gletschern und Gipfelschnee, herrschte Schwärze, seit das Gebirge seine Wurzeln in die Welt getrieben hatte.
Jahrmillionenlang war es dunkel geblieben. Und still.
Bis die Drachen kamen.
Der Goldglanz ihrer Schuppenleiber fiel auf Fels, der früher nur Finsternis kannte. Ihr Licht beschien Türme aus Tropfstein, flirrte auf Adern aus Erz und Kristall, weckte eiskalte Seen aus uraltem Schlummer.
In einer dieser Höhlen, getaucht in die Bernsteinglut der Drachen, nahm Niccolo Abschied von Mondkind.
Langsam trug er das Mädchen ins Zentrum der Grotte und legte es sanft auf ein Felspodest. Mondkinds schmale Finger schlossen sich um seine Hand.
»Ich habe Angst«, flüsterte sie. Eine einzelne Träne löste sich aus ihrem Augenwinkel, zog eine Spur hinab zur Schläfe und verschwand in der Flut ihres nachtschwarzen Haars.
Ihre Stimme war leise wie ein Atemhauch. Sie so zu hören brach Niccolo das Herz. Aber noch schmerzhafter war es, ihren flehenden Blicken standzuhalten.
»Der Zauber der Drachen wird dich heilen«, sagte er, aber damit beruhigte er weder sie noch sich selbst. Sie wussten beide, dass es so einfach nicht sein konnte.
Mondkind ruhte flach auf dem Rücken, zerbrechlicher denn je. Die weiße Seide ihres Kleides bewegte sich ganz von selbst, verteilte sich in weiten, fließenden Wogen um ihren zierlichen Körper. Mehrere Lagen krochen über die blutende Wunde in ihrer Seite. Eine Wunde, die sie töten würde, wenn die Magie der Drachen sie nicht zu schließen vermochte.
Niccolo wusste, dass die Zeit drängte. Der Felsbuckel, auf den er Mondkind gebettet hatte, erhob sich wie ein Altar inmitten des hohen Höhlendoms. Schon jetzt, da sie zu schwach war, sich aus eigener Kraft zu bewegen, erschien sie ihm wie eine Statue aus makellosem Marmor. Weiß war die Seide ihres Gewandes, geisterhaft bleich ihre Haut. Nur das schwarze Haar, das weit aufgefächert um Kopf und Schultern lag, bildete einen Gegensatz – so als wollte etwas den Goldglanz der Drachen von ihr fernhalten, eine Krone aus Finsternis, die Mondkinds atemberaubende Schönheit noch unwirklicher machte.
»Wie lange werde ich schlafen?«, fragte sie.
»Bis du gesund bist«, sagte er sanft. »Die Drachen versetzen dich in einen Heilschlaf, der die Wunde verschließen wird.« Sie wusste das alles – sie hatten längst darüber gesprochen, in den Momenten, wenn sie klar genug war, ihn zu verstehen. Aber mit ihrem langsamen Sterben ging auch Vergessen einher, und nie war er sicher, ob sie wirklich verstand, was mit ihr geschah, oder ob sie sich nur treiben ließ, ganz allmählich vom Diesseits ins Jenseits.
Wenn du mich tötest, wird das alles hier ein Ende haben. Das hatte sie gesagt, damals, als sie zum ersten Mal in seinen Armen gelegen hatte. Wenig später hatte sie nach seinem Schwert gegriffen und es sich selbst in den Leib gestoßen.
Silberdorn war keine gewöhnliche Waffe. Die Wunden, die seine Klinge schlug, heilten nicht auf natürlichem Weg. Als Niccolo Mondkind hierhergebracht hatte, in die Heiligen Grotten der Himmelsberge, war die Lage aussichtslos gewesen. Die Drachenmagie war ihre einzige Hoffnung.
»Aber wird sie wirklich gesund sein, wenn sie erwacht?«, hatte Niccolo gefragt.
»Wenn sie erwacht«, hatten die Drachen geantwortet, »wird es ihr besser gehen.«
Das war alles. Eine schemenhafte Hoffnung. Nur ein verzweifelter Wunsch, der vielleicht einmal wahr werden würde.
»Ich bleibe bei dir«, flüsterte er, als er sich ein letztes Mal ganz nah an ihr Gesicht beugte. »Egal was geschieht. Wenn du die Augen aufschlägst, werde ich da sein.« Dann küsste er sie, bis ein wenig Wärme in ihre eiskalten Lippen zurückkehrte, das Einzige, was er ihr mit auf den Weg geben konnte.
»Keine Versprechen«, wisperte sie, als er sich von ihr löste, nur einen Fingerbreit.
Aber er sagte: »Ich werde dich immer lieben.«
Ihre Augen fielen zu. Um ihre Mundwinkel lag die Spur eines Lächelns.
»Es ist so weit«, erklang die Stimme des Drachenkönigs in seinem Rücken.
Niccolo blinzelte. Mondkinds Griff um seine Finger löste sich, ihre Hand sank zurück an ihre Seite; etwas Bittendes war in dieser letzten Berührung gewesen, ein stummes Flehen.
Nicht um Hilfe.
Nur um Vergebung.
Ein Schwarm wilder Bücher
Die Wolkeninsel trieb nach Norden.
Sie hatte wieder ihre einstige Höhe erreicht, zweitausend Meter über dem Erdboden. Oben auf den Gipfeln der fünf wattigen Wolkenberge saugten die Aetherpumpen das Lebenselixier des Eilands aus den Regionen jenseits des Himmels. Nur wer sein Ohr fest an das Metall ihrer Außenhaut legte, hörte ihr leises Stampfen. Ein elektrisierendes Kribbeln übertrug sich von der Pumpe auf die Haut, nicht schmerzhaft, nicht einmal unangenehm, aber doch ungewohnt und rätselhaft genug, um die meisten zurückschrecken zu lassen.
Alessia hatte die Eisenhaut der Türme immer für glatt und makellos gehalten, bis sie dem Schattendeuter vor einigen Tagen heimlich durch den Zugang ins Innere gefolgt war. Heute aber war die Tür wieder verschlossen, und wer von ihrer Existenz nichts ahnte, hätte sie niemals bemerkt.
Das Schlüsselloch war gut getarnt und wurde nur sichtbar, wenn man mit einem spitzen Gegenstand fest auf die richtige Stelle drückte.
Einmal mehr hob Alessia ihren Dolch und stocherte in der winzigen Öffnung herum. Sie versuchte nun schon seit Stunden die Tür aufzubekommen. Langsam musste sie einsehen, dass es zwecklos war. Ohne den Schlüssel würde sie hier niemals hineinkommen.
Fluchend schob sie die Klinge zurück unter ihren Mantel. Es war eine lange, schmale Waffe, beinahe ein Stilett, die sie aus der herzoglichen Waffenkammer entwendet hatte. Niemand hatte etwas bemerkt. Ihr Vater, der Herzog, verbrachte jede Stunde des Tages – und einen Großteil der Nächte – damit, Sitzungen des Rates zu leiten. Er und alle anderen waren viel zu sehr damit beschäftigt, den Schattendeuter zu feiern, den Retter des Wolkenvolks, den Herrn über den Aether, wie sie ihn jetzt nannten.
Alessia wurde übel bei dem Gedanken. Sie war die Einzige, die die Wahrheit kannte – und niemand hörte ihr zu, nicht einmal ihr Vater. Herr über den Aether, von wegen. Oddantonio Carpi, der Schattendeuter des Wolkenvolks, diente dem Aether wie ein Sklave. Aus einem Grund, den sie nicht kannte, hatte er bis vor wenigen Tagen damit gewartet, die Pumpen wieder in Gang zu setzen. Sie war nicht einmal sicher, ob wirklich er dafür verantwortlich war oder nicht eher sein Meister, der Aether selbst, jene unfassbare Macht, die sich wie eine unsichtbare Glocke jenseits des Himmels über die Welt spannte.
Sie wusste, dass nur einer ihr Antworten auf ihre Fragen geben konnte. Dazu aber musste sie ins Innere der Wolkeninsel gelangen, und dorthin führte nur der Weg durch die Pumpen.
Zornig trat sie mit dem unverletzten rechten Bein gegen die Tür, ohne zu bedenken, dass das linke allein zu schwach war, um damit ihr Gleichgewicht zu halten. Mit einem Aufschrei geriet sie ins Schwanken und wurde vom eigenen Schwung gegen die Pumpe geworfen. Sie fiel hin, wälzte sich mit einem wütenden Schluchzen herum und lehnte den Rücken gegen das eiskalte Eisen. Tränen der Wut liefen ihr übers Gesicht, als sie mit beiden Händen das verwundete Bein ausstreckte.
Das Felsenwesen, mit dem sie in der Halle der Luftschlitten gekämpft hatte, hatte Alessias Oberschenkel mit einem seiner säbelartigen Armdorne durchbohrt. Die Hornklinge hatte den Knochen verfehlt, was ihr Glück gewesen war. Trotzdem würde es lange dauern, bis die Wunde in Muskeln und Fleisch verheilt war.
Sie rappelte sich auf, rieb sich die Tränen aus den Augen und stieß einen Pfiff aus. Die Sonne war fast untergegangen. Bald würde es auf dem Berg noch kälter werden. Es war zwecklos, hier länger auszuharren.
Aus der anbrechenden Dämmerung trabte ihr Pferd heran. Sie zog sich auf seinen Rücken und lenkte es vom Gipfel auf den schmalen Pfad, der zwischen erstarrten Wolkenbuckeln den Berg hinabführte. Hier oben befand sie sich rund achthundert Meter über dem ebenen Teil der Wolkeninsel. Selbst in der aufziehenden Dunkelheit sah sie von hier aus noch die Narben der Schlacht. Wo die Felsenwesen den Rand der Insel erklommen hatten und vom Herzog und seinen Männern in Kämpfe verwickelt worden waren, markierten hässliche schwarze Flecken das Schlachtfeld. Wälle aus Reisig waren entzündet worden, um die Angreifer aufzuhalten; ihre Überreste sahen aus wie Brandwunden im weißen Leib der Insel. Alessia glaubte noch immer den Gestank der Feuer zu riechen, in deren Flammen zahlreiche Felsenwesen umgekommen waren. Später hatte man auch die Toten des Wolkenvolks verbrannt, so wie es seit jeher Sitte war auf der Insel. Vielleicht war es ihr Geruch, der dem Eiland noch immer folgte, eine Aschespur aus verlorenen Seelen.
Alessias Pferd suchte sich seinen Weg den schmalen Pfad hinunter. Der Wind war stärker geworden und würde womöglich bald zum Sturm. Normalerweise bedeutet dies, dass die Wolkeninsel durchgeschüttelt und von den Winden kreuz und quer über das Land geweht wurde. Stattdessen aber hielt sie seit Tagen einen stabilen Kurs nach Nordwesten, während in der Ferne die Felsgipfel eines mächtigen Gebirges vorüberzogen. Nicht einmal das weckte das Misstrauen ihres Vaters und der Priesterschaft – der Zeitwind wisse schon, wohin er die Insel führe, behaupteten sie. Alles sei vorherbestimmt, alles sei Schicksal. Alessia hätte schreien mögen vor Wut.
Als sie im Dunkeln am Fuß des Berges ankam, hatte sich der Schmerz in ihrem Bein ein wenig beruhigt und pulsierte gleichmäßig vor sich hin. Die ersten Sterne glitzerten am Himmel. Und da war noch ein anderer Lichtpunkt, nicht weit entfernt – eine schwankende Öllampe. Alessia hatte sie schon vom Hang aus entdeckt, aber da hatte sie noch geglaubt, dass es einer der Bauern wäre, der sich auf dem Heimweg zu einem der abgelegenen Höfe befand. Jetzt erkannte sie, dass sie sich geirrt hatte.
Direkt vor ihr, mittlerweile unsichtbar in der Nacht, lag der Hof der Spinis. Niccolo hatte dort gelebt, zuletzt ganz allein, nachdem sein Vater vom Wolkenrand in die Tiefe gestürzt war. »Nachdem ihn der Zeitwind geholt hat«, hatten die Priester behauptet.
Mit einem Mal erlosch das einsame Licht in der Dunkelheit. Wer immer es trug, hatte die Flamme entweder erstickt oder war in eines der Gebäude verschwunden. Wer aber geisterte bei Nacht auf dem verlassenen Gehöft der Spinis umher?
Sie wusste, dass der alte Emilio Niccolos Vieh auf seinen eigenen Hof gebracht hatte und es dort versorgte. Emilio war über siebzig und hatte nicht an den Kämpfen gegen die Felsenwesen teilgenommen. Ganz sicher hatte er auch heute Nacht Besseres zu tun, als in der Finsternis über den Spinihof zu schleichen.
Der weiche Wolkenboden dämpfte den Hufschlag ihres Pferdes, aber sie war unsicher, ob er vom Hof aus nicht trotzdem zu hören war. Der Wind wehte tückisch und mochte Laute in ungeahnte Richtungen tragen. Andererseits übertönte sein Säuseln und Fauchen vieles, und so beschloss sie nach kurzem Zögern, so nah wie nur möglich heranzureiten.
Noch immer erkannte sie nur eine schwarze Masse irgendwo vor sich. Das mussten das Haupthaus und der einzelne Schuppen sein.
Während sie mit klopfendem Herzen nach Hinweisen auf einen weiteren Menschen suchte, kroch der Mond hinter den Wolkenbergen hervor. Ein mattgrauer Schein schob sich über die Wolkenlandschaft und traf auf das kleine Gehöft.
Alessia zügelte abrupt ihr Pferd. Nur ein schmales Stück des aufgehenden Mondes lugte hinter dem Gipfel hervor, aber sein Licht reichte aus, um ihr einen gehörigen Schreck einzujagen. Nicht weil dort vorn etwas war – vielmehr wegen dem, was nicht mehr da war.
Der Hof der Spinis hatte immer nah am Rand der Wolkeninsel gestanden, gerade einmal einen kräftigen Steinwurf vom Abgrund entfernt. Jetzt aber ragte er wie eine klobige Galionsfigur geradewegs in die Leere hinaus.
Nachdem die Aetherpumpen zeitweise ihre Arbeit eingestellt hatten, hatten sich Teile der Insel vom Rand her aufgelöst. Während der Wochen, die sie verkeilt zwischen drei Felsgiganten gehangen hatte, war sie mit jedem Tag ein wenig tiefer gerutscht, auf den Erdboden zu, und hatte dabei eine Spur aus Wolkenfetzen an den Granithängen zurückgelassen. An den meisten Stellen der Randregion fiel das heute nicht weiter auf, weil sie unbewohnt waren und kaum jemand dorthin ging. Hier aber, am Einsiedlerhof der Spinis, zeigte sich das ganze Ausmaß der Katastrophe.
Das Wolkenland zwischen Hof und Rand hatte sich aufgelöst. Der Dielenboden des hölzernen Haupthauses ragte zu einem guten Drittel über den Abgrund hinaus; es fehlte nicht viel und das Gebäude würde über den Rand kippen. Schon jetzt kam es Alessia vor, als hätte es sich leicht der Tiefe zugeneigt, so als zögerte es noch damit, sich endgültig hinabzustürzen.
Während sie das Pferd in einem Bogen um das Anwesen lenkte und sich dem Haus nun von der Seite näherte, erkannte sie, dass der Schaden größer war, als sie vermutet hatte. Die Wand, die dem Abgrund zugewandt war, existierte nicht mehr. Sie war mitsamt einem Teil des Dachs fortgerissen worden, wahrscheinlich von einem Felsvorsprung. Auch der Boden sah ausgefranst und zersplittert aus.
Sie hörte ein Flattern wie von gefiederten Schwingen. Zugleich entdeckte sie mehrere dunkle Punkte, die an der aufgerissenen Seite des Hauses umherwirbelten. Ein Vogelschwarm, dachte sie im ersten Moment. Dann erkannte sie die Wahrheit.
Bücher.
Cesare Spinis Bücher, die er über Jahrzehnte hinweg gesammelt und in seinem Haus gehortet hatte. Uralte Schriften, die auf der Wolkeninsel verboten waren. Auch ihretwegen hatte sich Cesare mit seinem Sohn Niccolo so weit draußen, fernab der Ortschaft angesiedelt.
Jetzt flatterten und schwirrten sie wie ein Pulk wild gewordener Sperlinge. Das Erstaunlichste daran war, dass nur wenige in die Tiefe stürzten. Die meisten wurden von den heftigen Aufwinden gepackt und umhergeschleudert, aus dem zerstörten Haus, dann wieder hinein, ein bizarrer Luftwirbel, wie es sie an den Rändern der Wolkeninsel immer wieder gab.
So gebannt starrte Alessia vom Rücken des Pferdes auf den wilden Bücherschwarm, dass sie den Mann, der jetzt aus dem Eingang der Ruine trat, beinahe zu spät entdeckte. Ihr blieb keine Zeit, eine Deckung zu finden, und so blieb sie reglos sitzen, flehte in Gedanken das Pferd an, nur ja keinen Huf zu heben oder gar zu schnauben, und blickte abwartend auf die Gestalt vor dem Haus.
Im fahlen Schein der Öllampe, die der Mann am Boden absetzte, konnte sie kein Gesicht ausmachen. Wohl aber erkannte sie den weiten schwarzen Mantel und die Kapuze, die der Wind so weit aufbauschte, als wäre der Schädel darunter zu monströsen Ausmaßen angewachsen.
Oddantonio Carpi. Der Schattendeuter.
Rund zwanzig Meter trennten sie voneinander. Alessia hätte ihr Pferd herumreißen und davongaloppieren können; zu Fuß hätte Carpi sie niemals eingeholt. Und doch blieb sie stehen, erstarrt vor Schreck, aber auch unfähig, ihren Hass auf ihn unter Kontrolle zu bringen und das einzig Vernünftige zu tun: die Flucht zu ergreifen.
Er hatte sie nicht bemerkt. Blickte nicht einmal in ihre Richtung. Stattdessen schaute er zum Berg hinauf.
Nein, daran vorbei – zum Mond. Es sah aus, als fiele ein besonders heller Lichtstrahl auf die Stelle, an der er stand. Carpi zog die Kapuze zurück, und nun sah sein Gesicht beinahe weiß aus, wie eingefroren.
Hinter ihm gähnte der schwarze Umriss der Tür. Aus dem Inneren drang das Flattern von Papierseiten, die der Wind mit aberwitziger Geschwindigkeit umblätterte.
Das Pferd ruckte ungeduldig mit dem Kopf hoch und stieß einen Laut aus. Ehe der Schattendeuter reagieren konnte, lag Alessias Hand am Dolch.
Aber Carpi bewegte sich noch immer nicht. Er musste das Tier gehört haben. So groß war die Entfernung nicht. Warum drehte er sich dann nicht zu Alessia um?
Das Mondlicht meißelte ihn aus den Schatten wie eine Skulptur aus Glas. Selbst sein schwarzer Mantel schien alle Färbung zu verlieren, war nun kaum mehr grau, fast weiß. Er hatte die Augen geschlossen. Langsam begann er sich vor und zurück zu wiegen, während seine Lippen sich bewegten, ohne dass ein einziges Wort an Alessias Ohren drang.
Vorsichtig trieb sie das Pferd mit den Fersen an, ließ es langsam vorwärtstraben, nur wenige Meter von der Wolkenkante entfernt. Sie näherte sich dem Haus und befand sich jetzt schräg hinter Carpi. Sie war sich der Gefahr durchaus bewusst, so nah am Abgrund. Doch falls er sie wirklich noch nicht bemerkt hatte, war sie in seinem Rücken im Vorteil.
Stumm ließ sie das Pferd anhalten und glitt mit zusammengebissenen Zähnen aus dem Sattel. Jäher Schmerz raste an ihrem linken Bein empor, als sie es aufsetzte. Nicht allzu weit von Carpi entfernt sah sie die Überreste des Windmühlenrades, das sich beim Absturz der Wolkeninsel gelöst hatte und bis hierher gerollt war. Vielleicht wäre es besser gewesen, dahinter Deckung zu suchen. Aber dazu war es zu spät.
Der Schattendeuter badete weiter im Mondlicht, stand schwankend da wie in Trance, während der knochenweiße Schein ihn wie ein Spinnenkokon umgab, Lichtfäden, die ihn festhielten – und lenkten.
Plötzlich verstand sie. Was sie da vor sich sah, musste so etwas wie ein Zwiegespräch zwischen Carpi und dem Aether sein. Eine Verbindung. Sie hätte nicht erklären können, wie es geschah, aber dass es geschah, bezweifelte sie nicht. Ihre beiden größten Feinde – der eine ein Mensch, der andere, ja, was eigentlich? – tauschten etwas aus. Befehle wahrscheinlich.
War sie zuvor noch unsicher gewesen, stand ihre Entscheidung jetzt fest. Langsam zog sie den Dolch hervor. Die lange Stilettklinge schimmerte im Mondschein, wenn auch längst nicht so gleißend wie Carpis Körper. Der Umstand, dass das grobe Leinen seines Gewandes heller reflektierte als blanker Stahl, machte den Anblick noch unwirklicher.
Alessia befand sich jetzt genau hinter dem Schattendeuter, fünf oder sechs Meter entfernt. Rechts von ihr erhob sich die Wand des zerstörten Haupthauses, in ihrem Rücken lag der Abgrund.
Carpi hatte versucht sie zu töten. Er hatte den Pumpeninspekteur Sandro Mirandola vor ihren Augen ermordet. Und sie glaubte fest daran, dass er eine Mitschuld am Absturz der Wolkeninsel trug. Er war ein Verräter, der den Tod verdient hatte. Und obgleich ihre Hand zitterte und ihr Herz zum Zerspringen hämmerte, war sie die Einzige, die verhindern konnte, dass er weitere Verbrechen beging.
Noch ein Schritt. Und noch einer. Ihr Bein tat wieder höllisch weh, und ihr war klar, dass sie es nicht auf einen Kampf ankommen lassen durfte. Sie musste ihn erledigen, solange er wehrlos war, gefangen in dieser gespenstischen Trance, gebadet in Mondlicht, das … irgendetwas mit ihm tat.
Dann stand sie hinter ihm, hob die Klinge hoch über ihren Kopf, die Spitze auf seinen Rücken gerichtet …
… und konnte es nicht.
Er war einen guten Kopf größer als sie. Sie hätte den Dolch genau zwischen seine Schulterblätter treiben können.
Stattdessen aber stand sie da, die Waffe erhoben, und starrte auf seinen Rücken, der eigentlich im Schatten hätte liegen müssen und dennoch leuchtete, so als strahlte das Mondlicht geradewegs durch ihn hindurch. Als setzte es jede Faser seines Körpers in weiße, kalte Flammen.
Sie konnte ihn nicht hinterrücks ermorden. Sie hatte zwei Felsenwesen getötet, weil sie ihr keine andere Wahl gelassen hatten. Aber Oddantonio Carpi war in diesem Augenblick wehrlos. Was immer er auch getan hatte – sie war keine Mörderin. Nicht einmal dann, wenn ihr Opfer den Tod verdient hatte.
Carpi bewegte sich. Kein benommenes Vor- und Zurückwiegen mehr, sondern ein Strecken seiner Glieder, dann ein Neigen seines Schädels nach vorn und nach hinten, als müsste er seine Muskeln lockern. Zugleich ließ der durchdringende Lichtschein nach. Schatten krochen an seinem Rücken empor, sein Mantel färbte sich wieder schwarz. Der Mond am Himmel, gleich neben dem Berggipfel, blieb hell und weiß, aber der eine ganz besondere Strahl, mit dem er den Schattendeuter berührt hatte, war erloschen.
Alessia huschte rückwärts durch den Eingang des Hauses. Noch in der Bewegung wurde ihr bewusst, dass es sinnlos war, sich zu verstecken. Er würde das Pferd sehen, nur wenige Meter entfernt. Er würde wissen, wem es gehörte. Und dass sie hier war. Ganz allein im Dunkeln. Verletzt.
Aber es war zu spät, um zu fliehen. Sie presste sich mit dem Rücken in den Schatten, blickte angespannt zurück zum Eingang. Carpis Kleidung raschelte, als er sich in Bewegung setzte. Ein leises Stöhnen erklang, wie von jemandem, der gerade erst erwacht war.
Die Finsternis in der Ruine war nur auf den ersten Blick vollkommen. Schon nach wenigen Sekunden gewöhnten sich Alessias Augen daran. Sie sah die aufgerissene Seite des Gebäudes keine zehn Schritt entfernt. Das ausgefranste Loch wies hinaus in die Nacht, geradewegs in den Abgrund. Mit seinem gezahnten, gesplitterten Holzrand erweckte es den Eindruck eines riesenhaften Mauls. Darin flatterten die Bücher umher, auf und ab, kreuz und quer durcheinander.
Alessia starrte nach draußen und fühlte sich eingesperrter denn je. Sie war ihr Leben lang eine Gefangene gewesen – eine Gefangene ihrer Abstammung und ihrer Zukunft als Herzogin, eine Gefangene der Wolkeninsel, zuletzt eine Gefangene der Aetherpumpe –, aber dies hier war beängstigender als alles zuvor. Der Schattendeuter würde denselben Fehler nicht zweimal begehen. Sie einzuschließen und sich selbst zu überlassen hatte nicht funktioniert.
Diesmal würde er sie kurzerhand in die Tiefe werfen, ohne dass je ein Verdacht auf ihn fiele.
Sie hätte ihn doch umbringen sollen. Sie war eine Närrin gewesen.
Carpi erschien im Eingang. Seine Silhouette verfinsterte den Ausschnitt der mondhellen Landschaft.
Schweigend blieb er stehen und starrte herein zu ihr ins Dunkel.
Am Abgrund
Die heftigen Winde, die aus der Tiefe in die Ruine stürmten, erfassten nicht nur die Bücher, sondern auch Alessias rotes Haar und das Gewand des Schattendeuters.
»Ich weiß, dass du hier bist«, sagte er.
Sie zog sich tiefer in die Finsternis zurück und tastete nach einer Stelle, an der sie ihr verletztes Bein aufstützen konnte. Sie brauchte einen festen Stand, falls der Schattendeuter näher kam.
Es gab zwei Fenster, eines ganz in ihrer Nähe, ein anderes auf der gegenüberliegenden Seite. Das Erdgeschoss bildete einen einzigen Raum, in dem zerstörte Regale, eingestürzte Büchertürme und umgefallene Möbel eine gefährliche Trümmerlandschaft bildeten. Ihm hier im Dunkeln zu entkommen war für Alessia so gut wie unmöglich.
Aber noch hatte Carpi sie nicht gesehen. Er zog sich wieder ins Freie zurück, wahrscheinlich um die Öllampe zu holen. Ein paar Sekunden später hörte sie den Metallhenkel knirschen.
Sie eilte vorwärts, so gut das mit ihrer Beinwunde ging, an der Tür vorbei und auf den Abgrund zu. Bücher umschwärmten sie, harte Kanten streiften ihre Schultern und Schläfen. So weit vorn am Rand lief sie Gefahr, von den Winden gepackt und in die Tiefe gerissen zu werden. Aber sie musste das Risiko eingehen. Sie war viel leichter als Carpi, und sie spekulierte darauf, dass er nicht wagen würde, ihr auf den morschen Holzboden zu folgen. Dieser Teil der Ruine ragte über den Abgrund hinaus, unter den Dielen war nichts als gähnende Leere.
Der Schattendeuter kehrte mit der Lampe zurück, leuchtete erst in den vorderen, dunklen Teil des Raumes, wandte sich dann dem zerstörten Ende zu. Er hätte kein Licht benötigt, um Alessias Umriss vor dem sterngesprenkelten, bücherumtosten Schlund zu entdecken.
»Da bist du.« Er klang weder überrascht noch erregt. Seine Ruhe war beängstigender als jeder Wutausbruch.
»Bleib, wo du bist!«, rief sie zurück. Nicht allzu beeindruckend, gestand sie sich ein. Nicht, wenn man eindeutig die Schwächere, Verletztere, Unterlegene ist.
»Tut dein Bein sehr weh?«, fragte er mit geheuchelter Freundlichkeit.
Ein Buch wurde vom Sturm in ihren Rücken geschleudert und hätte sie beinahe stolpern lassen. Ein anderes zischte an ihrem Ohr vorüber, krachte gegen die Wand und fiel neben ihr zu Boden. Aufgeschlagen blieb es liegen, während der Wind die Seiten durchstöberte wie ein unsichtbarer, geisterhafter Leser.
Carpi kam näher. Er befand sich jetzt in der Mitte des Hauses, noch auf festem Boden, während Alessia auf ihrem gesunden Bein so nah am Abgrund balancierte, dass selbst ein Gedanke zu viel sie ins Nichts zu schleudern drohte. Mit der linken Hand hielt sie sich an einem vorstehenden Holzbalken fest, einem Überrest der Rückwand.
Unter den Füßen des Schattendeuters knarrte der Boden. Er blieb stehen und hob die Öllampe ans Gesicht. Auf unheimliche Weise kam er Alessia jünger vor als bei ihrer letzten Begegnung, so als hätte das Mondlicht die Falten von seinen hageren Zügen radiert. Er wirkte ausgeschlafen und kraftvoll. Aus seiner Stimme sprach unerschütterliches Selbstvertrauen.
»Ich bin ein Auserwählter des Aethers«, sagte er. »Ihr werdet sterben und ich werde leben. So ist es vorherbestimmt.«
Zwei Einfälle kamen ihr. Der erste: Ich könnte den Dolch auf ihn schleudern. Nur dass sie damit keine Erfahrung hatte und wahrscheinlich alles Mögliche getroffen hätte, nur nicht ihn. Und der zweite: Ich könnte um den Rand der Außenwand klettern und draußen vor ihm davonlaufen. Nur dass sie mit ihrem Bein weder besonders gut klettern noch schnell genug rennen konnte.
Die Wahrheit war: Sie konnte überhaupt nichts tun, nur dastehen und abwarten.
»Du sitzt in der Falle«, stellte er folgerichtig fest. »Und nun wirst du sterben.«
Unter ihr geriet der Boden ins Schwanken. Das ganze Haus neigte sich merklich dem Abgrund zu wie eine Wippe.
»Ich glaube nicht«, sagte sie und stieß einen Pfiff aus.
* * *
Ihr Pferd schob den Kopf durch die Tür. Die Stute war stark genug, um einen Reiter zu tragen, der viermal so viel wog wie Alessia. Die Brust des Tieres war gewaltig, viel zu breit, um ins Haus zu kommen. So breit, dass es den Weg nach draußen versperrte wie ein Felsblock.
»Steh!«, befahl Alessia dem Tier.
Der Schattendeuter knurrte einen Fluch.
»Sieht aus«, sagte sie, »als säßen wir alle beide in der Falle.« Ihre Hand klammerte sie noch fester an den Balken, damit sie auf dem abschüssigen Boden nicht nach hinten fiel. Sie hatte eine Heidenangst, dass das Haus jeden Moment aus seiner Verankerung reißen und in die Tiefe stürzen könnte. Der Erdboden lag zweitausend Meter unter ihnen. Die Vorstellung, dass auch ihr Erzfeind sterben würde, bot wenig Trost – noch so ein Schwindel, den einem die Geschichten in den verbotenen Büchern oft weismachen wollten.
Carpi ging auf das Pferd zu und holte mit der Öllampe aus.
Alessia zögerte nicht länger. Sie federte in die Knie und stieß sich ab. Ihr verletztes Bein wurde von dem Aufprall fast taub, aber das konnte ihr nur recht sein. Das Haus neigte sich mit einem Ruck weiter in ihre Richtung. Ein Stuhl geriet ins Schlittern und rutschte über die Kante, riss einen Haufen Bücher mit sich – und beinahe auch Alessia.
Carpi stolperte rückwärts, wieder fort vom Eingang und dem Tier, das ihn versperrte. Das Pferd wieherte aufgeregt, wich aber nicht zurück. Jetzt schauten nur noch Brust und Schädel durch die Tür. Die Öffnung befand sich auf einen Schlag ein gutes Stück höher, während das Gebäude Richtung Abgrund kippte.
Der Schattendeuter fuhr wutentbrannt herum und suchte vergeblich nach Halt. Schwankend bemühte er sich, den schrägen Winkel des Bodens mit den Beinen auszugleichen. »Du bringst uns beide um!«, schrie er.
»Allein zu sterben ist natürlich viel verlockender«, entgegnete sie.
Das Haus kam wieder zur Ruhe, nun allerdings in gefährlicher Schräglage. Weitere Möbeltrümmer gerieten in Bewegung und glitten abwärts. Ein Regalbrett wischte wie ein breiter Besen über den Boden und fegte eine Unzahl umherliegender Bücher in den Abgrund, ehe es selbst hinterherfiel.
»Ich würde mich an deiner Stelle nicht bewegen«, krächzte Alessia dem Schattendeuter zu.
Carpi stand zwei Schritt von der Tür entfernt. Die Stute in der Öffnung schnaubte aufgeregt, das Weiße war in ihren Augen zu sehen. Doch sie rührte sich noch immer nicht.
»Ruf das Pferd zurück!«
Alessia schüttelte den Kopf. »Nicht, bevor du etwas für mich tust.«
»Was willst du?«, brüllte der Schattendeuter sie an. Er balancierte wie ein Seiltänzer auf dem schrägen Boden, doch er schien zu wissen, dass jeder Ausfall in Richtung Tür das Haus endgültig aus seinen Verankerungen reißen würde. Alessias Worte waren keine leere Drohung gewesen.
Eine Windhose tanzte über die zerfranste Dielenkante herein und riss an Alessias langem Haar.
»Den Schlüssel!«, rief sie über das Tosen hinweg. »Wirf mir den Schlüssel zur Pumpe zu!«
Sie hatte keinen Plan, was sie tun würde, falls er ihr das Ding tatsächlich überließ. An ihrer verzweifelten Lage änderte das nichts, und um den Schlüssel zu benutzen, um überhaupt aus dieser Ruine herauszukommen, musste sie erst an Carpi vorbei.
Das erkannte auch er selbst. Wahrscheinlich ließ er sich deshalb darauf ein. »Nur den Schlüssel? Das ist alles?«
»Danach lässt du mich laufen!« Sie wusste, wie einfältig das klang, und das war volle Absicht. Sollte er sie ruhig unterschätzen.
Das Haus knackte und knarrte bedenklich, selbst über die tobenden Winde hinweg.
»Einverstanden«, antwortete er.
»Gib ihn mir! Schnell!«
Während er versuchte, schwankend auf den Beinen zu bleiben, tastete er mit der linken Hand unter sein Gewand. Rechts hielt er noch immer die Lampe, die sich an ihrem Eisenhenkel bedenklich dem Abgrund zuneigte.
»Hier.« Er zog einen Metallring hervor, an dem nur ein einziger langer, aber sehr filigraner Schlüssel baumelte.
»Schieb ihn mir über den Boden zu«, verlangte sie. »Nicht zu fest. Und gib dir Mühe beim Zielen.«
Er fluchte leise vor sich hin, als er sehr, sehr langsam in die Hocke ging und ausholte. Mit einem schrammenden Laut schlitterten Schlüssel und Ring auf sie zu. Alessia musste sich zur Seite beugen, um danach greifen zu können. Erneut geriet das Haus ins Schwanken.
»Bei Leonardo!«, brüllte Carpi. »Pass doch auf!«
Sie unterdrückte einen Schrei, zerrte den Schlüssel mit links an sich, während sie sich mit rechts weiterhin an dem vorstehenden Balken festhielt. Ihr war klar, dass sie sich möglichst schnell wieder aufrichten musste, wagte aber kaum, sich zu bewegen.
Das Haus lag jetzt fast in einem Fünfundvierzig-Grad-Winkel auf der gewölbten Wolkenkante. Am oberen Ende musste es noch immer Pflöcke und Seile geben, die es festhielten. Aber wie lange konnten sie ein solches Gewicht halten?
»Und nun?«, fragte der Schattendeuter.
»Ich komme zu dir«, entgegnete sie aus einem Reflex heraus, den sie als Entschlossenheit kaschierte. »Wir schaffen es nur, wenn wir beide in die obere Hälfte klettern.«
Carpi kniff die Augen zusammen und fixierte sie. Dann streckte er ihr die Hand entgegen. »Komm her. Ich halte dich.«
»Ja«, erwiderte sie verächtlich, »sicher doch.«
Er zuckte die Achseln. »Wie du meinst.« Damit machte er vorsichtig einen Schritt von ihr fort, die Schräge hinauf.
Ein so heftiges Zittern fuhr durch Balken und Dielen, dass Carpi einen erschrockenen Schrei ausstieß und sofort erstarrte. Von irgendwoher ertönte ein dumpfer Laut, als ein straff gespannter Strick zerriss.
»Sieht aus, als wäre dir der Aether keine große Hilfe!«, rief Alessia. Windböen zerrten sie gleichzeitig in mehrere Richtungen, dann gaben sie ihr einen unverhofften Stoß und schleuderten sie vorwärts. Sie verlor ihren Halt, stolperte mit zwei, drei ungeschickten Schritten die Schräge hinauf und war plötzlich nur noch anderthalb Meter vom Schattendeuter entfernt. Ihre Beinwunde brannte; wahrscheinlich war die Naht aufgeplatzt und blutete wieder.
Genau wie er stand sie jetzt frei im Raum. Da war nichts, woran sie sich festhalten konnten. Ihr verletztes Bein drohte einzuknicken.
Das Pferd wartete noch immer vor der Tür, hatte lediglich einen halben Schritt nach hinten gemacht. Der Dielenboden war so hoch, dass gerade noch der Kopf des Tiers durch die Öffnung hereinblickte.
Alessia sah dem Schattendeuter an, dass er dasselbe dachte wie sie.
Beide stolperten los, ungeachtet der Erschütterungen, die sie verursachten. Carpi hatte einen Vorsprung. Aber es war Alessias Pferd, nicht seines.
Das Tier stieß ein schrilles Wiehern aus, als der Schattendeuter die Hand nach seinem Kopf ausstreckte. Mit einem panischen Zucken riss es das Maul auf – und schnappte nach ihm.
Carpi schrie auf und geriet ins Schwanken.
Im selben Moment prallte Alessia gegen ihn. Unter ihnen stöhnten die Dielen auf. Holzsplitter regneten vom Dachstuhl auf sie herab. Tausende Bücher rutschten die Schräge hinab und prasselten in den Abgrund.
Der Schattendeuter wollte sich an ihr festhalten, doch Alessia hatte bereits nach dem Zaumzeug des Pferdes gegriffen und ihre Finger darunter verhakt.
»Lauf!«, brüllte sie.
Das Tier wich nach hinten zurück und vollzog dabei eine halbe Drehung. Mit einer Bewegung seines Schädels zerrte es Alessia durch die Öffnung. Ihre Wunde schrammte über die Schwelle; es fühlte sich an, als würde ihr Bein abgerissen. Dann fiel sie. Alles ging so schnell, dass sie im ersten Moment nicht wusste, ob sie in den Abgrund stürzte oder fort vom Haus. Mit einer Hand hing sie noch immer am Zaumzeug, ihr Arm wurde verdreht und fast ausgekugelt, aber dann blieben Dielenboden und Türschwelle hinter ihr zurück.
Ein gellender Schrei ertönte, als Carpi sich hinter ihr herwarf. Seine Finger krallten sich in ihr Haar, und als sie versuchte, ihn abzuschütteln, sah sie, dass er mit dem Oberkörper über der Schwelle hing, halb im Haus, halb draußen, während aus mehreren Richtungen die Laute reißender Sicherungsseile erklangen.
Er klammerte sich noch immer an ihr Haar, auch als das Gebäude schon abwärtsrutschte. Einen Moment lang schien es, als hätte er genug Halt, um sich von ihr in Sicherheit ziehen zu lassen. Dann aber rammte sie blindlings den Ellbogen nach hinten, traf ihn im Gesicht – und war plötzlich frei.
Das Zaumzeug entglitt ihren Fingern, sie stürzte der Länge nach zu Boden und wäre fast unter die Vorderhufe des Pferdes geraten. Aber es wich immer weiter zurück, jetzt ohne sie. Geistesgegenwärtig blickte sie nach hinten und erkannte erleichtert, dass sie gerade weit genug von dem abstürzenden Gebäude entfernt war, das jetzt wie ein Schlitten die Wölbung des Wolkenrandes hinabglitt. Carpis Gesicht wurde im Türrahmen kleiner und kleiner. Sein Mund war weit aufgerissen, die Augen panisch verdreht, die dürren Hände tasteten rechts und links ins Leere. Unter furchtbarem Getöse rumpelte das Haupthaus des Spinihofes abwärts, unaufhaltsam und jetzt immer schneller.
Der Lärm endete abrupt. Ein letztes Knarren – dann Stille.
Das Haus war fort. Und mit ihm der Schattendeuter.
Alessia wollte sich aufrichten, dem stürzenden Gebäude nachsehen, aber dazu fehlte ihr die Kraft. In dieser Höhe würde sie auch keinen Aufschlag hören. Nur der Wind pfiff unvermindert aus dem Abgrund herauf, zerzauste ihr Haar und blätterte in einer Handvoll Bücher, die auf dem wattig-weißen Wolkengrund zurückgeblieben waren.
Die Schnauze ihres Pferdes senkte sich auf sie herab, berührte mit einem Stups ihre Wange. Alessia blickte zu ihm auf, sah nur verschwommen die großen dunklen Augen, die fransige Mähne und das Blitzen einer Zaumzeugschnalle im Mondschein. Sie versuchte etwas zu sagen, aber die Worte blieben ihr im Hals stecken. Nur ein Schluchzen drang hervor, teils vor Erleichterung, teils vor Schmerz, vor allem aber, weil ihr auf einen Schlag klar wurde, welchem Schicksal sie gerade entronnen war.
Eine Weile lang blieb sie auf dem Rücken liegen und blickte zu den fernen Pumpen auf dem Gipfel empor, winzige Nadeln vor der Lichtaureole des Mondes. Sie hatte das Gefühl, dass die Wolke unter ihr vibrierte wie von einem geheimen Herzschlag tief im Inneren. Ihre zitternde Hand kroch abwärts, und sie spürte die sanfte Wölbung von Metall unter dem Stoff ihrer Jacke.
Der Schlüssel zur Aetherpumpe.
Vor dem Sturm
Der Frieden über den Wolken war trügerisch.
Niccolo saß allein auf einer Felsspitze, einem der höchsten Gipfel der Himmelsberge, und blickte hinab auf das brodelnde Wolkenmeer. Hätte er die Flanke des Berges erklimmen müssen, um hier herauf zu gelangen, so hätte ihn das Tage gekostet – schlimmstenfalls sein Leben. Stattdessen hatte ihn der Riesenkranich eines Unsterblichen zum Gipfel getragen, durch die graue Dunstdecke der Wolken und darüber hinaus in die menschenleere Einöde des Hochgebirges.
Der Gipfel ragte kaum höher als zwanzig Meter über die Wolken hinaus, eine einsame, schroffe Granitzacke. Ringsum, in mehreren Kilometern Entfernung, waren hier und da weitere Spitzen zu erkennen, die wie Haifischflossen aus der Wolkensee stachen. Sie waren die einzigen Spuren des Erdbodens; sonst war da nur waberndes Weiß, glatt gestrichen wie mit einem Pinsel, unter einer leuchtenden Kuppel aus Blau.
Es fiel Niccolo leicht, sich vorzustellen, er wäre wieder daheim auf der Wolkeninsel, zu Hause beim Volk der Hohen Lüfte. Zurück bei den Menschen, die ihm vertraut hatten.
Bei den Menschen, die er verraten hatte.
Er wollte nicht daran denken, aber natürlich konnte er nicht anders. Früher hatte er geglaubt, er könne das Wolkenvolk hinter sich lassen und würde ihm keine Träne nachweinen. Heute wusste er es besser. Das Heimweh fraß ihn innerlich auf; den Rest zersetzte seine Sorge um Mondkind.
Der Blick seiner goldenen Augen glitt über die Weite des Wolkenmeeres. Er wusste, wie es darunter aussah, manche Gegenden hatte er auf seinem Flug mit dem Kranich überquert. Es gab gewaltige Gletscher in diesem Gebirge, weite Eisfelder, in denen tödliche Spalten klafften.
Doch hier oben über den Wolken sah die Welt aus wie immer. So ruhig, so ungetrübt.
Und dennoch ging es dem Ende entgegen.
Heute hatte er Mondkind zum ersten Mal allein gelassen. Seit die Drachen sie vor drei Tagen in den magischen Heilschlaf versetzt hatten, war er ununterbrochen an ihrer Seite gewesen. Tag und Nacht hatte er über sie gewacht, kaum geschlafen, manchmal geweint, dann wieder nur dagesessen und sie angesehen. Sie lag tief unten in einer der Dongtian, einer der Heiligen Grotten. Der Schlaf sollte sie heilen – und schützen. Vor dem Aether, aber auch vor sich selbst. Ihre Sucht nach reinem Mondlicht barg Gefahren für sie alle, sagten die Drachen.
Vielleicht hatte Mondkind, ausgerechnet Mondkind, es am besten getroffen. Vielleicht war es ihr vergönnt, den Weltuntergang zu verschlafen, einfach hinüberzudämmern zu jenem Ort, der jenseits von allem lag. Dann blieb ihm wenigstens die Hoffnung, sie dort wiederzusehen.
Niccolo hatte niemandem verraten, dass auch er einer Mondlichtattacke des Aethers ausgesetzt gewesen war. Nicht einmal Nugua wusste davon. Mit einem Mal fragte er sich, ob er der Macht des Aethers bereits erlegen war, als er hier heraufgekommen war, an einen Ort, der ihrem Feind näher war als irgendein anderer. Aber nein, er stand noch nicht unter dem Einfluss des Aethers, nicht so wie Mondkind. Er war stark genug, dem Flüstern und Zerren standzuhalten, den fremden Gedanken, die klammheimlich ins Hirn krochen, getarnt als eigene Ideen und Wünsche.
Der Kranich neben ihm regte sich. Der Vogel, der einst dem Unsterblichen Tieguai gehört hatte, lauschte aufmerksam in die Unendlichkeit des Wolkenmeeres. Ehe Niccolo das Wort an ihn richten konnte, brach der Dunst am Fuß der Gipfelspitze auf, schwappte zäh auseinander wie vergorene Milch und spie einen zweiten Riesenvogel hinauf ins Blau.
Einen Moment später glitt Nugua aus dem Sattel. Das Mädchen mit dem struppigen schwarzen Haar kletterte gewandt die letzten paar Meter zu Niccolo herauf.
»Ich hab dich gesucht.« Sie schlug die Arme um ihren Oberkörper und rieb sich die Schultern. Wie Niccolo trug sie einfache Kleidung, Hose und Wams aus Leinen, weit geschnitten nach Art der chinesischen Bauern. Zusätzlich hatte sich Nugua einen Überwurf aus abgestoßener Drachenhaut um die Schultern gelegt und mit einem gegabelten Tierknochen vor der Brust befestigt. Der Anblick weckte die ferne Erinnerung an eine Nacht in den Wäldern von Sichuan, als Niccolo unter ihre Drachenhautdecke gekrochen war. Damals hatte er geträumt, dass sie ihn im Schlaf unentwegt ansah. Grüne, leuchtende Mandelaugen, die im Dunkeln stundenlang auf sein Gesicht gerichtet blieben.
»Du hättest mir sagen können, dass du hier hochwillst.« Sie setzte sich neben ihn und folgte seinem Blick zum Wolkenhorizont. Als sich zufällig ihre Knie berührten, spürte er, dass die leere Weite sie schaudern ließ.
»Ich wollte allein sein«, entgegnete er mit einem Seufzer.
»Gut – ich wollte auch allein mit dir reden.«
Spöttisch sah er sie an. »Du hast Geheimnisse vor deinen Drachenfreunden?«
»Sag das nicht so geringschätzig.«
Er schüttelte langsam den Kopf. »Versuch doch mal, sie mit meinen Augen zu sehen. Ich bin nicht wie du unter Drachen aufgewachsen. Dort unten wimmelt es nur so von ihnen, und für mich sind das alles –«
»Ungeheuer?«, fiel sie ihm ins Wort.
»Fremde.«
»Aus Fremden können Freunde werden.«
»Sie trauen mir nicht. Und ich kann es ihnen nicht mal verdenken. Erst habe ich die Dienerin ihres Erzfeindes in ihr geheimes Versteck gebracht und dann auch noch verlangt, dass sie sie heilen … Ich könnte mich auch nicht leiden, wenn ich sie wäre.«
Sie schüttelte den Kopf und suchte einen Moment lang nach den richtigen Worten. »Das ist es nicht. Sie sind Drachen, Niccolo. Mach nicht den Fehler, sie mit Menschen zu verwechseln. Sie denken anders, sie fühlen anders. Stell dir vor, die Gefühle eines Menschen wären …« Sie zögerte und sagte dann mit einem Schulterzucken: »Ein Grashalm. Dann wären die von Drachen ein riesiger Baum, dessen Wurzeln bis tief in die Erde reichen. Ihre Erinnerung und ihr Wissen gehen zurück bis zu Ereignissen und Orten, die wir uns nicht mal ausmalen können. Wenn ein Drache etwas beschließt, dann hat er tausend Gründe mehr dafür als –«
»Als wir?« Er runzelte die Stirn. »Du hast immer gesagt, du bist selbst so was wie ein Drache.«
»Ja«, sagte sie niedergeschlagen. »Das dachte ich auch.« Fast ein Jahr war es her, seit Yaozi und die anderen Drachen Nugua allein in den Bergwäldern des Südens zurückgelassen hatten. Sie hatten sie aufgezogen, vom Neugeborenen bis zum jungen Mädchen; sie hatten ihr das Gefühl gegeben, eine von ihnen zu sein; und dann, von einem Tag auf den anderen, waren sie verschwunden. Ohne Abschied, ohne ein Wort der Erklärung. Heute, Monate später, hatte Nugua zwar die Drachen wiedergefunden, aber sie wusste noch immer nicht, warum Yaozi sie damals alleingelassen hatte. Niccolo kannte sie gut genug, um zu ahnen, wie enttäuscht und verletzt sie war.
Er berührte tröstend ihre Hand, aber sie zog die Finger sofort wieder zurück, als hätte sie sich verbrannt. »Tut mir –«, begann er, aber Nugua unterbrach ihn.
»Nein, mir tut es leid. Ich …« Sie suchte nach Worten. »Ich muss mit dir reden«, sagte sie schließlich.
»Sicher.«
»Über Mondkind.«
Er wich ihrem Blick aus. Als sich ihre Wege am Ufer des Lavastroms getrennt hatten, hatte er gesagt, dass er hoffe, sie wiederzusehen. Das war aufrichtig gewesen, aber zugleich von seiner Empfindung für Mondkind überlagert. Es war Mondkind, die er liebte. Und Nugua … nun, sie war eben Nugua. Das kratzbürstige, stets ein wenig schmuddelige Mädchen aus der Wildnis. Herrje, er hatte sich daran gewöhnen müssen, dass er sie roch, bevor er sie sah.
»Die Drachen haben dir nicht alles gesagt.« Auch sie sah ihn nicht an, sondern hatte ihren Blick nachdenklich hinaus auf den Wolkenozean gerichtet.
»Was meinst du damit?«
»Sie wollten nicht, dass du es erfährst. Dass ich dir davon erzähle …« Sie zog tief die Luft ein. »Yaozi wird nicht froh darüber sein.«
»Was haben sie mir nicht gesagt?«
»Der Schlaf, in den sie Mondkind versetzt haben, soll sie heilen. Von ihren Wunden, vor allem. Und er soll dafür sorgen, dass der Aether keine Macht mehr über sie hat.«
Er nickte. Das alles wusste er. Mondkind war mit ihm in die Heiligen Grotten geflohen, weil die Macht des Aethers für gewöhnlich nicht in die Dongtian hinabreichte. Schon einmal, unten im Süden, hatten sie in einer der geheiligten Grotten Schutz gesucht, und in diesen hier hätte es genauso sein sollen. Wie hätten sie auch ahnen können, dass die Drachen sich ausgerechnet hierher zurückgezogen hatten? Aether war ursprünglich nichts anderes als Drachenatem, und die Tatsache, dass sich die Drachen in den Höhlen aufhielten und atmeten, stellte eine Verbindung zum Aether über dem Himmel her, die geradewegs in die Dongtian führte. Deshalb gab es hier für Mondkind keine Sicherheit. Genauso wenig wie für Niccolo selbst.
»Was haben sie mir verheimlicht?«, fragte er noch einmal. Eben noch hatte er die Kälte der Gipfelregion als klar und erfrischend empfunden. Nun stachen die Winde mit einem Mal wie Nadeln in seine Haut.
»Der Schlaf wird sie heilen«, sagte Nugua zögernd. »Aber nicht nur von ihren Wunden. Auch von … allem anderen.« Sie seufzte leise, dann rückte sie endlich mit der Sprache heraus: »Wenn sie aufwacht, wird der Liebesbann keine Macht mehr über sie haben. Die Tatsache, dass sie dein Chi in sich aufgenommen hat, hat dann keine Bedeutung mehr.«
Einen Moment lang brachte er keinen Ton heraus. Er hatte Mühe, die Tragweite ihrer Worte zu erfassen. »Willst du damit sagen, sie wird mich … nicht mehr lieben?«
In Nuguas Augen erschien ein unausgesprochener Schmerz. Und wie in solch einem Augenblick üblich, suchte sie ihr Heil im Angriff. »Ach, verdammt, glaubst du denn wirklich, dass das Liebe ist? Ein Zauberbann, der euch aneinanderbindet?«
In seiner plötzlichen Verzweiflung spürte er noch etwas anderes in sich aufsteigen, etwas, das ihm nicht gefiel und das er dennoch nicht aufhalten konnte – Gehässigkeit. »Was weiß jemand wie du schon von Liebe?«