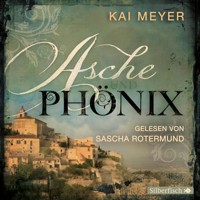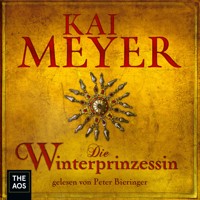8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Im alten China tobt ein Krieg zwischen Seide und Schwert. Mächte von jenseits des Himmels haben das Mädchen Mondkind ausgesandt, um die letzten Unsterblichen zu vernichten – aber bedeutet ihr Tod wirklich den Untergang der Welt? Oder gibt es ein älteres, dunkleres Geheimnis in den Tiefen der Berge? Nur die Drachen kennen die Antwort, doch sie sind verschollen. Während Nugua ihren Spuren folgt und auf sich allein gestellt um ihr Leben kämpft, jagt Niccolo auf der Suche nach Mondkind durch Gebirge und Wüsten. Er weiß, er muss sie töten, um das Wolkenvolk und ganz China zu retten. Aber wie kann er gegen ein Mädchen kämpfen, das er mehr liebt als das Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolkenvolk
LANZE UND LICHT
DIE WOLKENVOLK-TRILOGIE
BUCH ZWEI
KAI MEYER
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Text © by Kai Meyer
Korrektorat: Michaela Retetzki & Elisabeth Kirchharz
Layout Ebook: Stephan Bellem
Buchsatz:
Elisabeth Kirchharz, Corinna Götte & Astrid Behrendt
Illustrationen: Shutterstock
Umschlag- und Farbschnittdesign: Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
Druck: Booksfactory
ISBN 978-3-69130-070-3
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining
im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Inhalt
Prolog
DER DRACHENFRIEDHOF
SEELENSCHLUND
IM UNWETTER
STILLE WIPFEL
TIEGUAI
SEIDENLANZEN
JAGD IM GEBIRGE
SKLAVIN DES MONDES
ALESSIAS ABSTIEG
DIE STIMME DES AETHERS
ÜBER DEN KNOCHENPASS
DRACHENZAUBER
DIE GEHEIMEN HÄNDLER
DAS GILDENSCHIFF
RUINEN
DAS ERWACHEN DER SCHLÄFER
DER FEIND
KAMPF IN DER WOLKE
AETHERSTURM
DER SCHREI DES SPÜRERS
DAS BÜNDNIS
STERNENBEBEN
DAS HERZ DER WÜSTE
IN KETTEN
DIE HIMMELSBERGE
DRACHENGOLD
Drachenpost
China
während der Qing-Dynastie
1761 n. Chr.
Prolog
Einsam verlor sich der Junge in der ungeheuren Weite der Landschaft.
Das Schwert auf seinem Rücken war einst für die Götter geschmiedet worden, aber ein Krieger war er nicht. Seine Liebe gehörte einem Mädchen mit Zauberkräften, doch auch ein Magier war er nicht. Und obwohl er um das Schicksal des Reiches China kämpfte, war er selbst kein Chinese.
Niccolo wanderte den Felsenkamm eines Berges entlang und stemmte sich gegen Winde, die von den höheren Hängen und Gipfeln herabstrichen. Zu seiner Linken gähnte ein Abgrund, viele Hundert Meter tief. Aber Niccolo kannte keine Höhenangst. Er war auf einer Wolke aufgewachsen, hoch über dem Erdboden.
Seine Augen waren golden wie Bernstein, sein Haar dunkelbraun wie das seiner italienischen Vorfahren. Er trug die Kleidung chinesischer Bauern, erdfarbene Hosen und ein knielanges Wams, außerdem ein Bündel, das er sich seitlich an die Hüfte geschnallt hatte, damit es dem Schwert auf seinem Rücken nicht im Weg war.
Vor drei Tagen hatte er seine Gefährten verlassen und sich allein auf den Weg gemacht, hinauf ins Gebirge, auf der Suche nach dem Unsterblichen Tieguai. Bislang hatte er nichts gefunden außer schroffem Fels, eisigen Winden und ein paar Bergziegen mit zerzaustem Fell. Wenn er über die Schulter blickte, zurück in die Lande am Fuß der Berge, dann sah er Wälder und zerfurchte Felsnadeln, auf deren Spitzen knorrige Zedern wuchsen. Unsichtbar in der Ferne floss der uralte Lavastrom. Wolken hingen dort über dem Horizont, dunkelgrau, fast schwarz; sie verbargen, was Niccolo, Nugua und die anderen im Lavasee am Ende des Stroms gefunden hatten.
Er wandte sich nach vorn und sah zu den schneebedeckten Kuppen des Himalayagebirges empor. Er war noch Tage, vielleicht Wochen von den wirklich hohen Gipfeln entfernt. Aber bis dorthin würde er nicht gehen müssen. Seit gestern Abend hatte er sein Ziel vor Augen. Der Unsterbliche Tieguai lebte im Vorgebirge, auf einem Gipfel wie schnurgerade abgeschnitten. Doch obgleich Niccolo den Berg vor sich sah, hatte er nicht das Gefühl, ihm näher zu kommen. Hinter jeder Kuppe lag eine weitere, am Ende jedes Gipfelgrates der nächste Pfad über albtraumtiefen Schluchten und Klüften.
Oft träumte er im Gehen von Mondkind.
Wenn er ihr Seidenband an seinem Gürtel berührte, sah er ihr Gesicht vor sich, bleich und herzförmig, mit dunklen Mandelaugen, umrahmt von schwarzem, glattem Haar. Ihren schlanken Hals, an dem sichtbar die Schlagader pochte, immer so schnell wie Niccolos eigenes Herz.
Mondkind schwebte in diesen Träumen langsam auf ihn zu, gehüllt in einen Ozean aus Seide, der mit wehenden Schleiern und Bändern nach ihm tastete. Bald war ihr Gesicht ganz nah an seinem, er konnte ihre Wärme spüren, roch ihre Haut, sah zu, wie sich ihre Lippen bewegten und lautlose Versprechen formten. Sie lächelte sanft, und das Glück, das Niccolo dabei empfand, lullte ihn ein und betäubte seine Verzweiflung.
Doch wenn er in ihre Augen blickte, tief in sie hinein, dann entdeckte er sein Spiegelbild, und es zeigte keine Spur von Freude. Stattdessen sah er sich schreien, eine Grimasse des Entsetzens, denn etwas in ihm erkannte die Wahrheit. Das Wolkenvolk starb, während er Zeit vergeudete. Die Menschen hatten ihm vertraut, und er hatte sie aufgegeben für eine Liebe, die nur im Verderben enden konnte – für die Liebe zu einer Mörderin.
Aber immer wenn er das erkannte, schloss Mondkind ihre Augen, und Niccolos Abbild verschwand unter ihren langen dunklen Wimpern.
Das Schwert auf seinem Rücken erschien ihm von Tag zu Tag schwerer. Er wusste, warum Wisperwind ihm die Klinge Silberdorn überlassen hatte. Töte Mondkind!, schien die Waffe zu flüstern. Töte sie und rette das Wolkenvolk. Rette alle Völker dieser Welt.
Doch er verbannte die Stimme aus seinem Verstand und kämpfte sich wie betäubt weitere Hänge empor, erklomm kargen Fels, suchte sich seinen Weg über schwindelerregende Tiefen. Weiter ging seine Suche nach Tieguai, dem unsterblichen Einsiedler dieser Berge.
Aber Niccolo fand ihn nicht.
Stattdessen – am dritten Tag seiner Wanderung – fand der Unsterbliche ihn.
DER DRACHENFRIEDHOF
Der Riesenkranich flog höher und überwand einen Wall aus zerklüfteten Felszähnen. Dahinter waberte Nebel, schlängelte sich in Schlieren über die unteren Pässe und kletterte an grauen Granitzähnen empor.
»Wir sind bald da«, rief Li über seine Schulter. Der Unsterbliche packte die Zügel des Kranichs fester und gab dem Tier mit seinen Füßen Signale.
Nugua hörte kaum hin. Sie saß hinter ihm auf dem Rücken des Vogels, eng an Lis gewaltigen Körper gepresst, und konzentrierte sich auf den Schmerz in ihrem Inneren. Li meinte es gut, natürlich. Aber sie spürte, wie der Fluch der Purpurnen Hand sie mit jedem Tag schwächer machte. Ihr Pulsschlag galoppierte so schnell, dass sie manchmal kaum Luft bekam, und sie wagte nicht mehr, das magische Mal auf ihrer Brust anzusehen: der Umriss einer Faust, die sich immer fester um ihr Herz schloss. Lotusklaue, ein Hauptmann der Mandschu, hatte ihr die Verletzung vor drei Tagen im Kampf zugefügt, und nun blieb ihr nur noch wenig Zeit. Vielleicht, wenn sie den Drachenfriedhof rechtzeitig erreichten … Aber all ihre Hoffnungen waren nicht aufrichtig. Tief im Inneren wusste sie, wie schlecht ihre Chancen standen. Sie ahnte, dass sie sterben würde.
Nugua war zierlich, mit struppigem schwarzem Haar und braunen Mandelaugen. Im Vergleich zu dem Unsterblichen, der vor ihr die Zügel des Riesenkranichs führte, wirkte sie zerbrechlich wie eine Puppe. Nugua war kein gewöhnliches Mädchen: Sie war aufgewachsen in der Obhut von Yaozi, dem Drachenkönig des Südens.
Inzwischen war es fast ein Jahr her, seit Yaozi und die übrigen Drachen verschwunden waren und Nugua sich auf die Suche nach ihnen gemacht hatte. Unterwegs war sie Niccolo begegnet, dem Jungen mit den goldenen Augen. Niccolo, der ausgezogen war, das Wolkenvolk zu retten. Er hatte die Wolkeninsel, auf der das Volk der Hohen Lüfte seit zweihundertfünfzig Jahren lebte, verlassen, um in den Weiten Chinas nach einem Drachen zu suchen. Denn Drachen atmeten eine rätselhafte Substanz aus, die der Wolkeninsel Festigkeit verlieh. Ohne sie drohte die Heimat des Wolkenvolks abzustürzen und alle, die auf ihr lebten, ins Verderben zu reißen.
Nugua sah nach vorn und folgte Lis Blick über die Felszacken hinweg. »Woher weißt du, wie nah wir sind? Da ist nur Nebel.«
Der Xian, einer der acht Unsterblichen, nickte mit dem kahlen Schädel, aber weil man zwischen den mächtigen Schultern seinen Hals nicht sah, fiel das kaum auf. Li war der größte Mensch, dem Nugua jemals begegnet war – vor allem aber der breiteste. Drei Männer nebeneinander hätten seinen Umriss nicht hinter sich verbergen können, selbst sein haarloser Kopf hatte einen kolossalen Umfang. Als kleines Kind hatte sich Nugua manchmal Spielgefährten aus flachen Flusssteinen gebaut, die sie mit Baumharz aufeinanderklebte; ihre Körper hatten den Proportionen des Xian geähnelt.
Lis Rückenmuskulatur zuckte unter Nuguas Wange. Er deutete nach unten. »Das da ist die Schlucht von Wisperwinds Karte.«
Der Kranich flog mit majestätischem Flügelschlag zwischen zwei Felsnadeln hindurch, die sich mehrere Hundert Meter über dem Wald erhoben. Dahinter, im Norden, dampfte der Nebel als graue Masse aus der Schlucht empor. Es gehörte nicht viel dazu, sich vorzustellen, dass dieser Ort Geheimnisse barg.
»Es regnet nicht«, stellte Nugua beunruhigt fest. »Wenn da unten wirklich Drachen wären, müsste es regnen.«
Regenwolken folgten den Drachen auf ihren Wanderungen durchs Land. Selbst im Winter nieselte ein warmer Sommerregen auf die leuchtenden Schuppenleiber herab. Während der vierzehn Jahre, die Nugua an der Seite Yaozis und seines Clans verbracht hatte, hatte sie keinen trockenen Tag erlebt; ihr war der lauwarme Regen als etwas ganz Alltägliches erschienen.
Li seufzte leise, während der Kranich sie aus dem Schatten der Felsen trug. Keine zehn Meter unter ihnen breitete sich die Oberfläche des Nebels aus wie ein See, der bis zur gegenüberliegenden Seite der Schlucht reichte. Auch dort wuchs eine zerfurchte Kette aus Granitspitzen in die Höhe.
»Ist Nebel nicht genauso gut wie Regen?«, fragte der Xian.
Nuguas erster Impuls war zu verneinen, doch dann war sie nicht mehr sicher. Die Schuld daran trug die Purpurne Hand; sie machte es schwierig, sich auf einen Gedanken zu konzentrieren, der nicht ums Sterben oder stechende Schmerzen in der Brust kreiste. Trotzdem – Nugua konnte sich vage an Tage erinnern, an denen der Drachenclan durch Nebelbänke gezogen war und die Schwaden mit der Leuchtkraft ihrer gigantischen Schlangenleiber zum Glühen gebracht hatten. »Ich weiß es nicht«, gestand sie schließlich.
Li ließ den Kranich kreisen, während er nach einem aufgewehten Riss im Nebel suchte, nach einer Stelle, die ihnen einen Blick zum Grund der Schlucht gewährte. Doch der Dunst erfüllte die Senke zwischen den Felswänden so dicht wie grauer Schlamm.
»Das ist kein gewöhnlicher Nebel«, sagte Li nach einer Weile. Der Kranich zog gerade seine dritte Runde über der wabernden Oberfläche. »Versuchen wir’s!«
Sogleich neigte sich der Kranich nach vorn und schoss in die Tiefe. Nugua krallte die Finger in Lis Gewand. Darunter war sein massiver Oberkörper so hart wie Stein, ein Koloss aus purer Muskelmasse.
Der Kranich bohrte sich mit vorgerecktem Schnabel in den Nebel. Innerhalb weniger Augenblicke umgab sie dichtes Grau. Die Feuchtigkeit drang durch Nuguas Wams und Hose. Sie bekam eine Gänsehaut, auch weil sie jeden Moment mit einem Aufschlag rechnete. Nicht einmal die Augen des Kranichs konnten scharf genug sein, um durch solch einen Dunst zu sehen.
»Li, bist du sicher, dass –«
Sie brachte den Satz nicht zu Ende, denn von einem Atemzug zum nächsten lichtete sich der Nebel. Die letzten Dunstschwaden wischten wie weiße Fledermäuse an ihnen vorüber. Unter ihnen gähnte ein tiefer Abgrund. Düsternis verbarg die Rätsel dieser Kluft, obwohl die Sonne oberhalb des Nebels gerade ihren höchsten Stand erreichte.
Bald schälten sich helle Strukturen aus dem Dämmer, weißgelbe Bögen, manche so hoch wie Türme.
Titanische Gerippe.
»Wir sind da«, stellte Li zufrieden fest. »Der Friedhof der Drachen.«
Nugua blickte sich um und schwieg für lange Zeit. Selbst sie, die von Drachen aufgezogen worden war, war bis zuletzt nicht sicher gewesen, ob sie lediglich einer Legende nachjagten. Der Ort, an den sich die Drachen nach Jahrhunderten, manchmal Jahrtausenden zum Sterben zurückzogen, war unter Yaozis Volk ein Geheimnis, über das niemand sprach. Nur ein einziger Drache, so hieß es, lebte dort, wo alle anderen nichts als den Tod fanden: ein uralter Wächter, der den Friedhof seit vielen Zeitaltern vor Eindringlingen bewahrte. Er war Nuguas letzte Hoffnung – denn ganz gleich, was die Drachen dazu gebracht hatte, ohne ein Wort zu verschwinden, der Wächter würde niemals seine Pflicht verletzen und das Heiligtum seines Volkes ungeschützt zurücklassen.
Lebende Drachen besitzen Ähnlichkeit mit gigantischen Schlangen, doch aus der Luft erschienen Nugua ihre Skelette eher wie bizarre Hybriden aus Reptil und Säugetier. Die Bögen, die ihr aus der Höhe als Erstes auffielen, waren Rippen, dutzendfach aneinandergereiht, sodass sie am Grund der Schlucht gewundene Tunnel bildeten. Manche Drachen hatten sich zum Sterben ineinandergerollt, andere lang ausgestreckt. An einigen waren Kletterpflanzen emporgerankt, verschlungene, schwarzblättrige Gewächse, wie sie womöglich nur an einem Ort wie diesem gedeihen konnten.
Selbst aus der Luft war es unmöglich zu sagen, wie viele Drachenleiber dort unten zusammengekommen waren. Über Tausende von Jahren hinweg hatten sie sich zum Sterben hierher begeben, abgeschottet von der Welt durch Nebel und Granit. Es mussten Hunderte sein, viele so weit zerfallen, dass die Gestalt ihrer Körper nicht mehr zu erkennen war. Knochen waren ineinandergesunken, hatten sich zwischen anderen verhakt, waren zersplittert oder auf bizarre Weise miteinander verschmolzen. Dort, wo sich einzelne Leiber von anderen unterscheiden ließen, lagen viele so eng beieinander, dass sie wahre Labyrinthe formten, zehn, zwanzig Meter hohe Säulengänge aus bleichem Gebein und mit Vorhängen aus vermoderter Schuppenhaut.
Längst sank der Kranich nicht mehr tiefer, sondern kreiste wieder, aber das wurde Nugua erst nach einer Weile bewusst. Sie hatte den Atem angehalten, starr vor Erstaunen, zitternd vor Ehrfurcht. Schlagartig überkam sie die Erkenntnis, dass sie hier etwas erblickte, das nicht für menschliche Augen bestimmt war. Gewiss, sie hatte sich selbst nie als Mensch gefühlt, vielmehr als eine vom Drachenvolk, obgleich sie die Wochen an der Seite Niccolos, Feiqings und Wisperwinds beinahe eines Besseren belehrt hatten. Nun aber, da sie den Drachenfriedhof unter sich liegen sah, fühlte sie zum ersten Mal, dass sie nie ein echter Drache geworden wäre, ganz gleich, wie viele Jahrzehnte sie noch in Yaozis Clan verbracht hätte. Obwohl das dort unten nichts als tote Leiber waren, nur blanke Knochen ohne Leben, ohne Verstand, ohne das, was wahre Drachen ausmachte, flößten sie ihr doch ein so überwältigendes Gefühl von Fremdartigkeit ein, von Verlorenheit und schlichtem Kleinsein, dass ihr die Tränen kamen. Sie war kein Drache, würde nie einer sein; aber sie war auch kein Mensch wie alle anderen.
Li schien zu spüren, was in ihr vorging, denn er löste eine seiner Pranken von den Zügeln und legte sie auf Nuguas Hand an seinem Gewand. »Ich weiß, was du fühlst. Mir ist es genauso ergangen, als ich den Göttern gegenüberstand und begriffen habe, dass ich niemals sein würde wie sie. Nicht einmal wie der Staub unter ihren Füßen.«
»Immerhin haben sie dich zum Xian gemacht.«
Er nickte wehmütig. »Nicht Mensch, nicht Gott, sondern etwas dazwischen. Nirgends zu Hause, von keinem geliebt. Immer mit dem Gefühl zu leben, man gehöre weder hierhin noch dorthin, ist nicht einfach. Das ist es, was einen Auserwählten von anderen Lebewesen unterscheidet: seine Fähigkeit zu leiden, zu zweifeln, niemals Gewissheit über sich selbst zu besitzen. Nicht einmal die Aussicht, dass der Tod all dem einmal ein Ende bereiten könnte, ist uns Xian vergönnt.«
Zum ersten Mal spürte Nugua tiefe, uneingeschränkte Freundschaft für den Unsterblichen. Sie verstand ihn, erfasste das ganze Ausmaß seiner Worte, und obwohl manches davon auch auf sie selbst zutraf, fühlte sie, dass es ihr im Vergleich zu ihm doch viel besser erging. Sie konnte frei entscheiden, wie sie leben wollte – als Mensch oder unter Drachen.
Falls sie leben würde und die Purpurne Hand sie nicht umbrachte. Und falls sie die Drachen jemals wiederfände.
»Du willst nicht sterben«, sagte sie nach einem Moment. »Nicht wirklich.«
»Bist du dir da sicher?«
»Warum machst du sonst Jagd auf Mondkind?«
»Weil wir zu Xian gemacht wurden, um zu dienen. Den Göttern, aber vor allem der Welt der Menschen. Wenn wir aufhören zu existieren, reißen zugleich die Bande zwischen Himmel und Erde. Wir dürfen das nicht zulassen. Denkst du, wir wurden wegen unserer Stärke oder wegen unseres Wissens auserwählt? Unsere größte Tugend ist unsere Opferbereitschaft.« Er lachte und deutete aufwärts. »Aber erzähl das nicht denen da oben.«
Während der vergangenen Wochen hatte Li fünf seiner Brüder und Schwestern verloren. Mondkind hatte sie im Auftrag des Aethers ermordet. Von einstmals acht Xian waren nur noch Li und seine Brüder Tieguai und Guo Lao am Leben. Falls es Mondkind gelingen würde, auch über sie zu triumphieren, gab es niemanden mehr, der den Aether davon abhalten konnte, die Welt ins Chaos zu stürzen. Li hatte gar keine andere Wahl, als sich Mondkind früher oder später zu stellen – aber er würde alles tun, damit diese Begegnung zu seinen Bedingungen stattfand. Er musste sie aufhalten, um jeden Preis.
Nugua legte den Kopf an seinen Rücken, als sie ein neuerlicher Schwächeanfall überkam. Die Purpurne Hand presste ihre Brust zusammen und raubte ihr ein paar Sekunden lang den Atem. Panik schnürte ihr die Kehle zu, Todesangst grub sich in ihren Magen. Nur allmählich verging das Gefühl wieder. Die Abstände, in denen sich der Fluch des Mandschuhauptmanns in Erinnerung rief, wurden immer kürzer.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Li.
»Ja … schon gut.«
»Wir werden einen Drachen finden, der den Fluch aufheben kann«, erklärte er entschlossen. »Halt dich fest!«
Und wieder rauschten sie abwärts, begleitet von einem Krächzen des Kranichs, das verzerrt von den Felswänden widerhallte. Es gab keinen Grund zur Heimlichkeit. Sie mussten den Wächterdrachen des Friedhofs finden und ihn um Hilfe bitten – je früher er sie bemerkte, desto besser.
»Dort drüben«, rief Li über das Fauchen der Schwingen hinweg. »Dort gehen wir runter.«
Der Kranich näherte sich einer Lichtung im Irrgarten der Gerippe. Aus der Nähe hatten die Gebeine Ähnlichkeit mit einem bleichen, laublosen Urwald – riesige Stämme, morsche Äste, verwachsenes Unterholz aus Knochen. Dort, wo noch Schuppenhaut erhalten geblieben war, hing sie in verfaulten Fetzen von mächtigen Rippenbögen und wurde vom Luftzug der Kranichschwingen zum Wehen gebracht.
Hier unten war es düster, obwohl oberhalb des Nebels helles Tageslicht herrschte. Falls zwischen den Gerippen noch irgendetwas lebte, blieb es unsichtbar. Nugua bezweifelte, dass es Tiere gab, die sich von den Kadavern ernährten – dafür kam viel zu selten ein sterbender Drache hierher, im Abstand von Jahrzehnten, eher Jahrhunderten.
»Er ist nicht hier«, sagte sie finster, nachdem der Kranich den Boden berührte, auf seinen Stelzenbeinen in die Hocke ging und den Stoß der Landung abfederte. »Was, wenn Feiqing gelogen hat?«
Feiqing, der falsche Drache – ein Mann ohne Gedächtnis, den ein Zauber in einem lächerlichen Drachenkostüm gefangen hielt. Er hatte Nugua und Niccolo auf ihrer Reise begleitet und als Erster von dem Wächterdrachen berichtet, dem er angeblich das Dasein in seinem Kostüm verdankte. Und obwohl Feiqing so etwas wie ein Freund geworden war, vertraute sie ihm nicht uneingeschränkt – was daran liegen mochte, dass sie niemandem vertraute. Nicht einmal Niccolo, für den sie mehr empfand, als sie sich eingestehen wollte. Seine Liebe zu Mondkind hatte ihn unberechenbar gemacht; Nugua wusste noch immer nicht, wie sie damit umgehen sollte.
»Sei vorsichtig beim Absteigen«, riet ihr der Xian, aber da war sie schon nach hinten über das Schwanzgefieder des Kranichs gerutscht und versuchte, mit beiden Füßen gleichzeitig am Boden aufzukommen. Doch statt im Stehen zu landen, knickten ihre Beine ein. Ihre Knie waren nach dem langen Vogelritt wachsweich, ihre Beine ohne Kraft. Keuchend lag sie am Boden, biss die Zähne zusammen und versuchte sich einzureden, dass ihre Schwäche nichts mit der Purpurnen Hand auf ihrer Brust zu tun hatte.
Der Xian sprang trotz seines ungeheuren Gewichts leichtfüßig vom Kranich und landete auf dem Fels. Sie hatte den Verdacht, dass sein Schwanken nur gespielt war, damit sie sich nicht noch ungeschickter fühlte.
Er half ihr auf, aber es dauerte eine ganze Weile, ehe sie einigermaßen sicher stehen konnte. Ihre Beine und Hüften kribbelten wie von Ameisengift, aber Li meinte, das sei ein gutes Zeichen: Das Blut flösse zurück in ihre Glieder, und schon bald werde sie wieder die Alte sein.
Sie waren auf einer lang gestreckten freien Fläche gelandet, nicht sehr breit, aber mindestens fünfzig Meter von einem Ende zum anderen. Überall um sie wuchsen die riesenhaften Rippenbögen der Drachengebeine empor, fünf- oder sechsmal so hoch wie sie selbst. Der Kranich setzte sich nieder und ließ seine Beine unter dem Gefieder verschwinden. Müde bog er den Hals nach hinten und schob seinen langen Schnabel unter die linke Schwinge.
»Er hat sich ein wenig Ruhe verdient.« Li streichelte über den Kopf des Vogels und schaute sich um.
»Hier ist kein Drache!«, brachte Nugua in einem Anflug von Panik heraus. »Zumindest kein lebender! Er hätte uns doch längst bemerken müssen.«
»Hmm«, machte Li, was alles und nichts bedeuten mochte.
Sie ging mit wackligen Schritten zum nächstbesten Rippenbogen hinüber und berührte ihn mit den Fingerspitzen. Der Knochen reckte sich Ehrfurcht gebietend ins Dämmerlicht wie ein geschälter Baumstamm; nicht einmal gemeinsam hätten Nugua und Li ihn mit ausgebreiteten Armen umfassen können. Hoch über ihnen war die Rippe mit einem grotesk langen, vielfach segmentierten Brustbein verwachsen, das von Dutzenden ähnlicher Rippenbögen in der Luft gehalten wurde.
Li trat neben sie. »Schwer vorzustellen, dass das hier einmal ein lebender, atmender Drache war, hm?«
Der Knochen fühlte sich an wie Stein. Plötzlich kämpfte Nugua mit den Tränen. Der Schmerz der langen Trennung von Yaozi und den anderen stieg in ihr empor. »Ich vermisse sie so«, schluchzte sie. Sie hasste sich, wenn sie weinte, sogar jetzt noch.
Li zog sie unbeholfen an sich und tröstete sie. Alles drängte zugleich auf sie ein. Die Sorge um die Drachen, ihre einzige Familie. Die Angst um Niccolo und ihre Verzweiflung über den Bann, der ihn an Mondkind fesselte. Selbst der Druck des Versprechens, das sie ihm bei ihrer Trennung am Lavastrom gegeben hatte, war mit einem Mal zu viel für sie: Falls es gelang, sie zu heilen, dann würde sie an Niccolos Stelle den Atem eines Drachen zum Wolkenvolk bringen. Der Aether, den die Drachen ausatmeten, sammelte sich jenseits des Himmels in einer Schicht aus goldenem Dunst; von dort pumpte ihn das Wolkenvolk herab und verlieh damit seiner Wolkeninsel Festigkeit. Dass der Aether aber zugleich ihrer aller Leben bedrohte, gar die Existenz der ganzen Welt, war etwas, das Nugua noch immer kaum glauben konnte. Und dass die Aetherpumpen des Wolkenvolks versiegt waren und nun auf anderem Weg Drachenatem herbeigeschafft werden musste, schien ihr selbst jetzt noch bizarr und sehr weit weg von allem, was sie je mit eigenen Augen gesehen hatte.
Der Gedanke an ihr Versprechen aber traf sie wie ein Schlag. Auf einmal, ohne dass sie es wollte, verwandelte sich ihr Schmerz in Wut. Wie hatte Niccolo zulassen können, dass sie solch einen Schwur leistete? Sie würde sterben, wenn kein Wunder geschah. Und dieser selbstsüchtige, verblendete Dummkopf verlangte von ihr, dass sie seine Aufgabe übernahm, nur damit er weiter mit Mondkind herumturteln konnte.
Sie wusste, dass sie nicht wirklich so empfand, dass es nur ihr Kummer war, der sie das denken ließ – und doch: Irgendwo in all dem steckte ein wahrer Kern, der Ansatz eines Verrats. Sie mochte Niccolo einfach zu sehr, und das erschreckte sie. Und dieses Gefühl war nur eines von all den neuen, schwer zu begreifenden Dingen, die in letzter Zeit auf sie eingehagelt waren.
Li tätschelte ihren Kopf – ähnlich, wie er das vorhin beim Kranich getan hatte – und wartete, bis sie sich ausgeweint hatte. Abrupt zog sie sich wieder von ihm zurück.
»Wir sollten …«, begann er, runzelte unvermittelt die Stirn und stürmte dann zu seinem Vogel hinüber. Blitzschnell riss er die Lanze aus dem Lederschaft am Zaumzeug des Kranichs. Die rasiermesserscharfe Schaufelklinge an der Spitze der Waffe zog eine silberne Spur durch die Luft, als Li den Schaft mit beiden Händen packte und in Kampfposition sprang.
»Komm her!«, rief er Nugua mit gepresster Stimme zu. »Schnell! Hinter mich!«
»Was ist denn –«
»Beeil dich!«
Sie lief an seine Seite, nicht hinter ihn, und blickte in dieselbe Richtung wie er. Der Kranich zog seinen Schnabel unter der Schwinge hervor und richtete sich auf.
»Etwas kommt«, raunte Li.
Angestrengt starrten sie in das Zwielicht zwischen den Drachengerippen. Es war, als blickte man bei Nacht in einen Wald; jenseits der vorderen Knochentürme versank die Schlucht in einem verworrenen Durcheinander aus Rippenbögen, vermoderter Schuppenhaut und Dunkelheit.
Jetzt hörte sie etwas. Ein Scharren und Klappern. Es wurde rasch lauter. Zugleich erklang ein sanftes Trommeln, wie von Fingerspitzen auf Holz. Tausend Fingerspitzen.
»Auf den Kranich!«, brüllte Li und machte zwei Schritte in die Richtung der Geräusche.
Nugua rührte sich nicht. »Was ist das?«
»Steig auf den Kranich! Sofort!«
Das Tier verstand ihn und stieß Nugua mit dem Schnabel an. Widerwillig fasste sie die Zügel, als der Vogel neben ihr zu Boden sank, damit sie leichter aufsteigen konnte.
»Mach schon!«, befahl Li.
Nuguas Herz hämmerte fast genauso schnell wie das unheimliche Trommeln in der Finsternis. Sie setzte sich hinten auf den Kranich, kurz vorm Schwanzgefieder. »Was ist mit dir?« Sie deutete auf den freien Platz vor sich.
»Halt dich gut fest«, sagte Li, ohne aufzusteigen, und gab dem Riesenvogel einen Wink.
Nugua keuchte laut auf, als der Kranich das Hinterteil anhob und sie auf seinem Rücken ein Stück weit nach vorn warf; sie kam dort zum Sitzen, wo eigentlich Lis Platz war, kurz vor der Stelle, an der das graue Körpergefieder in den weiß-schwarzen Hals überging. Der Kranich drückte die Beine durch und erhob sich. Ein-, zweimal spreizte er versuchsweise die Schwingen, bevor er sich in die Luft erhob.
»Ich kann ihn nicht lenken!«, rief Nugua panisch. Ihr erster Impuls war, sich an dem langen dünnen Kranichhals festzuhalten, aber das Tier stieß ein drohendes Fauchen aus, sodass sie die Finger geschwind zurückzog und sich an die Zügel klammerte. Sie presste die Beine an die Flanken des Vogels, duckte sich tief über das Gefieder und war so beschäftigt damit, nicht herunterzufallen, dass sie gar nicht bemerkte, wie schnell sie an Höhe gewannen. In Windeseile schwebten sie fünfzehn Meter über dem Boden, weit über den höchsten Rippenbögen und Wirbelsäulen.
Ich kann das nicht!, durchzuckte es sie. Aber im nächsten Moment konnte sie es doch, denn sie blieb wider Erwarten sicher sitzen, so als hätte sie während des langen Fluges gemeinsam mit Li mehr über das Steuern eines Riesenkranichs gelernt, als ihr selbst bewusst gewesen war. Dabei war ihr klar, dass sie den Vogel nicht wirklich lenkte. Er tat nur das, was er wollte – oder was Li ihm befohlen hatte. In engen Runden kreiste er über der Lichtung im Knochenlabyrinth, wo sein Meister noch immer kampfbereit stand und auf den unsichtbaren Gegner wartete.
Nach der zweiten Runde saß Nugua sicher genug, um einen längeren Blick in die Tiefe zu riskieren. Der Schwingenschlag des Kranichs rauschte in ihren Ohren, und dennoch hörte sie noch immer das Scharren, das allmählich zu einem Wälzen wurde, während das Trommeln die Intensität einer nahenden Büffelstampede erreichte.
»Li!«, brüllte sie. »Worauf wartest du? Warum, verdammt noch mal, bist du nicht mit hier oben?«
Der Xian beachtete sie nicht. Angestrengt spähte er ins Dunkel, die Schaufellanze stoßbereit. Noch einmal versuchte Nugua, etwas zu erkennen, weiter östlich im Irrgarten der Gebeine, aber die Höhe lenkte sie ab, und es erforderte noch immer gehörige Mühe, sich auf dem Vogelrücken zu halten.
»Kannst du nicht irgendwo landen?«, fragte sie den Kranich, aber es klang eher wie ein Fluch, weil sie annahm, dass er sie eh nicht verstand und ihr erst recht nicht gehorchen würde. Zu ihrem Erstaunen schwenkte der Vogel aus seiner Kreisbahn und stieß auf den höchsten Punkt eines nahen Rippenbogens herab, unmittelbar neben der Stelle, wo der Knochen mit der titanischen Wirbelsäule verschmolz. Die Vogelkrallen fanden festen Halt, und Nugua hatte mit einem Mal freie Sicht auf die Lichtung und den Xian.
Die Dunkelheit auf der anderen Seite nahm Gestalt an. Aber erst als der vordere Teil des Wesens das Dickicht der Gebeine verließ und heraus in den Dämmerschein glitt, ließ sich erahnen, um was es sich handelte.
Nugua öffnete den Mund zu einem Schrei. Ihre Kehle war ausgetrocknet vor Entsetzen, und mehr als ein Krächzen drang nicht über ihre Lippen. Dafür stieß der Kranich ein schrilles Kreischen aus, schlug aufgeregt mit den Schwingen, blieb aber auf der Rippe sitzen, fünf Mannslängen über dem Boden. Nugua klammerte sich an Zügel und Gefieder und konnte den Blick nicht von der Kreatur nehmen, die sich auf Li zubewegte. Plötzlich wirkte selbst der mächtige Unsterbliche winzig im Vergleich zur Körpermasse des Ungeheuers.
Das Wesen hatte Ähnlichkeit mit einem Tausendfüßler, chitinartig glitzernd und segmentiert, mit einer Unzahl verwinkelter Beine zu beiden Seiten seines hässlichen Leibes. Es musste sechs, sieben Meter breit sein, vielleicht mehr. Wie lang es war, blieb ungewiss, denn bisher hatte es gerade einmal seine vorderen Segmente aus dem Gebeinlabyrinth ins Freie geschoben und füllte dennoch bereits die Hälfte der Lichtung aus. Mit brachialer Urgewalt raste es auf seinen rasselnden Panzerbeinen auf den Xian zu, der gar nicht erst versuchte, sich zum Kampf zu stellen. Stattdessen wirbelte er herum und rannte – rannte so schnell, wie Nugua es ihm bei seiner Leibesfülle niemals zugetraut hätte.
Der Kranich schrie erneut, als Li in das Dunkel zwischen den Drachengebeinen tauchte. Das Tausendfüßlerbiest glitt weiter hinaus auf die Lichtung, verharrte aber plötzlich, als sein Kopf die Stelle erreichte, an der eben der Xian gestanden hatte. Noch immer war kein hinteres Ende in Sicht. Der mächtige, wurmartige Leib verschwand irgendwo auf der anderen Seite des Platzes im Knochengewirr. Das Erstaunlichste war – abgesehen von seiner atemberaubenden Scheußlichkeit –, dass das Wesen trotz seiner Größe keines der Drachengerippe auf seinem Weg zermalmt hatte. Wendig wie eine Schlange musste es sich auf Hunderten von Beinpaaren durch das Labyrinth am Grund der Schlucht bewegen, so als besäße es, ja … Achtung vor den gewaltigen Skeletten.
Die Stelle, wo der Kranich und Nugua kauerten, war kaum zwanzig Meter vom Vorderende des riesenhaften Vielfüßlers entfernt. Sie hätte jetzt sein Gesicht sehen können – wäre da eines gewesen. Vielmehr endete das Vordersegment in einer nach außen gewölbten rauen Fläche, in deren Mitte eine winzige Öffnung erschien wie ein Trichter im Treibsand. Sie wurde immer größer, bis sich das halbe Kopfsegment in einen strudelartigen Schlund verwandelt hatte. Mehrfach öffnete und schloss er sich wieder, in pulsierenden, organischen Schüben, ehe er sich abermals glättete, einen Moment lang erstarrte und dann eine neue Form bildete, diesmal kein Trichtermaul, sondern ein Nest wirbelnder Tentakel wie ein Tintenfisch.
Nugua würgte vor Ekel und Furcht, aber noch immer gab sie dem Kranich keinen Befehl, sich in die Luft zu erheben. Der Vogel musste am besten wissen, wann der Augenblick zur Flucht gekommen war. Noch schien er sich hier oben auf dem Gerippe sicher zu fühlen.
Die Fangarme am Vorderende des Tausendfüßlers tasteten mit fingerdünnen Spitzen über den Boden, genau dort, wo Li und Nugua gestanden hatten. Sie schauderte, als ihr bewusst wurde, dass das Ungeheuer wie ein Raubtier ihre Witterung aufnahm.
Das Kopfende richtete sich auf. Die Vordersegmente zogen sich auseinander, richteten sich ebenfalls auf und wandten sich Nugua zu. Obwohl inmitten des Tentakelnestes keine Augen zu erkennen waren, hatte sie das schreckliche Gefühl, dass das Biest sie anstarrte.
»Los!«, brüllte sie heiser.
Der Kranich stieß sich vom Knochen ab, die Schwingen sorgten für blitzschnellen Auftrieb. Innerhalb eines Atemzuges war der Vogel zehn Meter aufgestiegen und flog in die Richtung, in der Li verschwunden war.
Nugua sah über die Schulter zurück zu dem Ungeheuer am Boden der Schlucht. Seine vorderen Segmente waren noch immer hochgereckt und folgten ihrem Flug mit einer schwingenden Bewegung. Die Tentakel wurden in das Kopfende zurückgezogen und verschmolzen wieder zu einer glatten Fläche. Statt ihrer erschien erneut der Trichter, diesmal von zottigen Auswüchsen umrahmt, die biegsame Zähne, aber auch Stopfwerkzeuge sein mochten.
Zugleich drang ein urgewaltiges Trompeten aus dem schwarzen Strudelmaul.
Das Kopfsegment sank zu Boden. Das Biest setzte sich wieder in Bewegung und glitt auf scharrenden Beinpaaren vorwärts, bis es die gesamte lang gestreckte Lichtung ausfüllte – und trotzdem noch kein Ende sehen ließ. Es war mindestens fünfzig Meter lang und dabei beängstigend schnell. Wendig wie ein Aal schoss es zwischen den Gebeinen dahin, ohne auch nur einen einzigen Drachenknochen zu zerbrechen. Kurvenreich und biegsam schlängelte es sich durch das Dickicht der Skelette, vielleicht auf Lis Spur, vielleicht aber auch dem Kranich hinterher. Obwohl der Vogel so geschwind flog, wie es der Platz zwischen den Felswänden zuließ, hielt die Tausendfüßlerbestie am Boden mühelos mit, trotz aller Schlenker, die sie um Beinberge und Knochensäulen machen musste.
Wo steckte nur Li? Nugua konnte ihn von oben nirgends entdecken, was womöglich ein gutes Zeichen war; vielleicht hatte er ein Versteck gefunden, in dem er vorerst sicher war. Er konnte unmöglich vor dem Biest herlaufen, so flink war nicht mal ein Xian.
Sie beugte sich vorsichtig zur Seite, um unter sich zu blicken. Mindestens dreißig Meter hoch flog der Kranich, während sich am Boden die schwarze Chitinmasse des Tausendfüßlers durch das Gebeinlabyrinth wälzte. Das Trommeln der zahllosen Krallen klang jetzt wie Hagel.
Der Vogel flog eine wilde Schlangenlinie, unbeeinflusst von Nugua. Er suchte sich selbst seinen Kurs, und sie vermutete noch immer, dass er Signalen des Xian folgte.
Fauchend und trompetend wurde der Riesentausendfüßler noch einmal schneller, bis sich seine Vordersegmente weit vor dem Kranich befanden, so als könnte er voraussehen, in welche Richtung der Vogel flog. Dann und wann sanken Nebelfetzen von der Dunstglocke in die Schlucht hinab; sie zerstoben, wenn der Kranich und Nugua sie durchstießen.
Ein panischer Schrei drang aus dem aufgerissenen Schnabel des Vogels, so unvermittelt, dass Nugua vor Schreck fast den Halt verlor. Dann begriff sie mit blankem Entsetzen, was geschehen war.
Der Kranich wurde herumgerissen und Nugua um Haaresbreite von seinem Rücken geschleudert. Ein schwarzer Strang hatte sich von unten um seinen Hals gewickelt, glitschig und ölig schimmernd – die Fangzunge der Bestie.
Der Tausendfüßler war zum Stehen gekommen, hatte sein Kopfsegment hoch aufgerichtet und gleichzeitig nach hinten gedreht, sodass er zurückblickte, dorthin, wo der Kranich genau über ihm schwebte und mit verzweifeltem Flattern gegen den Griff der Zunge ankämpfte. Der Strang dehnte sich über die volle Distanz, dreißig Meter vom dünnen Hals des Vogels hinab in den Trichterschlund.
Die Bestie begann zu ziehen.
Tobend und flatternd verlor der Kranich an Höhe, stemmte sich gegen den Sog der Zunge, schlug mit den riesigen Krallen danach. Nugua rutschte nach hinten, dann wieder nach vorn, und alles, was sie tun konnte, war, haltlos zu schreien, als das Tier immer tiefer sank, geradewegs auf das Maul des Ungeheuers zu.
Sie würde fallen. Das stand völlig außer Zweifel. Das Geflatter des gefangenen Kranichs wurde immer heftiger. Der Chitinrücken des Tausendfüßlers kam näher, schien unter ihnen jetzt die ganze Schlucht auszufüllen. Nugua hing an den Zügeln, klammerte zugleich die Beine um den Federleib des Vogels, hatte aber nicht genug Kraft, um den panischen Bewegungen des Tiers standzuhalten.
Ein neuer Laut drang aus dem Maul der Bestie.
Ein lang gezogener Kampfschrei ertönte, als Li mit einem gewaltigen Sprung aus dem Knochendickicht zur Linken des Ungeheuers wirbelte, im Federflug über den haushohen Leib hinwegsetzte und dabei einen gezielten Schlag mit der Schaufellanze führte.
Die schwarze Zunge zersprang und schnellte in beide Richtungen davon. Während Li im Schatten des Gebeindschungels abtauchte, verschwand das eine Ende der Zunge im Trichtermaul des Tausendfüßlers, das andere klatschte unter den Bauch des Kranichs. Vor Schmerz richtete sich der Vogel in der Luft auf, wollte in Panik nach oben davonschießen – und verlor in derselben Bewegung seine kreischende Reiterin.
SEELENSCHLUND
Sekundenlang sah es noch aus, als könnte sich Nugua an den Zügeln des Kranichs festhalten – dann entglitten sie ihren Fingern. Über ihr stieß der Vogel nach oben fort, immer noch panisch, ein weißer Schemen, der blitzschnell kleiner wurde. Nugua stürzte rückwärts in die Tiefe. Ihr Verstand war wie ausgebrannt, gähnende Leere in ihr und unter ihr.
Der Aufprall tat weh, aber der Schmerz wurde vom Schock verschluckt, als sie viel schneller als erwartet auf Widerstand traf. Ihr Rücken prallte auf Chitin, sie schlitterte abwärts, aber nicht zur Seite, sondern in die Vertiefung hinab, wo ein Segment des Untiers ans andere stieß. Dort blieb sie wie betäubt liegen, eingezwängt zwischen den mahlenden Panzerplatten, nur wenige Meter von den riesenhaften Beinen entfernt, die sie augenblicklich zermalmt hätten, wäre sie seitlich daruntergestürzt.
Ganz kurz dachte sie: Aber ich sterbe ja sowieso! Warum sollte sie noch vor diesem Ding davonlaufen? Was gewann sie dadurch? Ein paar Tage? Eine Woche?
Ihr Herzschlag hämmerte gegen den Klammergriff der Purpurnen Hand an, und sie hatte Mühe, sich zusammenzureißen und wieder klar zu denken. Hoch über ihr kreiste der Kranich. Sie sah ihn verschwommen unterhalb der grauen Nebeldecke, sichtlich angeschlagen, ein Bein leicht angewinkelt. Aber wie verletzt er auch sein mochte, schien er doch auf Nugua herabzublicken, als wollte er sie um jeden Preis im Auge behalten und sofort herabstoßen, wenn sich die Möglichkeit dazu bot.
Der Riesentausendfüßler erbebte und zitterte, als er sich wieder in Bewegung setzte. Entweder hatte er nicht bemerkt, dass da ein Mensch auf ihm lag, oder aber es kümmerte ihn nicht. Vielleicht hatte er wieder die Witterung des Xian aufgenommen, denn er änderte seine Richtung, bog seinen Titanenleib nach rechts und glitt unter dem Gitterwerk eines Drachengerippes hindurch, folgte dem beinernen Tunnel aus Rückgrat und Rippenbögen nach Norden.
Nuguas Überlebenswille kehrte zurück, als sie die blanken Wirbel über sich hinwegziehen sah, jeder einzelne so groß wie sie selbst. Rechts und links glitten die Rippen des toten Drachen vorüber. Unter ihrem Rücken bebten die Chitinplatten. Sie lag genau auf der Kante, wo zwei von ihnen zusammenstießen, der Übergang zwischen den Wurmsegmenten des Ungeheuers. Wenn sie in den Spalt geriet, würde sie sofort zerquetscht werden. Darum wagte sie kaum, sich zu bewegen oder gar ihre Position auf dem Rücken des Tausendfüßlers zu verändern.
Nur – irgendetwas musste sie tun.
Ihr Kreuz tat weh vom Aufprall auf dem Chitin, aber sie war nicht hoch genug in der Luft gewesen, als dass sie sich ernsthaft hätte verletzen können. Das monströse Wesen, das sie über den Drachenfriedhof trug, mochte sie nicht bemerkt haben, doch die Gefahr, zwischen den Chitinplatten entzweigeschnitten oder unter den verwinkelten Beinen zertrampelt zu werden, wurde dadurch nicht geringer.
Ganz vorsichtig zog sie erst einen Fuß an, dann den anderen. Langsam winkelte sie die Ellbogen an und setzte die Handflächen neben ihren Ohren auf das Chitin. Dann drückte sie die Hüften nach oben, bildete über dem Spalt zwischen den mahlenden Panzerplatten eine Brücke. Das Schaukeln und Ruckeln machte es alles andere als einfach, diese Position länger als ein paar Sekunden zu halten, aber das hatte sie auch gar nicht vor. Stattdessen federte sie mit einem Ruck den Oberkörper nach oben und stand im nächsten Moment schwankend auf den Füßen, mit dem Rücken zur knirschenden Chitinkante.
Sie war selbst überrascht, dass sie nicht gleich wieder hinfiel. Irgendwie gelang es ihr, die Erschütterungen des Untergrunds auszugleichen und sich vorwärtszubewegen, entgegen der Kriechrichtung der Kreatur. Im Augenblick folgte der Riesentausendfüßler noch immer dem Verlauf des Drachenskelettes, schlängelte sich durch den Säulentunnel aus Rippenbögen.
»Nugua!«
Sie hörte Lis Ruf, konnte aber nicht einordnen, aus welcher Richtung er kam. Der Xian war weder vor noch hinter ihr. Statt abzuwarten, erklomm sie die Kuppe des Chitinsegments, bis sie so weit wie möglich von den tödlichen Reibekanten entfernt war. Außerdem befand sie sich hier fast einen Meter höher, was es leichter machen würde, nach einem der Wirbelvorsprünge über sich zu greifen. Mit gespreizten Armen hielt sie ihr Gleichgewicht, drehte sich vorsichtig um, jetzt wieder in Kriechrichtung des Tausendfüßlers.
Das Kopfende der Bestie hatte den Gerippegang bereits verlassen. Noch zwanzig Meter, höchstens, dann würde auch Nugua wieder im Freien sein. Wenn sie wirklich versuchen wollte, sich an den vorübersausenden Wirbeln festzuhalten, dann musste sie es jetzt tun.
»Nugua!«
Wieder Lis Stimme. Und diesmal begriff sie.
Sie hob den Kopf und blickte nach oben. Da war er, sprintete trotz seiner Körpermasse schräg über ihr von einem Rippenbogen zum nächsten, parallel zur Drachenwirbelsäule. Als er sah, dass sie ihn entdeckt hatte, wurde er noch schneller. Nugua glaubte, die baumstammdicken Knochenbögen unter seinen Schritten erbeben zu sehen, war aber derart mit ihrem eigenen schwankenden Halt beschäftigt, dass sie keinen weiteren Gedanken an seine unglaubliche Geschwindigkeit verlor. Seit ihren Erlebnissen am Lavastrom wusste sie, dass ein Xian Entfernungen verkürzen konnte; Li hatte das bereits mehrfach getan, zuletzt während ihres Kranichfluges, und sie nahm an, dass er dort oben gerade etwas Ähnliches versuchte.
Mit einem Mal war er verschwunden. Aber als sie nach vorn sah, entdeckte sie ihn wieder. Er lag bäuchlings auf der letzten Rippe, direkt über dem Ausgang des Knochentunnels, und streckte beide Arme hinunter. Dazwischen hielt er den Schaft der Schaufellanze wie ein Trapez.
Nugua bewegte sich vorsichtig einen Meter nach rechts, bis sie auf dem gewölbten Panzer eine Stelle erreichte, die sich in wenigen Sekunden genau unter Lis Armen befinden würde. Der Riesentausendfüßler donnerte weiter, trug sie genau darauf zu. Einen Augenblick bevor ihr Segment ins Freie glitt, löste sie sich mit einem verzweifelten Sprung von dem Chitin, streckte die Hände nach dem Lanzenschaft aus und bekam ihn zu fassen. Sogleich fühlte sie sich nach oben gewirbelt, als Li sie an der Lanze aufwärtszerrte, fort vom Rücken des Ungeheuers, hinauf auf den äußeren Rippenbogen des Drachenskeletts.
Ehe sie sich’s versah, stand sie neben dem Xian, atemlos, schwindelig, mit schlotternden Knien. Unter ihr rauschte das Schwanzsegment des Tausendfüßlers aus dem Rippenkäfig ins Freie, hinaus in eine Schneise zwischen weiteren Gebeingebirgen.
»Schnell!«, sagte Li. »Er wird jeden Moment wieder meine Witterung aufnehmen.« Er ging in die Hocke und deutete auf seinen breiten Rücken. »Rauf da! Nun mach schon!«
Sie hatte den Ritt auf dem Tausendfüßler überlebt, da mutete es fast wie ein Spaziergang an, sich von dem Xian tragen zu lassen. Sie klammerte sich mit beiden Armen um seine Schultern, schlang die Beine um seine Brust – sein Oberkörper war so breit, dass sich ihre Füße vorn nicht berührten – und ließ sich von ihm emporheben.
Einen Steinwurf entfernt wälzte sich das Ungeheuer herum, stieß einen zornigen Schrei aus und ließ mehrere Gebeine unter seiner Körpermasse bersten – es war das erste Mal, dass Nugua mitansah, wie das Biest eines der Skelette beschädigte. Sein Zorn nahm überhand, und es vergaß alle Vorsicht.
Li sprang von Rippe zu Rippe, jetzt wieder in die entgegengesetzte Richtung. Das Brüllen des Riesentausendfüßlers hallte von den Felswänden wider, als er die Verfolgung aufnahm. Aus dem Augenwinkel sah Nugua eine Explosion aus Knochenstaub, als das Biest Teile eines Skelettes niederwalzte, um sich einen direkten Weg zurück zum Xian zu bahnen.
Li blickte im Laufen nach oben. Der Kranich war über ihnen, sank jetzt tiefer. Das eine Bein war noch immer angewinkelt, womöglich gebrochen. Er konnte sie unmöglich mit seinen Krallen packen und davontragen, auch wenn Nugua das einen Moment lang gehofft hatte. Um aber zu landen und sie aufsteigen zu lassen, blieb keine Zeit. Der Tausendfüßler war zu schnell.
Hinter ihnen ertönte ohrenbetäubendes Bersten und Brechen.
»Nicht umschauen!«, presste Li hervor.
Nugua sah trotzdem über ihre Schulter – und wünschte gleich, sie hätte es nicht getan. Das Ungeheuer bohrte sich abermals in den Tunnel aus Knochen, diesmal ohne jede Rücksicht auf das morsche Gebilde. Tatsächlich schien es die Rippen auf der einen Seite nun absichtlich zu streifen, sodass sie unter der Gewalt des Ansturms zerbrachen. Graue Fontänen aus Knochenstaub stiegen auf, folgten den beiden Flüchtenden, während hinter ihnen eine Rippe nach der anderen über der Bestie zerbarst, ohne sie merklich aufzuhalten. Das gesamte Skelett geriet ins Wanken, während die Erschütterungen den Xian fast von den Füßen warfen.
Das Kopfsegment des Tausendfüßlers hatte aufgeholt, war jetzt nur noch zehn Meter hinter ihnen, drei oder vier Rippen entfernt. Jeder Knochen, den es passierte, wurde zu Staub und Bruchstücken zermalmt. Schon neigte sich das Gerippe zur Seite. Die Wirbelsäule löste sich hinter Li und Nugua in Einzelteile auf, fiel auseinander wie Perlen von einer zerrissenen Kette.
Li stieß sich ab, federte von den berstenden Rippen zur Seite. Nugua schrie, während sie durch die Luft rauschten, fort von dem Staubinferno in ihrem Rücken. Li wandte jetzt den Federflug an, die rätselhafte Kraft chinesischer Krieger, mit deren Hilfe sie von Dach zu Dach, über Gewässer und Astspitzen schweben konnten. Aber Li war erschöpft, womöglich verletzt, und seine Flugkraft reichte nicht aus, sie beide in Sicherheit zu tragen. Er wollte die Felswand erreichen, die Nordseite der Schlucht, aber schon nach einem Augenblick wurde klar, dass sie es nicht schaffen würden. Sie sanken tiefer und gerieten ins Trudeln. Nugua drohte abzurutschen, doch da polterten sie schon gemeinsam zu Boden. Sie fiel auf den Xian, wurde weich aufgefangen und hatte trotzdem das Gefühl, sich alle Knochen zu brechen. Aber nein, nur der Schmerz des Aufpralls. Erleichtert begriff sie, dass sie keine schweren Verletzungen davongetragen hatte.
Über ihnen kreischte der Kranich eine Warnung, wollte herabstoßen und neben ihnen landen, aber Li scheuchte ihn mit einem Wink davon.
»Warum?«, rief sie nur, als der Vogel abdrehte und wieder an Höhe gewann.