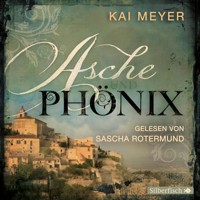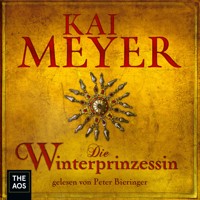8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Nie ist Nugua einem anderen Menschen begegnet. Sie wächst als Mädchen unter Drachen auf – bis die Drachen spurlos verschwinden. So beginnt sie ihre lange Suche in den Weiten Chinas. In einer ihr fremden Welt begegnet sie unsterblichen Magiern, fliegenden Schwertkämpfern – und Niccolo, einem Jungen mit goldenen Augen. Auch er ist auf der Suche. Seit Jahrhunderten lebt sein Volk auf einer Wolke, hoch oben in den Lüften. Doch das Wolkenvolk ist vom Untergang bedroht. Niccolo wurde ausgesandt, eine rätselhafte Substanz zu finden, ohne die es auf den Wolken kein Leben geben kann: den Atem der verschollenen Drachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Wolkenvolk
SEIDE UND SCHWERT
DIE WOLKENVOLK-TRILOGIE
BUCH EINS
KAI MEYER
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Text © by Kai Meyer
Korrektorat: Michaela Retetzki & Elisabeth Kirchharz
Layout Ebook: Stephan Bellem
Buchsatz:
Elisabeth Kirchharz, Samira Schweitzer & Astrid Behrendt
Illustrationen: Shutterstock
Umschlag- und Farbschnittdesign: Giessel Design
Bildmaterial: Shutterstock
Druck: Booksfactory
ISBN 978-3-69130-069-7
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining
im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Inhalt
Prolog
DIE HOHEN LÜFTE
GESTRANDET
DER LUFTSCHLITTEN
WISPERWIND
DIE BRÜCKE DER RIESEN
FEDERFLUG
LOTUSKLAUE
DER DRACHE
DER FLUCH DES WÄCHTERS
ALESSIAS PLAN
DIE LEGENDE VOM HIMMEL
DUELL DER UNSTERBLICHEN
MONDKIND
DER MÖNCH
DER SCHATTENDEUTER
UNTER DEM AETHER
STRAßE AUS LAVA
DIE TÜRME
SÄULEN DES HIMMELS
ZWILLINGSKLINGEN
DER GEHEIME SCHLÜSSEL
KRANICHFLUG
DIE PURPURNE HAND
GEFANGENE HERZEN
Drachenpost
China
während der Qing-Dynastie
1760 n. Chr.
Prolog
Sie war als Menschenmädchen unter Drachen aufgewachsen. Aber erst an dem Tag, als die Drachen aus der Welt verschwanden, wurde Nugua bewusst, wie sehr sie sich von ihnen unterschied.
Nie war sie einem anderen Menschen von Angesicht zu Angesicht begegnet. Sie hatte bei den Drachen gelebt, solange sie denken konnte, und keiner hatte ihr je das Gefühl gegeben, etwas anderes zu sein als eine von ihnen. Kleiner, natürlich. Ohne Schuppen, Hörner und goldene Augen. Aber im Herzen doch ein Drache wie alle anderen.
Der mächtige Yaozi, größter unter den Drachen des Südens, hatte sie einst zwischen den Bäumen am Fuß der Berge gefunden, ein Neugeborenes – ein Menschenopfer. Verzweifelte Bauern hatten die Drachen gnädig stimmen wollen, damit sie aus ihren Bergwäldern herabstiegen und den Menschen Regen brachten. Das war alles, was Nugua über ihre Herkunft wusste. Fast wäre es ihr lieber gewesen, Yaozi hätte ihr nie davon erzählt. Dann hätte sie vielleicht glauben können, wirklich ein Drache zu sein, trotz ihrer winzigen Gestalt, trotz der verletzlichen bleichen Haut und den grünen Mandelaugen.
Yaozi lachte oft über die Einfalt der Menschen am Fuß der Berge. »Wie können sie glauben, ein so kleines nacktes Ding könne uns satt machen? Wie können sie glauben, meine kleine Nugua sei aufgefressen mehr wert als lebendig?«
Sie saß im Schneidersitz vor ihm auf einem Felsen, weich gepolstert auf einem Kissen aus Moos. Yaozis gewaltiger Schädel pendelte in der Luft, zehnmal so groß wie sie selbst. »Warum gibt es nicht nur Drachen auf der Welt?«, fragte sie.
Ein amüsiertes Schnauben trompetete aus Yaozis Nüstern. Eine flirrende Wolke wie Goldstaub verflüchtigte sich himmelwärts. »Warum gibt es nicht nur die Berge, sondern auch Wälder und Flüsse und Seen?«, hielt er dagegen. »Alles hat seinen Wert für die Welt – nur ist es manchmal schwer, ihn zu erkennen.«
Und wie ein Berg überragte Yaozi das Mädchen tatsächlich. Sein Schädel senkte sich beim Sprechen zu ihr herab. Das spitze Maul öffnete sich nur unmerklich, wenn er damit Worte formte. Seine Schuppen, jede so groß wie Nuguas Oberkörper, waren rostrot und bronzefarben; sie schimmerten im Dämmerlicht der Bergwälder wie ein Sonnenaufgang. Aus seiner Stirn wuchsen Hörner, geformt wie ein Hirschgeweih, und aus den Lefzen seines Drachenmauls schlängelten sich zwei baumlange goldene Fühler wie Schnurrhaare, mit denen er Nugua manchmal anstupste, wenn er ihr zeigen wollte, wie gern er sie hatte.
»Wenn alles einen Wert hat, welchen Wert haben dann die Menschen?«, fragte sie. Sie sagte nicht »wir Menschen«, denn sie fühlte sich nicht wie einer.
»Irgendwann werden auch sie sich ihrer Bedeutung bewusst werden«, entgegnete der Drache.
»Das sagst du nur, weil ich aussehe wie sie.«
»Das sage ich, weil es die Wahrheit ist.«
Nugua schüttelte den Kopf und hob einen Käfer von ihrem Knie. Für sie war er so klein wie sie selbst in den Augen des Drachen. Vorsichtig setzte sie ihn neben sich auf den Stein. »Menschen sind schwach und dumm«, sagte sie leise. »Sonst würden sie ihre Kinder nicht den Drachen opfern, damit sie ihnen Regen bringen.«
»Ohne den Regen müssen die Menschen hungern.«
»Und ohne ihre Kinder gibt es bald keine Menschen mehr, die hungern könnten.«
Yaozi schüttelte lachend seine blutrote Drachenmähne, die vom Hinterkopf über seinen eingerollten Schlangenleib wallte. Sein rechter Fühler tupfte eine Freudenträne aus seinem goldenen Auge, der linke aber schob sich auf Nugua zu und berührte sanft ihre Stirn.
»Du sprichst wie ein Drache«, stellte er fest. »Wie ein junger, vorwitziger, nicht besonders gut erzogener Drache. Aber doch wie ein Drache.«
Nugua umfasste den riesigen Fühler und drückte ihn an sich. Er war breiter als sie selbst und fühlte sich warm an. Geschmeidige Muskeln lockerten sich unter der Goldhaut und passten sich der Form ihres Körpers an.
»Ich will niemals ohne euch sein«, sagte sie glücklich.
»Das musst du nicht«, sagte Yaozi.
Aber bald darauf waren die Drachen verschwunden.
Und Nugua blieb ganz allein zurück.
* * *
Als sie an jenem Morgen erwachte, hatte es aufgehört zu regnen. Das war das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte. Auf Orte, an denen Drachen hausen, fällt stets ein sanfter Sommerregen, auch während der kalten Jahreszeit.
Nugua öffnete die Augen – und kniff sie hastig wieder zu, als Sonnenlicht in ihre Pupillen stach. Weil sie sich ein Leben lang in der Nähe der Drachen aufgehalten hatte, hatte sie die Sonne nur selten zu sehen bekommen. Regenwolken folgten ihnen auf ihren Wanderungen durch die Weiten Chinas, keine schweren dunklen Ballen, sondern faserige Nieselschwaden, hinter denen die Sonne milchig schien, kaum heller als der Mond.
An diesem Morgen aber brannten ihre Strahlen nadelspitz und unbarmherzig aus einem beängstigend klaren Himmelsblau.
Nugua richtete sich auf und blickte vorsichtig zu Boden. Nur langsam gewöhnte sie sich an das schmerzhaft grelle Licht. Sie hatte zwischen den Wurzeln eines gewaltigen Baumes geschlafen, eingehüllt in eine Decke aus abgestoßener Drachenhaut. Die feine Feuchtigkeit, die der Regen sonst auf Felsen und Pflanzen hinterließ, war getrocknet. Das Laub der Wälder schimmerte stumpf. Es war nicht das Einzige, was an Glanz verloren hatte.
Nirgends war ein Drache zu sehen.
»Yaozi?«, rief sie krächzend. Angst überkam sie.
Keine Antwort.
Der Bergwald lag dicht und verlassen da, ein Gewirr aus verschachtelten Felsen, dunkelgrün bemoost, beschattet von Pinien, Buchen und Birken.
Nugua kletterte zwischen den Wurzeln hervor. Einen Drachen kann man nicht übersehen, selbst wenn ihn Felsen und Bäume verdecken. Die Glut seiner Schuppen strahlt dahinter empor, spiegelt sich auf der Unterseite von Blättern, sogar unter den Wolken, wenn einer der großen Drachenkönige vorüberzieht.
Aber Nugua sah hinter Dickicht und Gestein nichts als Düsternis. Allein das Sonnenlicht trieb funkelnde Bahnen durchs Blätterdach, schuf helle Pfützen im Unterholz. Wind pfiff von den Gipfeln herab und schüttelte die Baumkronen, bis sie miteinander flüsterten, in ihrer raschelnden, gespenstischen Sprache.
Sie fand ein paar abgeworfene Schuppen wie an jedem Morgen. Entdeckte vereinzelte Haare aus Drachenmähnen, rot und golden und türkis. Folgte vergeblich den Spuren fünfkralliger Riesenklauen. Betastete schneckenhausförmige Kuhlen im Erdreich, wo zusammengerollte Drachenleiber geschlafen hatten. Und bekam Panik, als sie spürte, dass bereits alle Wärme aus dem Boden entwichen war.
Die Drachen waren fort. Hatten sich über Nacht in Luft aufgelöst, ohne Nugua in ihre Pläne einzuweihen.
Aber was, wenn es gar keine Pläne gegeben hatte? War es denkbar, war es möglich, dass die Drachen gegen ihren eigenen Willen verschwunden waren?
Nein, nicht Yaozi, der Drachenkönig des Südens. Und nicht sein ganzer Clan, mehrere Dutzend der größten und gefährlichsten Geschöpfe, die das Reich der Mitte je mit ihrem Dasein gesegnet hatten. Drachen waren heilig und unantastbar. Wer oder was wäre wahnsinnig genug, es mit einem von ihnen aufzunehmen? Und erst recht mit so vielen?
Leiber wie Festungen, Zähne wie messerscharfe Türme. Und Augen wie aus purem Gold, unendlich weise – und bedrohlich.
Nugua inspizierte die Umgebung durch Tränenschleier. Nirgends gab es Kampfspuren. Nicht einmal Schneisen im Unterholz. Drachen werden viele Tausend Jahre alt und haben alle Zeit der Welt. Sie kennen keine Eile und schlängeln sich trotz ihrer Größe geschickt zwischen Bäumen hindurch.
Nichts deutete auf einen raschen Aufbruch hin. Keine abgeknickten Stämme, kaum niedergewalztes Dickicht. Die üblichen Spuren eines Drachenlagers, sicher. Aber keine Verwüstung, keine Anzeichen von Hast.
Nugua stieg in eine Kuhle im Boden, in der Yaozi während der vergangenen Nächte geschlafen hatte. Die Erde war ausgekühlt. Die Spuren seiner Schuppenränder waren deutlich zu sehen, ebenso die meterlangen Furchen, die seine Krallen im Schlaf ins Gestein geschnitten hatten. Seit Nugua zu alt war, um wie ein Kind in der Mitte von Yaozis aufgerolltem Schlangenleib zu schlafen, plagten düstere Träume den Schlummer des Drachenkönigs. Besser, man kam ihm nicht zu nahe, wenn er schlafend die Klauen ins Erdreich schlug.
Sie ging in die Hocke und betastete eine Schneise im Waldboden, als wäre dort etwas von seiner Anwesenheit zurückgeblieben, eine Nachricht vielleicht. Eine Erklärung, ganz gleich wie flüchtig. Sie wollte wütend auf ihn sein, dafür, dass er sie nach all den Jahren ohne ein Wort zurückgelassen hatte. Zorn wäre gut, dachte sie. Besser jedenfalls als diese entsetzliche Sorge, die in ihrem Inneren wühlte.
Sie wartete, bis ihre letzten Tränen getrocknet waren. Dann presste sie die Lippen aufeinander und sah trotzig zum Himmel hinauf, starrte stur in die Sonne, als wollte sie das Gestirn dort oben zwingen, den Blick von ihr abzuwenden.
Sie fürchtete sich vor der Welt da draußen. Aber sie hatte sich auch vor der Sonne gefürchtet, und jetzt hatte sie diese Angst besiegt. Sie würde auch mit allem anderen fertigwerden.
Sie dachte an Yaozi und an seine goldenen Augen. An seine dröhnende und doch so sanfte Stimme. An die Freundschaft der übrigen Drachen und ihre Geduld mit einem Menschenmädchen, das sie zu einem der ihren gemacht hatten.
Nugua suchte sich einen festen Stock; mit einer Steinklinge schnitt sie ihr schwarzes Haar, bis es kurz und struppig war; sie schnürte ihre Decke aus Drachenhaut zu einem Bündel und befestigte es auf ihren Schultern.
Dann kletterte sie auf einen Felsen und hielt Ausschau nach Regenwolken.
DIE HOHEN LÜFTE
Niccolo stand am äußeren Rand einer Wolke und blickte hinab in die Tiefe. Der Erdboden lag zweitausend Meter unter ihm. Deutlich zeichneten sich die Schatten der Wolkeninsel ab, legten sich wie Tintenflecken über Wälder und Berge und die glitzernden Fäden der Flüsse.
Während er in den Abgrund sah, fragte er sich zum tausendsten Mal, wie es wohl war, dort unten zu leben, auf festem Boden, auf Stein und Sand und Erde. Am Strand entlangzulaufen und auf Booten das Wasser zu befahren. Das musste ein aufregendes Leben sein, frei und ungezwungen. Gehen zu können, wohin man wollte. Kein Dasein zu führen wie in einem Gefängnis, so wie das seine hier oben auf den Wolken.
Das Volk der Hohen Lüfte bewohnte diese Wolkeninsel seit vielen Generationen. Vor über zweihundertfünfzig Jahren waren die Aetherpumpen zum ersten Mal in Gang gesetzt worden und verliehen den Wolken seither Festigkeit. Vom Boden aus sah niemand, dass Menschen hier oben lebten.
Niccolo tastete mit der Stiefelspitze einen weiteren Schritt nach vorn. Es war nicht leicht zu erkennen, wo die feste Wolkenmasse endete und die durchlässigen Dunstfetzen begannen, die sich immer wieder an den Rändern ansetzten. Die Insel wurde steuerlos vom Wind über die Welt geweht und sammelte dabei unfreiwillig allerlei Wolkentreibgut ein, von dünnen Fasern bis hin zu gewaltigen Ballen, die sich verkeilten und manchmal tagelang haften blieben. Äußerlich unterschieden sie sich nicht von der festen Masse, auf der das Volk der Hohen Lüfte seine Häuser und Höfe errichtet hatte. Doch wer nicht achtgab, der konnte sich leicht über die unsichtbare Grenze zwischen stabilem Untergrund und nachgiebigem Dunst verirren. Immer wieder kam es zu tödlichen Unfällen, und Niccolo fragte sich, was wohl die Menschen am Boden dachten, wenn – ganz buchstäblich – aus heiterem Himmel ein Körper in ihre Mitte stürzte.
Sie werden es ihren Göttern in die Schuhe schieben, dachte er und erinnerte sich an die Lektionen seines Vaters. Sie glauben, dass es hier oben im Himmel allmächtige Wesen gibt, die ihr Schicksal bestimmen.
Dabei gibt es nur uns. Und den Aether.
Die Menschen der Hohen Lüfte hatte den Glauben an einen Gott längst aufgegeben. Nach ihrem Aufbruch vom Boden, vor einem Vierteljahrtausend, hatten sie die engen Ketten ihrer alten Religion zurückgelassen – und sich bereitwillig von einer neuen in Fesseln legen lassen. Aber was, wenn der allmächtige Zeitwind, zu dem die Priester in ihren Windmühlen beteten, niemals wehen würde?
Rufen wir den Zeitwind herbei!, wiederholten sie wieder und wieder in ihren Predigten, und das Volk der Hohen Lüfte verneigte sich und murmelte ergeben: Der Zeitwind komme!
Niccolo machte einen weiteren Schritt zum Rand hin. Als ihm bewusst wurde, wie nah er sich am Abgrund befand, sprang er hastig zurück. Der heilige Zeitwind mochte niemals kommen, aber eine gewöhnliche Windbö konnte ihn jederzeit erfassen und mit sich reißen.
So wie seinen Vater. Cesare Spini war dem Sog der Tiefe erlegen. Niccolo hatte aus der Ferne mitansehen müssen, wie sein Vater von einem Windstoß von der Wolke gehoben wurde. Cesare hatte den Verlauf der festen Kante in- und auswendig gekannt, besser als irgendeiner sonst auf dieser Seite der Wolkeninsel, doch nicht einmal das hatte ihn vor dem Absturz bewahrt.
Die Grübelei darüber tat weh, und Niccolo versuchte, an etwas anderes zu denken. Aber alles hier erinnerte ihn an seinen Vater. Ihr Haus, zweihundert Meter wolkeneinwärts, war wie ein Schrein, in dem all das Wissen Cesares auf Tausenden von Seiten niedergeschrieben stand. Das war Niccolos liebste Erinnerung an seinen Vater: Wie er sich tief über eines der vielen Bücher beugte, die er gegen das ausdrückliche Verbot des Herzogs von den Geheimen Händlern gekauft hatte.
Cesare war wissbegierig gewesen, ein nimmersatter Leser, Forscher und kluger Denker. Er hatte sich bemüht, so viel wie möglich davon an seinen Sohn weiterzugeben, aber Niccolo hatte früh erkannt, dass er Cesare nicht das Wasser reichen konnte. Er lernte viel, weit mehr als die anderen Kinder und Jugendlichen auf der Wolkeninsel, aber er tat es nur, solange es ihm keine Mühe machte. Die Sprachen des Erdbodens waren sein Steckenpferd, er hatte sie beinahe wie von selbst erlernt, allein durch die Gespräche mit seinem Vater. Und geredet hatten sie viel, Stunde um Stunde, Tag um Tag, in dieser oder jener Sprache.
Er hat sich gewünscht, dass ich ein Gelehrter werde wie er, dachte Niccolo niedergeschlagen. Aber das wäre ich niemals geworden, selbst dann nicht, wenn der Wind und der Abgrund ihn mir nicht weggenommen hätten.
Die Bö hatte Cesare vor über einem Jahr in die Tiefe gerissen. Seither lebte Niccolo allein in einem Haus voller Bücher, einer Höhle aus Erinnerungen. Er kümmerte sich um die beiden Kühe und die Schweine, und wenn es sich gar nicht vermeiden ließ, tauschte er auf dem Markt Milch und Käse gegen Eier. Hier draußen, so nah am Rand, konnte man keine Hühner halten. Die Gefahr, dass ein Wind sie erfasste und davonriss, war zu groß. Deshalb lagen die großen Höfe, wie überhaupt die meisten Häuser, im Inneren der Wolkeninsel, über zwei Kilometer vom Rand entfernt.
Das fliegende Eiland selbst war gewaltig, ein Gebirge aus Wolkentürmen und einem tiefen Tal in der Mitte. Der Wind wehte es willkürlich über die Länder des Bodens hinweg. Das Volk der Hohen Lüfte hatte sich weitab vom gefährlichen Rand angesiedelt, trieb Ackerbau in Mulden, in denen Erdreich aufgeschüttet worden war, lebte von Viehzucht und der Jagd auf Vögel.
Es war ein einfaches Leben, ein Dasein voller Entbehrungen. Cesare hatte sich damit nicht abfinden wollen, und darin war Niccolo ihm ähnlich. Er träumte von der Weite des Erdbodens, von den Ländern, die in Cesares Büchern beschrieben wurden, von fremden Kulturen, fantastischen Landschaften. Und von Bäumen, die es auf der Wolkeninsel nicht gab.
Niccolo warf einen letzten Blick in die Tiefe, die seinen Vater getötet hatte und von der er sich doch nur widerwillig lösen konnte. Langsam ging er zurück zum Haus. Dort fütterte er die Schweine, streichelte ihr borstiges Fell und sprach mit ihnen wie mit Freunden; sie waren die einzigen, die er hatte.
Am Nachmittag schulterte er seine Armbrust, hängte sich eine Rolle Seil an den Gürtel und machte sich an den Aufstieg auf den höchsten der fünf Wolkenberge, die das Tal im Zentrum der Insel umgaben. Die Heimat des Wolkenvolks hatte Ähnlichkeit mit einer schalenförmig geöffneten Hand, mehrere Kilometer im Durchmesser. Der höchste der fünf Berge erhob sich – gemessen vom tiefsten Punkt des Tals aus – gute achthundert Meter hoch, ein Koloss aus aufgebauschten Wolken, seit zweihundertfünfzig Jahren zu dieser Form erstarrt wie gepresster Schnee.
Wenige vom Volk der Hohen Lüfte gingen dort hinauf. Die meisten gaben sich mit der Jagd an den Wolkenhängen eines niedrigeren Berges zufrieden. Auch Niccolo hätte sich die Mühe des Aufstiegs ersparen können, denn Vogelschwärme gab es an jedem Ort der Insel im Überfluss. Trotzdem kletterte er gern auf dem Berg herum, hangelte sich von einem Dunstvorsprung zum nächsten und betrachtete ehrfürchtig die Aetherpumpen, die sich auf den Gipfeln und Graten des Wolkengebirges erhoben wie schwarze, drohende Zeigefinger.
Er brauchte beinahe drei Stunden, ehe er auf der Bergkuppe ankam. Was er dort sah, überraschte ihn.
Er war nicht allein hier oben.
Mehrere Gestalten hatten sich zwischen dem halben Dutzend Pumpen versammelt, die von hier aus den Aether aus den höher gelegenen Himmelsregionen herabsaugten. Die rätselhafte Substanz, über die kaum jemand mehr wusste als den Namen, verlieh der Wolkeninsel Festigkeit und Flugkraft. Sie war die Lebensgrundlage des Volks der Hohen Lüfte, das Fundament ihrer abgeschiedenen Existenz hier oben am Himmel.
Niccolo ging hinter einer Wolkenwehe in Deckung und hängte sich die Armbrust über seine Schulter. Er hatte vier Tauben geschossen, die leblos an seinem Gürtel baumelten. Weil er es nicht übers Herz brachte, eines der Schweine zu schlachten, war er auf das magere Fleisch der Vögel angewiesen. Er würde sie später braten und essen, während er in einem Buch seines Vaters las. Auf der Wolkeninsel war das Lesen verboten, da die Zeitwindpriester seit jeher jegliche Form von Überlieferung und Wissen unterdrückten. Der Besitz von Büchern wurde mit Ausschluss aus der Gemeinschaft geahndet. Deshalb hatten Cesare und Niccolo ihr kleines Haus so weit draußen am äußeren Rand errichtet. Sie hatten es nie bereut. Sollten die anderen an ihrer Dummheit ersticken, vor allem Herzog Jacopo de Medici, das Oberhaupt des Wolkenvolks, und seine verzogene Tochter Alessia.
Die Menschen am Fuß der Aetherpumpen liefen aufgeregt hin und her, versammelten sich im Pulk und debattierten heftig, um dann erneut die Pumpen in Augenschein zu nehmen, so als wüsste einer von ihnen tatsächlich noch, wie die Technik im Inneren der schwarzen Türme funktionierte. Cesare hatte oft darüber gelacht, dass sie alle von etwas am Leben erhalten wurden, das sie nicht mehr verstanden. Vielleicht hatte die allererste Generation des Wolkenvolkes noch gewusst, auf welche Weise die Pumpen den Aether aus der Unendlichkeit zapften. Heute war das längst in Vergessenheit geraten. Kein Wunder, solange die Zeitwindpriester das Lesen und Schreiben unterdrückten, solange Bücher verboten und Gelehrte geächtet wurden.
Der Große Leonardo, der legendäre Erbauer der Aetherpumpen, hätte sich wohl dreimal überlegt, ob er die reichen Gaben der Medici für seine Forschungen angenommen hätte, wäre ihm bewusst gewesen, welche Zukunft dem Wolkenvolk bevorstand. Nichts hatte sich weiterentwickelt in zweihundertfünfzig Jahren, kein Fortschritt, kein neu erlangtes Wissen.
Erst der Zeitwind wird Veränderung bringen, predigten die Priester in ihren Windmühlen. Veränderung von Menschenhand war in den Hohen Lüften so unerwünscht wie freier Wille und das Recht, sein eigener Herr zu sein.
Niccolo schlich langsam hinter der wattigen Erhebung entlang. Die sechs Aetherpumpen waren in einem weiten Kreis angeordnet, zweihundert Schritt im Durchmesser. Die Menschen wanderten jetzt von einer Pumpe zur anderen, betasteten ihre metallenen Fundamente und legten die Ohren daran, um ins Innere zu horchen. Andere starrten angestrengt zu den fernen Spitzen empor, folgten mit Blicken dem Verlauf der dünnen Eisenfühler, deren Enden sich irgendwo in den Weiten des Himmels verloren. Zu weit oben für das menschliche Auge. Hoch genug, um die Regionen des Aethers zu erreichen, die jenseits des Himmels lagen.
Sechs Männer und eine Frau, zählte Niccolo. Nein, keine Frau, verbesserte er sich gleich darauf – ein Mädchen, nicht älter als er selbst.
Alessia de Medici schritt an der Seite ihres Vaters, des Herzogs Jacopo, und in ihrem Gefolge hasteten die Würdenträger des Rates von einer Pumpe zur nächsten. Oddantonio Carpi, der Schattendeuter, der aus den Wolkenschatten am Boden die Zukunft las. Federico da Montefeltro, der oberste der Zeitwindpriester. Tommaso Mantua, der höchste Ordnungswächter der Insel. Lorenzo Girolami, der Richter. Und natürlich Sandro Mirandola, kein Edler wie die anderen, sondern der Verantwortliche für die Aetherpumpen. Erstaunlicherweise war er es, der die meiste Zeit über redete, und selbst aus der Ferne konnte Niccolo sehen, dass ihn irgendetwas beunruhigte.
Tatsächlich schienen sie alle sich Sorgen zu machen, sogar Alessia, diese Ausgeburt von Arroganz und Selbstherrlichkeit. Niccolo konnte sie nicht ausstehen. Niemand konnte sie ausstehen, vermutlich nicht einmal ihr Vater. Nun, er vielleicht ein wenig.
Niccolo fragte sich, was diese sieben in solche Aufregung versetzt hatte. Aus dem Inneren der Pumpen ertönte dasselbe rhythmische Stampfen wie eh und je, seit zweieinhalb Jahrhunderten. Nichts erschien ihm auffällig oder besorgniserregend. Vielleicht konnte er sich unbemerkt noch näher heranschleichen, um zu hören, worüber sie sprachen.
Da fiel sein Blick hinüber zum Hauptweg, der auf den Gipfel des Wolkenberges führte; Niccolo hatte ihn nicht benutzt, weil er lieber die steileren Hänge erklomm. Nun war er froh, denn zehn bewaffnete Leibwächter des Herzogs bildeten ein Spalier rechts und links des Weges, einer seichten Rinne in der weißen Wolkenoberfläche.
Wenn die Soldaten ihn beim Spionieren entdeckten, würden sie ihn festnehmen. Vielleicht gar für ein paar Tage hinter Gitter stecken. Und wer würde dann seine Schweine und Kühe füttern? Er bezweifelte, dass die Männer ihm erlauben würden, dem alten Emilio Bescheid zu geben, der hin und wieder bei Niccolo vorbeikam, um nach dem Rechten zu sehen.
Sie durften ihn nicht bemerken.
Flink huschte er von einem Wolkenhügel zum nächsten. Seit jeher war es verboten, hier heraufzukommen, und Niccolo hatte sich schon als kleiner Junge über diese Regel hinweggesetzt. Selten genug, dass er auf dem Gipfel jemandem begegnete. Wenn überhaupt, dann höchstens Sandro Mirandola oder einem seiner nichtsnutzigen Pumpeninspekteure. Nichtsnutzig, weil nicht einmal sie die Technik der Türme verstanden.
Immerhin aber musste einem von ihnen etwas Ungewöhnliches aufgefallen sein, sonst hätte sich nicht der gesamte Rat hier oben versammelt. Irgendetwas stimmte nicht.
Ehe Niccolo nahe genug heranschleichen konnte, gab der Herzog den anderen einen Wink und ging mit seiner Tochter zurück zum Spalier seiner Soldaten. Palavernd folgten ihnen die Ratsherren, gestikulierend und diskutierend, bis sie allesamt hinter dem Rand der Gipfelkuppe verschwunden waren.
Niccolo war wieder allein auf dem Berg. Allein mit den Aetherpumpen und dem uralten Rätsel, das sie umgab.
Eine Weile lang lief er um die schwarzen Türme herum, ertappte sich sogar dabei, dass er das Gleiche tat wie die anderen vor ihm: Er horchte am Metall, fuhr mit den Fingerspitzen darüber, suchte nach Anzeichen für irgendetwas Außergewöhnliches hoch oben an den Aetherfühlern.
Aber nichts. Keine Antworten. Nicht einmal Fragen. Alles war genauso wie immer.
Zögernd machte er sich an den Abstieg. Es wurde bereits dunkel, als er das Haus erreichte, windumtost in der Dämmerung, weil ein Höhensturm aufzog, für den es wieder mal keine Vorzeichen gegeben hatte.
Niccolo sah nach den Tieren, erzählte den Schweinen, was er erlebt hatte, wunderte sich nicht, dass auch sie keine Lösung wussten, und ging ins Haus, um seine Tauben zu braten.
Der Sturm kam schneller, als er erwartet hatte, rüttelte an den Fensterkreuzen und ließ die Holzwände erbeben. Die Kühe draußen im Stall muhten ängstlich. Die Schweine scharrten im Stroh, bis sie auf weiße Wolkenmasse stießen.
Am nächsten Morgen erwachte er von Erschütterungen. Der Boden unter seinem Bett bebte, das ganze Haus erzitterte. Jetzt schrien sogar die Schweine vor Angst.
Doch es war nicht der Sturm, der Niccolos Welt aus den Fugen hob.
* * *
Er rollte aus dem Bett und kämpfte sich schwankend auf die Füße, während das Geschrei der Tiere aus dem Stall immer lauter wurde. Er stürzte abermals hin, als er in seine Hose schlüpfte, kletterte dann halb laufend, halb kriechend zwischen einstürzenden Bücherstapeln zur Tür.
Draußen fiel es ihm leichter, sich aufzurappeln. Mit einer Hand hielt er sich am Türpfosten fest, während er darauf wartete, dass das Beben verebbte. Aber die Erschütterungen setzten sich fort. Vom frühen Sonnenlicht geblendet sah er zum Rand der Wolke hinüber. Die losen Dunstfetzen lösten sich von der festen Masse und trieben davon, nicht wie sonst zur Seite, sondern nach oben.
Die Wolkeninsel verlor an Höhe.
Niccolos erste Sorge galt seinen Schweinen und Kühen. Mit schlingernden Schritten eilte er zum Stall und riss das Tor auf. Die Bretterwände klapperten und knirschten, aber das Dach war stabil genug, um die Erschütterungen abzufangen. Die zehn Schweine quiekten angsterfüllt durcheinander und stießen mit den Schnauzen ans Gatter ihrer Pferche. Auch die beiden Kühe muhten aufgeregt, standen aber da wie erstarrt, als vergrößerte jede unnötige Bewegung die Gefahr. Niccolo lief von einer Absperrung zur nächsten und redete beruhigend auf die Tiere ein, während ihm selbst die Frage durch den Kopf geisterte, ob dies nun das Ende wäre.
Die Wolkeninsel war niemals zuvor gesunken. Sicher, Stürme hatten sie durchgeschüttelt, Tornados die Höfe verwüstet oder starke Regenfälle das Tal unter Wasser gesetzt. Aber nie war sie dem Erdboden näher gekommen als bis auf zweitausend Meter. Das war ein ungeschriebenes physikalisches Gesetz, so wie die Tatsache, dass Regen nun einmal von oben fiel und Väter, die dem Rand zu nahe kamen, unweigerlich in die Tiefe stürzten.
Zweitausend Meter. Das war die unsichtbare Grenze der Hohen Lüfte, die vorderste Schwelle zum Reich des Aethers.
Und nun sanken sie, zum ersten Mal seit zweihundertfünfzig Jahren.
Niccolo rief den Tieren zu, alles werde gut, ganz sicher sogar; er werde sie mit seinem Leben schützen, wenn es sein müsse, und das meinte er ernst. Atemlos rannte er aus dem Stall und schaute sich um.
Die losen Dunstfetzen, die sich überall vom Rand der Insel lösten, verdeckten die Sicht auf die Wolkengipfel. Standen die Aetherpumpen noch? Ebenso gut hätte er fragen können, ob der Himmel noch an Ort und Stelle hing. Die Aetherpumpen waren unfehlbar, man zweifelte nicht an ihnen. Aber ihm kamen die sorgenvollen Mienen der Ratsmitglieder in den Sinn. Hatten sie geahnt, dass es Schwierigkeiten geben würde? Ganz sicher sogar.
Niccolos Blick huschte ins Tal, über Wolkenwehen hinweg, die Teile der Siedlung verdeckten. Zwischen seinem Haus und der kleinen Ortschaft lag auf halber Strecke der Hof des alten Emilio. Kurz dahinter erhob sich auf einem weißen Hügel eine Windmühle. Zwar wurde dort auch Korn gemahlen, doch diente das Gebäude vor allem als Ort der Versammlung. Einmal am Tag rief ein Priester zur Predigt und verkündete das baldige Kommen des Zeitwindes, der sie alle in eine bessere Zukunft wehen würde. Es gab sieben solcher Windmühlen auf der Wolkeninsel, und Niccolo hielt sich von allen fern.
Der Boden wurde erneut erschüttert, viel heftiger diesmal. Niccolo fuhr herum in Richtung Stall. Falls das Dach einstürzte, würden die Balken die Schweine und Kühe schwer verletzen, vielleicht sogar töten. Aber ihm blieb keine Zeit, sie alle ins Freie zu treiben, denn im selben Augenblick neigte sich die Insel in Niccolos Richtung und warf ihn von den Füßen. Die Balken der Gebäude knirschten erbärmlich, aber sein Vater hatte solide gebaut; Haus und Stallungen hielten den Belastungen stand.
In der Ferne ertönte ein grässliches Bersten. Wieder wirbelte Niccolos Blick herum. Das Flügelkreuz der Windmühle löste sich aus seiner Verankerung, riss die halbe Wand des Turmes ein und hüpfte hochkant wie ein Spielzeug über die Wolkenhügel, auf und nieder, vorbei an Emilios Hof – und genau auf Niccolo zu. Über tausend Meter mochten noch zwischen ihm und dem heranpolternden Flügelkreuz liegen. Der Anblick war so bizarr, dass er sich für einen Moment nicht davon abwenden konnte, einfach nur hinstarrte wie ein Vogel, der einem Jäger in die Augen blickt, ohne zu ahnen, dass ein tödlicher Pfeil auf ihn gerichtet ist.
Falls das gewaltige Flügelkreuz mit dem Haus kollidierte, würde von beidem nur ein Haufen Holztrümmer übrig bleiben. Welch böse Ironie, schoss es Niccolo durch den Kopf, dass es ausgerechnet die Windmühlenflügel sein sollten, die den Hof zerstörten. Die Zeitwindpriester trugen Mitschuld daran, dass Cesare Spini und sein Sohn die Gemeinschaft hatten verlassen müssen; auf ihr Geheiß hin hatte der Herzog den Ausschluss der beiden verhängt.
Die vier Windmühlenflügel drehten sich schneller als beim heftigsten Sturm, schlingerten und sprangen, neigten sich aber niemals weit genug, um auf die Seite zu fallen. Ihre Umrisse verschwammen in der Bewegung zu einem wirbelnden Rad, doppelt so hoch wie das Hofdach. Ihre Enden huschten wie Beine eines Riesentiers über die Wolkenoberfläche, fetzten weiße Flocken aus dem Untergrund, gruben eine Furche durch Wehen und Hügel. Die Insel lag noch immer schräg; der Rand, an dem sich Niccolos Haus erhob, bildete den tiefsten Punkt. Das Flügelkreuz musste zwangsläufig in diese Richtung rollen.
Die Tiere im Stall wurden durch die Neigung des Untergrunds durcheinandergeworfen. Niccolo hetzte ins Haus, zog den alten Langbogen seines Vaters aus einer Ecke und stürmte wieder ins Freie, hinauf auf einen Hügel, nicht weit vom Hof entfernt. Die Waffe zu spannen war nicht einfach, die Pfeile im Köcher waren beinahe doppelt so dick wie Niccolos Zeigefinger. Trotzdem gelang es ihm, die knirschende Bogensehne bis ans Ohr zu ziehen.
Er wartete, bis das Flügelkreuz über die nächste Erhebung rotierte, dann ließ er los. Der Pfeil fauchte mit ungeheurer Wucht davon, geradewegs auf das flirrende Rad zu – und wurde von dem Wirbel verschluckt, als hätte Niccolo ins Leere gezielt.
Schon lag ein zweiter Pfeil an seiner Sehne. Gleich darauf ein dritter und vierter. Pfeil um Pfeil feuerte er auf das Flügelkreuz ab, jeder mit genug Kraft, um einen Ochsenleib zu durchschlagen und auf der anderen Seite weiterzufliegen. Sein Vater war stolz auf diesen Bogen gewesen, ein Erbstück aus alter Zeit, als die Ahnen der Spinis am Boden gelebt hatten. Er hatte ihn gepflegt wie eine Kostbarkeit und voller Ehrfurcht damit auf hölzerne Ziele geschossen, denn zur Vogeljagd taugte das Ungetüm nicht.
Falls es Niccolo gelänge, das Flügelkreuz zum Schlingern zu bringen, es auf eine andere Bahn zu lenken … Verdammt, er war bereit, sich mit ausgebreiteten Armen vor den Stall zu werfen. Die Tiere waren die einzige Familie, die ihm geblieben war, und er würde nicht davonlaufen, um seine eigene Haut zu retten, während sie unter Trümmern zermalmt wurden.
Die Zeit verdichtete sich zu flüssigem Glas, während das Rad auf ihn zu klapperte, von der Neigung der Wolkeninsel angetrieben, ein vierbeiniges Monster aus zentnerschweren Holzbalken, gebaut, um selbst den Stürmen der Hohen Lüfte zu trotzen. Im Hintergrund wehten lose Wolkenfetzen himmelwärts, fortgerissen vom Gegenwind aus der Tiefe. Wie schnell die Insel fiel, war nicht zu erkennen. Niccolo war zu weit vom Rand entfernt, als dass er von hier aus den Erdboden hätte näher kommen sehen.
Er spannte den Bogen zum elften oder zwölften Mal und ahnte zugleich, dass es zu spät war. Eine neuerliche Erschütterung ließ die Wolken erbeben. Er verlor das Gleichgewicht, der Pfeil zischte ungezielt ins Nichts.
»Nein!«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Nicht der Stall!
Weitere Beben, weitere Stöße wie Hiebe einer unsichtbaren Riesenfaust. Die weiße Wolkenmasse fing ihn auf, als er zurückfiel, den Bogen verlor und die kleine Anhöhe hinabkugelte. Die restlichen Pfeile wurden über den Hang verstreut.
Mit einem Stöhnen kam er auf, schwindelig und mit Schmerzen im ganzen Leib. Sein Gleichgewichtssinn schlug Purzelbäume, der Herzschlag stampfte wild in seinen Ohren.
Er hob den Kopf, blickte durch Schleier nach vorn.
Das Flügelkreuz donnerte auf ihn zu. An ihm vorbei.
Genau auf das Haus und die Stallungen zu.
GESTRANDET
Sein Schrei und das Kreischen des berstenden Holzes waren eins. Die Luft um ihn herum vibrierte. Gegenwind peitschte über die Wolkenränder und riss heulend die letzten lockeren Reste davon.
Eine Erschütterung wie keine zuvor stieß die abgesunkene Seite der Insel abrupt nach oben. Die Neigung schlug ins Gegenteil um, der Boden hob sich unter Niccolo, unter Haus und Stall, unter den schreienden Tieren und dem tödlichen Flügelrad.
Kurz bevor das hölzerne Ungeheuer die Stallungen zermalmen konnte, wurde es vom aufsteigenden Boden zurückgestoßen, kam ins Schlingern, holperte rückwärts – und stürzte wie ein sterbender Riese auf die Seite. In einer Wolke aus weißen Fetzen und verwehtem Erdreich prallte es auf, seine Kreuzstreben brachen, die Bespannung fetzte in Stücke.
Das Ende eines Flügels lag keine Mannslänge von Niccolo entfernt.
Er stemmte sich hoch, während sein Blick zum Stall raste. Das Gebäude war unversehrt. Der Torflügel stand weit offen, ein Scharnier war gebrochen. Innen rumorten die Schweine. Die Kühe muhten verstört.
Es war noch nicht vorbei. Er hatte den Gedanken kaum gefasst, da schlug auch die andere Seite der Insel irgendwo auf. Das Beben rollte von den gegenüberliegenden Wolkenbergen durchs Tal heran, Wellen schüttelten den Untergrund und erreichten Niccolos Hof mit leichter Verzögerung. Abermals schien es ihm, als hätte irgendwer ihn gepackt, mit ihm ausgeholt wie mit einer ungeliebten Puppe und ihn zurück auf den Boden gedroschen.
Alles drehte sich um ihn. Taumelnd kämpfte er sich hoch und stolperte zum Tor des Stalls hinüber. Im Inneren war es dämmerig, deshalb erkannte er zu spät, dass eines der Gatter aufgesprungen war: Eine Horde Schweine drängte ihm entgegen und hätte ihn beinahe niedergetrampelt. Gerade noch rechtzeitig konnte er ausweichen, als sie an ihm vorbeipreschten, schneller, als man es ihren plumpen Leibern zugetraut hätte, panisch, vielleicht sogar wütend, aber immerhin lebendig und gesund. Er würde sie später wieder einfangen, falls ihm noch Gelegenheit dazu blieb.
Der zweite Schweinepferch war noch verschlossen, aber auch hier versuchten die Tiere mit aller Kraft, das Gatter aufzusprengen. Sie stießen aufgebracht dagegen und quiekten mit ihren hohen Schweinestimmen. Keines hatte sichtbare Verletzungen davongetragen.
Die beiden Kühe lehnten an der Rückwand und starrten ihn aus großen Augen an. Sie waren zu verängstigt, um etwas anderes zu tun, als dazustehen und abzuwarten. Niccolo litt mit ihnen und hätte sie am liebsten umarmt, weil keine von ihnen gebrochene Beine hatte oder sonst wie verletzt war.
Jetzt erst fiel ihm auf, dass die Erschütterungen aufgehört hatten. Der Boden zitterte nicht mehr, das Sturmgetöse des Gegenwinds war verstummt.
Die Wolkeninsel lag wieder ruhig in der Horizontalen. Der Absturz war abgewendet – zumindest hinausgezögert. Ein ungebremster Aufprall hätte sie in Stücke gesprengt. Der Aether machte die Wolken zwar fest, aber nicht unzerstörbar.
Niccolo strich den Kühen beruhigend über die bebenden Flanken, dann eilte er zurück ins Freie. Die entflohenen Schweine waren rund um das umgestürzte Flügelkreuz stehen geblieben, als hätten sie sich die Winkel zwischen den geborstenen Holzstreben als neuen Pferch ausgesucht.
Niccolos Blick schwenkte von den Tieren hinüber zum Rand.
Wo vor Minuten noch blauer Himmel gewesen war, erhob sich jetzt etwas Dunkles, Massiges. Eine schrundige Oberfläche, an deren Furchen und Klippen sich die Wolkeninsel verkeilt hatte. Eine Felswand.
Jenseits der Wolkenberge, auf der anderen Seite der Insel, ragte ebenfalls ein finsterer Umriss empor, höher als die weißen Gipfel, bedrohlich und Ehrfurcht gebietend. Und weiter links – das Gleiche. Die Wolkeninsel musste sich bei ihrem Sinkflug zwischen drei Felsgiganten verkeilt haben und steckte nun wie ein Pfropfen zwischen den Bergen fest.
Es dauerte drei, vier Atemzüge, ehe Niccolo realisierte, was das bedeutete.
Der Schmerz seiner Prellungen war vergessen, als er losrannte, der Wolkenkante entgegen, dorthin, wo die weiße Masse auf festes Gestein stieß.
Eine Felswand. Der Erdboden!
Sie waren nicht länger Gefangene der Hohen Lüfte. Nicht einmal die Zeitwindpriester und der Herzog konnten jetzt noch verhindern, dass jene, die gehen wollten, die Wolkeninsel verließen.
Während er lief, wünschte er sich, sein Vater hätte dies erleben können. Die Rückkehr der Wolkeninsel zur Erde. Die Gelegenheit, auf die Cesare gewartet hatte, um all sein Wissen über fremde Länder, Kulturen und Sprachen zum ersten Mal zu nutzen. Er hatte oft gesagt, er fühle sich wie der beste Koch der Welt, dem man nicht erlaubte, einen Topf auf die Feuerstelle zu stellen.
Schwarzes, kantiges Gestein nahm jetzt Niccolos gesamtes Sichtfeld ein. Noch nie hatte er einen Berg – einen echten Berg – aus so großer Nähe gesehen. Aus dem lockeren Lauf wurde gehetztes Sprinten, als er sich dem Rand der Wolkeninsel näherte. Die wattige Masse hatte an den zerklüfteten Felsen Spuren hinterlassen, abgeschürftes Weiß, das sich zusehends in faserige Nebelschwaden auflöste, unsichtbar wurde wie schmelzender Schnee. Zugleich hatte die Insel Felsstürze ausgelöst. Geröll und gesplitterte Brocken lagen weit verteilt auf der gesamten Randregion.
Niccolo blieb stehen und streckte zögernd die Hand aus. Seine Fingerspitzen berührten den kalten Fels. Er hatte noch nie Stein angefasst. Auf der Wolkeninsel wurde ausschließlich mit Holz gebaut, das meiste uralt und nicht selten morsch, denn Nachschub gab es nur, wenn die Geheimen Händler auftauchten. Das letzte Mal aber lag länger zurück als Niccolos Geburt.
So also fühlt sich ein Berg an, dachte er. Der Boden. Die Zukunft.
Ganz kurz überlegte er, ob er sich für seine Euphorie hätte schämen müssen. Der Absturz hatte im Wolkental gewiss schwere Schäden angerichtet. Sicher gab es Verletzte, vielleicht sogar Tote. Er machte sich keine Illusionen darüber, dass er und seine Tiere unglaubliches Glück gehabt hatten.
Und trotzdem hatte er kein schlechtes Gewissen. Ganz im Gegenteil, er kochte fast über vor Freude. Sie waren am Boden, zurück auf der Erde. Bald würde jeder gehen können, wohin er wollte. Sie würden –
Niccolos Gedankengänge endeten jäh.
Während er über die Zukunft nachgedacht hatte, war er dem Verlauf von Kante und Felswand gefolgt. Nun hatte er eine Stelle erreicht, an der das Gestein zurückwich. Der Fels, der die Wolkeninsel auf dieser Seite festhielt, endete abrupt. Niccolo konnte über den Rand blicken, an der Steilwand vorbei, hinaus in die Landschaft. Auf die Landschaft hinab.
Er hatte sich getäuscht. Die Wolkeninsel hatte noch lange nicht den Boden erreicht. Sie steckte zwischen den höchsten Gipfeln eines zerklüfteten Gebirges fest, säulenähnlichen Granittürmen, viel zu steil, um daran hinabzuklettern, ohne sich alle Knochen zu brechen.
Unter ihnen lagen weitere tausend Meter tödliche Leere.
* * *
»Wir sind gekommen, um mit deinem Vater zu sprechen«, sagte der Mann, den Niccolo bis zum heutigen Tag immer nur aus der Ferne gesehen hatte. Und selbst das nur wenige Male.
Herzog Jacopo de Medici schaute sich missbilligend im Wohnraum des Hauses um, entdeckte Bücher über Bücher, eines so verboten wie das andere. »Aber ich sehe nur wertloses Papier. Und dich.«
»Mein Vater ist tot«, sagte Niccolo.
Der Herzog wechselte einen Blick mit dem Schattendeuter Oddantonio Carpi. Der sah hinüber zu Federico da Montefeltro, dem obersten Zeitwindpriester. Beide Männer wirkten ratlos.
»Vielleicht lügt er«, brach Alessia das Schweigen der Männer. Die Herzogstochter sah Niccolo von oben herab an, obgleich sie einen halben Kopf kleiner war als er. »Vielleicht versteckt sich Cesare vor uns. Immerhin ist er ein Ausgestoßener.«
Niccolo presste die Lippen aufeinander und tat, als hätte er ihre Worte nicht gehört. Es fiel ihm nicht leicht. Alessia war mit ihrem dunkelroten Haar so hübsch wie hochmütig. Ihre Augen glänzten golden wie die aller Wolkenbewohner – das machte die Nähe des Aethers –, doch die ihren wirkten noch eine Spur heller und leuchtender als die aller anderen. Sie hatte fein geschnittene Züge und einen schönen Mund, der Gift und Galle spuckte. Im Widerspruch zu ihrem herrschaftlichen Gebaren standen die wilden Sommersprossen, die ihr ganzes Gesicht und ihren Hals bedeckten.
»Alessia«, ermahnte ihr Vater sie in einem Tonfall, der zu müde klang, um sie einzuschüchtern. Mit einer Bewegung, als täten ihm alle Glieder weh, wandte er sich wieder an Niccolo. »Wann ist er gestorben?«
»Vor über einem Jahr. Der Wind hat ihn mitgenommen.«
»Warum weiß ich nichts davon?«
Weil es dich nichts angeht, dachte Niccolo. »Wir sind Ausgestoßene«, sagte er mit einem finsteren Blick auf Alessia.
Sie waren zu viert gekommen, kaum eine Stunde nachdem Niccolo das letzte Schwein zurück in den Pferch gesperrt hatte. Noch immer klang das Quieken der Tiere aufgeregter als sonst, selbst durch die Holzwand zwischen Wohnraum und Stall.
Herzog Jacopo. Sein Schattendeuter. Der schwammige Zeitwindpriester. Und natürlich Alessia, die sich jetzt verächtlich von den Männern abwandte und einen unauffälligen Blick auf die Bücher warf, die noch immer auf dem Boden verteilt lagen. Sie kehrte Niccolo den Rücken zu, daher konnte er ihren Gesichtsausdruck nicht sehen, während sie sich umschaute. Erstaunt fragte er sich, ob sie wohl lesen konnte. Eigentlich war das undenkbar, da doch ihr Vater das Lesen verboten hatte. Und trotzdem schien sie ihm ein wenig zu lange auf einzelne Bücher zu starren. Auch der Zeitwindpriester bemerkte es und hob missbilligend eine Augenbraue.
»Niccolo.«
Die Stimme des Herzogs ließ ihn zusammenzucken. Das Oberhaupt des Wolkenvolkes trug keines seiner prunkvollen Amtsgewänder, sondern einen schlichten Mantel über Hosen aus Leinen und eine kurze dunkle Samtjacke. Er war nicht älter als fünfzig, doch er ging leicht gebeugt, so als lastete mehr als die Herzogswürde auf seinen Schultern. Manche munkelten, er litte unter der Tatsache, dass seine Frau ihm keinen Sohn geboren hatte. Irgendwann würde Alessia, sein einziges Kind, das Amt des höchsten Wolkenbewohners übernehmen. Vermutlich war das der Grund, weshalb er sie seit geraumer Zeit an Ratssitzungen und Unterredungen wie dieser teilnehmen ließ, auch wenn er damit den Unmut der Priester heraufbeschwor. Die Vorstellung, es erstmals in der Geschichte des Wolkenvolks mit einer Herzogin zu tun zu bekommen, belastete das Verhältnis zwischen den Zeitwindpriestern und der mächtigen Medici-Familie.
»Niccolo, wir sind hergekommen, um mit deinem Vater zu sprechen.« Der Herzog sah sich einmal mehr im Raum um und schien zu erwägen, Alessia von den Büchern fortzuzerren. Dann aber ließ er sie mit einem lautlosen Seufzen gewähren. »Nun sagst du uns, Cesare lebt nicht mehr. Was gewisse … Schwierigkeiten mit sich bringt.«
»Ich muss seitdem allein zurechtkommen«, sagte Niccolo. »Welche anderen Schwierigkeiten könnte irgendwer dadurch haben?«
»Schau, mein Junge«, mischte sich der Priester ein. Seine Ringe klirrten aneinander, als er beim Sprechen mit den Händen gestikulierte. »Dein Vater spricht doch die Sprachen des Erdbodens, nicht wahr?«
»Er hat sie gesprochen. Jedenfalls ein paar.«
»Wir hatten gehofft, er könnte … nun, er könnte uns allen einen großen Dienst erweisen.«
Habt ihr es denn noch immer nicht verstanden?, schrie es in Niccolo. Mein Vater ist tot. Er ist in die Tiefe gestürzt, weil ihr ihn dazu gezwungen habt, so nah am Rand zu leben.
Er wusste selbst, dass das nur die halbe Wahrheit war. Cesare hatte gern hier draußen gewohnt. Sie beide waren zufrieden gewesen mit ihrem Dasein. So zufrieden man eben sein konnte, wenn man eigentlich der Meinung war, dass man hier oben auf den Wolken wie in einem Gefängnis hauste.
Und dennoch … Was bildeten sich die vier ein, hier aufzutauchen und fortwährend über seinen Vater zu reden, als wäre er nicht nach einem Sturz aus zweitausend Metern Höhe am Boden zerschmettert?
Um seine Wut nicht laut hinauszubrüllen, versuchte er es seinerseits mit einer Frage. »Was genau ist eigentlich passiert?«
Wieder wurden Blicke gewechselt, so als wäre es ein Geheimnis, dass die Wolkeninsel zwischen den Berggipfeln feststeckte.
»Die Pumpen saugen keinen Aether mehr in die Wolken«, sagte der Herzog nach einem Moment. »Wir wissen nicht, warum das so ist. Aus irgendeinem Grund haben wir an Höhe verloren. Erst ganz langsam, bis der Kontakt zum Aether abgerissen ist, dann aber … nun, du hast es selbst erlebt. Im Ort herrscht Panik. Viele Häuser wurden zerstört und noch mehr schwer beschädigt. Die Menschen sind verrückt vor Angst. Und zu allem Überfluss hängen wir zwischen diesen verdammten Bergen fest.«
Alessia wandte sich zu ihnen um. »Wie es aussieht, haben die Berge uns allen das Leben gerettet.«
»Ja«, entgegnete ihr Vater zerknirscht, »ja, das haben sie wohl.«
»Sie sind Boden!«, empörte sich der Zeitwindpriester. »Sie sind Stein! Boden und Stein sind die Sklaven des Abgrunds!«
Alessia verdrehte die Augen, was sie Niccolo für einen winzigen Moment beinahe sympathisch machte. Offensichtlich hielt sie ebenso wenig von den Priestern wie er selbst. Doch als hätte sie gespürt, dass da etwas in ihm ins Schwanken geriet, fixierte sie ihn mit ihren Goldaugen und schnauzte: »Wenn dein Vater tot ist, weshalb brauchst du dann all diese Bücher?«
Hinterm Rücken ballte er die Hand zur Faust, bis es wehtat. »Würdet Ihr sie gern lesen?«, fragte er gedehnt.
»Meine Tochter kann nicht lesen«, ging der Herzog eilig dazwischen. »Sie braucht keine Bücher.«
Alessia sah aus, als ob sie etwas entgegnen wollte. Dann aber schüttelte sie nur den Kopf und verließ hocherhobenen Hauptes das Haus. Niccolo atmete innerlich auf.
»Da ist noch etwas«, sagte der Herzog. »Noch sind die Wolken mit Aether gesättigt, der sie zusammenhält. Aber dieser Zustand wird nicht ewig anhalten. Wenn es uns nicht gelingt, in die Hohen Lüfte zurückzukehren, und wenn die Pumpen keinen neuen Aether fördern, dann heißt das nicht nur, dass wir hier unten festsitzen. Es bedeutet vielmehr, dass sich die Insel auflösen wird! Wir haben weder die Zeit noch die Mittel, alle Bewohner bis dahin zum Erdboden zu bringen.« Der Priester wollte aufbegehren, aber der Herzog schüttelte den Kopf. »Nicht jetzt!«, sagte er hitzig. »Wir könnten sie nicht in Sicherheit bringen, selbst wenn wir es wollten. Wir können nur abwarten – und zusehen, wie sich die Wolken unter unseren Füßen in Luft auflösen. Es sei denn, wir finden hier und jetzt eine Lösung.«
»Weißt du, wo wir uns befinden?«, fragte der Schattendeuter in Niccolos Richtung. »In welchem Land?«
»Nein.«
»Ich habe Berechnungen angestellt«, erklärte der Schattendeuter. »Das Reich, zu dem dieses Gebirge gehört, trägt den Namen China. Es ist ein großes Land –«
»Voller Sünde«, fiel ihm der Priester ins Wort.
»Ein großes Land voller Sünde«, bestätigte der Herzog beflissen. »Wir besitzen keine Aethervorräte, mit deren Hilfe wir wieder aufsteigen könnten. Wenn es uns aber gelänge, die Fühler wieder in Kontakt mit dem Aether über dem Himmel zu bringen, nun, dann wäre alles wieder gut. Alles könnte wieder sein wie früher.«
Davor bewahre uns der Große Leonardo, dachte Niccolo.
»Wir müssen uns anderweitig Aether beschaffen«, sagte der Herzog. »Wenigstens so viel, dass wir ihn von Hand den Pumpen zuführen und sie so wieder zum Laufen bringen können. Die Inspektoren sagen, das sei möglich.«
Niccolo verstand weder, was das mit seinem Vater noch mit den Sprachen des Erdbodens zu tun hatte. Gewiss, China war ihm ein vertrauter Begriff. Sein Vater hatte ihm oft von der Geschichte und den Menschen dieses Reiches erzählt – auf Chinesisch. Aber Niccolo hatte nicht vor, das einem dieser Männer auf die Nase zu binden.
»Hat Cesare dir jemals erklärt, wie der Aether entstanden ist?«, fragte der Herzog.
Niccolo schüttelte den Kopf. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Alessia außen am Fenster vorbei in Richtung der Stallungen schlenderte. Der Wind wirbelte ihr rotes Haar auf wie einen Flammenkranz.
»Drachenatem«, sagte der Schattendeuter. »Aether ist nichts anderes als Drachenatem.«
Der Priester murmelte tonlos ein Gebet an den allmächtigen Zeitwind, widersprach aber nicht. Augenscheinlich akzeptierte selbst er diese Aussage als Tatsache.
»Drachen atmen Luft ein wie wir«, erklärte der Herzog. »Doch das, was sie ausatmen, ist reiner Aether. Er steigt nach oben auf und sammelt sich jenseits des Himmels.«
Niccolo war überrascht, aber nicht besonders beeindruckt. Was brachte es ihnen schon, das zu wissen? Sein Schulterzucken signalisierte Unverständnis.
»China ist ein Land der Drachen«, sagte der Schattendeuter. »Seine Bewohner verehren sie wie Götter.«
Der Zeitwindpriester betete noch schneller und schloss die Augen wie Scheuklappen vor der Wahrheit.
»Kurzum«, sagte Herzog Jacopo, »jemand muss zum Erdboden hinabsteigen, einen Drachen aufspüren und den Aether aus seinen Nüstern einfangen. Genug davon, um die Pumpen wieder in Gang zu setzen.«
»Da wir wissen, dass dein Vater Chinesisch gesprochen hat, hatten wir gehofft, er könnte diese Aufgabe übernehmen.«
In Niccolo nahm eine wilde Hoffnung Gestalt an.
»Ich kann gehen!«, platzte er heraus, bevor er sich überhaupt klargemacht hatte, was er da sagte. »Ich spreche Chinesisch. Und Russisch. Ein bisschen Japanisch. Einen indischen Dialekt. Ich kann sogar –« Er bremste sich selbst in seiner Euphorie und hätte sich am liebsten die Hand vor den Mund geschlagen.
Der Herzog seufzte. »Wie sollte es auch anders sein … Schließlich konnte dein Vater sein Leben lang keinem Verbot über den Weg laufen, ohne es wenigstens im Vorbeigehen zu übertreten.«
»Ihr habt meinen Vater gekannt?«, fragte Niccolo verblüfft.
»Wir waren einmal Freunde. Vor sehr langer Zeit.«
»Und trotzdem habt Ihr ihn –«
»Die Verantwortung für seine Verbannung lag allein bei ihm.«
Der Schattendeuter räusperte sich. »Bitte, meine Herren, zurück zur Sache. Dein Vater, Junge, ist also tot. Demnach sieht es aus, als wärest du in der Tat der einzige Mensch auf der Insel, der sich dort unten verständigen kann.«
»Er ist noch ein halbes Kind!«, hielt der Zeitwindpriester dagegen.
»Dann wisst Ihr sicher eine bessere Lösung!«, fuhr ihn der Herzog unerwartet heftig an.
Der Priester wollte protestieren, kniff dann aber nur schweigend das Gesicht zusammen.
Niccolo dachte an den Abgrund, der unter ihnen lag, weitere tausend Meter Nichts. Die Vorstellung vermochte ihn kaum mehr zu schrecken.
»Jemand muss ihn begleiten«, unterbrach der Priester seine Gedankengänge. »Es wäre doch absurd, eine solche Verantwortung in die Hände dieses Jungen zu legen. Eines Ausgestoßenen!«
»Wollt Ihr vielleicht mit ihm gehen?«, fragte der Schattendeuter amüsiert.
»Und meine Gemeinde auf sich allein gestellt zurücklassen?«
Carpi nickte verschmitzt. »Natürlich nicht.«
Der Herzog ging im Raum auf und ab, was sich als schwierig erwies, weil noch immer überall die eingestürzten Bücherstapel lagen. Er setzte die Füße äußerst vorsichtig, so als könnte er sich an den Buchdeckeln die Zehen verbrennen.
»Vielleicht Soldaten?«, schlug er vor.
»Zu auffällig«, hielt der Schattendeuter dagegen. »Jemand würde ihrer Spur folgen und herausfinden, was sich auf diesen Wolken verbirgt. Nein, einer allein hätte es leichter. Allerhöchstens zwei.«
»Ich gehe mit«, erklang es vom offenen Eingang her.
»Niemals!«, stieß Niccolo aus.
Alessia de Medici trat zurück ins Haus. Stroh klebte an ihren Schuhen. Demnach war sie im Stall gewesen.
»Vater, bitte.« Sie achtete nicht auf Niccolos Protest. »Lass mich mitgehen. Ich kann auf ihn aufpassen. Jemand muss das tun.«