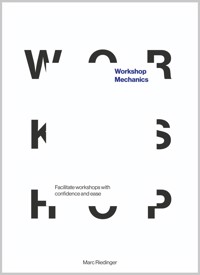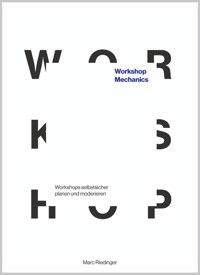
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Workshop Mechanics bietet eine Anleitung für jede Art von Workshops. Lesende erfahren von den vier Schritten der Workshop-Arbeit und lernen, worauf es beim Vorgespräch, der Konzeption, der Moderation und der Auswertung von Workshops ankommt. Mithilfe des Buchs können sie alle Phasen eines Workshops gestalten und mit motivierenden Elementen aus dem Spiel, dem Storytelling und dem Flow-Konzept zu einer positiven Workshop-Erfahrung für die Teilnehmenden verbinden. Angereichert mit Anekdoten, Beispielen, Vorlagen und Checklisten bekommen Sie alles an die Hand, um Workshops selbstsicher planen und moderieren zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
"Workshop Mechanics - Workshops selbstsicher planen und moderieren"
Autor: Marc Riedinger Design: Nina Erschfeld
© Accso - Accelerated Solutions GmbH 2023 1. Auflage Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Kontakt: Accso - Accelerated Solutions GmbH, Hilpertstraße 12, 64295 Darmstadt, www.accso.de
Haftungsausschluss
Der Inhalt dieses Buches wurde mit großer Sorgfalt geprüft und erstellt. Für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Garantie oder Gewähr übernommen werden. Der Inhalt dieses Buches repräsentiert die persönliche Erfahrung und Meinung des Autors. Es wird keine Garantie für Erfolg übernommen. Der Autor übernimmt daher keine Verantwortung für das Nicht-Erreichen der im Buch beschriebenen Ziele.
Kontakt und weitere Informationen über den Autor:
LinkedIn: Marc Riedinger
Über dieses Buch
"Wenn du dich selbst erheben willst, erhebe jemand anderen."
Booker T. Washington
Es ist enorm befriedigend, Menschen dazu zu befähigen, ein hartnäckiges Problem zu lösen und es ihnen zu ermöglichen, Gewohntes auf neue Weise zu sehen, sodass sie wertvolle Erkenntnisse gewinnen können. Und es ist nicht nur erfüllend, sondern auch erlernbar. Dazu dient dieses Buch. In den letzten zehn Jahren habe ich mich intensiv damit beschäftigt, welche Rahmenbedingungen nötig sind, um jene methodischen Strukturen zu schaffen, die Menschen zu Lösungsfindungen ermächtigen und motivieren. Und sie dabei zu begleiten. Ich habe hunderte Workshops für verschiedenste Unternehmen, Verbände, Behörden und Rundfunkanstalten entwickelt und moderiert. Als Trainer gebe ich mein Wissen zu Methodik und Moderation weiter.
Ich bin überzeugt, dass nachhaltige Lösungen am besten gemeinsam von den Menschen erarbeitet werden, die zusammen unter einem Problem leiden. Eine professionelle Unterstützung von außen hilft dabei, die oft vorhandene Betriebsblindheit zu überwinden, die verschiedenen Sichtweisen, Interessen und Kompetenzen der Beteiligten zu bündeln und sie konsequent auf das bestimmende Ziel auszurichten: die Problemlösung.
Workshops spielen dabei eine zentrale Rolle. Hier kommen verschiedene Menschen zusammen, die eines eint: Sie alle sind auf irgendeine, oft unterschiedliche Weise mit einer Fragestellung verbunden, die gemeinschaftlich gelöst werden soll. Unter entsprechender Anleitung bündeln sie ihr Wissen und erreichen etwas, das sie sehr wahrscheinlich alleine nicht geschafft hätten. Wenn es gelingt, sind Teilnehmende oft regelrecht euphorisch, denn sie haben nicht nur Lösungsansätze für ihr Problem geschaffen, sondern sich selbst bewiesen, dass sie es sind, die das Problem lösen konnten. Dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit wirkt weit über die Veranstaltung hinaus.
Allerdings ist es nicht gerade leicht, sich das nötige Wissen zu beschaffen, um Workshops so konzipieren und moderieren zu können, dass sie die Teilnehmenden ermächtigen, echte Lösungen und wirklichen Mehrwert zu schaffen. Ein Großteil der Literatur, die man zu Workshops finden kann, konzentriert sich auf einzelne, teils sehr spezialisierte Aspekte, beispielsweise auf Methoden zum Teambuilding oder Kreativitätstechniken. Oft sind diese Informationen auch einem Thema oder einem übergeordneten Ansatz verpflichtet. So findet man beispielsweise "die hundert besten Methoden für Design Thinking", "Anleitungen für erfolgreiche Retrospektiven" oder "effiziente Strukturen, um Meetings zu gestalten". Entsprechende Bücher und Webseiten zählen ihre Techniken meist auf wie ein Kochbuch seine Rezepte. Aber zu welchem Anlass und für welche Gäste ein Gericht am besten passt, wie kurzfristig auf Unverträglichkeiten reagiert werden kann oder in welcher Reihenfolge und mit welchen Getränken ein Menü gelingt, diese Fragen beantwortet ein solches Kochbuch meist nicht. Und wie bei Kochrezepten sind viele Workshop-Methoden einfache Varianten weniger Basis-Techniken. Es gibt also nicht nur viel Unvollständiges zu lesen, sondern auch vieles vielfach.
Deshalb ist dieses Buch keine Methodensammlung, kein Kochbuch. Es deckt vielmehr alle vier Schritte der Workshop-Arbeit ab: vom Vorgespräch über die Methodik und Agenda hin zur Moderation und schließlich zur Dokumentation. Wie bei einem gelungenen Abendessen kommt es eben nicht nur auf das eine Gericht an, sondern auch auf vieles mehr: auf das Ambiente, die Gäste, die Gespräche oder die Dauer der Zusammenkunft. Alles beeinflusst sich dabei gegenseitig und nicht alles ist vollständig planbar. Das Ganze ist etwas anderes als die Summe seiner Teile. In diesem Sinne behandelt dieses Buch das Format Workshop als Ganzes und wird Sie dadurch unterstützen, Ihre Workshops in allen Aspekten selbstsicher planen und moderieren zu können.
Mit diesem Buch bekommen Sie
Eine umfassende Anleitung für alle Phasen eines Workshops an die Hand. Diese Anleitung funktioniert für jede Art von Workshops, in jedem Kontext und ist damit nicht an Themen oder bestimmte Ansätze gebunden. Ein tiefes Verständnis für die Zusammenhänge dieser Phasen und wie Sie dadurch beispielsweise schwierige Situationen in der Moderation schon im Vorfeld ausräumen können. Einen völlig neuen Zugang zu Methoden. Mit dem eigens für das Buch entwickelten Ansatz der Mechanik lernen Sie Methoden auf funktionaler Ebene zu verstehen und können sie so wesentlich leichter sortieren, anpassen und sogar neu entwickeln. Vorlagen und Checklisten, die Sie immer wieder zur Unterstützung heranziehen können.Das Buch selbst ist nach den beschriebenen vier Schritten aufgebaut und widmet dem Vorgespräch, der Vorbereitung, der Moderation und der Dokumentation eigene, aufeinander aufbauende Kapitel. Die wichtigsten Informationen sind farblich markiert. So können Sie sie schnell wiederfinden oder auch das Buch ein weiteres Mal im Schnelldurchgang lesen.
Soviel vorab. Bevor wir uns gleich mit der Gestaltung und Moderation von Workshops beschäftigen, lassen Sie uns zunächst konkretisieren, was ein Workshop ist und wofür er sich eignet.
Marc Riedinger
B.Sc. (Hons) Design & Innovation zert. Innovationsmanager zert. Team Facilitator zert. Agile Coach
Was ist ein Workshop?
Workshop ist das englische Wort für Werkstatt, also für einen mit Werkzeugen und Materialien ausgestatteten Raum, um etwas Konkretes herzustellen. Nur für diesen Zweck ist dieser Ort wirklich sinnvoll. Er eignet sich weder für Besprechungen noch für Präsentationen oder Vorträge. Ich persönlich finde diese Bedeutung des Begriffs sehr hilfreich und nutze sie als Analogie, um Workshops von anderen Formen zeitlich befristeter Zusammenarbeit von Menschen abzugrenzen.
Ein Workshop ist also ein Format, in dem eine Gruppe von Menschen etwas gemeinsam erarbeitet. Durch diese Zielsetzung unterscheidet er sich von Abstimmungen, Diskussionen, Präsentationen, Vorträgen oder Schulungen. Auch wenn ein Workshop Diskussionen und Abstimmungen beinhalten kann, sollten sie hier nur als Mittel zum Zweck eingesetzt werden, um ein konkretes Arbeitsergebnis zu schaffen. In aller Regel bedeutet das auch, dass diese Formate dabei nur einen sehr kleinen Raum einnehmen.
Wie Sie sicherlich schon erlebt haben, führen Diskussionen und Abstimmungen nicht zwangsläufig zu konkreten Ergebnissen. Sie dienen eher dem Austausch und dem Abgleich verschiedener Sichtweisen. Präsentationen oder Vorträge wiederum stellen die bereits abgeschlossene Arbeit meist einer einzelnen Person in den Vordergrund und unterscheiden sich dadurch vom Workshop-Format, das auf gemeinschaftliches Arbeiten ausgerichtet ist.
Die Werkstatt-Analogie hilft auch zu prüfen, ob ein Workshop wirklich zur gegebenen Aufgabenstellung passt oder ob sich ein anderes Format nicht besser eignen würde, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Eine solche Festlegung ist Teil der ersten Phase der Workshop-Arbeit: Das Vorgespräch mit den Auftraggebern.
Der erste Schritt: das Vorgespräch
Jeder Workshop dient einem Zweck. In Vorgesprächen mit dem Auftraggeber versuchen wir diesen Zweck zu verstehen, was also genau mit dem Workshop erreicht werden soll. Wir besprechen Rahmenbedingungen, wie Termin und Dauer, die Anzahl der Teilnehmenden und in welchem Raum der Workshop stattfinden soll, sofern er nicht remote gehalten wird. So wichtig diese Punkte auch sind, sie reichen nicht aus, um einen Workshop gut vorbereiten zu können. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Ein Beispiel:
Es ist kurz vor acht Uhr und ich betrete den Raum, der von unserem Kunden für den heutigen Workshop gebucht wurde. Jedes Gefühl von zuvor vorhandener Müdigkeit ist mit einem Schlag verflogen: Der Raum entspricht so ziemlich jedem No-Go, das man sich für moderierte Zusammenarbeit vorstellen kann. Es gibt kaum freien Platz an den Wänden, um mit Klebezetteln zu arbeiten. Es hallt fürchterlich. Der Raum ist kalt, freudlos und wie für eine Schulklasse des letzten Jahrhunderts bestuhlt. Die Luft ist schlecht, die laute Baustelle vor den Fenstern wird uns das Lüften wohl nur in Pausen erlauben. Noch eine knappe Stunde, dann geht es los.
Die Teilnehmenden reisen aus dem ganzen Bundesland an, auch der Vorstand ist dabei. Der Workshop hat Bedeutung für den Kunden und damit auch für uns. Anstatt in aller Ruhe den vor uns liegenden Tag gemeinsam noch einmal durchzugehen, bauen meine Co-Moderatorin und ich den Raum schnell notdürftig um und überlegen methodische Alternativen für die geplanten Arbeiten mit Klebezetteln. Bis die Teilnehmenden eintreffen, sind wir eigentlich schon gestresst.
Bei diesem Workshop ist der Wurm drin, denke ich mir. Zwei Tage zuvor wurden wir darüber informiert, dass einige Teilnehmende nur remote dabei sein können. Auf einen hybriden Workshop waren wir bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorbereitet, weder methodisch noch was die technische Ausstattung angeht. Nachdem die Reisen der anderen Teilnehmenden schon fest geplant waren, konnten wir nicht mehr auf eine rein virtuelle Veranstaltung ausweichen. Die nicht Anwesenden auszuladen war auch keine Option. Auch hier waren kurzfristige wie notdürftige Lösungen notwendig, um den Termin überhaupt stattfinden zu lassen.
Der Workshop beginnt. Von den remote Teilnehmenden hat sich nur eine Person angemeldet. Von den anderen gibt es keine Rückmeldung. Nach kurzer Begrüßung stelle ich das Ziel für den Workshop vor. Es geht um das Entwickeln von Strategien für das Change Management des Kunden im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Unternehmens. Dem Termin gingen Monate der gemeinsamen Arbeit voraus. Eine Teilnehmerin meldet sich und fragt, wozu wir uns hier damit befassen sollten. Es gäbe doch schon Strategie-Workshops und Ergebnisse zum Thema. Weitere Teilnehmende bestätigen die Aussage, andere wissen nichts davon. Ich bin baff. Nicht genug, dass ich von den parallelen Unternehmungen zur Sache bislang nichts gewusst habe. Es steht jetzt die gesamte Zielsetzung, der Zweck des Workshops, grundlegend in Frage. Wir müssen einen neuen Sinn für die Veranstaltung finden und zwar schnell, oder wir sind alle umsonst angereist. Die Teilnehmenden schauen meine Kollegin und mich erwartungsvoll an.
"Transparenz, Wissensaustausch und gute Kommunikation sind wesentliche Bestandteile des Change Managements", höre ich mich sagen. "Wie kann es dazu kommen, dass nur ein Teil der hier Anwesenden von den bisherigen Unternehmungen weiß und was können wir für die zukünftige Kommunikation daraus lernen?". Ich teile die Teilnehmenden in Gruppen auf und gebe ihnen die Aufgabe, sich die nächsten 45 Minuten mit dieser Frage zu beschäftigen - in erster Linie, um uns Zeit zu verschaffen. Meine Kollegin und ich nutzen die Zeit, um den Workshop völlig neu aufzusetzen. Letztlich ist der Termin erfolgreich, die Teilnehmenden sind mit den Ergebnissen zufrieden. Das sind wir auch, fragen uns allerdings, wie es zu diesen anstrengenden, kurzfristigen Umplanungen und Notlösungen kommen konnte.
Alle Irritationen traten im Workshop auf und mussten ad hoc durch die Moderation aufgefangen und gelöst werden. Dabei wären sie ausnahmslos im Vorfeld zu vermeiden gewesen. Die Antwort auf unsere Frage ist einfach: Wir haben relevante Themen nicht in den Vorgesprächen geklärt. Aufgrund der langen Zusammenarbeit mit dem Kunden haben wir uns zu sehr darauf verlassen, dass die wichtigsten Dinge sowieso klar sind und wir sie nicht mehr besprechen müssen. Das betrifft nicht nur die Zielsetzung des Workshops, sondern beispielsweise auch die Anforderung an den Raum, dort Klebezettel an Wände heften zu können. All das schien uns selbstverständlich.
Ich denke, die Anekdote macht deutlich: Welche Themen wie umfassend im Vorfeld mit dem Auftraggeber besprochen werden, wirkt sich unmittelbar und vielfältig auf den Ablauf des Workshops aus. Unklarheiten, die im Vorgespräch beseitigt werden, fallen der Moderation im Termin nicht mehr auf die Füße. Gute Gründe also, sich Zeit für ein solches Gespräch zu nehmen und folgende Themen mit dem Auftraggeber zu besprechen.
Erwartung und Zielsetzung des Auftraggebers
Das vorrangige Thema eines Vorgesprächs ist zu verstehen, was der Auftraggeber mit dem Workshop erreichen möchte und welche Erwartungen mit dem Ergebnis verknüpft werden. Diese Zielsetzung beeinflusst sämtliche weiteren Schritte, weshalb sie so präzise wie nur möglich geklärt und formuliert werden sollte.
Eine effektive Methode dafür ist, die Zielsetzung mit dem Auftraggeber zusammen als Frage zu formulieren. Aufgabe des Workshops ist es dann, diese Frage zu beantworten. Statt beispielsweise einen Workshop zu beauftragen, der eine Vision für die Digitalisierung der eigenen Organisation zum Ziel hat, könnte er Antworten auf folgende Fragen erarbeiten: Wie wird uns die Digitalisierung in fünf Jahren vorangebracht haben? Was wird sich dann konkret für uns geändert haben?
Das Formulieren in Frageform hilft dabei, das Ziel präzise zu fassen. Im oben genannten Beispiel wurde es mit einem Zeitraum - fünf Jahre - und einem Fokus ergänzt, nämlich dass die Digitalisierung die Organisation vorangebracht hat. Dementsprechend wäre eher nach positiven Veränderungen und weniger nach Risiken zu suchen. Gleichzeitig dient die Frage als praktische Aufgabenstellung im Workshop. Eine Frage provoziert fast reflexhaft eine Antwort. Den Workshop mit einer Frage zu beginnen, die im Verlauf gemeinschaftlich beantwortet werden soll, aktiviert Teilnehmende demnach deutlich stärker als eine einfache Überschrift wie "Visionsworkshop Digitalisierung".
Zudem können sämtliche Ergebnisse im Laufe des Workshops leichter bewertet werden: Hilft uns dieses Ergebnis, die gestellte Frage zu beantworten? Eine solche Fragestellung dient damit der durchgehenden Fokussierung aller Teilnehmenden auf das Ziel, den Zweck des Termins. Sofern möglich, können Sie die Frage für alle jederzeit sichtbar im Raum platzieren, beispielsweise auf einem Plakat oder als Folie, die an die Wand projiziert wird. Dadurch wird die fokussierende Wirkung noch unterstützt.
Format des Termins
Zielsetzung und Erwartungshaltung des Auftraggebers helfen uns dabei, das passende Format für die Aufgabenstellung zu finden. Sollen gemeinschaftlich konkrete Ergebnisse erarbeitet werden, ist ein Workshop, also eine Werkstatt, das geeignete Format. Je nach Komplexität des Themas oder der Anzahl und Zusammensetzung der Teilnehmenden kann auch eine Workshop-Reihe notwendig sein, um ein gutes Ergebnis zu erreichen.
Verlangt die Aufgabenstellung aber beispielsweise nach Wissensaufbau oder einer ergebnisoffenen Diskussion, ist der Workshop als Format nicht geeignet.
Historie und Kultur
Haben wir schon im Vorfeld ein möglichst präzises Bild der Ausgangssituation von Auftraggeber und Teilnehmenden gewonnen, können wir uns leichter vorbereiten und den Workshop auf die Bedürfnisse dieser Situation zuschneiden. Beim Thema Historie stehen Fragen im Vordergrund wie:
Welche Geschichte hat das im Workshop zu behandelnde Thema? Ist es neu oder wurde es schon in der Vergangenheit bearbeitet? Wenn ja, wie oft und mit welchem Ergebnis? Waren die für den Workshop vorgesehenen Teilnehmenden daran beteiligt?Es geht dabei um die Historie des Themas in der Organisation, nicht um die Geschichte der Organisation selbst. Der Punkt gibt Hinweise darauf, mit welcher Motivation wir im Workshop bei den Teilnehmenden rechnen und welche Fehler aus der Vergangenheit wir vermeiden können.
Nicht selten werden Problemstellungen in Organisationen immer wieder ergebnislos diskutiert. Das kann die Motivation der Beteiligten zermürben, bis sich bei manchen die Überzeugung einstellt, dass sich das Problem ja doch nicht lösen lässt und sich ein neuer Versuch nicht lohnt. Eine solche Ausgangssituation verlangt von uns eine gänzlich andere Herangehensweise an einen Workshop als bei einem Thema, das für alle Beteiligten neu und daher noch potenziell spannend ist. Fragen nach der Historie hätten im Beispiel der zuvor geschilderten Anekdote sehr wahrscheinlich über die bereits stattgefundenen Workshops informiert, ebenso wie über die ungleiche Wissensverteilung innerhalb der Organisation des Kunden. Mit diesem Wissen hätten wir frühzeitig reagieren können und uns viel Aufregung erspart.
Beim Thema Kultur geht es primär darum, wie einfach und offen die Teilnehmenden im Workshop miteinander werden arbeiten können, selbst wenn unterschiedliche Abteilungen, Disziplinen und hierarchische Ebenen aufeinander treffen.
Sind die Teilnehmenden es gewöhnt, abteilungs- und hierarchieübergreifend zu arbeiten? Wie offen wird Wissen in der Organisation geteilt? Ist das Führungsverständnis eher von oben nach unten oder unterstützend und auf Augenhöhe? Wie sieht die Innovations- und Fehlerkultur in der Organisation aus? Einfach gesagt: Werden Fehler als Versagen oder als Teil eines Lernprozesses verstanden? Wird Ausprobieren gefördert oder eher verhindert? Spricht man sich eher per Du oder per Sie an?Antworten auf diese Fragen geben Hinweise darauf, ob eine grundsätzliche Offenheit der Teilnehmenden im Workshop vorausgesetzt werden kann oder sie aktiv unterstützt werden muss. In vielen Organisationen arbeiten Abteilungen eher getrennt voneinander und geben ihr Wissen nur begrenzt an die anderen weiter. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, mehrere kleine, abteilungsinterne Workshops zu planen, um in den Veranstaltungen selbst keine Zeit für den Abbau von Reibungen zwischen den Abteilungen zu verlieren. Wurde dadurch ausreichend Vertrauen und Offenheit aufgebaut, kann ein abschließender gemeinsamer Workshop Ergebnisse und Sichtweisen der vorangegangenen zusammentragen und ergänzen.
Offenheit in der Zusammenarbeit ist im Workshop essentiell, und zwar über die Grenzen von Disziplinen, Hierarchien und Abteilungen hinweg. Die Arbeit in einem Workshop ist stark verdichtet: Die Teilnehmenden haben nur begrenzt Zeit, sich als Gruppe zusammenzufinden, um ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu bündeln und damit die vorgegebene Fragestellung zu beantworten. Und genau in dieser Bündelung liegt die Stärke des Formats. Daher sollten alle Personen, die einen Workshop konzipieren und moderieren, bereits im Vorgespräch ein sicheres Gespür dafür bekommen, mit welcher Offenheit sie im Workshop rechnen können.
Teilnehmende
Hier geht es um die Zusammenstellung der Menschen, die am Workshop teilnehmen werden. Die Kernfrage in diesem Zusammenhang ist: Sind alle relevanten Disziplinen und Sichtweisen vertreten, um die Fragestellung des Workshops beantworten zu können?
Stellen Sie auch Fragen wie diese:
Gibt es hierarchische Beziehungen unter den Teilnehmenden? Wie sehen die Beziehungen der vertretenen Abteilungen aus? Spielen betriebs- oder abteilungspolitische Aspekte eine Rolle? Gibt es große Unterschiede, was die Betriebszugehörigkeit angeht, die für den Workshop relevant sein könnten? Gibt es relevante Wissensunterschiede in Bezug auf das Thema des Workshops? Gibt es dem Thema gegenüber besonders positive oder kritische Stimmen unter den Teilnehmenden?Ziel ist es, ein möglichst klares Bild der Zusammensetzung der Teilnehmenden zu bekommen, damit Sie in der Vorbereitung und später in der Moderation optimal auf die Gruppe eingehen können.
Hierarchische Beziehungen spielen dabei eine besondere Rolle. In einem Workshop arbeiten alle Teilnehmenden quasi vor Publikum und oft unter Zeitdruck. Für viele Menschen ist das ungewohnt und manchmal unangenehm. Arbeiten Führungskräfte mit ihren Mitarbeitenden in einem Workshop zusammen, können unterschiedliche Irritationen entstehen. Die Führungskraft hat eventuell die Sorge vor den eigenen Mitarbeitenden nicht überdurchschnittlich zu performen und sich dadurch zu blamieren. Die Mitarbeitenden befürchten vielleicht insgeheim, dass sich ihr Auftreten oder ihre Leistung auch auf das Verhältnis zur Führungskraft außerhalb des Workshops auswirken kann. Diese und ähnliche Befürchtungen hemmen Teilnehmende und lassen sie entweder besonders zurückhaltend oder besonders dominant auftreten, was sich sofort negativ auf die Zusammenarbeit und die Qualität der Ergebnisse des Workshops auswirken kann.
Als Verantwortliche für einen Workshop sollten wir von solchen Beziehungen wissen, um durch entsprechende Gruppeneinteilungen und vertrauensbildende Maßnahmen Irritationen entgegenzuwirken.
Rahmenbedingungen
Hier liegt der Fokus auf organisatorischen Fragen zum Workshop selbst:
Wer kümmert sich um die Terminfindung? Wie lange soll der Workshop dauern? Wie viele Menschen nehmen teil? Soll der Workshop vor Ort oder remote stattfinden? Wer kümmert sich um Raum und Verpflegung? Erfüllt der Raum alle nötigen Anforderungen? Ist Arbeitsmaterial vorhanden oder muss es mitgebracht werden? Welche Informationen brauchen Teilnehmende vorab und wer kommuniziert sie?Im eingangs beschriebenen Beispiel kümmerte sich der Kunde um die Buchung eines Raums, den weder wir noch der Kunde kannten. Hätten wir im Vorgespräch alle für uns wichtigen Anforderungen an einen solchen Raum zusammengestellt, wäre uns vielleicht ein Raum mit besserer Akustik und freien Wänden zur Verfügung gestanden.
Noch eine Anmerkung zu hybriden Workshops, also solchen, an denen manche Menschen vor Ort und andere remote teilnehmen. Meiner Erfahrung nach sind sie, selbst bei sehr guter technischer Ausstattung, weder effektiv noch effizient. Meist kommen dabei die remote Teilnehmenden zu kurz, beispielsweise weil sie sich weniger direkt einbringen und akustisch weniger gut folgen können als Menschen vor Ort. Sofern der Workshop nicht vollständig in Präsenz gehalten werden kann, lohnt es sich, ihn entweder zu teilen, in einen vor Ort und einen remote, oder den Workshop vollständig remote abzuhalten. Hybride Formen sind dagegen sehr gut umsetzbar bei Vorträgen, Präsentationen oder Schulungen, bei denen sich die Interaktion der Teilnehmenden auf einfache Frage- und Antwort-Elemente beschränkt.
Liefergegenstand
Der letzte Punkt klärt den Liefergegenstand, also die praktische Form des Workshop-Ergebnisses für den Auftraggeber. In vielen Fällen handelt es sich dabei um einen Bericht oder eine Präsentation.
Checkliste zum Vorgespräch
Es besteht ein klares und gemeinsames Verständnis von Workshop-Ziel und Erwartungshaltung an die Ergebnisse. Das Ziel ist als Frage formuliert. Ein zumindest grobes Verständnis von Hintergründen und hierarchischen Beziehungen der Teilnehmenden ist vorhanden. Die Historie des Workshop-Themas ist bekannt. Dauer des Workshops und Anzahl der Teilnehmenden stehen fest. Ort, Ausstattung und Verpflegung sind geklärt. Der erwartete Liefergegenstand ist definiert.Der zweite Schritt: Konzeption und Methodik
Sind die im ersten Schritt besprochenen Themen geklärt, können Sie den Workshop inhaltlich und methodisch vorbereiten. Wenn Sie einen Workshop entwerfen, konzipieren Sie dabei eine Art Spielfeld, einen Ablauf und Spielregeln, mit denen die Teilnehmenden optimal an der Fragestellung des Workshops arbeiten können. Und auch wenn sich Workshops in vielen Punkten stark unterscheiden, beispielsweise was die Dauer, die Anzahl der Teilnehmenden oder die Zielsetzung angeht, können sie strukturell alle gleich aufgebaut werden. Diese Struktur besteht aus vier aufeinander folgenden Phasen:
Dem Warmup zur Begrüßung und Kommunikation des Workshop-Ziels. Den Arbeitsphasen, in denen die Teilnehmenden an möglichen Antworten auf die Fragestellung arbeiten. Der Evaluation, in der Ergebnisse daraufhin überprüft werden, inwieweit sie die Ausgangsfrage beantworten können. Dem Feedback, bei dem sich Teilnehmende zum Workshop äußern können und ein Ausblick auf die weitere Vorgehensweise erfolgt.Die folgenden Kapitel bieten Ihnen Anleitungen für die Ausgestaltung jeder dieser Phasen. Das Ziel dabei ist es, für jeden Workshop einen maßgeschneiderten Rahmen zu entwickeln, der die Teilnehmenden bestmöglich dabei unterstützt, die Fragestellung des Workshops gemeinsam zu beantworten.
Phase 1: Das Warmup
Jeder Workshop beginnt mit einer Phase der Begrüßung, die auf Thema und Ziel der Veranstaltung einstimmt. In der Regel besteht sie aus vier Elementen:
Der Vorstellung von Ziel und Ablauf. Einer Vorstellungsrunde. Dem Abfragen der Erwartungshaltung der Teilnehmenden und einem Abgleich mit dem Ziel des Workshops. Einem Briefing, um Teilnehmenden einen Kontext zur Fragestellung zu geben (oft durch den Auftraggeber) inklusive kurzer Fragerunde dazu.Das Warmup erfüllt zwei Aufgaben: Kommunikation und Vereinbarung des Ziels sowie das Schaffen einer gemeinsamen Wissensbasis.
Kommunikation und Vereinbarung des Ziels.
Die im Vorfeld vereinbarte Fragestellung, die im Workshop beantwortet werden soll, wird den Teilnehmenden als Ziel für die Veranstaltung vorgestellt. Geben Sie den Teilnehmenden dabei auch immer eine Gelegenheit, sich mit ihren eigenen Erwartungen zur Fragestellung zu äußern. Sie erkennen dann schnell, ob sich die gesamte Gruppe auf die Zielvorgabe und damit die Zusammenarbeit im Workshop einlassen kann oder an welchen Stellen vielleicht Einigung erarbeitet werden muss. Dabei bleibt die Fragestellung selbst unverändert, denn sie steht für Ihren Auftrag, den Sie mit Ihrem Auftraggeber vereinbart haben.
Eine sehr einfache Möglichkeit, die Erwartungshaltung der Teilnehmenden abzufragen, ist, sie auf Klebezetteln festzuhalten. Ich gebe dazu gerne einen Satzanfang vor, den die Teilnehmenden auf einem Klebezettel vervollständigen.
Die Teilnehmenden bekommen zum Beispiel den Satzanfang: "Von der Beantwortung der Fragestellung erwarte ich mir…". Alle Teilnehmenden schreiben stumm ihre Ergänzungen auf jeweils einen Klebezettel. Der zeitliche Rahmen dafür liegt in der Regel bei zwei bis fünf Minuten. Alle Teilnehmenden stellen der Reihe nach ihre Ergänzungen kurz vor und kleben sie an eine dafür vorbereitete Stelle im Raum, beispielsweise auf einem Flipchart, an die Wand oder auf ein digitales Whiteboard, wenn der Workshop remote gehalten wird. Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Zettel zu anderen zu heften, wenn sie sich inhaltlich ähneln.