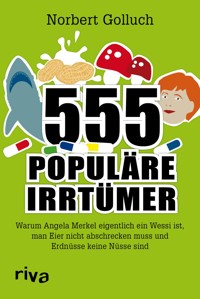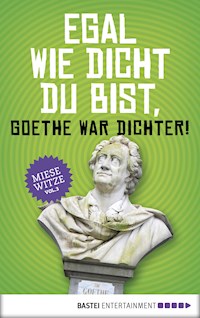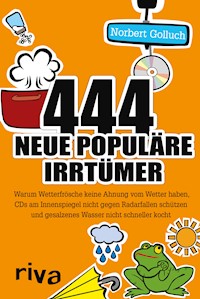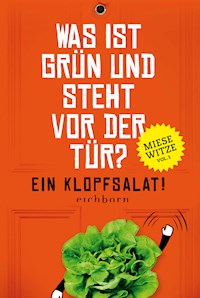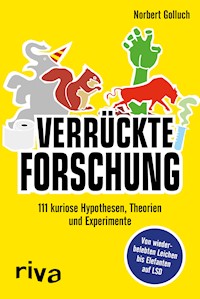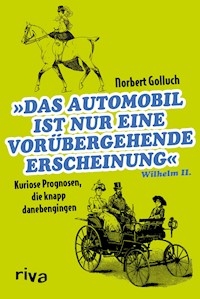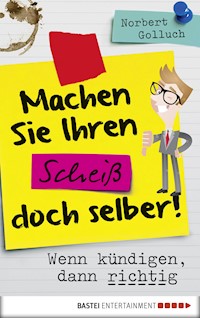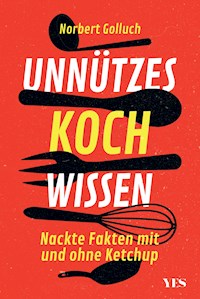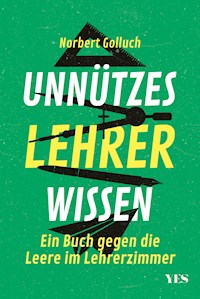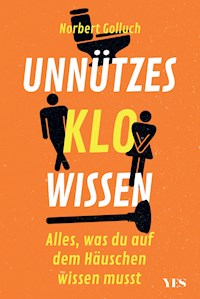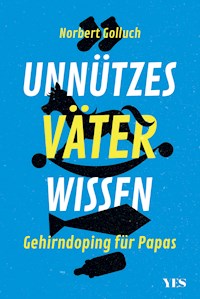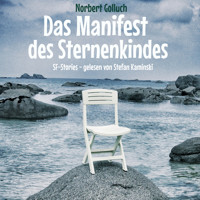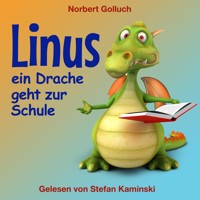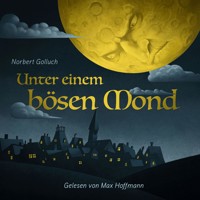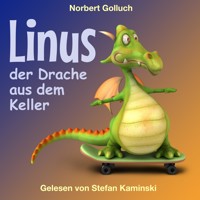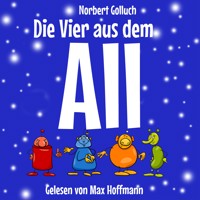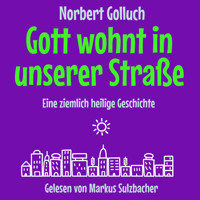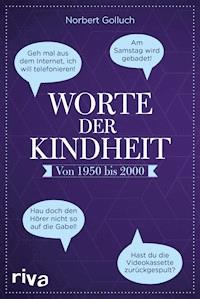
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Riva
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Oft braucht es nur ein Wort und wir fühlen uns wieder in unsere Kindheit versetzt. Für den einen ist es der »Vokuhila«, der unangenehme Erinnerungen daran weckt, dass diese peinliche Trendfrisur nicht an ihm vorbeigegangen ist, für den anderen der Satz »Ich kauf mir 'ne Wundertüte«, der an unsere kindliche Freude über die bunten Überraschungen in Form von Bonbons, Spielzeug oder Schmuck denken lässt. Worte der Kindheit enthält eine Sammlung von typischen Ausdrücken der Jahre 1950 bis 2000, von denen sich manche zu Klassikern entwickelt haben, während andere in Vergessenheit geraten sind. In unterhaltsamen Texten nimmt Norbert Golluch uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Norbert Golluch
WORTE
DER
KINDHEIT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Originalausgabe
2. Auflage 2019
© 2018 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Ulrike Reinen
Umschlaggestaltung: Manuela Amode, München
Umschlagabbildungen: Shutterstock.com: blackzheep; Curly Pat
Abbildungen im Innenteil: Shutterstock.com: Curly Pat; diluck; Elena Terletskaya;
Iconic Bestiary; Mix3r; oorka; Steinar
Layout: Manuela Amode, München
Satz: Carsten Klein, Torgau
Druck: CPI books GmbH, Leck
eBook by ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-7423-0667-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-0247-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-0248-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Nachrichten aus der Sprachwolke
1950–1959
1960–1969
1970–1979
1980–1989
1990–1999
Nahezu zeitlos
Worte reisen in die Zukunft
Nachrichten aus der Sprachwolke
Jeder kennt sie – alltägliche Wörter oder auch Sätze, solche, die wir jeden Tag gebrauchen, die uns so selbstverständlich über die Lippen gehen, dass wir sie nicht einmal bewusst wahrnehmen. Sie verschmelzen mit dem Strom unseres Mitteilungsbedürfnisses und tun ihren Dienst – zuverlässig, problemlos und als Baumaterial unserer Sprache wie die Wassertropfen in einer Wolke, jeder einzelne mit etwas Größerem verschmolzen und dadurch unbemerkt.
Doch irgendwann stoßen wir in dieser Wolke aus Sprache, die uns eigentlich immer umgibt, auf Kondensationspunkte. Ein kleines Stück tritt klar hervor, wird zum Angelpunkt oder Widerhaken in unserer Wahrnehmung, beeindruckt uns als brillantes Funkeln oder verlockendes Leuchten. Ein einzelnes Wort fasziniert uns, eine kurze Formulierung fesselt unsere ganze Aufmerksamkeit, weil sie aus den vielen anderen hervorsticht – ungewöhnlich, nicht mehr gebräuchlich, irgendwie von gestern, aber aufgeladen mit Emotionen und letztlich etwas ganz Besonderes – ein Wort aus unserer Vergangenheit, eine Wegmarke auf der Straße unseres Lebens.
Wählscheibe! Hatte Opa nicht so ein glänzendes schwarzes Telefon mit einem durchlöcherten Rad, mit dem man eine Telefonnummer wählen konnte? Aber es ist nicht nur einfach das Telefon – der Duft nach den alten Möbeln im Wohnzimmer der Großeltern, das gedämpfte Licht durch die Gardinen, die Bonbons in der Dose auf dem kleinen runden Tisch mit der altmodischen Spitzendecke. Ein einfaches Wort, aber ein Stück Kindheit.
Bonanzarad! Die Überraschung, als es plötzlich dasteht, das Gefühl kindlicher Unabhängigkeit, und Mutters Satz »Fahr aber nur auf dem Bürgersteig!«, die wilden Bremsspuren und die zu engen Kurven und natürlich auch die aufgeschlagenen Knie. Die Frage »Darf ich auch mal fahren?« der anderen Kinder an den stolzen Besitzer, ihre Blicke zwischen Neid und Bewunderung.
Wir alle kennen diese ganz besonderen Wörter oder Sätze, die eine Explosion an Erinnerungen wachrufen, an denen lustige persönliche oder berufliche Erlebnisse haften. Sätze, die man vergessen hat, an die man sich aber immer weiter erinnern möchte, wenn sie erst einmal wiederentdeckt wurden und im Fokus der nun erwachsenen Wahrnehmung aufgetaucht sind. Dieses Buch enthält eine Sammlung davon, alltägliches Wortgeklingel der Vergangenheit, heute manchmal sprachliche Schätze. Viel Spaß bei einer Reise in deine eigene Vergangenheit und in die anderer Menschen, die auch einmal Kinder waren.
1950–1959
Die schweren 40er-Jahre lagen hinter deinen Eltern und der Zweite Weltkrieg war noch ein Teil der jüngeren Vergangenheit, als du auf die Welt kamst. Königin Elisabeth II. bestieg den Thron, die erste Wasserstoffbombe brachte eine neue Bedrohung in die Welt und das »Wunder von Bern« verhalf den Deutschen zur Fußballweltmeisterschaft. Im Fernsehen lief Was bin ich?, das heitere Beruferaten mit Robert Lembke, Rock-’n’-Roll-Star Elvis Presley und die Barbiepuppe kamen in die Bundesrepublik, der eine als Soldat der US-Army, die andere als Spielzeug ins Kinderzimmer. In der DDR regierte Walter Ulbricht. Wenn du Glück hattest, warst du Kind in einem Jahrzehnt des Wiederaufbaus und des Wirtschaftswunders zwischen den Ruinen der Vergangenheit und den Hoffnungen auf eine großartige Zukunft.
»Man leckt das Messer nicht ab!«
Manieren bei Tisch waren besonders in der Nachkriegszeit wichtig. Vieles war noch alles andere als normal, da sollte wenigstens bei der familiären Mahlzeit Ordnung herrschen. Tischmanieren, so sagte man sich, sind für das ganze Leben wichtig. Wer als Bewerber für einen Arbeitsplatz beim Essen mit dem Personalchef Senf auf die Krawatte kleckert oder die Suppe aus dem Teller schlürft, hat schlechte Karten. Vielleicht war das gemeinsame Essen der Familie auch deshalb so mit Merksätzen zugepflastert, die sich den Kindern fürs Leben einprägen sollten. Das klappte tatsächlich, denn sie wurden endlos wiederholt. Manche davon hatten ursprünglich auch einen Sinn: »Kartoffeln schneidet man nicht mit dem Messer!« war so lange eine wichtige Regel, wie die Tafelmesser aus weichem Eisenmetall bestanden, das beim Kontakt mit Kartoffeln oxidierte und dunkel anlief. Edelstahlmesser machten diese Regel überflüssig – dennoch blieb sie lange Zeit erhalten. Anderes bleibt zeitlos gültig: Das Messer leckt man nicht etwa deshalb nicht ab, weil man sich in die Zunge schneiden könnte – es sieht einfach eklig aus. Ähnliche Kampfansagen an das schlechte Benehmen: »Man isst nicht mit den Fingern!« Von gewissen Ausnahmen einmal abgesehen, gehört der direkte Zugriff auf die Nahrung eher in Urwald und Steppe als an den gedeckten Tisch. »Mit vollem Mund spricht man nicht!« Empf hömpft söch eimmpfach ummöphlich am.
Manche Regeln sind auch komplexer und deshalb kennt sie nicht jedes Kind, weil sie nur in der großbürgerlichen Familie beachtet wurden: »Führe nicht den Kopf zum Essen, sondern das Essen zum Kopf.« Wie gesagt, man schlürft die Suppe nicht aus dem Teller. Mehr aus dem alltäglichen Bereich scheint der folgende Satz zu stammen: »Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!« Nein, Mutti mochte es nie, wenn man sich über ihre Kochkünste beklagte, zumal in diesen kargen Zeiten oft nur die Auswahl zwischen Spinat und Grünkohl zur Verfügung stand. Über das angebotene Gericht zu maulen ist aber auch in unseren Tagen ungünstig, wenn du dich um die Stelle des Oberbezirkshanswurst beim Fachverband Hotel und Luxus bewerben willst. Ein Mal »Igitt, Austern!« und du bist draußen. Auch Sushi findest du eklig, bäh, roher Fisch? Kein Platz für dich in unserer Werbeagentur! Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt!
»Dich haben sie ja wohl mit dem Klammerbeutel gepudert!«
Ältere Menschen erinnern sich mit verklärtem Lächeln an das Geschehen in ihrer Kindheit. Jüngere fragen: Hä? Was bitte ist denn ein Klammerbeutel? Und wieso kann man jemanden damit pudern? Fragen der jüngeren Generation, die zu beantworten nicht ganz einfach ist. Ein Klammerbeutel oder -sack enthält nicht etwa Sonderzeichen, sondern Wäscheklammern. Früher pflegte man Wäsche auf der Leine zu trocknen (nicht im Trockner). Da dies manchmal draußen – zum besseren Verständnis outdoor – geschah, bestand die Gefahr, dass der Wind die Wäschestücke von der Leine wehte und so nicht nur die ganze Arbeit des Waschens zunichtemachte, sondern auch die gesamte Nachbarschaft mit interessanten Informationen zum Beispiel über deine Unterwäsche oder den Zersetzungsgrad deiner Socken versorgte. Um dies zu verhindern, hatte man in der Vergangenheit einfache mechanische Hilfsmittel erfunden, um Wäschestücke an der Leine zu fixieren: Wäscheklammern eben. Diese wurden in einem textilen Sack aufbewahrt, der einem anderen solchen, der ebenfalls in einer jungen Familie Verwendung fand, nicht unähnlich sah: dem kleinen Beutel, in dem sich Babypuder befand. Hatte man das Baby von seinen Hinterlassenschaften gereinigt, wurde es zur Hautpflege gepudert – klopf-klopf, mit dem Säckchen, durch dessen Poren das feine Puder drang. Und wenn man dabei versehentlich nicht das mit dem Puder, sondern das mit … na, gerafft? … Klammern erwischte, konnte es geschehen, dass das geliebte Kleinkind deutlichen Schaden nahm. So zumindest in der Vorstellung, denn dass ein Kind, auf das man mit Wäscheklammern klopft, wirklich ernsthaften geistigen Schaden nimmt, ist zu bezweifeln. Schlimmstenfalls gibt es blaue Flecken. Dennoch steht der obige Satz quasi als Redewendung für die Unterstellung, jemand sei nicht ganz da – bei voller geistiger Gesundheit. Wenn dir allerdings diese Geschichte zu weit hergeholt erscheint (wie dem Autor gerade auch, wenn er recht darüber nachdenkt), wäre da noch die alternative Formulierung: »Dich haben sie wohl zu heiß gebadet!« Und dieser Satz muss wohl gar nicht erklärt werden.
»Ich zieh dir den Hosenboden stramm!«
Körperliche Strafen waren für Kinder jener Tage nichts Besonderes. Eltern meinten ihren erzieherischen Bemühungen mit Ohrfeigen, der Hand auf dem Hinterteil, aber auch mit Kochlöffel und Teppichklopfer Nachdruck verleihen zu müssen. Mancher besonders gewalttätige Vater nutzte auch seinen Ledergürtel zu diesem Zweck. Dabei wurde oft systematisch bestraft, nicht nur mit einer spontanen kleinen Ohrfeige oder Kopfnuss, sondern regelrecht vorbereitet in Form eines familiären Strafrituals. Dazu gehörte es, den Stoff der Bekleidung über dem Hinterteil glattzuziehen – kein Faltenwurf sollte die Wucht der Schläge abmildern. Heute würde man vielfach Kindesmisshandlung nennen, was damals ablief, denn die geprügelten Kinder schleppten diesen schmerzhaften Ausdruck elterlicher Verachtung oft durch ihr ganzes Leben. Ein schlagender Vater, eine ohrfeigende Mutter waren für viele die Ursache für ihre persönliche Unsicherheit, einen allgemeinen Vertrauensschwund gegenüber der Welt, für mangelndes Selbstbewusstsein oder sogar Depressionen. Wer mit Trotz reagierte, konnte von Glück sagen. Prügel? Pah, ihr könnt mich mal! Ausgesprochen wurde dieser Satz jedoch nie.
»Wir treffen uns an der Bude!«
Onlineverabredungen lagen noch in weiter Ferne, meist machte man ein Treffen mit Freunden für den Nachmittag auf dem Heimweg von der Schule ab. Die »Bude« war ein beliebter Treffpunkt, weil Kinder in den frühen 50er-Jahren auf Trümmergrundstücken alles fanden, was sie benötigten, um sich irgendwo einen abenteuerlichen Unterschlupf zu bauen und darin zu spielen. Andere trafen sich zum Turnen an der Teppichstange auf dem Hof oder irgendwo auf dem Gelände einer aufgelassenen Fabrik, wenn sie ein Loch in Mauer oder Zaun entdeckt hatten. So wurden großartige Nachmittage programmiert: Erlebnisqualität überragend, Freiheitsgefühl kaum zu beschreiben.
»Fall nicht rein!«
Wo hinein? In das Plumpsklo natürlich – darüber ließen sich ganze Romane schreiben. Noch sehr viele Menschen mussten sich damals mit dieser urtümlichen Form der Fäkalienentsorgung behelfen, das Plumpsklo befand sich auf dem Bauernhof praktischerweise gleich neben dem Misthaufen. Bei uns lag der Fall anders – entschuldige, lieber Leser, wenn ich hier in sehr persönlicher Form über eigene Erfahrungen berichte, denn schließlich geht es ja um ein geradezu intimes Problem. Wenn also ein gewisser Junge im Alter von fast sechs Jahren ein menschliches Drängen verspürte, so folgte er den Spuren seiner Väter, die schon vor ihm diesen Weg gegangen waren, hinaus aus der Wohnung in der backsteinroten Arbeitersiedlung in der Margarethenstraße, hinüber über den Platz zwischen zwei Wohnblöcken, hinein in einen winzigen Verschlag, verschlossen durch eine fahlgrüne Tür aus verwitterten Brettern. Dieser Weg endete stets mit einer Drehung um 180 Grad, mit dem Fallenlassen der Hosen, dem Öffnen eines kreisrunden Lochs durch Entfernung eines ebenso kreisrunden Deckels aus Holz, welches genau so groß und exakt so platziert war, dass ein nun nackter Kinderpopo es nahezu hermetisch verschloss, sobald man sich setzte. Die Gefahr hineinzufallen bestand also nicht. Umschlungen von Duftwolken aus der Tiefe, in deren Aroma sich – trotz der regelmäßigen Leerung der Fäkaliengrube alle paar Monate – vermutlich auch noch Duftkomponenten seiner Ahnen und Urahnen mischten, ließ nun der Knabe erleichtert unter sich fallen, was sein Körper nicht mehr benötigte. Es konnte sein, dass im selben Augenblick in dem ebenso dimensionierten zweiten Verschlag neben dem beschriebenen jemand anderes exakt derselben Tätigkeit nachging oder auch gegenüber auf der anderen Seite des Hofes, wo genau von Angesicht zu Angesicht zwei weitere derartige Örtlichkeiten des Nachbarhauses zur Linken die des anderen Wohnblocks anblickten.
Nun hätte man meinen sollen, dass der Besucher eines solchen Ortes nichts eiliger zu tun gehabt hätte, als diesen vorzeitlichen Lokus voller untergründiger Gärung und unkontrollierbarer organischer Reifung schnell wieder zu verlassen. Doch vom rätselhaften Zauber des Ortes umfangen, ja eingehüllt von anheimelnden, weil durchaus auch familiären Aromen, vertiefte sich mancher in Gedanken, verstieg sich in die Welt seiner Helden und Abenteurer oder genoss die Lektüre von zurechtgeschnittenen Zeitungsfragmenten, die sorgfältig vorbereitet für hintersinnige Zwecke an einem zurechtgebogenen Draht seitlich an der Wand hingen – des einzigen Ortes übrigens, an dem Kinder freiwillig Zeitung lasen. Man erhielt so die Fantasie anregende Informationen wie »Schwerer Unfall in der Ley…« oder »Adenauer: Der eiserne Vo …«, erfuhr aber nicht, ob es die Leyendeckerstraße gewesen war und auch nicht, ob es dem Bundeskanzler nun um einen eisernen Vogel oder Vorgartenzaun ging, weil eine fürsorgliche Schere genau dort das Zeitungspapier durchtrennt hatte, wo die Lösung gestanden hätte. Wenn man Glück hatte, fand sich das passende Puzzlestück im restlichen Papierformat. Auch rätselte man bei durchtrennten Todesanzeigen, wer denn nun gestorben sei, oder fragte sich bei Annoncen, zu welchem Preis die angebotenen Seifenflocken wohl zu haben seien, obwohl Seifenflocken sonst nicht zum Hauptinteresse im kindlichen Gedankenuniversum gehörten. Bis in die 80er-Jahre reinigten sich übrigens viele Menschen auf diese Weise gedanklich und hinterrücks mit nicht mehr benötigten Presseprodukten. Parallel entwickelte sich allerdings auch eine Klopapierkultur, von der harten, einfachen Rolle über das weichere Tissuepapier bis zum mehrlagigen oder sogar feuchten und parfümierten Superpapier von heute, das allerdings ohne jeden Informationswert ist. Vermutlich ist aber bald mit einer Erweiterung des Internets der Dinge und somit einem Onlinezugang auch an dieser Stelle zu rechnen.
»Und heute Abend gibt es Toast Hawaii!«
In manchen Haushalten ist dieser Satz auch heute noch zu hören, aber erstmals kam er einer treu sorgenden Mutter Mitte der 50er-Jahre über die Lippen. Vorher gab es nämlich keinen Toast Hawaii. Erfunden hat das kulinarische Meisterwerk nach eigenen Angaben der Fernsehkoch Clemens Wilmenrod, der seine Täterschaft auch vor laufender Kamera zugab. Das simple Rezept – eine Scheibe Toast, darauf Käse, roher Schinken oder Kochschinken, Ananas und Cocktailkirsche – könnte aber auch von seinem Konkurrenten und Lehrer Hans Karl Adam stammen. Toast Hawaii traf auch wohl deshalb den Nerv der Zeit, weil die für damals ungewöhnliche Kombination von Lebensmitteln etwas Verschwenderisches und Exotisches hatte. Für manchen älteren Mitbürger duftet es dabei auch heute noch nach Kindheit und festlicher Familie.