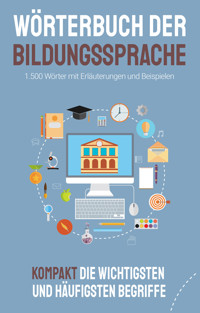
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Weil kluge Sprache nicht kompliziert sein muss. Die wichtigsten Begriffe der Bildungssprache – klar erklärt, ohne Ballast. Mit einleuchtenden Beispielen, verständlich formuliert und frei von Fachjargon. Damit du anspruchsvolle Texte schneller verstehst und sprachlich sicherer wirst. Ein nützliches Nachschlagewerk für Schule, Studium und Beruf. - Verstehe anspruchsvolle Texte schneller und leichter - Bereichere deinen Wortschatz mit klugen Begriffen - Schreibe präziser und ausdrucksstärker Das Wörterbuch hat 314 Seiten. Enthalten sind 1670 bildungssprachliche Wörter mit Erläuterungen plus zwei nützliche Zugaben. Kennst du das? Du liest einen anspruchsvollen Artikel, und plötzlich taucht ein Wort auf, dessen Bedeutung du nur ungefähr erahnst. Genau hier hilft das Wörterbuch der Bildungssprache! Also habe ich angefangen, mir diese Wörter zu notieren – ein angeborener Sammeltrieb, kombiniert mit Neugier. Heutzutage kann man alles fast jederzeit nachschlagen: mal eben in den Duden gucken, bei Google suchen, ChatGPT fragen, per Sprachbefehl mit dem Handy oder per Mausklick. Das ist bequem, aber noch besser ist es, diese Wörter tatsächlich zu kennen – möglichst viele davon. Das lässt sich lernen. Für mich waren das immer wieder Aha-Erlebnisse, wenn ich ein bekanntes Wort plötzlich präzise definiert sah. - Für Studenten, die anspruchsvolle Texte besser verstehen wollen. - Für Autoren, die ihre Texte sprachlich bereichern möchten. - Für Neugierige, die Sprache lieben. - Für Deutschlernende, die über das B2-Niveau hinaus wachsen wollen. - Für Texter, Lektoren und Redakteure, die auf präzise Formulierungen angewiesen sind. - Für Eltern, die ihren Kindern beim Verstehen schulischer Texte helfen wollen. - Für alle, die öfter mal denken: „Was heißt das eigentlich genau?“ - Für alle, die sich wirklich weiterbilden wollen. Bildungssprache ist anspruchsvoll, abstrakt und vielfältig. Doch diese Begriffe machen die Sprache nicht einfach nur schwerer, sie sorgen auch für die Präzisierung des Gesagten oder Geschriebenen. Auf diese Weise entsteht eine Abgrenzung zur Alltags- oder Umgangssprache. Weil sich das, je nach Zielgruppe oder Gesprächspartner, möglicherweise sogar anbietet. Für einen besseren und genaueren Austausch. Für eine klügere Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
WÖRTER DER BILDUNGSSPRACHE
KOMPAKT – Die wichtigsten und häufigsten Wörter
bildungssprache.net
»Lesen heißt borgen, daraus erfinden abtragen.«
Georg Christoph Lichtenberg
Vorwort … ein Handbuch schlauer Wörter
Mir ging es wie vielen Leuten: Las ich einen anspruchsvollen Artikel, kamen unvermeidlicherweise Wörter darin vor, die mir zwar geläufig erschienen und deren Bedeutung ich mir aus dem Kontext herleitete. Aber ihre genaue Definition konnte ich nicht oder nur vage benennen. Wissen ist etwas anderes.
Also habe ich angefangen, mir diese Wörter zu notieren. Der angeborene Sammeltrieb; kombiniert mit Neugier. Heutzutage kann man alles fast jederzeit nachschlagen … mal eben in den Duden gucken oder bei Google, per Sprachbefehl mit dem Handy oder per Mausklick. Das ist bequem, noch besser wäre es aber, diese Wörter tatsächlich zu kennen. Möglichst viele davon. Das lässt sich lernen. Bei mir kam es immer wieder zum Aha-Erlebnis, wenn ich ein bekanntes Wort definiert sah.
Mit der Zeit ist ein bisschen was zusammengekommen. Daraus wurde dann eine praktische Liste, die ich in einem meiner Blogs veröffentlicht habe. Jedes Mal nachzuschlagen ist immer noch viel zu mühsam. Das macht man ein paarmal und dann ist es auch gut. Besser ist eine handliche Übersicht.
Die Idee fand schnell Zuspruch. So wuchs sich die Liste über die Zeit zur Website aus. Und nun gibt es das alles auch als Buch. Selbstverständlich nochmals erweitert, geprüft, mit System und umfangreicher befüllt.
Es handelt sich nicht um beliebige Fremdwörter, von denen es reichlich gibt und einige geradezu Modewörter sind. Die Bildungssprache hingegen ist ein Kanon, ein Wörterkosmos eigener Art, der sich über Jahrhunderte herausgebildet hat. Dazu gleich mehr.
Sämtliche Wörter der Bildungssprache würden den Umfang dieses Buches noch einmal verdoppeln. Ich habe mich deshalb bei dieser Ausgabe auf die wichtigsten und häufigsten Begriffe beschränkt.
Die Häufigkeit der Benutzung ließ sich nur aus der Presse ableiten (via DWDS), nicht aber aus der amtlichen/behördlichen Verwendung, aus der gesprochenen Sprache an Hochschulen und nicht aus Büchern. Dafür gibt es keine Statistiken. In manchen Fällen musste ich deshalb schätzen.
Die Voraussetzung für eine Aufnahme in dieses Buch war eine entsprechende Klassifizierung der Dudenredaktion als bildungssprachlich. Das habe ich als Maßstab genommen. Allerdings ist zu bedenken, dass die Zuweisung mit jeder neuen Ausgabe des Werkes Veränderungen unterliegen kann. Die jeweiligen Definitionen stammen nicht aus dem Duden. Sämtliche Beispielsätze sind frei erfunden. Sie können Spuren von Ironie enthalten.
Dies ist ein Buch für die Praxis, vor allem zum Lernen, zum Sich-selbst-Überprüfen und zum Üben. In diesem Sinne ist das Buch gedacht als Grundlage zum Büffeln, Pauken, Sich-Merken. Oder aus Spaß und Interesse, als Tauchgang in die die Tiefen der deutschen Sprache, als intellektuelle Herausforderung an sich selbst. Es handelt sich nicht um ein wissenschaftliches Werk. Es ist für die heutige Zeit und für normale Menschen gedacht. Bildungssprache jagt nicht dem Zeitgeist hinterher, Gendersternchen und sogenannte geschlechtergerechte Sprache gibt es hier deshalb nicht.
Sven Edmund Lennartzim April 2021
Bildungssprache – was ist das eigentlich?
Bildungssprache findet sich außer in Schule und Universität auch in der Literatur, in Sachbüchern, in der Politik. Es gibt sie in Debatten, sogar im TV. Wer Kant im Original oder das Feuilleton der FAZ lesen und vor allem verstehen will, braucht das hier. Denn ihr angestammtes Biotop ist der Journalismus. Kaum ein Artikel, der auch nur halbwegs anspruchsvoll sein will, kommt ohne sie aus.
Deshalb geistern Begriffe aus der Bildungssprache täglich um uns herum. Zahlreiche davon werden aktiv benutzt, ohne dass die jeweiligen Bedeutungen jedem wirklich klar sind. Hier kann jeder sein Wissen auffrischen oder erweitern.
Das ist die eine Sache. Mit Bildungssprache kann man aber auch Leser, Kollegen, Freunde und natürlich Lehrer überraschen und sie glauben lassen, man hätte eine extraordinäre, mindestens exquisite Bildung genossen. Jemand aus bestem Hause sozusagen.
Wörter aus der Bildungssprache wirken mehr oder weniger gescheit, gelehrt, prätentiös, distinguiert, extravagant, kultiviert, bewandert, kenntnisreich, beschlagen, zivilisiert, gepflegt, gewählt, ausgesucht, geschliffen, eloquent oder belesen. Nicht schlecht, oder?
So sollte sich aber niemand dauerhaft und schon gar nicht in jeder Situation ausdrücken. Das überfordert den Leser oder Zuhörer. Im schlechtesten Fall könnte man sich sogar lächerlich machen, wenn man es übertreibt. Es reicht, sich ein bisschen was abzugucken, um Texte und mündliche Rede interessanter und variantenreicher zu machen. Sprachliche Würze sozusagen.
Was ist nun also Bildungssprache? Es handelt sich um einen Kanon. Nicht alles, was nach Fremdwort oder Anspruch klingt, gehört dazu. Das ist wichtig zu wissen.
Eine mit bestimmten Begriffen angereicherte Sprache wird von gebildeten Menschen und akademisch geschulten Schichten verwendet. Es sind die Worte der Intellektuellen, der Professoren und Ärzte. Aber auch Journalisten und Schriftsteller verwenden sie. Wenn man will, kann man es als einen Code bezeichnen. Tatsächlich ist es ein Kanon.
Nur wer diese Begriffe kennt, sie korrekt verwendet und versteht, gehört dazu. Das kann Auswirkungen auf berufliche Chancen haben und mitbestimmend sein für die Position, die man sich im Leben schaffen will.
Bildungssprachliche Begriffe sind häufig dem Lateinischen entlehnt. Trotzdem handelt es sich nicht um Fach- oder Fremdwörter. Auch wenn sie aus anderen Sprachen zu uns kamen, sie sind allesamt ins Deutsche eingeflossen und in Gebrauch. Nicht enthalten sind Fachbegriffe, etwa aus Medizin oder Soziologie. Es gibt allerdings Überschneidungen.
Ja, Bildungssprache ist anspruchsvoll, abstrakt und vielfältig. Doch bildungssprachliche Begriffe machen die Sprache nicht einfach nur schwerer, sie sorgen auch für die Präzisierung des Gesagten oder Geschriebenen. Auf diese Weise entsteht eine Abgrenzung zur Alltags- oder Umgangssprache. Wer gebildeterweise noch weiter gehen will, der wird sie aktiv verwenden. Weil sich das, je nach Zielgruppe oder Gesprächspartner, möglicherweise sogar anbietet. Für einen besseren und exakteren Austausch. Für eine klügere Sprache.
Viele Begriffe haben zusätzliche oder andere Bedeutungen. Um im praktischen Einsatz nichts versehentlich falsch zu machen, googele man ein Wort und schaue, wie andere es einsetzen und in welchen Zusammenhängen es vorkommt.
Ein Beispiel: Typisch wäre es, von einem Lapsus zu sprechen, statt Wörter wie Versehen oder Ungeschicklichkeit zu verwenden. Das Narrativ hingegen ist nicht bildungssprachlich. Das liegt am Alter. Das Wort war vor 1960 noch unbekannt und konnte deshalb nicht Teil des bildungssprachlichen Kanons werden. Man könnte das Narrativ als Modewort bezeichnen, dazu gehören auch die Resilienz, die Inzidenz oder die Disruption, um Beispiele dafür zu nennen.
Es gibt Wörter, die man nicht als bildungssprachlich wahrnimmt, weil sie Allgemeingut geworden sind. Aber sie waren es einst nicht. Einiges scheint uns aber auch banal, vertraut und nichts Besonderes. Diese Wörter hatten früher einen anderen Klang. Gewöhnlich sind sie erst durch häufigen Gebrauch geworden. Beispiele dafür sind die Palette, das Paradox, hineinspielen, feminin oder das Finale.
Leicht wird es uns nicht immer gemacht. Das Danaergeschenk ist bildungssprachlich, das Damoklesschwert aber nicht. Wer kann das verstehen? Aber wissen kann man es.
Doch Vorsicht. Erschwerenderweise kann ein Wort unterschiedliche Bedeutungen haben, die sich erst aus dem jeweiligen Zusammenhang, dem Kontext erschließen. Wann ist denn nun etwas bildungssprachlich, wann nicht?
Ein Wort ist in dem einen Zusammenhang das der Bildungssprache und in einem anderen nicht. Das muss genau beachtet werden.
Dann sind da noch häufig benutzte Begriffe wie Mechanik, die nur zu einem kleinen Teil bildungssprachlich sind, da wird es knifflig. Beispiel für ein häufiges Wort, das Fremdwort ist, dessen bildungssprachliche Variante aber nicht sonderlich häufig ist: Transparenz.
Ein Beispiel: Operation bedeutet allgemein so viel wie ein chirurgischer Eingriff. In der Bildungssprache steht Operation für eine Handlung, eine planmäßig durchgeführte Unternehmung. Wird das Wort im bildungssprachlichen Kontext verwendet, geht es eben nicht um Medizin, sondern um zielgerichtetes Agieren zu einem bestimmten Zweck.
TIPP: Manche Wörter kann man sich gut über die englische Entsprechung merken, etwa imaginieren, sekundieren, Sentiment.
Das Fundament der Bildungssprache ist Latein und Altgriechisch. Dazu kommen mehrere hundert Entlehnungen aus dem Französischen, rund fünfzig aus dem Englischen (Showdown). Auch ein paar genuin deutsche Wörter finden sich (Schlangengrube) darunter.
Die wichtigsten und häufigsten Wörter aus der Bildungssprache von A-Z
Den Substantiven ist jeweils ihr grammatisches Geschlecht beigefügt. Und zwar [f] für feminin, [m] für maskulin und [n] für neutral. Die am häufigsten benutzten Begriffe sind mit <!> gekennzeichnet.
Aa
abstrahieren verallgemeinern, generalisieren; von etwas absehen
Wer die Wirklichkeit zeigen will, muss abstrahieren.
Abstraktion [f] <!> aus einem höheren Blickwinkel betrachtet, Verallgemeinerung
Der Außerirdische in der Science-Fiction ist ein Mittel der Abstraktion.
Jenseits aller Differenzierung wird aus der Abstraktion ein Allgemeinplatz.
TIPP: Den Begriff der Abstraktion findet man häufig, wenn es um Malerei geht.
Achillesferse [f] schwache beziehungsweise verwundbare Stelle, wunder Punkt
Algebraische Gleichungen sind ihre Achillesferse.
adäquat <!> angemessen, angebracht, entsprechend
Die Buchhalterin adäquat zu ersetzen, schien unmöglich.
Adept [m] Eingeweihter, Anhänger, Schüler
Alles verriet der Meister seinen Adepten dann doch nicht.
ad hoc <!> aus dem Augenblick heraus; zu diesem Zweck
Eine Pressekonferenz wurde ad hoc abgehalten.
Dazu kann ich ad hoc nichts sagen.
Dieses Problem kann nicht ad hoc gelöst werden.
adoleszent heranwachsend, jugendlich
Ihre adoleszenten Energien wollten abgebaut werden.
Advokat [m] Anwalt, Fürsprecher, auch Rechtsanwalt
Er gerierte sich als Advokat der Unterschicht.
Advocatus Diaboli [m] Person, die absichtlich die Gegenseite vertritt, ohne dazuzugehören, oder die in einer Erörterung absichtlich gegnerische Positionen vertritt
Mit diebischer Lust nahm der Essayist die Rolle des Advocatus Diaboli ein.
Äon [m] Welt- oder Zeitalter, Ewigkeit, unendlicher langer Zeitraum
In dem sich dramatisch entwickelnden Internet sind Jahre Äonen.
Das Immunsystem kämpft bereits seit Äonen für unser Überleben.
TIPP: Wird häufig im Plural verwendet, ohne ein Pluralwort zu sein.
äquivalent gleichwertig, entsprechend
In der EU existiert keine zu Google äquivalente Suchmaschine.
Äquivalent <!> [n] Gegenwert, Ersatz, Gegenstück, Entsprechnung
Das russische Äquivalent zu Google heißt Yandex, das chinesische ist Baidu.
Ära [f] Zeitabschnitt, Epoche, oft unter einem bestimmten Blickwinkel gesehen
Wir leben in der Ära des Mobiltelefons.
Affekt <!> [m] Leidenschaften (nur Plural)
Er kultivierte seine Affekte, um sie in seine Kunstwerke einfließen zu lassen..
TIPP: Im weitesten Sinne stellt man sich unter einem Affekt eine leidenschaftliche Erregung vor, eine heftige Gefühlsaufwallung, während der es immer zu Mord und Totschlag kommt. Die bildungssprachliche Form ist eingeschränkter.
affektiert gekünstelt, gespreizt, geschraubt, affig
Vor dem Mikrofon verfiel er in eine affektierte Pose.
Affront [m] <!> Schmähung, Beleidigung, Kränkung
Beispiel: Die Forderungen stellten einen Affront dar.
Agglomeration [f] Ansammlung, Anhäufung
Die Agglomeration verbraucht zunehmend mehr Fläche.
TIPP: Wird zumeist in Bezug auf Urbanität verwendet.
agieren <!> handeln, machen; schauspielern, auftreten
Seit er Geschäftsführer ist, agiert er wie unter Strom stehend.
Man agierte in grellbunten Kostümen, schließlich war Fastnacht.
agil <!> beweglich, wendig, behänd, geschäftig
Agil und treffsicher flogen ihre Finger über die Tasten.
Agonie [f] Todeskampf, Niedergang, Untergang
Die Republik liegt in politischer Agonie darnieder.
Es gelang ihr, den Konzern aus seiner Agonie herauszuführen.
Akklamation [f] Applaus, Beifall, Klatschen; aber auch Abstimmung durch Rufe oder Handzeichen (in der Politik)
Die Wahl erfolgte durch Akklamation.
akklamieren applaudieren, durch Klatschen zustimmen; jemanden durch Rufe oder Handzeichen wählen
Sie akklamierten ihn zum Vorsitzenden.
akklimatisieren sich an ein verändertes Klima gewöhnen, anpassen; sich eingewöhnen
Schon nach zwei Wochen hatte sie sich akklimatisiert und galt nicht mehr als die Neue.
Sobald die Touristen sich akklimatisiert haben, reisen sie schon wieder ab.
Akkumulation [f] Anhäufung, Ansammlung
Die Akkumulation neuer Geschäftsfelder gelingt am schnellsten durch Zukäufe.
akkumulieren ansammeln, speichern, anhäufen, zusammentragen
Wissen akkumuliert sich im Laufe eines Lebens.
Akkuratesse [f] Sorgfalt, Akribie
Die Autorin bemühte sich erfolgreich um historische Akkuratesse.
Akribie [f] <!> äußerste Genauigkeit, größte Sorgfalt in der Ausführung
Der Chefermittler ging mit Akribie zu Werke.
akribisch <!> höchst sorgfältig, sehr genau, äußerst gründlich
Seinen Weg an die Spitze hatte er akribisch vorbereitet.
aktualisieren auf den aktuellen Stand bringen
Dieses Wörterbuch wurde für die 2. Auflage aktualisiert.
Akzentsetzung [f] das Betonen oder Hervorheben bestimmter Aspekte, Ziele oder Einstellungen
Das Theater wagte eine radikale Akzentsetzung.
Akzeptanz [f] <!> Annahme, Anerkennung; Bereitschaft, etwas anzunehmen oder zu akzeptieren
Digitale Assistenten finden verstärkt die Akzeptanz der User.
Mit Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht zu rechnen.
Allüre [f] eigenwilliges Gehabe oder Benehmen, Getue
Allüren hat sie immer noch mehr als Falten, schrieb der Kritiker über die Diva.
TIPP: Wird meist im Plural verwendet.
Alternative [f] <!> (Aus)wahlmöglichkeit, Ausweichmöglichkeit
Das Tablet ist eine Alternative für den eBook-Reader.
altruistisch selbstlos, uneigennützig, sich aufopfernd
Ist die Willkommenskultur altruistisch?
Altruismus [m] Selbstaufopferung, Opferbereitschaft
Von Altruismus kann im Geschäft keine Rede sein.
Altruist jemand, der altruistisch handelt, ein uneigennütziger, selbstloser Mensch
Der ehemalige Vorstandschef gibt heute den Altruisten.
amalgamieren verschmelzen, verquicken, verbinden
Es gelang ihm, die verschiedensten Stile zu amalgamieren.
ambitiös voller Ambitionen; vom Willen beseelt, etwas Erstrebenswertes zu erreichen, ehrgeizig
Man konnte ihre Pläne durchweg als ambitiös bezeichnen.
Ambition [f] <!> Streben nach Höherem, Ehrgeiz
Ihre Ambition, Präsidentin werden zu wollen, ließ sich nicht verhehlen.
ambivalent <!> widersprüchlich, doppeldeutig, zwiespältig
Sie hatte ein ambivalentes Verhältnis zur Musik Wagners.
Ambivalente Charaktere waren seine Stärke.
Ambivalenz [f] <!> Doppeldeutigkeit, Doppelwertigkeit, Zwiespältigkeit
Der Artikel spiegelt die Ambivalenz der Deutschen gegenüber Russland wider.
amoralisch abweichend von der Moral; der Moral entgegenlaufend; losgelöst von moralischer Beurteilung, jenseits jeder Moral
Seine Kritiker hielten ihn für einen amoralischen Mistkerl. Aufstellen ließ er sich dennoch.
TIPP: Amoralisch ist gewissermaßen die Steigerung von unmoralisch. Während Letzteres einen Verstoß gegen die Moral benennt, beschreibt Ersteres das Fehlen jeglicher Moral, was eben noch schlimmer ist.
Amoralität [f] Handlungs- oder Lebensweise ohne Rücksicht auf geltende Moral- und Sittenvorstellungen
Ein Taliban wittert überall Amoralität.
amorph formlos, ohne Gestalt und Form
Die Schaulustigen nahm der Delinquent als amorphe Masse wahr.
amourös die Liebe oder eine Beziehung betreffend
Während des Unterrichts gab er sich amourösen Schwärmereien hin.
Amüsement [n] vergnüglicher Zeitvertreib, unterhaltsames, heiteres Vergnügen
Die Abendgesellschaft erging sich in köstlichem Amüsement.
amusisch fantasielos, ohne Verständnis für die Kunst
Der Staatsdiener nannte ein amusisches Naturell sein eigen.
Anachronismus [m] <!> inkorrekte zeitliche Einordnung, überholte Einrichtung oder Ansicht
Das Fax ist ebenso ein Anachronismus wie der Adel.
anachronistisch <!> zeitlich inkorrekt eingeordnet, nicht in die Zeit passend; überholt, altmodisch
Grenzkontrollen erscheinen dem EU-Bürger anachronistisch.
Anagramm [n] Wörter, die mit gleichen Buchstaben in anderer Reihenfolge sinnvolle Wörter darstellen; Buchstabenrätsel
Wein ist ein Anagramm von Wien.
analog <!> entsprechend, vergleichbar, komparabel
Analog zum Smartphone verfügen auch Tablets über einen Touchscreen.
TIPP: Analog als Gegenstück zum Digitalen ist hier nicht gemeint.
Analogie [f] <!> Ähnlichkeit, Übereinstimmung, Entsprechung, Similarität
Man musste lange suchen, um eine historische Analogie zu finden.
Analyse [f] <!> Vorgang, bei dem etwas systematisch in seine Einzelteile zerlegt und dann untersucht wird
Nach eingehender Analyse sind wir zu einem Schluss gekommen.
Analytiker [m] Person, die einen komplexen Sachverhalt detailliert untersucht
Um die Sache aufzuklären, wurde ein forensischer Analytiker vom LKA herangezogen.
TIPP: In der Alltagssprache ist häufig ein Psychoanalytiker (Seelenklempner) gemeint.
analytisch <!> zergliedernd, analysierend, zerlegend
Ihrem analytischen Verstand fiel es leicht, die Argumente der Gegenseite zu pulverisieren.
androgyn nicht eindeutig männlich oder weiblich, weil beiderlei Eigenschaften vorhanden oder nicht unterscheidbar sind
Auf der Bühne gab er die androgyne Kunstfigur.
anglophil die englische Sprache, Kultur, Lebensart besonders schätzend, liebend
Die weltoffenen Hamburger gelten seit jeher als besonders anglophil.
anglophon auch anglofon Englisch als (Mutter)Sprache (be)nutzend
Der Text stammte offensichtlich aus dem anglophonen Raum.
Annalen [f] Jahrbücher, nach Jahren geordnete Aufzeichnungen von Ereignissen
Dieser Sieg wird in die Annalen des Vereins eingehen.
annektieren widerrechtlich anschließen, angliedern, sich etwas aneignen, in Besitz nehmen, beispielsweise den Teil eines fremden Staates
Israel hat die syrischen Golanhöhen im Jahre 1981 annektiert.
Annektierung [f] die gewaltsame Aneignung von etwas, zum Beispiel eines Territoriums
Eine Annektierung der sogenannten Palästinensergebiete schloss der Regierungschef aus.
Annex [m] Anhang, Anhängsel
Im hundertseitigen Annex der Münchner Konvention wurden zahlreiche Beispiele aufgeführt.
Annexion [f] <!> die widerrechtliche Inbesitznahme fremden Territoriums
Aus Sicht der NATO war der Anschluss der Halbinsel Krim an Russland eine Annexion.
Anonymität [f] <!> Zustand, in dem jemand nicht bei seinem Namen genannt wird, Namenlosigkeit, Unerkanntsein
Er offenbarte sich erst im Schutze der Anonymität.
Antagonismus [m] Gegensatz
Unzählige Posts sind über den Antagonismus zwischen Windows und Macintosh verfasst worden.
Antagonist [m] Gegner, Widersacher, Widerpart, Gegenspieler, Bösewicht
Shakespeares Jago gilt als einer der prominentesten Antagonisten der Bühnengeschichte.
antagonistisch gegensätzlich
In der Gruppe haben sich zwei Lager herausgebildet, die sich antagonistisch gegenüberstehen.
Anthologie [f] <!> Zusammenstellung, Auswahl von Texten verschiedener Autoren in einem Buch
In die Anthologie aufgenommen zu werden, bedeutete für ihn den ersten Schritt zum Ruhm.
anthropogen durch den Menschen oder durch menschliches Handeln erzeugt oder entstanden
Wie groß ist der anthropogene Anteil an der Erwärmung der Ozeane?
anthropomorph von menschlicher Gestalt, dem Menschen ähnelnd, vermenschlicht
Der Roboter soll ein anthropomorphes Design erhalten.
anthropozentrisch allein auf den Menschen bezogen, der Mensch als Maß und Mittelpunkt der Dinge
Die Kirche pflegt ein anthropozentrisches Weltbild.
antichambrieren um Gunst betteln, buckeln, arschkriechen
Ein guter Lobbyist antichambriert bis zur Selbstverleugnung.
Antipathie [f] Widerwille, Abneigung, das Gegenteil von Sympathie
Den Streikbrechern schlug eine Welle der Antipathie entgegen.
Antipode [m] auf entgegengesetztem Standpunkt stehender Mensch, wird auch auf Länder bezogen
Die politischen Antipoden verzettelten sich in Diskussionen.
Antithese [f] Gegenbehauptung; Gegensatz, entgegengesetzte These
Die Demokratie wirkt als Antithese zur Diktatur.
Seine Antithese brachte Dynamik in die Diskussion.
antithetisch gegensätzlich, konträr
Demokratie und Diktatur könnten antithetischer nicht sein.
Antizipation [f] gedankliche Vorwegnahme
Einzelfälle von heute sind mitunter die Antizipation der Normalität von morgen.
antizipieren etwas gedanklich vorwegnehmen, vorgreifen, vorausahnen
Der Markt antizipierte das Unglück bereits, die Kurse stiegen wieder.
TIPP: Häufig werden (Spiel-)Situationen antizipiert. Das Wort findet sich oft in der Fußballberichterstattung.
antizyklisch gegen einen Zyklus gerichtet; unregelmäßig wiederkehrend
Wer Erfolg haben will, muss antizyklisch denken, sonst läuft man nur hinterher.
Apathie [f] <!> Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit
Jahrelang hatte sie versucht, ihn aus seiner Apathie reißen.
apathisch gleichgültig, teilnahmslos, interesselos
Apathisch hockt er jeden Abend vor dem Fernsehgerät.
Aperçu [n] {französisch aussprechen} geistreiche Bemerkung
Weil er geistreich wirken wollte, warf er ein Aperçu Goethes in die Runde.
Aphorismus [m] <!> prägnanter Ausspruch oder Gedanke; Gedankensplitter, ein geistreicher, origineller Einfall
Der in der Titelei dieses Werkes zitierte Georg Christoph Lichtenberg gilt als der Begründer des Aphorismus.
Aphoristiker [m] eine Person, die sich auf das Verfassen von Aphorismen versteht
Georg Christoph Lichtenberg war ein bekannter Aphoristiker.
aphoristisch prägnant, präzise, treffend formuliert, wie ein Aphorismus
Das Duo beherrschte die Kunst der aphoristischen Pointe.
Aplomb [m] Selbstsicherheit, Forschheit, Dreistigkeit
Dem Einwerben von Forschungsgeldern widmete sie sich mit großem Aplomb.
Appendix [m] Anhängsel
Die russlandfreundliche Gruppe wird als Appendix der Partei wahrgenommen.
TIPP: Der Appendix ist hauptsächlich bekannt als Wurmfortsatz des Blinddarms, ein Begriff aus der Anatomie.
apropos <!> übrigens, im Übrigen, dabei fällt mir ein. Heutzutage sagt man ganz anglophon auch schon einmal BTW (by the way).
Apropos Käsekuchen, wo steht noch mal der Kühlschrank?
apodiktisch keinen Widerspruch zulassend, unbestreitbar, unumstößlich, unwiderlegbar
Ihre messerscharfen Buchkritiken wurden vielfach als apodiktisch wahrgenommen.
Apokalypse [f] <!> Weltuntergang, das Ende der Welt, Götterdämmerung, Ragnarök
Es ist noch nicht entschieden, ob uns die künstliche Intelligenz Frieden oder die Apokalypse bringen wird.
Apokalyptiker [m] Person, die visionär vom Ende der Welt redet oder schreibt
Das Lieblingsthema moderner Apokalyptiker ist der Klimawandel.
apokalyptisch <!> den Weltuntergang betreffend; auch für dunkel, düster, unheilschwanger
Mit apokalyptischen Reden und Beschwörungen lässt sich auch heutzutage noch gutes Geld verdienen.
apokryph unecht, nicht dazugehörend, zweifelhaft, dubios
Seinen apokryphen Aussagen war nicht zu trauen.
apolitisch unpolitisch, ohne Interesse an Politik
Man versteht sich als apolitisch und wolle auch nicht zur Wahl gehen.
Apologet [m] jemand, der eine Überzeugung, Ansicht oder Theorie intensiv verteidigt, Fürsprecher
Mit den Jahren hat er sich zu einem Apologeten der Polystilistik entwickelt.
Apologetik [f] Verteidigung, Rechtfertigung einer Weltsicht oder eines Systems
Der Streit artete in spitzfindige Apologetik aus.
apologetisch sich selbst oder seine Ansichten rechtfertigen, verteidigen
Apologetische Argumente vermochte die Kritik nicht umzustimmen.
apostrophieren erwähnen, benennen, bezeichnen, anmerken
Jahrelang war sie als Naturlyrikerin apostrophiert worden.
Sie zählte sich, wie von ihr selbst apostrophiert, zur Avantgarde der Medienkünstlerinnen.
Apotheose [f] Verherrlichung, Vergöttlichung, Glorifizierung
Die Apotheose des Komponisten schritt voran.
Appeal [m] {englisch aussprechen} Ausstrahlung
Im Wahlkampf setzt er auf seinen Appeal.
appellieren <!> sich mit einem Anliegen oder einer Bitte an jemanden wenden; jemandem zureden oder ihn aufrufen, etwas zu tun
Er appellierte an ihre Gefühle.
Ich appellierte an euch, haltet ein!
TIPP: Typischerweise wird appelliert an das Gewissen, an Gefühle und Instinkte, an die Menschlichkeit, an den Gerechtigkeitssinn oder an die Vernunft.
applaudieren klatschen, Beifall bekunden
Dem Laudator wurde wärmstens applaudiert.
Applaus <!> [m] Beifall
Nichts vermochte die Harfenistin glücklicher zu machen als rauschender Applaus.
applizieren anwenden, verwenden, anbringen
In seinem Traktat appliziert er wilhelminisches Gedankengut auf moderne Vorstellungen.
a priori grundsätzlich, im Vorhinein, von vornherein
Meisterschaft existiert niemals a priori, sie muss durch stetige Arbeit entwickelt werden.
Archetyp [m], auch Archetypus Urform, Urgestalt, Vorbild, Inbegriff
Der römische Kaiser Nero ist der Archetypus des wahnsinnigen Herrschers.
Argusaugen [f] ein scharfsichtiger Blick, dem nichts entgeht (nur Plural)
Der Tutor beobachtete alles mit Argusaugen.
TIPP: Argus war ein Riese in der griechischen Mythologie. Er soll hundert Augen besessen haben. Nachdem Argus von Hermes getötet worden war, wurden seine hundert Augen von Hera in das Federkleid des Pfaus überführt.
argumentativ durch oder mittels Begründungen oder Argumente/n
Die Sache ließ sich argumentativ nicht widerlegen.
Arkadien [n] eine Art Paradies im antiken Griechenland gelegen; idyllische, glückselige Landschaft
Auf der beschaulichen Insel fand er sein Arkadien.
arkadisch idyllisch, malerisch, romantisch, ideal oder auf das Traumland Arkadien bezogen
Die Bühne hatte man in eine arkadische Szenerie verwandelt.
Armada [f] Kriegsflotte (historisch), wird auch im übertragenen Sinne verwendet für eine große Menge von Dingen oder Menschen
Im siebten Level sah sie sich einer Armada von Monstern gegenüber.
Armageddon [n] Katastrophe, Verhängnis
Sollte sich an den Zuständen nichts ändern, steuern wir auf ein Armageddon zu.
Arrangement [n] <!> Übereinkommen, Abmachung, Vereinbarung
Der Vertrag war ein Arrangement der Macht.
arrivieren sich etablieren, Erfolg haben
Sie verspürte den Drang, als Publizistin zu arrivieren.
arriviert angesehen, etabliert
Er gehört unzweifelhaft zu den arriviertesten Theatermachern der Republik.
Arrivierter [m] jemand, der Erfolg erlangt hat, gesellschaftlich aufgestiegen ist
Was der Nachwuchs erst noch anstrebt, darüber verfügen die Arrivierten bereits.
Artefakt [n] ein künstlicher, von Lebewesen geschaffener Gegenstand oder Phänomen
Die Artefakte waren uralt und ein Vermögen wert.
TIPP: Artefakte tauchen oft als Störungen in Daten oder Bildern auf. Dort sind sie aber nicht bildungssprachlich.
artifiziell künstlich, gekünstelt
Das in dem Film gezeigte Leben wirkt gestellt, geradezu artifiziell.
artikulieren <!> in Worte fassen, zum Ausdruck bringen
Auf diese Weise artikulierte die Künstlerin ihre verborgenen Ängste.





























