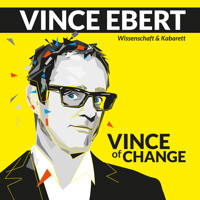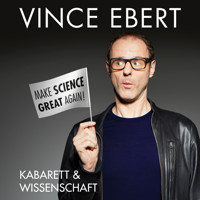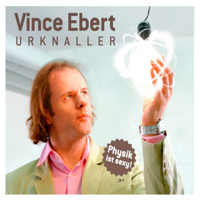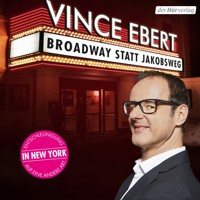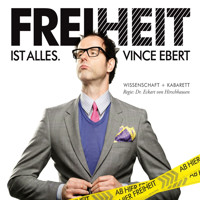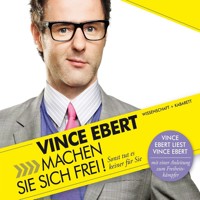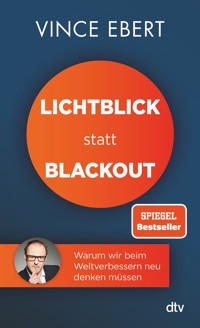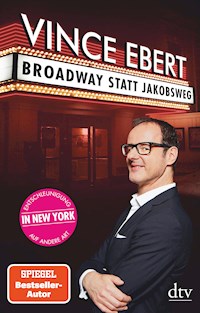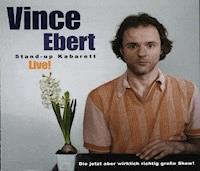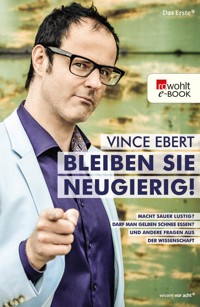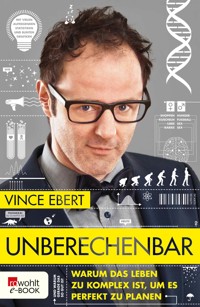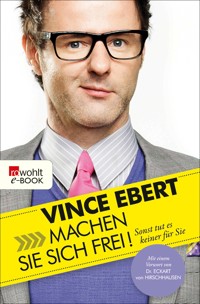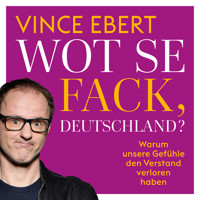
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: HERBERT Management
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gefühltes Wissen Wir leben in einer Zeit, in dem das Wissen nicht mehr zählt. Vince Ebert beschreibt, wie heute Politik und Ideologie über Wissen und Tatsachen gestellt werden. Der Zeitgeist nimmt Fakten nicht mehr wahr, diskreditiert die Experten und verabschiedert sich von der Wissensgesellschaft, in der Wahrheit und Debatte noch wichtig waren. Ebert nimmt diese Entwicklung aufs Korn, ordnet sie historisch ein und fordert eine Renaissance der Aufklärung: Digitales Detox, zurück zur Wissenschaft und raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir koppeln uns vom Wissen und von der Wissenschaft ab, wir verweigern uns damit der Realität. Um die Zukunft zu meistern, brauchen wir aber mehr Wissen, Vernunft und Naturwissenschaft, nicht weniger.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti sagt, die Fähigkeit, ohne jegliche Bewertung zu beobachten, ist die höchste Form der Intelligenz. Wenn das stimmt, sind wir derzeit alle geistige Stubenfliegen. Denn egal, um welches Thema es geht:
Wir fühlen uns gezwungen, Sachverhalte reflexhaft zu bewerten. Wir teilen Meinungen ein in »gut« und »böse«, in »moralisch« und »unmoralisch« und führen einen Dauerkrieg mit jedem, der auf der vermeintlich falschen Seite steht. Ein kräfteraubender und destruktiver Aufschaukelungsprozess der Erregung. Unsere Gefühle haben buchstäblich den Verstand verloren.
Von Vince Ebert ist bei dtv außerdem lieferbar:
Lichtblick statt Blackout. Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen.
Vince Ebert
Wot se Fack, Deutschland?
Warum unsere Gefühle den Verstand verloren haben
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Einleitung
TEIL 1
Vom Faustkeil zum Selfiestick
Vom Durchblick zum Irrsinn
Die Tyrannei der Wehleidigen
OK Boomer
Von der analogen Rebellion zur digitalen Angepasstheit
Wer denken will, muss fühlen
Wissenschaft als Trojanisches Pferd
TRIGGERWARNUNG!!!
TEIL 2
Wer bin ich und wenn ja wie viele?
Frauen sind die besseren Männer
Wir sind bunt
Burn Capitalism Burn!
Wir schaffen das …?
TEIL 3
Quo vadis, Deutschland?
Ehrlichkeit
Mut
Leistungsbereitschaft
Eigenverantwortung
Danksagung
»Kaum zu fassen, dass bei jedem Menschen, dessen Schädel man nach seinem Tod öffnete, ein Gehirn gefunden wurde.«
Unbekannt
Einleitung
Vor einiger Zeit musste die Deutsche Bahn einem männlichen Zuggast 1000 Euro Schmerzensgeld zahlen, weil sie ihn mit »Herr« angesprochen hat, er sich aber als Frau identifiziert. In Berlin-Kreuzberg dürfen neue Straßen nur noch nach weiblichen Personen benannt werden. Sackgassen inbegriffen.
Auf der Insel Langeoog blockieren Touristen immer wieder Rettungsfahrzeuge, weil es sich ja um eine autofreie Insel handelt, und in Hamburg hat ein Mitglied der Letzten Generation ein Kind bekommen. Immerhin.
In einer Kolonialismus-Ausstellung der Zeche Zollern sind an Samstagen zwischen 10 und 14 Uhr weiße Besucher laut Museumsleitung »unerwünscht«[1] und an deutschen Universitäten werden seit dem Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 jüdische Studenten von linken und muslimischen Antisemiten systematisch eingeschüchtert und bedroht.[2]
Schon diese wenigen Beispiele zeigen: Wir leben in verstörenden Zeiten. Tagtäglich prasseln Meldungen auf uns ein, die immer absurder, bizarrer und bedrückender werden. Als im Januar 2025 in einem Aschaffenburger Park ein zweijähriger marokkanischer Junge von einem Afghanen bestialisch ermordet wurde, fiel einer Gruppe von Politikern auf der eilig organisierten Demo gegen rechts nichts Besseres ein, als ein fröhlich grinsendes Selfie ins Netz zu stellen. Eine Selbstzentriertheit und Empathielosigkeit, die sprachlos macht.
Was passiert da gerade? Haben wir als Gesellschaft unseren Kompass verloren? Fast jeder spürt, dass etwas aus dem Lot geraten ist. In immer mehr Bereichen unseres Lebens werden auf einmal Dinge auf groteske Weise hinterfragt und diskutiert, die noch vor wenigen Jahren als selbstverständlich galten. Anfangs konnten wir das als skurrile Einzelfälle abtun, die keine besondere Relevanz für unseren Alltag haben. Inzwischen jedoch realisieren immer mehr Menschen, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht mehr stimmt. Schleichend sind Zustände entstanden, die wir vor gar nicht so langer Zeit für unmöglich gehalten hätten. Unsere Innenstädte verwahrlosen mehr und mehr – die Hauptbahnhöfe werden sogar offiziell zur Waffenverbotszone erklärt. In Frankfurt übrigens nur von 20 bis 5 Uhr. Tagsüber ist dort das Mitführen von Macheten, Revolvern und Schlagringen anscheinend kein Problem.
»Für Sie als Comedian müssten die heutigen Zeiten eigentlich super sein …«, sagen viele Zuschauer meiner Shows. Doch, ganz ehrlich: Wenn die Realität immer mehr zur Satire wird, wenn selbst Parlamentsdebatten kaum mehr von Postillon-Artikeln zu unterscheiden sind – wie willst du das als Satiriker noch groß toppen?
Deutschland schaltet seine hochmodernen Kernkraftwerke ab und importiert im Gegenzug Atomstrom aus uralten französischen Atommeilern. In Peru finanzieren wir Radwege mit einem zweistelligen Millionenbudget, während unsere eigenen Brücken zerfallen. Die neue Regierung beschließt eine historische Schuldenaufnahme in Billionenhöhe und bezeichnet sie nonchalant als »Sondervermögen«.
1986 hat Herbert Grönemeyer gesungen: Kinder an die Macht. Und immer öfter denke ich: Sein Wunsch hat sich erfüllt.
Seit über 25 Jahren stehe ich auf der Bühne und rede mir den Mund fusselig über Vernunft, über Wissenschaft und rationales Denken. Und? Was hat’s gebracht? Sind wir in den letzten Jahren rationaler, besonnener oder gar klüger geworden? ChatGPT sagt nein.
Es erfüllt mich mit großer Sorge, in welche Richtung sich unser Land entwickelt. Fast unbemerkt haben verschiedene gesellschaftliche Strömungen an Einfluss gewonnen, die allesamt Wunschdenken und Fantasie an die Stelle von Rationalität und Wissen stellen. Und nicht nur das. Auch Werte wie Humanität und Liberalität werden von ihnen nach Gutdünken relativiert und nach eigenem Gusto uminterpretiert.
So lassen wir den WDR-Kinderchor Oma ist ’ne alte Umweltsau singen und warnen im selben Atemzug vor Hetze und Hass. Wir fordern »Kein Millimeter nach rechts«, aber wenn Linksextremisten am 1. Mai Straßenzüge verwüsten, schauen wir weg.
Besonders in den angeblich so progressiven Kreisen hat sich nach und nach die Vorstellung breitgemacht, dass westliches Gedankengut zweifelhaft, ja sogar »toxisch« sei, eben ein überholtes Konstrukt von »alten weißen Männern« – rücksichtslosen Typen, die aber ganz nebenbei auch noch die Deklaration der Menschenrechte, die Abschaffung der Sklaverei, die moderne Demokratie und den Sozialstaat etabliert haben.
Nach Jahrhunderten der Irrungen, der Brutalität und des Imperialismus haben wir es auf wundersame Weise hingekriegt, ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln, das auf der Achtung der Schwachen basiert. Wo auf der Welt gibt es einen so großzügigen, auf Solidarität gründenden Wohlfahrtsstaat, der den Bürgern die Chance auf Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht, wie bei uns? Es ist recht simpel: Würde unser Modell nicht auf diesen humanistischen Prinzipien gründen, wären wir nicht so attraktiv für viele, die das aus ihren eigenen Kulturen nicht kennen.
Statt auf all diese fantastischen Errungenschaften stolz zu sein und sie selbstbewusst und mit geradem Rücken zu verteidigen, kreisen wir masochistisch um unsere historischen Verfehlungen und zerfleischen uns dabei selbst.
Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde unsere Art zu leben zu etwas, dessen man sich schämen soll. Wir beschuldigen uns für buchstäblich alles, was gerade in der Welt falsch läuft: Bürgerkriege in Afrika, Überschwemmungen in Bangladesch, Kinderarbeit in Indonesien.
Historische Verdienste wie Redefreiheit, Individualrechte oder Säkularismus – all das ist plötzlich nicht mehr viel wert. Lebensrettende Medizin, die freie Marktwirtschaft, ingenieurstechnische Meisterleistungen – alles, was unzählige Menschen aus bitterer Armut geholt hat, wird inzwischen mit Skepsis und Feindseligkeit betrachtet. Eine Kultur, die Luther, Kant, Benz und Einstein hervorgebracht hat, wird dargestellt, als hätte sie nichts Relevantes mehr zu sagen.
Es hat sich eine Abkehr vollzogen von dem, was unsere Kultur im Kern ausmacht: der vernünftige Blick auf die Welt. Der war ein Erbe der Aufklärung, die uns gelehrt hat, selbstständig zu denken. Deren Werte sehe ich in unserer Kultur bedroht. Eine Bedrohung, die in vielen Schattierungen daherkommt: als unterschiedliche politische Bewegungen, als religiöser Fundamentalismus, als soziale Medien, als teilweise krude Ideologien aus unseren Universitäten und Bildungseinrichtungen.
Es ist gespenstisch, wie verbohrt, fanatisch und aggressiv mittlerweile Positionen und Ansichten vertreten werden, ohne auch nur die geringste Bereitschaft, die eigene Sichtweise infrage zu stellen. Stattdessen wird mit allen Mitteln versucht, den Andersdenkenden moralisch zu diskreditieren, bis hin zu dem Versuch, ihn gesellschaftlich auszugrenzen. Und das alles verbunden mit einer verkrampften Humorlosigkeit, die selbst vor den Humorschaffenden nicht mehr Halt macht.
2023 hat sich die Komikerin Anke Engelke rückwirkend für eine Parodie der Popsängerin Ricky in der Sendung Die Wochenshow entschuldigt, weil sie dabei »Blackfacing« betrieben hatte. Auch ich möchte mich an dieser Stelle für mein Comedyprogramm »Denken lohnt sich« aus dem Jahr 2008 entschuldigen. Der Titel ist anstößig und inakzeptabel, weil er schon damals erhebliche Teile der Bevölkerung ausgegrenzt hat.
Können Sie sich an das Sommermärchen 2006 erinnern? Eine große, bunte Party. Auf den Fanmeilen, in den Innenstädten, auf den Straßen. Viele hatten Fahnen an den Autos, der warme Sommer tat sein Übriges. Was war das geil, oder? Keine zwanzig Jahre ist das her.
Heute ist davon nicht mehr viel übrig. Wir befinden uns nicht nur in einer wirtschaftlichen, sondern vor allem in einer mentalen Rezession. In einer tiefen Phase der Verunsicherung und Mutlosigkeit.
Politik und Ideologie haben sich bis in den Sport und in die Heizungskeller der Republik ausgebreitet.
Im Sommer 2024 fand mit der Europameisterschaft wieder ein großes Fußballturnier im eigenen Land statt. Im Vorfeld brachte die Bundeszentrale für politische Bildung ein Video heraus, in dem die rhetorische Frage gestellt wurde, ob die Welle des Hochgefühls und des Patriotismus während des Sommermärchens 2006 für den heutigen Rechtsruck verantwortlich ist.
Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach und des Meinungsforschungsinstitutes Media Tenor fühlen sich 44 Prozent der Befragten gezwungen, bei politischen Äußerungen vorsichtig zu sein. Nur 40 Prozent sagen, dass sie ihre politischen Meinungen ohne Bedenken äußern können.[3] Sie haben das Gefühl, abweichende Ansichten würden geächtet und das Hinterfragen vorherrschender Narrative werde verpönt. Frust, Wut und Hoffnungslosigkeit sind allgegenwärtig.
Wenn ich im Osten auf Tour bin, erzählen mir viele Zuschauer, dass sie der Zeitgeist an die Situation in der DDR erinnert. Damals gab es eine Meinung, die man nach außen hin kundtat, und eine andere, die man nur im Freundeskreis äußerte. So wie Toni Kroos, der nach der EM2024 in einem Anflug von Ehrlichkeit sagte, dass er nach seinem Karriereende in Spanien bleiben werde, weil er es zu gefährlich fände, seine Tochter abends alleine in einer deutschen Großstadt auf die Straße zu lassen. Eingeleitet mit dem übervorsichtigen Satz: »Wie drückt man das am besten aus, ohne in eine Ecke gestellt zu werden …?«[4]
Die Angst, bestimmte Dinge offen auszusprechen und zu diskutieren, hat in unserer Gesellschaft eine Stufe erreicht, die ich als hochbedenklich betrachte. Das äußert sich unter anderem auch in der Löschung von immer mehr Postings in den sozialen Medien.[5] Postings, wohlgemerkt, mit eindeutig nicht strafbarem oder juristisch angreifbarem Inhalt. Die pure Tatsache, dass sich eine bestimmte Gruppe beleidigt fühlen könnte, genügt bereits. Vor 19 Jahren druckten renommierte deutsche Zeitungen die Mohammed-Karikaturen der dänischen Jyllands-Posten ab. Im April 2025 gab es sieben Monate Gefängnis zur Bewährung für einen deutschen Journalisten, weil er ein satirisches Meme postete, das Innenministerin Nancy Faeser mit dem Schild »Ich hasse die Meinungsfreiheit« zeigte.[6]
Auch viele Unternehmen und Konzerne haben sich diesem unseligen Trend angeschlossen und geben interne Memos über geforderte Sprachregelungen und den Umgang mit bestimmten Themenfeldern heraus, deren Missachtung bei den Mitarbeitern zu ernsten Konsequenzen führen können. Auch hier handelt es sich nicht um justiziable Dinge (die natürlich zu Recht unterbunden gehören), sondern um Formulierungen und Sachverhalte, die eigentlich durch das Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt sind.
Am dramatischsten ist jedoch die Entwicklung an unseren Hochschulen. Orte, an denen der freie Austausch von Ideen und Meinungen zur intellektuellen Grundausstattung gehören sollte. Immer öfter erzählen mir Professoren, Doktoranden und andere Hochschulangehörige, dass es ihre Karriere gefährden könnte, würden sie öffentlich den gesellschaftspolitischen Kurs ihrer Universitäten kritisieren.
Auch die Art der Kritik hat sich geändert. Früher haben die Leute bei einem Witz, der ihnen nicht gefiel, gemeckert. Heute gilt das als Verstoß gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Irgendetwas läuft also verdammt schief. Wir alle sehen die Symptome. Und es ist eine Entwicklung, die sich nicht nur bei uns in Deutschland vollzieht, sondern in großen Teilen des westlichen Abendlandes. Überall verhalten sich die Menschen in ähnlicher Weise: zunehmend irrational, emotional, herdenartig. Oftmals unangenehm.
In der Londoner National Gallery übergossen zwei junge Menschen van Goghs Sonnenblumen mit Tomatensuppe, weil ihnen die Erderwärmung Sorgen bereitet, und im norwegischen Frühstücksfernsehen trat eine Frau auf, die sich als »transbehindert« bezeichnet. Jørund Viktoria Alme ist körperlich gesund, aber sitzt freiwillig in einem Rollstuhl. Seit Langem ist es ihr sehnlichster Wunsch, von der Hüfte abwärts gelähmt zu sein.[7]
In den USA sympathisiert der Präsident mit einem russischen Diktator und ein Gegner der Masernimpfung wird Gesundheitsminister. Nebenan in Kanada wollen Bildungspolitiker den Mathematikunterricht an Schulen »dekonstruieren«, weil zu viel Rechenkompetenz rassistisch ist, da sie die indigene Bevölkerung diskriminiert. Zwei plus zwei ist vier? In Ontario ist man da inzwischen nicht mehr so sicher.[8]
Fast scheint es, dass uns eine Epoche jahrzehntelangen Friedens, stetig wachsenden Wohlstands und permanenten technologischen Fortschritts zu Kopf gestiegen ist.
Eine Gesellschaft, die glaubt, keine gemeinsamen Probleme und Ziele mehr zu haben, richtet ihre Energien und Aggressionen nach innen. Und bauscht so vollkommen normale Meinungsunterschiede zu radikalen Freund-Feind-Bildern auf. Das führt zu zwei Dingen: Eine solche Gesellschaft wird immer blinder für echte Bedrohungen und gleichzeitig zerfleischt sie sich durch ihre hausgemachten Pseudokonflikte selbst.
Der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti sagt, die Fähigkeit, ohne jegliche Bewertung zu beobachten, ist die höchste Form der Intelligenz. Wenn das stimmt, sind wir derzeit alle geistige Stubenfliegen.
Denn egal, um welches Thema es geht: Wir fühlen uns gezwungen, Sachverhalte reflexhaft zu bewerten. Wir teilen Meinungen ein in »gut« und »böse«, in »moralisch« und »unmoralisch« und führen einen Dauerkrieg mit jedem, der auf der vermeintlich falschen Seite steht. Ein unsäglicher, kräfteraubender und destruktiver Aufschaukelungsprozess der Erregung. Unsere Gefühle haben buchstäblich den Verstand verloren. In gigantischer Geschwindigkeit erleben wir einen Rückfall in voraufklärerische Zeiten.
Das ist auch auf der Bühne zu spüren. Hätte ich zum Beispiel vor zehn Jahren in einem Programm gesagt, dass eine Person mit Bart und Penis auch die Möglichkeit haben sollte, ein Kind zu gebären, dann hätten die Leute im Publikum leicht gelangweilt geantwortet: »Jaja, wir haben alle Das Leben des Brian gesehen.« Heute wird darüber ernsthaft im Deutschen Bundestag diskutiert. Da bist du als Komiker doch arbeitslos.
Das zentrale Element dieses Zeitgeistes ist die Überzeugung, dass die Dinge so sind, wie man sie fühlt. Dass also die Realität immer weniger durch Fakten und immer mehr durch Gefühle definiert ist. Man ist, wie man sich fühlt. Das ist das neue Credo.
Ich gebe zu, ich profitiere davon: Rein äußerlich gesehen mag ich vielleicht ein 57-jähriger Physiker mit Haarausfall sein. Aber das ist nur ein soziales Konstrukt. Tatsächlich fühle ich mich als 32-jähriger braun gebrannter Surflehrer aus Kalifornien. Auch meine Gefühle verlieren eben ab und zu den Verstand. Wie bei allen mischt sich auch bei mir manchmal Vernunft mit Gefühl.
Heute ist alles »fluid«, alles ist fließend. Selbst in der Technik. Ein Hybrid ist im Grunde ein Transauto. Also ein Verbrenner, der sich als Elektroauto identifiziert. Und wenn eine Teslabatterie in Flammen aufgeht, identifiziert sie sich eben wieder als Verbrennungsmotor.
Falls Sie das gerade lustig fanden, dann ist die Chance recht groß, dass Ihnen dieses Buch gefallen könnte. Mit Satire, Sarkasmus und Humor versuche ich seit jeher, den Zeitgeist auf die Schippe zu nehmen. Denn ich bin davon überzeugt, dass man den täglichen Wahnsinn nicht stark genug durch den Kakao ziehen kann.
Dass Sie bei einigen Passagen dieses Buches – hoffentlich – immer auch lachen werden, sollte Sie allerdings nicht bezweifeln lassen, dass es mir ernst ist mit meinem Kampf gegen die Feinde der Vernunft.
Denn in der Tat ist die Welt aus den Fugen geraten, wenn Gefühle mehr zählen als Fakten. Während es in unserer Gesellschaft hinsichtlich sexueller Orientierung, traditioneller Ehe oder auch des Drogenkonsums in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Liberalisierung gekommen ist, erleben wir auf anderen Gebieten erhebliche Rückschritte. Naturwissenschaftliche und biologische Erkenntnisse werden relativiert. Energieversorgung und Wirtschaftspolitik werden nach Bauchgefühl betrieben, Migrationsfragen ideologisch verengt. Probleme werden nicht mehr durchdacht, sondern durchfühlt. Doch wenn alles nur Gefühl ist, löst sich die Wahrheit auf.
Die Progressiven, die Linken, haben sich historisch von den Konservativen abgegrenzt, indem sie sich als rationaler und vernunftbasierter präsentiert haben. Konservative hingegen hatten nie ein Problem damit zuzugeben, dass ihr Weltbild stärker an Gefühle und Emotionen wie Heimatliebe, Familie, Glaube oder Traditionen geknüpft ist.
Auch heute noch behaupten viele links eingestellte Menschen, dass sie sich viel stärker als die Konservativen dem kritischen Denken und der Rationalität verpflichtet fühlen. Sie werden nicht müde, diese intellektuelle Überlegenheit gegenüber dem rechten Populismus, der nur die dumpfen Emotionen seiner Anhänger triggert, ins Feld zu führen.
Ich beobachte, dass das vernunftbasierte Denken, das die Basis unserer toleranten und freiheitlich-demokratischen Kultur darstellt, mittlerweile von allen Seiten des politischen Spektrums angegriffen wird. Oder anders gesagt: Richtiges Denken ist weder links noch rechts. Es ist so rational wie möglich.
2024 forderte die prominente Journalistin Carolin Emcke bei einer Podiumsdiskussion unter großem Applaus, bei gesellschaftspolitischen Reizthemen wie der Klima- und der Migrationspolitik Andersdenkende aus der öffentlichen Diskussion auszuschließen.[9]
Und wenn progressive Bewegungen den geringen Frauenanteil in DAX-Konzernen als nicht mehr zeitgemäß anprangern, aber gleichzeitig die Vollverschleierungen von jungen Frauen als kulturelle Spielerei abtun, dann frage ich mich, wie modern und aufgeklärt diese Kreise wirklich sind.
Es sind eben nicht nur die oft genannten rechten Strömungen, die unsere Werte bedrohen.
Wer die anhaltende Popularität der AfD beklagt oder den Aufstieg von Donald Trump, sollte sich ernsthaft fragen, ob nicht vielleicht das jahrelange Verdrängen, Verharmlosen und Ignorieren vieler gesellschaftlicher Missstände genau diese Phänomene mitverursacht und beflügelt haben.
Wir befinden uns an einem gefährlichen Punkt. Weil wir Gefahr laufen, die Werte des aufgeklärten Abendlandes zu verlieren: Rationalität, evidenzbasiertes Denken, Meinungs- und Redefreiheit. Im Laufe der vergangenen Jahre hat quer durch die Gesellschaft eine seltsame irrationale Gefühligkeit von uns Besitz ergriffen, die den gesunden Menschenverstand nahezu vollständig über den Haufen geworfen hat.
Es ist ein Kulturkampf, den wir gerade erleben. Und dieser Kampf ist kein Kampf zwischen linken oder rechten Positionen. Es ist ein Kampf zwischen klarem Realitätssinn und weltfremdem Wunschdenken.
Wie konnte es nur dazu kommen? Welche Mechanismen sind dafür verantwortlich? Und vor allem: Wie kommen wir da wieder raus? Denn das müssen wir. Der Zeitgeist des übergroßen Gefühls, der ideologischen Verblendung und einer kindisch-naiven Sicht auf unsere Welt ist eine denkbar schlechte Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit.
Eine Kurskorrektur ist also dringend nötig. Und die betrifft nicht nur die Politik. Wir alle sind vielmehr gefragt und aufgefordert, wieder unseren Verstand zu benutzen. Denn wer mit dem Bauch denkt, bekommt vieles in den falschen Hals.
Auch ich habe in den vergangenen Jahren meine Leichtigkeit und viel von meiner Zuversicht verloren. Die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen machen mich traurig, treiben mich um und lassen mich nachts wach liegen. Ich blicke auf mein Land und frage mich: »Wot se Fack, Deutschland?« Was zum Teufel tun wir nur?
TEIL 1
Vom Faustkeil zum Selfiestick
Um zu verstehen, warum unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahren so irrational geworden ist, möchte ich einen Schritt zurückgehen und die umgekehrte Frage stellen: Waren wir überhaupt schon mal vernünftiger?
Blickt man nämlich zurück, war die Entwicklungsgeschichte der Menschheit die allermeiste Zeit nicht gerade von Logik und Faktenliebe geprägt.
Hochkulturen wie die Azteken opferten Zigtausende unschuldiger Menschen, nur um zu garantieren, dass die Sonne wieder aufgeht oder die Ernte gelingt. Hätten sie nur einen Funken wissenschaftlicher Methodik in sich gehabt, hätten sie sich gefragt: »Hey, lasst uns diesen Freitag die Menschenopfer einfach mal weglassen und schauen, was in den nächsten Tagen so passiert …« Aber vielleicht machte ihnen die Sache mit den Menschenopfern einfach auch nur viel zu viel Spaß.
Grundsätzlich galt über Jahrmillionen das Motto: Verlasse dich nicht allzu sehr auf deinen Verstand, sondern folge deinem Gefühl. Sei spontan! Wenn in grauer Vorzeit ein männlicher Urmensch an ein Wasserloch kam und dort auf einen unbekannten Artgenossen traf, musste er intuitiv und sehr schnell vier große Fragen beantworten: männlich oder weiblich? Wenn weiblich, paarungsbereit oder nicht? Wenn männlich, Freund oder Feind? Wenn Feind, stärker oder schwächer?
Innerhalb von nur 0,3 Sekunden musste unser Vorfahre eine Entscheidung treffen. Sonst gab es nichts mehr zu entscheiden. Kein Meeting, kein Coaching, kein Telefonjoker. Im Grunde lief es vor 500000 Jahren für Männer oft auf die banale Alternative hinaus: Vögle es oder töte es!
Ich weiß, wir halten uns für reflektierte, kluge Köpfe, die sich vom Tier durch übergroße Intelligenz abheben. Aber was wohl unser Hund denkt, während wir ihm den Kackbeutel hinterhertragen?
Wenn William Shakespeare seinen Hamlet sagen lässt: »Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie edel durch Vernunft! Wie unbegrenzt an Fähigkeiten! In Gestalt und Bewegung wie bedeutend und wunderwürdig!«, dann nicken wir, weil wir uns alle in der Tradition von großen Denkern wie Sokrates, da Vinci oder Galilei sehen. Doch diese Menschen waren absolute Ausnahmen. Von denen stammen wir nicht ab. Wir stammen von denen ab, die abends in der Höhle am Lagerfeuer gesessen haben und mit großen Augen einem Typen zuhörten, der, mit einem Tierschädel auf dem Kopf, abstruse Zauberformeln gesungen hat. Heute heißt das Ganze »Bundesparteitag«.
Okay, ich übertreibe ein wenig. Tatsächlich hat sich die menschliche Spezies über die vergangenen fünf Millionen Jahre als ein unglaubliches evolutionäres Erfolgsmodell erwiesen. Nicht zuletzt, weil wir ein großes Gehirn entwickelt haben, das uns zum Nachdenken befähigt. Kein anderes Lebewesen kann das.
Mit 1,5 Kilogramm Hirnmasse sind wir der neuronale Weltmarktführer. Das entspricht etwa 2 Prozent unseres gesamten Körpergewichts. Überboten werden wir nur vom Elefantenrüsselfisch. Bei dem macht das Gehirn über 3 Prozent seines Gewichts aus. Ich kann Sie beruhigen: Intellektuell gesehen ist dieser Fisch bisher nicht groß in Erscheinung getreten. Denn der überwiegende Teil seines Denkapparats besteht aus Kleinhirn. Und das Kleinhirn ist nicht für das Denken, sondern vorwiegend für die motorischen Funktionen verantwortlich. Der Elefantenrüsselfisch ist sozusagen der Sportlehrer unter den Meeresbewohnern.
Bei uns dagegen sorgt die Großhirnrinde aus 20 Milliarden Nervenzellen für ein kognitives Feuerwerk. Jede einzelne dieser Zellen, auch Neuronen genannt, ist mit etwa 1000 anderen verbunden, um Informationen auszutauschen. Etwa 1000-mal pro Sekunde gibt die Nervenzelle dabei ein Status-Update von sich. Das schafft nicht einmal Kim Kardashian auf Instagram!
Oberflächlich gesehen arbeitet das Gehirn wie eine Behörde: 99 Prozent aller Aktivitäten werden für interne Abläufe aufgewendet. Da werden Anträge geprüft, Entscheidungen abgelehnt, Widersprüche eingelegt, Genehmigungen erteilt, Revisionen sortiert und zahllose Vermerke gemacht. Und genauso wie bei einer Behörde kriegt der kleine Mann davon praktisch nichts mit. Gerade mal 1 Prozent der gesamten Energieleistung des Gehirns wird nämlich für die Kommunikation mit der Außenwelt verwendet.
Eigentlich ist rein körperlich gesehen ein großes Hirn viel zu kostspielig. 20 Prozent der gesamten Energiezufuhr unseres Körpers gehen direkt in die Birne. Ob Sie wollen oder nicht. Um die wirklich wichtigen Tätigkeiten wie Essen, Trinken, Schlafen oder Fortpflanzen kümmert sich nicht Ihr Kopf, dafür reicht Ihnen im Prinzip das Rückenmark.
Warum also leistet sich die Evolution so eine unglaubliche Verschwendung? Weil wir Menschen sonst nichts anderes gut können. Praktisch jedes Lebewesen ist uns durch irgendeine Fähigkeit haushoch überlegen. Es gibt eine interessante Tintenfischart, bei der das Männchen über einen Begattungsarm verfügt, der sich vom eigentlichen Körper abtrennen kann. Kein Witz. Dieser Arm macht sich mit dem Samen alleine auf den Weg und befruchtet selbstständig die Weibchen. Keine schlechte Sache, wenn zum Beispiel die Paarungszeit genau mit dem Bundesligastart zusammenfällt.
Und was können wir? Wir können nicht besonders gut hören oder riechen, sind kümmerlich behaart, haben keine Krallen und keine Reißzähne. Als wir vor rund drei Millionen Jahren auf der Bildfläche erschienen sind, hätte jede Marketingabteilung schon vor der Serienproduktion gesagt: »Aufrechter Gang? Braucht kein Mensch!«
Aber trotzdem haben wir uns vermehrt wie die Karnickel. Wir haben Herden gebildet, haben das Rad, das iPhone und schließlich sogar das vegane Mineralwasser erfunden. Weil wir nichts besonders gut können außer Denken. Das ist unsere evolutionäre Nische. Insofern ist es immer wieder erstaunlich, wieso es so wenige von uns tun.
Obwohl es menschenähnliche Wesen mit aufrechtem Gang und einem großen Gehirn schon vor mehreren Millionen Jahren gab, begann der Homo sapiens erst vor rund 70000 Jahren so richtig durchzustarten. Diese Zeit ist als kognitive Revolution bekannt.
Unser Vorfahre fing an, mit seinen Artgenossen intensiver zu kooperieren, was im Wesentlichen durch die Entwicklung einer komplexen, nuancenreichen Sprache und später durch die Erfindung von Schrift befördert wurde. Dadurch war es dem Homo sapiens plötzlich möglich, sein Wissen mit anderen zu teilen.
Gemeinsam fertigten sie komplexere Werkzeuge wie Pfeil und Bogen, malten Bilder auf Felswände, schufen Schmuck und Musikinstrumente. Die Fähigkeit zu kommunizieren katapultierte uns in kürzester Zeit an die Spitze der Nahrungskette. Denn selbst wenn es zu diesem Zeitpunkt noch andere Lebewesen mit höherer Intelligenz gegeben hätte, ohne Sprache ist nun mal kein großer Fortschritt möglich. Hätte ein kluger Calamari vor zwei Millionen Jahren die Fritteuse erfunden – es hätte niemand mitgekriegt. Und dabei hätte der sogar eigene Tinte zum Schreiben gehabt.
Mehr noch: Zum allerersten Mal war ein Lebewesen auf diesem Planeten in der Lage, Geschichten zu erzählen und über seine Träume, Wünsche und Sehnsüchte zu sprechen. Plötzlich entwarfen wir Szenarien für die Zukunft, formulierten Ideen und Pläne und konnten andere für unsere Vorhaben begeistern und gewinnen.
Kurzum: Die Entwicklung von Sprache und Schrift war die Basis für alles, was wir heute als Zivilisation und Kultur bezeichnen. Dass wir die Erde dominieren und Berggorillas eine gefährdete Art darstellen, liegt allein daran, dass nur wir Menschen in der Lage waren, komplexe Kulturtechniken zu entwickeln. Ein Adler kann sein Fressen aus über drei Kilometern Entfernung erkennen, während wir ohne Brille nicht mal die Speisekarte lesen können. Trotzdem finden wir rascher eine Stecknadel im Heuhaufen, weil wir in der Lage waren, den Magneten zu erfinden.
Mit der Fähigkeit, über Worte und Begriffe zu kommunizieren, konnten wir nach vereinbarten Regeln agieren, wir konnten immer effizienter in größeren Gruppen zusammenarbeiten, Aufgaben koordinieren und Gesetze festlegen.
Kein Wunder, dass sich ab diesem Zeitpunkt unsere Lebensweise grundsätzlich änderte. Vor etwa 12000 Jahren begannen wir, sesshaft zu werden, wir bauten Häuser und markierten unser Revier nicht mehr mit einer Urinspur, sondern mit dem Jägerzaun. Sesshaftigkeit war eine Folge erfolgreicher Landwirtschaft. Durch Ackerbau und Viehzucht mussten wir nicht mehr mühsam der Mammutherde hinterherziehen, sondern konnten uns in Dörfern und später in Städten niederlassen. Eine enorme Zeitersparnis, die heutzutage von der Parkplatzsuche wieder zunichtegemacht wird.
Schon bald kamen die ersten Hochkulturen auf. Die Sumerer erfanden das Rad, die Babylonier die Metallverarbeitung, der Baden-Württemberger den Bausparvertrag. Unorthodoxe Ideen, die unsere Welt innerhalb kürzester Zeit komplett veränderten. Wir errichteten Aquädukte, erschufen Imperien, pflegten Handelsbeziehungen und bildeten Allianzen.
Vor knapp 3000 Jahren kam es zu etwas, was uns als intelligente Spezies einen großen Schritt voranbrachte: Im antiken Griechenland entstand die Philosophie. Sozusagen die Kunst des Hinterfragens: Gibt es so etwas wie Wahrheit? Was ist die Welt? Woraus besteht sie?
Natürlich hatten sich die Menschen diese Fragen auch schon vorher gestellt. Doch bei der Beantwortung landeten sie bei irgendwelchen mehr oder weniger mystischen Erklärungen. Erst die griechische Philosophie versuchte, sich diesen Fragen mit den Gesetzen der Logik anzunähern.
Als zum Beispiel einmal ein junger Grieche über das Mittelmeer nach Ägypten segeln wollte, riet man ihm, vor der Abfahrt unbedingt dem Gott Poseidon ein Opfer zu bringen. Im Tempel gäbe es schließlich eine lange Liste von Personen, die nach einer Opfergabe unbeschadet angekommen waren. Der junge, philosophisch angehauchte Grieche war jedoch skeptisch und überlegte: Um zu wissen, ob eine Opfergabe wirklich etwas bringt, brauche ich eigentlich vier unterschiedliche Listen. Eine Liste von Personen, die etwas geopfert haben und gut ankamen. Eine zweite Liste von Personen, die trotz ihrer Opfergaben ertrunken sind. Eine dritte Liste mit Leuten, die kein Opfer darbrachten und gut ankamen. Und schließlich eine vierte Liste von Seefahrern, die ohne eine Opfergabe ertrunken sind. Erst aus dem Vergleich dieser vier Listen kann ich schließen, ob es sich lohnt, Poseidon ein Opfer zu bringen. Heute ist diese Überlegung in der Statistik als »Chi-Quadrat-Test« bekannt.
Das zeigt: Die griechische Philosophie legte den Grundstein für das, was wir heute als wissenschaftliches Denken bezeichnen.
Einer der wichtigsten und bekanntesten Vertreter der damaligen Zeit war Sokrates. Er spazierte durch Athen und verwickelte die Menschen in endlos lange Diskussionen über den Sinn und Zweck des Lebens, über die Seele, die Tugend oder die Gerechtigkeit. Anscheinend bereitete es ihm eine diebische Freude, buchstäblich alles infrage zu stellen und darüber hinaus seine Gesprächspartner auflaufen zu lassen, wenn sie seiner Meinung nach unsauber argumentierten und sich in Widersprüche verstrickten. Kurzum: Sokrates war ein kluger, aber eben auch ein ziemlich nerviger, politisch unkorrekter Besserwisser. Ein Anarcho im Denken, der den Institutionen Athens mehr und mehr auf den Zeiger ging. Sein Ende ist wohlbekannt. Man klagte ihn an, warf ihm Missachtung der Götter, Verführung der Jugend und Respektlosigkeit gegenüber den Autoritäten vor. Vor Gericht blieb er hart, versuchte sich nicht zu verteidigen, sondern stellte vielmehr die Kleingeistigkeit seiner Ankläger bloß. Danach nahm er klaglos sein Urteil an und trank den tödlichen Schierlingsbecher, was zeigt, dass es kritische Geister mit unorthodoxen Ideen schon immer schwer hatten gegen die Mehrheit derer, die wenig Lust verspüren, den Status quo zu hinterfragen. So gesehen ist Sokrates das erste Opfer der Cancel-Culture.
Als später im Mittelalter die Überzeugung aufkam, dass es so etwas wie physikalische Naturgesetze geben müsse, die unabhängig von einem Gott existieren, war die Kirche erwartungsgemäß nicht besonders begeistert. Papst Johannes der XXI. ließ im Jahr 1276 eine solche Behauptung sogar als Ketzerei definieren. Die Gravitationskonstante hat sich daraufhin bitterböse an ihm gerächt, indem sie ihm ein paar Wochen später das Dach seines Palastes auf den Kopf fallen ließ.
Im 17. Jahrhundert war es dann ein berühmter italienischer Universalgelehrter, der Probleme mit der Obrigkeit bekam. Galileo Galilei behauptete zum Entsetzen der Kirche, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt. (Einige Historiker sind übrigens der Meinung, dass Galilei nicht deswegen Schwierigkeiten bekam, weil er das Weltbild der Kirche infrage stellte, sondern weil er seine Erkenntnisse auf Italienisch statt in Latein veröffentlichte. Es waren anscheinend nicht so sehr die revolutionären Ideen, die den Inquisitoren Kopfzerbrechen bereiteten, sondern ihre mögliche Verbreitung beim Volk.)
Nichtsdestotrotz unterscheidet sich der Fall Galilei fundamental von dem von Sokrates. Der griechische Philosoph wurde wegen seiner unliebsamen Meinungen angeklagt, Galileo Galilei dagegen bekam Probleme, weil er etwas herausfand, das er mit eindeutigen Fakten beweisen konnte. Er beobachtete mit einer neuartigen Erfindung, dem Fernrohr, unterschiedliche Himmelsbewegungen und konnte so unter anderem nachweisen, dass sich der Planet Venus um die Sonne dreht. 1632 veröffentlichte er dazu sein Buch Dialog, in dem er das heliozentrische Weltbild beschrieb, das bereits von Aristoteles und später von Nikolaus Kopernikus postuliert worden war. Die Kirche war darüber »not amused«, weil die Vorstellung, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums sein könnte, den Behauptungen der Bibel entgegenstand. Nach ewigem Hin und Her beugte sich Galilei den kirchlichen Faktencheckern, widerrief seine Hypothese und soll am Ende des Prozesses gemurmelt haben: »Und sie bewegt sich doch …«
Es ist dieses kritische Hinterfragen von angeblich gesicherten Wahrheiten, das Autoritäten suspekt finden. Skeptische Gedanken sind nämlich ähnlich wie Hämmerchen, mit denen man an der Statik der gängigen Überzeugungen klopft. Hält das Weltbild? Oder ist es vielleicht ziemlich hohl und brüchig?
Schon immer reagierten gläubige Menschen beleidigt und verärgert, wenn rational denkende Menschen Elemente ihres Glaubens anzweifelten oder gar ad absurdum führten. Die Bibel ist voll von Personen, die sich nicht brav an die Anweisungen von oben hielten und sich stattdessen ihrer Neugier hingaben, in der Hoffnung, etwas Überraschendes herauszufinden: Eva oder auch Lot. Sie wurden für ihre Neugierde und ihre Skepsis von Gott bestraft.
Auch heute ermuntert kein einziges Glaubenssystem seine Anhänger, die Kerngedanken des Systems in Zweifel zu ziehen. Wissenschaftliche Systeme dagegen tun das. Skeptisch gegenüber den eigenen Ideen zu sein, ist einer ihrer Grundprinzipien. Denn man kann sich nie sicher sein, ob eine Theorie zu 100 Prozent korrekt ist. Aber man kann ihre Behauptungen überprüfen. Man muss sie sogar überprüfen. Ich erinnere mich an eine Semesterparty während meines Studiums, auf der ich mit meinem Astronomieprofessor angestoßen hatte, ohne ihm dabei in die Augen zu gucken. Daraufhin meinte er im Scherz: »Haha, Herr Ebert, jetzt haben Sie sieben Jahre schlechten Sex.« Und er hat recht gehabt! Das habe ich empirisch überprüft. Aber, hey, als Physiker ist man froh, wenn man überhaupt welchen hat …
Zurück zu Galilei. Auch wenn er auf Druck der Kirche seine Ideen widerrufen musste, war die Katze aus dem Sack. Die Entwicklung hin zu mehr Wahrheit war nicht mehr aufzuhalten. Die physikalischen Gesetze kümmert es ohnehin nicht, ob man sie vor einem Tribunal von Bürokraten widerruft. Außerdem waren Galileis Behauptungen sowieso für jeden, der klar denken konnte, nachvollziehbar. Damals wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit das Experiment als Erkenntnismethode etabliert. Es war die Geburt der modernen Wissenschaft.
Einige stutzen an dieser Stelle vielleicht, weil es doch die alten Griechen waren, die die wissenschaftliche Denkweise etabliert haben. Aber das stimmt nicht ganz. Archimedes zum Beispiel hat zwar eine wissenschaftliche Entdeckung gemacht, aber er hat den Weg, wie er zu dieser Entdeckung kam, nie überprüft. Auch Aristoteles war der Meinung, dass man die Zusammenhänge der Natur durch reines Nachdenken ergründen konnte. Die antiken Griechen neigten in ihrer logisch-deduktiven Vorgehensweise dazu, ihre Modelle und Hypothesen von theoretischen Axiomen und Prinzipien abzuleiten, nicht aber von einer experimentellen Überprüfung.
In der griechischen Philosophie gab es keine Doppelblindstudien. Weder Platon noch Sokrates kümmerte sich um Evidenzen, um Falsifizierbarkeiten oder Placebogruppen. So soll Aristoteles der festen Überzeugung gewesen sein, dass Männer mehr Zähne im Mund haben als Frauen. Einfach nachzuschauen war ihm vermutlich viel zu profan.
Die philosophische Elite beschäftigte sich ausschließlich mit geistigen Dingen. Das Machen oder etwas praktisch zu nutzen, galt als vulgär. Im antiken Athen konnte man ein noch so guter Arzt oder ein genialer Architekt sein, in der gesellschaftlichen Rangordnung jedoch stand man trotzdem hinter dem unwichtigsten Philosophen.
Wenn ein antiker griechischer Denker etwas Bemerkenswertes herausfand, kam er in den seltensten Fällen auf die Idee, dieses Wissen auch praktisch anzuwenden. Er redete lieber mit anderen darüber. Auf dem berühmten Fresko der Schule von Athen zeigt Platon nicht aus Zufall in die Wolken. In der griechischen Hochkultur ging es um hochtrabende philosophische Konstrukte, nicht um Umsetzung.
Das soll deren Beitrag zur Geistesgeschichte keinesfalls schmälern. Selbstverständlich kann man durch Logik und theoretische Gedankenspiele zu bedeutenden Erkenntnissen gelangen. Galileo Galilei zum Beispiel wollte wissen, ob Körper mit unterschiedlicher Masse unterschiedlich schnell fallen. Also hat er sich überlegt: Angenommen, ein schwerer Körper fällt schneller als ein leichter. Was passiert, wenn ich beide zusammenbinde? Der neue Körper müsste sowohl langsamer fallen als der schwere, aber auch schneller fallen als der leichte. Da dies nicht möglich ist, ist daraus nur der Schluss zu ziehen, dass beide gleich schnell fallen müssen.
Auch der griechische Philosoph Demokrit, der behauptete, dass es unteilbare Teilchen gibt, die Atome genannt werden, lag mit seiner Vermutung weitgehend richtig. Doch absolut sicher sein konnte er nicht.
Erst im 17. Jahrhundert begannen die Forscher nach und nach Hypothesen und Behauptungen durch Experimente zu überprüfen. Es kam zu einer Annäherung von Theorie und Praxis.
Damals machte der irische Naturforscher Robert Boyle folgenden Versuch: In einer öffentlichen Vorführung setzte er einen Vogel in einen Behälter und saugte die Luft heraus, worauf der Vogel starb. Boyles Schlussfolgerung: »Ich habe ein Vakuum geschaffen.« Die religiösen Menschen im Auditorium sagten: »Das kann nicht sein. Denn Gott ist überall, und in einem Vakuum kann es keinen Gott geben. Also ist ein Vakuum nicht möglich.« Aber Boyle erwiderte: »Blödsinn! Der Vogel ist tot.« Worauf sich unter den tiefgläubigen Herren verständnislose Entrüstung breitmachte. Logik verwirrt Dogmatiker.
Ein paar Jahre später experimentierte der englische Theologe und Chemiker Joseph Priestley abermals mit einem Vakuum. Dieses Mal stellte er eine Minzpflanze unter eine Glasglocke, pumpte die Luft ab und erwartete, dass die Pflanze genauso eingehen würde wie der bedauernswerte Vogel von Robert Boyle. Erstaunlicherweise geschah das Gegenteil. Die Pflanze wuchs und gedieh. Diese Beobachtung führte zu einer der wichtigsten Erkenntnisse in der Biologie: dass Pflanzen bei der Fotosynthese Sauerstoff erzeugen.
Dieses Beispiel führt uns sehr anschaulich vor Augen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse oftmals kontraintuitiv sind. Mit reiner Logik und sorgfältigem Nachdenken kommt man in vielen Fällen nicht sehr weit. Erst die Überprüfung durch ein geeignetes Experiment schafft Klarheit.
Wenn man sich nicht mit Wissenschaft auskennt, denkt man gerne, dass sich die eigene Intuition mit den wirklichen Zusammenhängen deckt. Leider ist fast immer das Gegenteil der Fall. Steckt man beispielsweise einen Strohhalm bündig durch einen Bierdeckel, hält ihn über ein Blatt Papier und pustet hinein, so wird das Blatt nicht – wie man vermuten könnte – weggeblasen, sondern es saugt sich an den Deckel an.
Oder angenommen, man würde ein Band um den gesamten Äquator legen und es dann um einen Meter verlängern, wie hoch würde es über dem Äquator schweben? Ziemlich genau 16 Zentimeter. Wenn Sie’s nicht glauben, probieren Sie es einfach aus.
Lange war es zum Beispiel ein Rätsel, warum Seeleute Skorbut bekamen. Um die Ursache herauszufinden, experimentierten viele herum. Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama zwang seine Männer, ihren Mund mit Urin auszuspülen. Was weder besonders gut gegen Skorbut half noch besonders gut für die Stimmung war. Andere glaubten, Skorbut werde durch unvollständig verdautes Essen ausgelöst. Zum »Beweis« dafür machte der britische Arzt William Stark einen mutigen Selbstversuch. Er ernährte sich wochenlang nur von Wasser und Brot und beobachtete, was geschah. Er starb an Skorbut, ohne hilfreiche Schlussfolgerungen ziehen zu können. Trotzdem widmete er sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes der Wissenschaft.
Der Erste, der in die richtige Richtung dachte, war der britische Marinearzt James Lind. Er machte – wie es sich für einen Wissenschaftler gehört – Versuchsreihen mit an Skorbut erkrankten Matrosen, bei denen er ihnen unterschiedliche Dinge zu essen gab. Damit konnte er zeigen, dass Zitrusfrüchte, aber auch Kartoffeln und Sauerkraut wirksame Mittel gegen Skorbut sind. James Cook setzte 1776 die Ernährungsempfehlung des Arztes als Erster um. Er nahm auf seine Weltumseglung als Proviant Karottenmus und Sauerkraut mit, was eine beeindruckende Überlebensrate seiner Mannschaft zur Folge hatte.
Das zeigt: Die rationale, wissenschaftliche Herangehensweise an verschiedenste Problemstellungen führte nicht nur zu neuen, verblüffenden Erkenntnissen, sie verlängerte sogar Leben.
Als zum ersten Mal unter dem Mikroskop Krankheitserreger sichtbar wurden, war plötzlich klar, dass es eben nicht die rothaarige Nachbarin war, die die Kinder mit Cholera verhext hatte. Das hat sich mittlerweile sogar bis in den Odenwald rumgesprochen.
Die Menschheit hat sehr lange gebraucht, um zur wissenschaftlichen Methode zu finden. Denn richtig betrieben wirft sie permanent Weltbilder über den Haufen und gefährdet Machtstrukturen, weil sie das Wissensmonopol der Obrigkeit infrage stellt. Und das können mitunter Zusammenhänge sein, die völlig harmlos daherkommen.
Isaac Newton hat sich beispielsweise als Erster die harmlose Frage gestellt: Warum fällt ein Apfel nach unten? Das war eine vollkommen absurde Frage, weil man damals der Überzeugung war: »Na ja, das ist eine göttliche Entscheidung … Ein Apfel fällt nach unten, weil das Gott so will!«
Aber es waren Menschen wie Kepler, Newton oder Galilei, die sich mit diesen einfachen Antworten nicht zufriedengegeben haben. Sie und andere haben nach den wahren Ursachen gesucht und so Schritt für Schritt ein Wissen erlangt, das auf Logik, aber eben auch auf Experimenten und Beweisen basierte – und nicht mehr auf Glauben oder Gottvertrauen.
Und wichtig dabei: Sie haben erkannt, dass durch den Erwerb von Wissen die Welt zu einem besseren Ort wird. Zukunft ist nicht das, was uns zustößt, sondern das, was wir aktiv gestalten. Die Idee des Fortschritts war geboren.
Das Penicillin, der Kühlschrank, die Röntgenstrahlen haben unsere Lebensqualität immens verbessert. Noch vor zwanzig Jahren wurde Rudolph Moshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Das wäre heute rein technisch gar nicht mehr möglich.
Vor der wissenschaftlichen Revolution glaubten die Menschen nicht an Fortschritt. Die meisten vormodernen Kulturen dachten, das Goldene Zeitalter läge bereits hinter ihnen und die Menschheit befände sich auf dem absteigenden Ast. Die Wissenschaften räumten mit dieser Vorstellung auf. Denn neben vielen erstaunlichen Entdeckungen und Erfindungen gaben sie den Menschen auch Hoffnung auf ein besseres Leben.
Naturwissenschaft ist die lange Geschichte davon, wie wir gelernt haben, uns nichts mehr vorzumachen. Weil sie Glauben und Bauchgefühl durch Beweise und Fakten ersetzt hat.
Für mich jedenfalls besteht das größte Geschenk der Wissenschaft darin, dass sie uns etwas über den Gebrauch von geistiger Freiheit lehrt. Skeptisch zu sein, kritische Fragen zu stellen und vor allem: Autoritäten nicht blind zu vertrauen.
Parallel zur naturwissenschaftlichen Revolution schwappte diese neuartige faktenbasierte und vernunftgeleitete Sicht auch auf andere Gebiete über. In den Geisteswissenschaften und der Philosophie traten plötzlich Denker auf den Plan wie René Descartes (»Cogito, ergo sum« – Ich denke, also bin ich), Francis Bacon (»Scientia potentia est« – Wissen ist Macht) oder Immanuel Kant (»Sapere aude« – Wage es zu denken). Sie alle stellten die Vernunft und nicht das Gefühl in den Mittelpunkt.
Der britische Philosoph und Skeptiker David Hume beantwortete die Frage, ob es etwas wie Wunder gäbe, ganz im Geiste der Rationalität so: »Die Annahme, etwas sei ein ›Wunder‹«, meinte er, sei »nur dann gerechtfertigt, wenn alle alternativen Erklärungen noch unwahrscheinlicher sind.« Angenommen, Ihr Nachbar behauptet, er hätte einen Königspudel, der sämtliche Arien aus Verdis Aida singen kann. Was ist wahrscheinlicher: Es gibt diesen singenden Königspudel oder Ihr Nachbar hat einen Sprung in der Schüssel? Jeder weiß doch, dass Königspudel ein Faible für Puccini haben.
Nach jahrhundertelangem intellektuellem Stillstand im Mittelalter setzte überall in Europa das kritische, rationale Denken ein. Mehr und mehr distanzierten sich die Menschen von mystischen Erklärungsmodellen und ideologischen Wunschvorstellungen. Eine neue Epoche war eingeläutet, die der Aufklärung.
Das war in dieser Radikalität nur möglich, weil gleichzeitig auch die Kirche immer mehr an Einfluss verlor. Im Zuge der Reformation wurde die Allmacht der Kirche erstmals grundsätzlich infrage gestellt.
Nach jahrhundertelanger Dominanz des Klerus war der Widerstand gegen die religiöse Bevormundung durch den Vatikan zu stark geworden. Nach der Vorstellung von Martin Luther sollte die Beziehung zu Gott für jeden Gläubigen persönlich und individuell sein und eben nicht durch eine autoritäre Amtskirche definiert werden, in der ein Papst die Deutungshoheit über alle religiösen Fragen hat.
Dazu sollten Männer, aber eben auch Frauen, die Bibel selbst lesen und interpretieren können, und so wurde die Heilige Schrift aus dem Lateinischen in die jeweilige Landessprache übersetzt.[10] Durch Luther wurde die Sinnfrage quasi privatisiert: Frei von Bevormundung konnte jeder in seiner eigenen religiösen Bubble leben.
Doch nicht nur das. Parallel zu seiner Bibelübersetzung ins Deutsche begann Luther die Bedeutung von Alphabetisierung und Schulbildung zu predigen. Die historische Verbindung von Protestantismus und Alphabetisierung ist recht gut dokumentiert. Noch Ende des 19. Jahrhunderts lagen in den protestantischen Gebieten die Alphabetisierungsraten mehr als 20 Prozent höher als in den katholischen Regionen. Die Reformation ist also nicht nur eine religiöse Bewegung gewesen, sie war auch ein entscheidender Treiber von Bildung.
Erfolgreich war sie nicht zuletzt deswegen, weil die traditionellen Erklärungsmodelle der Kirche angesichts des wissenschaftlichen Fortschritts immer unglaubhafter wurden. Das, was in der Bibel über die Natur des Menschen, der Erde und des Universums stand, war durch die immer neuen Entdeckungen der Kosmologie, Physik oder Biologie einfach nicht mehr haltbar. Die Kirche konnte sich aus diesem Dilemma nur befreien, indem sie der Bibel ihre Wortwörtlichkeit nahm und stattdessen viele der darin enthaltenen Geschichten nicht mehr als Fakten, sondern als Metaphern darstellte. Dreifaltigkeit, unsterbliche Seele, die Existenz des Teufels, Wiederauferstehung und Erbsünde – all das sind Begriffe, die für moderne, aufgeklärte Christen praktisch keine reale Bedeutung mehr haben und eher im Reich der Fabel angesiedelt sind.