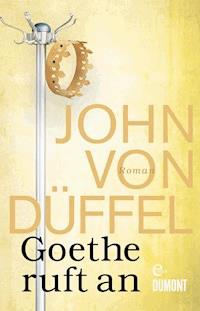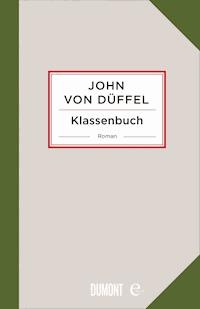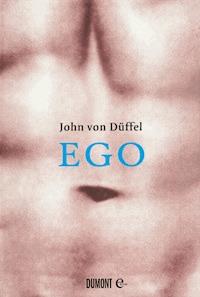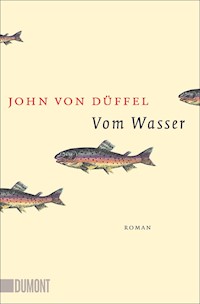8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Worauf kommt es im Leben an? Am Ende sind es die gleichen Dinge, die in ein gutes Buch gehören. Und wie meistert man das Leben? Mit allem, was auch zum Schreiben eines Romans gehört. John von Düffel ist ein dem Leben zugewandter Schriftsteller. Seine Themen, Figuren und Geschichten verfolgt er über den Rand der Buchseite hinaus. In persönlichen Beobachtungen macht er sich nun auf die Suche nach den vielfältigen Berührungspunkten von Literatur und Wirklichkeit, er verknüpft Leben und Schreiben. Die Kunst, Ich zu sagen, ist auf beiden Feldern gefragt, ebenso der Umgang mit Familie, die Bewegung, die verschiedenen Formen von Zeit. Und erstaunlich viele Deutungsmuster aus der Literatur lassen sich auf den ganz privaten Alltag übertragen. Was John von Düffel gelingt, ist nicht weniger als eine Poetik des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
John von Düffel
Wovon ich schreibe
Eine kleine Poetik des Lebens
eBook 2014
© 2009 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Zero, München
Umschlagabbildung: Christian Schoppe
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook: 978-3-8321-8799-6
www.dumont-buchverlag.de
Die Kunst des Ich
Über Leben und Lesen
Identität ist das große Thema unserer Zeit. Das läßt sich ganz einfach beweisen. Bis Ende der 90er Jahre war man als Theaterdramaturg bei Publikumsdiskussionen immer mit einem Stichwort aus dem Schneider, wenn die unvermeidliche Frage kam: »Aber worum geht’s in dem Stück wirklich?« Man sagte einfach: »Faschismus«. Diese Antwort war immer richtig. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Wir leben im 21.Jahrhundert, und wenn man heute als Dramaturg gefragt wird, »aber worum geht’s in dem Stück wirklich«, sagt man: »Identität«. Und alle nicken.
Um Identität kommt man heutzutage nicht herum. Es ist nicht nur ein komplexes, philosophisches Thema, sondern auch ein sehr lebenspraktisches, lebensnahes. Identität ist eine lokale, regionale, nationale Frage in Zeiten der Globalisierung – ein politisch und geschichtlich hochbrisantes Problemfeld. Ich will mich da nicht unnötig einmischen. Ich habe auch keine wasserdichte Identitätstheorie. Was ich vielmehr versuchen möchte, ist eine Art Gedanken- und Erfahrungsbericht aus der literarischen Beschäftigung mit diesem Thema, eine Werkstattbeschreibung zur Frage »Identität«.
Das Thema Identität begegnet einem Autor als erstes in der Frage nach dem Autobiographischen. Diese Frage liegt bei jeder Lesung in der Luft: Wo berühren sich das literarische Erzählen und die persönliche Erfahrung des Autors? Selbst ich, der ich eine literaturwissenschaftliche Ausbildung genossen habe und weiß, daß man diese Frage gar nicht stellen darf, stelle sie natürlich trotzdem. Wenn ich ein Buch lese und es kommt eine abgründige Szene darin vor, ertappe ich mich oft dabei, wie ich mir das Autorenfoto auf dem Umschlag ansehe, die Kurzbiographie lese und überlege: »Na, hat der das erlebt?« Diese Frage nach dem Verhältnis von Erleben und Erzählen stellt sich instinktiv. Ich glaube, sie hat eine uralte Berechtigung, auch wenn Literaturwissenschaftler das nicht gerne hören. Vielleicht liegt es daran, daß das Erzählen von den Großvätern und Großmüttern kommt, die früher am Feuer saßen und Geschichten zum besten gaben. Natürlich glaubten alle, daß sie das, was sie erzählen, auch erlebt haben, oder zumindest jemanden kennen, der es wirklich erlebt hat. Insofern hat Erzählen auch immer etwas mit der Unterstellung von Wahrheit oder besser Erfahrung zu tun. Wer will schon etwas Ausgedachtes, ganz und gar frei Erfundenes hören oder lesen? Das ist ein Punkt, der mich beim Schreiben, aber auch beim Lesen immer wieder beschäftigt, die Frage, wo verbindet sich das Erzählen mit der Erfahrung und der Identität eines Autors, wieviel »Autobiographisches« verträgt ein Text, wann wird er persönlich, wann wird er peinlich, welches Maß an Selbstentblößung und Maskierung ist das richtige?
Unter dem Aspekt der Identität sind aber auch die Einführungen oder Anmoderationen auf Lesungen interessant: Jedesmal passiert sozusagen in Zahlen und Fakten der eigene Lebenslauf noch einmal Revue, und man sitzt als Autor da und hört sich an, wo man Abitur gemacht hat, wann die ersten Bücher erschienen sind etc. Doch all diese biographischen Tatsachen, diese scheinbar unwiderruflichen Eckdaten einer Vita lassen sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise miteinander verknüpfen – zu ganz unterschiedlichen Geschichten. Ich kann dieselben Zahlen und Fakten, die meine Biographie kennzeichnen, sehr verschieden interpretieren. Und das Erstaunliche daran ist: Wenn ich keinen Grund habe zu lügen, sind diese verschiedenen, einander widersprechenden Geschichten, die ich von mir erzähle, alle gleichermaßen wahr. Damit sind wir mitten im Thema »Identität als Fiktion«.
Wie kommt überhaupt eine Verbindung zwischen all diesen Fakten zustande, die wir in unserem Leben anhäufen, all den Zufällen und den vielleicht absichtsvoll herbeigeführten Begegnungen und Umständen? Wie kommt eine solche Verbindung in die Welt, wer stiftet sie und wie real und belastbar ist sie überhaupt? Ich möchte nicht zu allgemein werden, sondern mit einigen ganz persönlichen Beispielen fortfahren – wenn es um Identität geht, muß man unbescheidenerweise von sich selber sprechen. Ich will mir ein paar Daten aus meinem Leben vornehmen, um zu zeigen, wie unterschiedlich man diese interpretieren kann. Erstes Beispiel: meine sogenannte Universitätslaufbahn, die eine der kürzesten im deutschsprachigen Raum sein dürfte. Ich war insgesamt vier Jahre auf der Universität, ein Jahr in Stirling/Schottland, drei Jahre in Freiburg im Breisgau und habe dort sehr schnell in Philosophie promoviert – oder wie es so schön heißt –, ich bin dort promoviert worden. Oft wird bei der Einführung zu Lesungsbeginn hervorgehoben, daß ich mit dreiundzwanzig Jahren Doktor der Philosophie war – und ein Raunen irgendwo zwischen Anerkennung und Bestürzung geht durch den Saal. Tatsächlich ist es aber für mich eine ganz andere Geschichte. Ich bin durch diese Promotion keineswegs zum Akademiker geworden. Eigentlich war sie eine Flucht vor dem Akademischen, eine Flucht nach vorn, gewiß, aber gerade meine kurze Studienzeit weist mich eben nicht, wie vielleicht ein Personalchef denken würde, als den zielstrebigen Superakademiker aus, sondern vielmehr als Nichtakademiker. Das ist zumindest die Geschichte, die ich von mir erzählen würde. Es gäbe auch andere.
In der Chronologie der Anmoderation folgen dann die beruflichen Stationen im Lebenslauf, Übergangsjobs, erste schriftstellerische Gehversuche, Dinge, die man geschafft oder geschaffen hat. Ein Beispiel hierfür wäre mein Debütroman »Vom Wasser«. Das ist ein Buch, auf das ich wahrscheinlich nach wie vor stolz sein kann, doch gleichzeitig ist mir bewußt, daß ich nicht mehr derselbe bin, der dieses Buch geschrieben hat. Wahrscheinlich geht es vielen Künstlern, vielen Autoren so, daß sie zu ihrem Werk keine narzißtisch ungebrochene Liebesbeziehung unterhalten, sondern ein Wechselverhältnis der Anziehung und Abstoßung, der Nähe und Distanz, Identifikation und Fremdheit. Noch heute bekomme ich Anfragen, aus »Vom Wasser« zu lesen, dem Aqua-Klassiker sozusagen, und ich sage mitunter sogar ganz gerne zu, aus einer gewissen Neugier heraus. Ich lese dieses Buch und denke dabei unentwegt: »Ist das wirklich von mir? Und wenn ja, wer war ich, als ich das geschrieben habe?«
Dieser Mensch, der ich damals war, ist mir natürlich noch bekannt, und ich erkenne ihn sozusagen zwischen den Zeilen recht gut, aber ich bin inzwischen ein anderer geworden. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem verhältnismäßig gut informierten Journalisten, der mir vorrechnete, daß ich in zehn Jahren fünf Romane geschrieben hätte, und das, meinte er, sei doch eine recht ungebrochene Produktivität. In gewisser Weise hat er damit recht, doch auch das ist wieder nur eine Lesart, seine Interpretation. Meine Interpretation ist eine ganz andere. In diesen zehn, zwölf Jahren ist sehr viel passiert, für mich persönlich, beruflich und privat, aber auch in meiner Art, die Welt zu sehen. Jedes dieser fünf Bücher ist gewissermaßen von einem anderen geschrieben worden, es war immer etwas anderes, das mich dazu getrieben hat. In dieser Zeit hat sich so viel ereignet, daß es jedesmal einen anderen Erfahrungsstand gab, ein anderes Lebensgefühl, vielleicht auch eine Not oder einen Druck, neu zu schreiben, anders zu schreiben. Es war also keine »ungebrochene«, sondern im Gegenteil eine sehr »gebrochene« Produktivität, soll heißen, die Brüche und Umbrüche in meinem Leben waren gerade das produktive Moment und die Veränderung und Abstoßung von mir selbst die treibende Kraft.
Ich hoffe, diese Beispiele machen klar, wie sehr es darauf ankommt, die eigenen biographischen Daten zu deuten. Wir »lesen« unser Leben – immer wieder neu, immer wieder anders –, wir interpretieren es und kommen zu Schlüssen oder Mutmaßungen darüber, wie es weitergehen soll und kann. Die Art und Weise, unser biographisches Material zu ordnen und in einen Zusammenhang zu bringen, gleicht dem Lesen eines Buches. Wir unterstellen nämlich insgeheim, daß es in der Abfolge der Fakten und Erfahrungen einen »Sinn«, eine autorenähnliche Absicht gibt, wie dieses Leben gemeint ist. Und wir hoffen, daß unser Leben, während es voranschreitet, uns wie das sukzessive Lesen eines Buches der Erkenntnis, wer oder was wir sind, immer näher bringt. Und vielleicht werden wir am Ende unseres Lebensbuches zurückschauen und verstehen, wer wir waren und uns über unsere Identität ein für alle Mal im klaren sein.
Es ist leicht, diese zuversichtliche Lesart des Lebens zu belächeln. Denn natürlich mahnt uns der Existentialismus, das absurde Theater, aber auch der morgendliche Blick in die Tageszeitung, daß dieser »Sinn« nicht existiert, daß unser Leben eben kein Buch ist und auch kein zusammenhängendes Ganzes ergibt. Eine »höhere Absicht«, die »Intention« eines gottähnlichen Autors unserer Lebensgeschichte, ist nicht zu erkennen und gehört heutzutage mehr in den Bereich des Aberglaubens als des Glaubens. Dennoch sind wir meines Erachtens viel zu schnell mit der Äußerung: »Das Leben hat keinen Sinn!« Gerade im Alltag ist diese nihilistische Betrachtungsweise kaum durchzuhalten. Wir stellen ständig Beziehungen zwischen den Dingen her, die uns widerfahren. Wir geben unserem Leben Ordnung und Struktur, versuchen unsere Zeit »sinnvoll« zu nutzen und die »Zeichen« für die Zukunft zu deuten. Unentwegt müssen wir Entscheidungen treffen und können dies nur mit Blick auf einen Sinn, ein Richtig oder Falsch.
Die Semantik des Lebens ist nicht so leicht aus unseren Köpfen zu eliminieren. Sie muß auch gar nicht immer optimistisch sein, im Gegenteil. Auch der Pessimist gibt den Dingen eine Deutung, nur eben eine negative. Insofern schwanken die Interpretationen, die Bewertungen unseres Lebens, und das bisweilen extrem. Zumindest geht es mir so. Wir sind also wieder bei den Beispielen: Wenn ich zurückblicke, an guten Tagen wie heute, wo die Sonne scheint und ich ausgeschlafen habe, dann denke ich, mein Leben ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Immer wieder habe ich im richtigen Moment großes Glück gehabt, und wo nicht, habe ich das Beste daraus gemacht. Doch es gibt auch andere Tage, schlechte Tage, an denen schon das Wetter dagegen spricht aufzustehen, ich habe schlecht geschlafen, quäle mich aus dem Bett, schaffe es mit Ach und Krach unter die Dusche und denke, mein Leben ist eine einzige Geschichte des Scheiterns. All meine Niederlagen fallen mir ein, und die wenigen Erfolge scheinen mir viel zu teuer bezahlt. – Beide Interpretationen meiner Lebensgeschichte, die positive wie die negative, sind wahr. Natürlich entspringen sie einer momentanen Stimmung, dem Gefühl eines Augenblicks, aber man kann jede Erfolgsgeschichte auch als eine Geschichte des Scheiterns lesen, denn hinter jedem Erfolg verbirgt sich auch ein großes Maß an Verzicht oder Verlust, an Opfern, die gebracht wurden, auf eigene Kosten und, schlimmer noch, auf Kosten anderer.
Hierzu ein ganz banales Rechenexempel: Die Zeit, die ich damit verbracht habe, am Schreibtisch zu sitzen, habe ich nicht mit meiner Familie verbracht. Gott sei Dank ist meine Familie, was das angeht, relativ tolerant, bislang, aber falls meine Tochter irgendwann einmal über mich schreibt – ich hoffe zwar nicht, daß es dazu kommt, doch möglicherweise läßt es sich nicht verhindern –, dann kann es natürlich sein, daß sie eine ganz andere Geschichte von meinem Leben erzählt, nämlich die von einem abwesenden Vater und allem, was man mir möglicherweise sonst noch vorwerfen kann. Das wäre dann wahrlich eine Geschichte des Scheiterns, nicht nur aus einer Stimmung heraus, sondern aus gewissen sozialen Verlusten: eine sehr schmerzliche Geschichte, weil sie die Grenzen der eigenen Person übersteigt. Letztlich kann man sein Leben als ein Nullsummenspiel betrachten, denn jeder Erfolg, den man sich auf einem Gebiet erarbeitet, ist mit einem Scheitern oder zumindest mit einer Abwesenheit, einem Ausfall auf einem anderen Gebiet erkauft. Alles gleicht sich wieder aus, wie der Volksmund sagt, und insofern sind große Erfolgsgeschichten auch immer große Geschichten des Scheiterns.
Beide Lesarten des Lebens haben ihre Berechtigung. Wenn man also über das Thema Identität nachdenkt, stößt man sehr schnell auf eine logische Grundfigur, die eine Ausnahmestellung in der Philosophie innehat, auf die Figur des Paradoxons. Es sind Widersprüche, aber Widersprüche in ihrer schönsten Form, nämlich Widersprüche in Bewegung, Widersprüche, die oszillieren. Und das wäre für mich ein erster Anhaltspunkt dessen, was Identität meiner Erfahrung nach ist: nämlich so etwas wie ein Widerspruch in Oszillation.
Ein Verständnis von Identität, das den Widerspruch und die Bewegung mit einschließt, steht allerdings im krassen Gegensatz zum herkömmlichen Konzept von Identität als etwas Festem, Fixem, Unwandelbarem. Diese tiefverwurzelte Vorstellung von Identität als einer festen Größe entspringt einer nicht zu unterschätzenden mentalen Sehnsucht: der Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Mit klaren Zuordnungen und Festlegungen machen wir uns das Leben geheuer. Wir kategorisieren unsere Umgebung, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, und weisen allen Dingen ihren Platz an. Damit schaffen wir Orientierung und Stabilität. Wir definieren andere Menschen unentwegt, lassen uns selber aber ungern definieren. Im Fluß des Lebens erfahren wir äußere Festlegungen, Einschränkungen und Grenzziehungen oft als etwas Künstliches, Schmerzliches oder Unwahres. Wir werden nicht gern in Schubladen gesteckt und wollen auch keine Sätze hören wie: »Das sieht dir doch gar nicht ähnlich! Du bist doch überhaupt nicht der Typ! Also, das hätte ich nun wirklich nicht von dir gedacht!« Wir fühlen uns um unser Recht auf Veränderung gebracht durch jene, die genau zu wissen scheinen, wer wir sind. Wenn man uns auf gewisse Eigenschaften festlegen oder gar reduzieren will, fordert das unseren Widerspruch heraus. Denn jede unserer Eigenschaften steht im Spannungsfeld einer Ambivalenz: Der Fleißige weiß um seine Faulheit, er bekämpft sie, aber er kennt sie als eine Möglichkeit von sich. Und er wäre nicht der Mensch, der er ist, ließe sich logisch ausschließen, daß er ihr irgendwann einmal nachgeben könnte. Sonst wäre sein ganzer Kampf gegenstandslos.
Im Leben sind wir intime Kenner unserer Widersprüche und Ambivalenzen, unserer Eigenschaften und Gegeneigenschaften. Wir spüren, daß jede Definition von uns falsch ist oder zumindest sehr, sehr vorläufig. Dennoch klammern wir uns im Denken an eben solche Definitionen und handeln mit fixen Größen und logischen Ausschließlichkeiten wie mit einer zeitlosen Identitätswährung. Wir zwängen die Dinge in engste Begriffe, tun ihnen Gewalt an und unterstellen noch dazu, daß unsere Grenzziehungen und Unterscheidungen Bestand haben. Es gibt kaum eine stärkere Triebkraft des Denkens als die Sehnsucht nach Eindeutigkeit. Immer wieder überziehen wir die Welt mit einer starren, logischen Ordnung, und dabei erleben wir doch tagtäglich, wie sehr wir uns selber solchen Festlegungen immer wieder entziehen.
Wer über Identität ernsthaft nachdenkt, gerät notgedrungen an die Grenzen der Logik. Aber es wäre wiederum zu einfach, deshalb zu sagen, wir werfen bei diesem Thema jegliche Logik über Bord. Denn die Sehnsucht nach Eindeutigkeit ist zwar kein guter Ratgeber für die Lösung des Identitätsproblems, sie ist aber ein Teil dessen, ein Teil von uns, und gleichzeitig eine elementare Kraft, die unsere inneren Widersprüche zum Tanzen bringt. Trotz aller Sehnsucht nach Eindeutigkeit neige ich zu der Auffassung, daß Identität eine Art von Prozeß ist, ein spannungsgeladener, unberechenbarer, quasi-elektrischer Wirkungszusammenhang von Erfahren und Vergessen, Annehmen und Abstoßen, Mehrwerden und Verlust. Ich glaube, unsere Identität berührt und überschreitet immer wieder ihre eigenen Grenzen, sie schließt die Veränderung nicht aus, sondern ein, sonst wäre sie, wären wir tote Materie. Doch das sind alles Metaphern. An dieser Stelle will ich zunächst nicht mehr sagen, als daß man meines Erachtens gut beraten ist, Identität als etwas in Bewegung Befindliches zu verstehen.
Und damit sind wir schon bei dem Problem von Definition als solcher. Die alten Griechen, Aristoteles insbesondere, haben ein sehr interessantes logisches Problem entdeckt, daß man nämlich Bewegung logisch gar nicht beschreiben kann. Bewegung heißt, daß etwas hier und gleichzeitig nicht hier ist, dergleichen schließt die Logik eigentlich aus. Bewegung stellt die binäre Logik vor erhebliche Probleme, und gerade wenn man sich mit Identität substantiell auseinandersetzt, merkt man sehr schnell, daß diese Logik des Entweder/Oder überhaupt nicht weiterführt. Wie Hegel schon wußte, heißt es in einer komplexen Realität statt Entweder/Oder meistens Sowohl-Als-Auch.
Ich komme wiederum unbescheidenerweise auf mich selber zurück. Ich persönlich würde mich als einen Menschen beschreiben, der eine sehr starke kommunikative Ader hat, ich suche die Nähe zu anderen, den Dialog – nicht nur im Privaten, sondern auch in der kollektiv-kreativen Arbeit als Dramaturg im Theater. Andererseits ist es so, daß ich mir mit dem Schreiben eine der denkbar einsamsten Beschäftigungen ausgesucht oder auferlegt habe. Meine wahrscheinlich wichtigste Tätigkeit ist eine völlig einsame, isolierte und a-soziale. Was charakterisiert mich mehr? In welcher Art von Arbeit bin ich wirklich ich, im Theater oder am Schreibtisch?
Es handelt sich um eine Spielart der ganz alten Frage, die Camus schon gestellt hat, die des »solitär« oder »solidär«. Ist man in seinem Wesen ein einsamer Mensch oder einer, der in Gemeinschaft lebt und die Gesellschaft braucht, ist man ein Familienmensch oder der totale Solist und Einzelgänger? Diese Frage stelle ich mir in meinem Leben immer wieder, es ist ein Widerspruch, der sich nicht ohne weiteres lösen läßt, an dem ich manchmal auch verzweifle. Aber es ist ein Widerspruch in Bewegung: Denn natürlich gibt es Momente, wo der Satz »John von Düffel ist ein einsamer Mensch« zutrifft. Es gibt jedoch genauso Momente, wo der Satz »John von Düffel ist ein sehr sozialer und kommunikativer Mensch« ebenso zutrifft. Und es ist nicht zu entscheiden, wer oder was ich »eigentlich« bin. Man kann diesen Widerspruch nicht einfach auflösen, indem man sagt: »Sicher, er kann sehr kommunikativ und sozial sein, aber in seinem innersten Wesen ist er einsam.« Denn ich habe schon sehr oft die schmerzliche Erfahrung gemacht, daß diese Einsamkeit ein Messer ist, das mich von allem abschneidet, auch von der Kraft und Quelle meiner Kreativität. In der Isolation der schriftstellerischen Arbeit bin ich schon unzählige Male gescheitert, an eine absolute Grenze gestoßen. Ein »Leben im Schreiben«, von dem Ingeborg Bachmann einst träumte, ist mir zumindest nicht möglich. Und ich komme immer wieder an den Punkt, an dem ich mir sage, »der Mensch wird vom Menschen bewegt, ich lebe und arbeite, indem ich mit anderen lebe und arbeite«. Insofern ist das Gegenteil vielleicht viel richtiger, und das Schreiben ist »eigentlich« und »in seinem Wesen« eine Tätigkeit, die sich aus dem Miteinander, der Wechselwirkung des Erlebens und Erzählens, des Teilens und Mitteilens in Gemeinschaft speist. Gerade das scheinbar so einsame Schreiben ist möglicherweise »solidär« …
Ein anderes Beispiel. Als ich angefangen habe zu schreiben, galt ich unter den Autoren als eine Art Paradiesvogel, weil ich Schwimmer bin, Langstreckenschwimmer von Haus aus, überhaupt ein Sport liebender Mensch. So etwas gehört sich nicht für einen Autor. Autoren und Sport, das geht nicht zusammen. Aus diesem Vorurteil spricht das alte Bohemedenken, daß ein Künstler ohne zwei Schachteln Zigaretten und anderthalb Flaschen Rotwein pro Tag kein Künstler ist. Inzwischen hat sich das Bild sehr gewandelt. Wenn man in Hamburg einen Autor treffen möchte, geht man nicht ins Café oder gar in die Bibliothek, man stellt sich an die Alster und wartet, bis er vorbeigelaufen kommt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, ob sich der joggende Dichter sozusagen schon globalisiert hat und dieser Trend zur körperlichen Ertüchtigung bei Autoren verallgemeinerbar ist, aber er zieht schon erstaunliche Kreise. Ich habe einen guten Autorenfreund, Christoph Peters, der fast zeitgleich mit mir debütiert hat. Er war, was seine Lebensweise angeht, immer das genaue Gegenteil von mir, sozusagen der Prototyp der Rotweinfraktion, ein leidenschaftlicher Trinker und schwerer Raucher, der morgens vor 10 Uhr nicht ansprechbar war. Vor kurzem habe ich ihn wieder getroffen, und das war ein Schock. Er ist durchtrainiert wie ein Ruderer und macht jeden Morgen eine Dreiviertelstunde Gymnastik bei offenem Fenster. So kann es kommen.
Die Liebe zum Sport und das Schreiben stehen aber – da hatte die alte Boheme ganz recht – auch in einem starken Widerspruch. Mit den anderthalb bis zwei Jahren reiner Schreibzeit, die ich für einen Roman benötige, beginnt eine Phase der rigorosen Selbstdisziplinierung zum Stillsitzen – im ständigen Konflikt mit dem Drang des Sportlers, sich zu bewegen, seine Gliedmaßen zu gebrauchen, sich zu verausgaben. Es ist ein Kampf gegen die eigene Natur, ein Akt der Selbstbeherrschung und -verleugnung. Am liebsten würde ich nur draußen sein, mich unablässig bewegen – wenn ich etwas von Natur aus nicht bin, dann ein »Stubenhocker« –, doch ich muß diesen lebendigen Drang unterdrücken. Was aussieht wie die gemächliche Ruhe am Schreibtisch, ist tatsächlich ein permanentes Sich-Niederringen, Niederzwingen. Stillsitzen ist für mich eine einzige exerzitienartige Qual, die Position der maximalen inneren Unruhe, wo Bewegungsdrang und Erzählambition in einem kaum erträglichen Spannungsverhältnis zueinander stehen und einen enormen Druck aufbauen – bis zu dem Moment, in dem ich es wirklich nicht mehr aushalte und loslaufe, losschwimme.
Auf einen wesentlichen Teil von mir trifft sicherlich die Bezeichnung »Naturbursche« zu. Aber ich bin auch Theatermensch und schreibbedingter Stubenhocker wider Willen. Insofern arbeite ich tagtäglich im Spannungsfeld des uralten Widerspruchs zwischen Natur und Kunst. Das spielt auch hinüber auf die inhaltliche Ebene. Meinem ersten Roman »Vom Wasser« merkt man die Nähe zur Natur, zu gewissen Landschaften und Flüssen unschwer an. Das hat mit Romantik und Naturschwärmerei nichts zu tun. Diese Landschaften sind einfach ein Teil von mir, ihre Flüsse, Seen, Meere haben mich geprägt.
In »Vom Wasser« habe ich mich nicht entblödet, seitenweise Naturbeschreibungen abzuliefern, zu einer Zeit, als die sogenannte Popliteratur sehr hoch im Kurs stand. Ich habe es gewagt, dieser starken Anziehung nachzugeben, auf die Gefahr hin, mich vor meinen Autorenkollegen lächerlich zu machen als der Wald- und Wasserschrat unter den Schreibern. (Vielleicht waren diese Naturbeschreibungen auch eine gewisse Art literarische Ersatzhandlung – Kompensation für das lange Stillsitzen am Schreibtisch.) Doch ich hätte es von mir selber nicht gedacht, bis ich mit dem Schreiben dieses Buches anfing.
Für einen Theatermenschen ist das Naturthema verpönt. Als Dramaturg halte ich mich fast ausschließlich in abgedunkelten Räumen auf, in der totalen Künstlichkeit des Theaterbetriebs. Ganz zu Beginn hatte ich die sehr schlechte Idee, die Geschichte von »Vom Wasser« als Theaterstück zu erzählen, aber über die Elemente der Natur läßt sich schwerlich Theater machen. Man kann einen Roman von Adalbert Stifter lesen und stundenlang in Naturbeschreibungen schwelgen, aber im Theater hört Natur nicht nur auf zu sein, sie ist nicht einmal als Illusion zu haben. Wenn ich an einem sonnigen Tag wie heute zur Probe müßte und abends vielleicht noch eine Vorstellung zu begleiten hätte, wäre das einmal mehr ein Tag, an dem ich mich zerrissen fühle. Es ist nicht so, daß diese Widersprüche sich so einfach auflösen ließen im Wohlgefallen des Sowohl-Als-Auch.
Die Endlichkeit unser Zeit stellt uns immer wieder vor die Alternative: Entweder/Oder. Wir können nicht alle unsere Möglichkeiten gleichzeitig und auch nicht gleichermaßen verwirklichen. Angesichts der vielen Widersprüche, die in einer Biographie stecken, stellt sich daher die Frage: »Was prägt oder formt einen Menschen? Wieso kommt diese Möglichkeit zur Entfaltung, während jene verkümmert?« Nehmen wir den Fall auseinanderstrebender Begabungen oder Talente – die meisten Menschen sind nicht nur zu einer Sache begabt, sondern haben unterschiedlichste Interessen. Als ich Abitur gemacht habe, wurde mir eine Auszeichnung für meine Leistungen in den Naturwissenschaften verliehen. Inzwischen bin ich nicht einmal in der Lage, meine Steuererklärung selbst zu machen, weil ich nicht mehr dividieren kann. Diese Möglichkeit meiner selbst ist also verlorengegangen. Ich hatte mal eine mathematische Begabung, inzwischen beherrsche ich kaum noch das Einmaleins, so kann es kommen. Was wäre, wenn ich das Talent gehabt hätte, einer der besten deutschen Skifahrer zu werden, während mein Lebenslauf es nun einmal unglücklicherweise mit sich brachte, daß ich in der Norddeutschen Tiefebene aufgewachsen bin, wo Erhebungen von hundert Metern schon Berge heißen. Vielleicht hätte ich der beste Skifahrer der Welt werden können, und ich hab’s nicht gemerkt.
Wie also kommt eine Anlage, die Begabung eines Menschen zur Entfaltung, und warum diese und nicht eine andere? Diese Problematik verschärft sich in einer hochspezialisierten Arbeitswelt wie der unseren besonders, weil das Konzept einer universellen Bildung und Ausbildung immer weiter in den Hintergrund tritt zugunsten eines einseitigen Expertentums, polemisch gesagt, einer hochentwickelten Fachidiotie. Die Wahl der Ausbildung, des Studienplatzes etc. wird zu einer Lebensentscheidung, man setzt Prioritäten, andere Interessen werden vernachlässigt oder auf die Ebene des Hobbys herabgewürdigt. Gerade bei der Ausbildungs- und Berufswahl steht man immer wieder vor der Frage: »Ist das, was mir jetzt widerfährt, ist diese biographische Möglichkeit, die sich vor mir auftut, Zufall oder Schicksal, sprich, folgt sie einer inneren Notwendigkeit?«
Es gibt Scheidewegssituationen im Leben, wo dieser Konflikt zu einer Zerreißprobe wird. Ich hatte zum Beispiel nach meinem Volkswirtschaftsstudium eine Phase, in der ich glaubte, als Homo oeconomicus tätig werden zu müssen. Ich fing an, für eine Wirtschaftsagentur in Eschborn bei Frankfurt zu arbeiten, wo im Grunde außer Geld nichts gemacht wird. Drei Wochen war ich dort tätig, dann wußte ich, das ist ein Irrweg. Man kann natürlich im Leben nur eine begrenzte Anzahl dieser Irrwege beschreiten, und es ist jedem zu wünschen, daß er irgendwann eine Tätigkeit findet, die ihm – und jetzt kommt ein sehr wichtiges Wort! – »entspricht«. Dieses Gefühl der Entsprechung ist wie eine Antwort auf die immer wieder ans Leben gestellte Frage: Wer bin ich?
Es ist vielleicht keine Definition, aber doch bezeichnend für die Identität eines Menschen, daß er das Gefühl hat, das Richtige zu tun: ganz persönlich für sich das Richtige zu tun. Und es ist keineswegs selbstverständlich, daß man sich in Lebensumständen bewegt, von denen man sagen kann: Sie entsprechen mir. Dieses Gefühl der Entsprechung ist nicht losgelöst oder ausgenommen von dem Prozeßhaften der Identität, denn es kann sich auch schnell wieder ändern. Es gibt durchaus Tätigkeiten, von denen man das Gefühl hat, sie entsprechen mir jetzt, in dieser Phase meines Lebens, aber vielleicht hören sie irgendwann auf, das Richtige für mich zu sein – weil sie für die eigene Entwicklung ausgereizt sind oder sich in der Wiederholung erschöpfen. In meinem neuesten Roman »Beste Jahre« erzähle ich die Geschichte eines Schauspielers, der in starken Konflikten mit seiner Familie, vor allem mit seinen Eltern, seinem Vater gelebt hat, doch diese Konflikte verschwinden aus seinem Leben. Das Vater-Sohn-Problem hört auf, sein Problem zu sein. Er spürt, wie langsam das Dramatische, der Sturm und Drang, das sexuelle Begehren, die Haßgefühle und Feindbilder seiner Jugend verschwinden hinter einer sehr angenehmen Gelassenheit, einem verständnisvollen Zurücklehnen und Betrachten des Lebens. Das heißt, er gerät von einem dramatischen in einen epischen Zustand und das, was ihm all die Jahre entsprochen hat, was seine primäre Ausdrucksform war, nämlich das Theaterspielen, entspricht ihm auf einmal nicht mehr. Auch in dieser Hinsicht leben und erleben wir Identität als etwas Prozeßhaftes, das sich verändern, verwandeln kann und, wie die alten Griechen sagten, »im Fluß« ist.
Ich habe mir persönlich drei Definitionen oder Auffassungen von Identität zurechtgelegt, um meine Gedanken und Beobachtungen zu diesem Thema zu sortieren. Sie haben sich zu verschiedenen Zeiten als hilfreich erwiesen, ich kann aber leider nicht entscheiden, welche die absolut Richtige ist. Vielleicht gibt es auch keine »ewig wahre« Definition, und Identität ist immer wieder etwas anderes.
Die erste nenne ich die starke Definition von Identität. Es handelt sich um das Identitätskonzept, das bei Aristoteles angelegt ist und auf den Gedanken der »Entelechie« zurückgeht. Gemeint ist, daß es ein dem Menschen innewohnendes »telos« gibt, ein Ziel im Leben, gepaart mit der Energie und Kraft, es zu erreichen, also das zu werden, was man im Kern schon immer ist. Mit anderen Worten: Jeder Mensch hat eine Bestimmung, und wenn sich nicht alle Umstände dagegen verschwören oder man sich in Irrtümern verzettelt, dann erfüllt sich diese Bestimmung auch. Demnach hat unser Leben eine Richtung und seinen sinnhaften Kern in uns, den zur Entfaltung zu bringen unsere Lebensaufgabe ist – im wahrsten Sinne des Wortes –, denn es ist uns vom Schicksal und gemäß einer inneren Notwendigkeit aufgegeben, dieses oder jenes zu werden.
Es gibt durchaus Momente im Leben, in denen man das Gefühl hat, einer solchen Bestimmung zu folgen, so als habe man es nicht mit einer Aneinanderreihung von Zufällen, sondern mit einer höheren Schicksalsmacht oder inneren Notwendigkeit zu tun. Manchmal fühlt man sich geführt und spürt mit Gewißheit: »Daß mir das jetzt passiert, ist kein Zufall!« Diese Art und Weise zu denken kommt uns als Sinnstiftern unserer eigenen Biographie sehr entgegen. Gerade in Liebesdingen glauben wir leidenschaftlich gerne, daß es Menschen gibt, die »füreinander geschaffen« sind. Daß wir diese Frau oder diesen Mann heiraten, eine Familie gründen, dieses Kind bekommen usf., das kann doch kein Zufall sein?!
Das menschliche Gehirn ist eine Sinnmaschine. Im Prinzip sind wir ohne Unterlaß damit beschäftigt, in allem, was uns widerfährt, einen Sinn zu erkennen. Wir suchen unentwegt nach einer Antwort auf die Frage: Warum passiert mir das jetzt? Insbesondere bei Unfällen oder Katastrophen. Man denke an den klassischen Verzweiflungsausruf: »Warum mir das?« Wir wollen immer wissen, warum. Was ist der Grund dafür, daß ausgerechnet mir das passiert. Und wir bestehen geradezu darauf, daß es diesen Grund gibt, selbst wenn es sich um »reines Pech« oder »dumme Zufälle« handelt. Wir weigern uns hartnäckig, die Sinnlosigkeit eines Unfalls zu akzeptieren, so wie wir in einem Roman die Dramaturgie des Zufalls nicht gelten lassen. Es muß doch eine tiefere oder höhere Absicht geben!