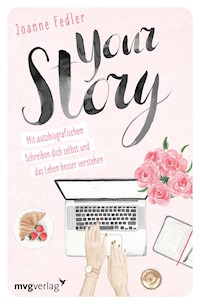6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem beeindruckenden und unter die Haut gehenden Roman "Wovon wir nicht sprechen" erzählt SPIEGEL-Bestsellerautorin Joanne Fedler ("Weiberabend") die Geschichte einer Liebe in Zeiten von Angst und Gewalt. Dramatisch, anrührend und mit großer Empathie verarbeitet Fedler in "Wovon wir nicht sprechen" auch ihre eigenen Erfahrungen als engagierte Rechtsberaterin für Frauen in Südafrika. Die 34-jährige Heldin Faith ist fast schon am Leben zerbrochen: Nicht nur hat sie ihre Jugendliebe viel zu früh an eine heimtückische Krankheit verloren, ihr Job verlangt der empathischen jungen Frau auch so viel mehr ab, als ihr selbst bewusst ist: Denn Faith betreut Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Als eine ihrer Klientinnen trotz Faithʼ Einsatz von ihrem Mann ermordet wird, verliert Faith auch das letzte Zutrauen in sich und die Welt. Erst die Begegnung mit dem Tierarzt Caleb, dessen ruhige, geduldige Art so wohltuend anders ist, lässt sie erkennen, dass auch in ihrem Herzen noch immer ein helles Licht leuchtet. Ein außergewöhnlicher Roman, der Mut macht und Trost spendet, der die Liebe als Chance auf Nähe, Glück und Geborgenheit feiert, selbst in einer Welt, die von Lieblosigkeit, Kälte und Brutalität geprägt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joanne Fedler
Wovon wir nicht sprechen
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Dahmann
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die 34-jährige Faith ist fast schon am Leben zerbrochen: Nicht nur hat sie ihre Jugendliebe viel zu früh an eine heimtückische Krankheit verloren, ihr Job verlangt der empathischen jungen Frau auch so viel mehr ab, als ihr selbst bewusst ist: Faith betreut Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, und versucht nach Kräften, ihnen zu helfen. Als eine ihrer Klientinnen trotz Faiths Einsatz von ihrem Mann ermordet wird, verliert Faith auch das letzte Zutrauen in sich und die Welt. Erst die Begegnung mit dem Tierarzt Caleb, dessen ruhige, geduldige Art so wohltuend anders ist, lässt sie erkennen, dass auch in ihrem Herzen noch immer ein helles Licht leuchtet.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Nonna brachte mir das [...]
1 Scheren
2 Vogel
3 Taschentücher
4 Libelle
5 Spinne
6 Zauberei
7 Polaroid
8 Ecke
9 Pitbull
10 Lächeln
11 Usambaraveilchen
12 Blut
13 Das Medaillon
14 Laken
15 Umschlag
16 Kerzen
17 Katze
18 Ratte
19 Nagellack
20 Traum
21 Zähne
22 Zucker
23 Kuss
24 Eimer
25 Engel
26 Wurm
27 Memo
28 Leiter
29 Apfelkuchen
30 Baby
31 Notizen
32 Epitaph
33 Nudelholz
34 Affe
35 Pillen
36 Geist
37 Glöckchen
38 Regen
39 Anakonda
40 Eier
41 Stufen
42 Narzissen
43 Burgunder
44 Umhang
45 Schublade
46 Zeitschrift
47 Zirkus
48 Rosinen
49 Beil
50 Apfel
51 Buch
52 Elefant
53 Einkaufen
54 Kuchen
55 BH
56 Süßstoff
57 Reizung
58 Socken
59 Steine
60 Fernglas
61 Nacken
62 Skalpell
63 Bruder
64 Kaugummi
65 Zaun
66 Nüsse
67 Prinz
68 Koffer
69 Schweiß
70 Königin
71 Loch
72 Seide
73 Suppe
74 Abgrund
75 Spritze
76 Popcorn
77 Alibi
78 Schaum
79 Windschutzscheibe
80 Mythos
81 Strand
Danksagung
Anhang: Was bedeutet ein Name?
Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die still hinter verschlossenen Türen leiden.
Euer Leiden hat einen Namen.
Und es gibt eine Tür in ein besseres Leben.
»Wenn ein Mensch mehr weiß als andere, wird er einsam.«
Carl Jung
»Sieh deine Wunden an. Dort wird das Licht eindringen.«
Rumi
Nonna brachte mir das Lesen bei.
Mein erstes Buch war aus Sperrholz und hatte Bilder, neben denen Wörter standen.
Nonna zeigte auf die Buchstaben neben dem Bild von einem Haus: H-au-s.
Sie zeigte auf die Buchstaben neben einem Vogel. Vo-gg-ell.
Weil sie einen starken italienischen Akzent spricht, lernte ich, Englisch mit italienischem Akzent zu lesen.
»Nonna – bin ich, deine Großmutter. Faith – bist du. Überall, wohin du schaust, hoch, runter, rechts, links, haben Dinge Namen.«
»Warum müssen alle Dinge Namen haben?«, fragte ich.
»Sonst wie sollen wir wissen, was sie sind? Dinge brauchen Namen zum Varrstehen. Damit wenn du fragst nach fiore, Blume, dann ich dir nicht bringe ragno, Spinne.« Und sie ließ ihre neun Finger krabbeln wie die Beine einer Spinne.
»Aber ich mag Spinnen«, sagte ich zu Nonna.
»Ja, aber eine Spinne ist nicht eine Blume.«
»Was ist mit den Dingen, die keinen Namen haben?«, fragte ich. »Wie die Farbe von gestern, oder die Dinge, die wir vergessen?«
Nonna hielt sich die Hand mit den vier Fingern vor den Mund, als wollte sie damit verhindern, dass ihr eine Wahrheit herausrutscht. Dann lächelte sie kurz, ehe sie mir antwortete:
»Diese Dinge existieren nicht. Und wenn sie es tun, dann sind sie dimenticato. Verloren.«
1 Scheren
Ich hätte heute Morgen im Bett bleiben sollen, anstatt meinen mageren Hintern ins Büro zu bewegen, bei all dem, was mich da erwartete.
Klar ist es nicht meine Schuld, dass Priscillas Schwester mit einer Schere erstochen wurde. Aber ich hätte mir wenigstens etwas Nützliches dazu ausdenken sollen.
Priscilla auf dem Stuhl hinter meinem Schreibtisch, die Rotz und Wasser in ihren Ärmel heult, Freitagfrüh gleich zu Arbeitsbeginn – das ist es, was meinen Job so anstrengend macht. Ich muss mir immer etwas Nützliches ausdenken. Die Hinterbliebenen wollen keinen Trost von mir. Trauer ist wie ein abgeriegelter Tatort, Durchgang für Unbefugte nicht gestattet. Menschen, die unter Schock stehen, suchen nicht nach Sinn, also ist es am besten, die Philosophie außen vor zu lassen. Ich bin immer für nützlich. Dem, was geschehen ist, einen Namen geben. Den nächsten Schritt planen. Klare Fakten gehen nicht verloren; auch wenn die Zweifel wie ein Tsunami darüber hinweggefegt sind, kann man sie noch lange danach an derselben Stelle wiederfinden, wo sie verschüttet wurden. Dann beginnen die Leute nach Goldklümpchen, zerbrochenen Muscheln und Glasscherben zu suchen. Nach allem, woran sie sich klammern können.
Auch ich gehöre unglücklicherweise zu den Dingen, an die sich die Menschen gerne klammern. Ich bin Faith Ava Roberts, gesetzliche Beraterin bei SISTAA. Das steht für »Sisters in the Struggle Together to Alleviate Abuse«, also »Schwestern im gemeinsamen Kampf gegen den Missbrauch«, und ist ein ziemlich langer Satz für Frauen, die eine aufgeplatzte Lippe oder einen gebrochenen Kiefer haben.
Mein Schreibtisch in diesem kleinen Zimmer, das auf der Südseite der SISTAA-Räume liegt, hat weder Inspiration noch Trost zu bieten. Er wurde gebraucht gekauft und ist mit riesigen Kaffeeflecken, Kugelschreiberkritzeleien und ein paar unverständlichen Einritzungen überzogen (mal abgesehen von dem »du kannst mich mal«, das ich kürzlich auf der Unterseite entdeckte, als ich bei dem Versuch, eine Gottesanbeterin in eine leere Papiertuchbox zu bugsieren, auf allen vieren herumkroch). Dieser Schreibtisch könnte so manche Geschichte erzählen. Der Spendeneingang für die Arbeit, die ich mache, ist spärlich und kommt immer überraschend, wie eine Wüstenblume oder ein leuchtender Käfer. Und ist das Geld dann da, ist man erst mal völlig benommen, weil einem all die Dinge einfallen, die damit vielleicht möglich wären. Neue Schreibtische stehen nicht oben auf der Liste, dafür brauchen wir immer Matratzen, Windeln und Cremes für Babys in Frauenhäusern. Aber ich will mich nicht beklagen (Nonna sagt, das ist absolut onnwürdig) – es ist ein normaler funktionaler Schreibtisch, auf dem rechts eine Papiertuchbox und einer dieser weichen Antistressbälle liegen. Links sind drei Schubladen, die ich für mein Reserve-Asthmaspray, meine Stifte, einen Hefter und eine Schere benutze; Letztere versuche ich gerade gedanklich aus der Abteilung »tödliche Waffe« wieder ins Fach »Schreibtischutensilien« zu schubsen.
Schere. Gewinnt gegen Papier, verliert gegen Stein. Meine Schwester Libby und ich haben das früher gespielt, um zu entscheiden, wer das letzte Stück türkischen Honig bekommt. Immer dreimal. Ich habe sie jedes Mal gewinnen lassen. Wie man das als große Schwester eben tut.
Meine Nagelschere liegt irgendwo unten in meiner Tasche, denn wenn ich Nonna besuche, schneide ich ihr immer die Finger- und Zehennägel. Sie ist blind und behauptet, es sei schwierig zu unterscheiden, wo der Nagel ende und die Haut beginne. Dazu nur zwei Dinge: Alte Menschen brauchen Berührung, auch wenn sie nur die Nägel geschnitten kriegen. Außerdem macht es überhaupt keinen Sinn, mit Nonna zu streiten.
Mal angenommen, du hast deine Sachen schon immer nach einem eigenen, merkwürdigen System sortiert, zum Beispiel deine CDs in alphabetischer Reihenfolge, die DVDs aber thematisch; oder du hast dir angewöhnt, vor dem Essen immer erst an allem zu riechen, auch wenn du nicht weißt, was du beim Schnuppern eigentlich erwartest – das weißt du erst, wenn du es gerochen hast. Oder du studierst immer ganz genau die Inhaltsstoffe auf jeder Packung, damit du nicht leichtfertig irgendwelche Teile von Tieren isst, die nur an die Tiere selbst drangehören. Oder du denkst bei »Schere« immer gleich an »Papier«. Und dann kommt jemand daher und schmeißt dir diese ganze Ordnung über den Haufen. So dass dir im Kopf alles durcheinandergerät. Schnell, und völlig unerwartet, wie ein Blinddarmdurchbruch, oder wie wenn jemand mit der Floskel beginnt: »Leider muss ich Ihnen mitteilen …« Dann steckst du in deinem Gedankenchaos drin, unfähig, eine Schere jemals wieder so zu betrachten wie früher.
Auf meiner Seite des Schreibtisches steht mein Drehstuhl, der drei volle Umdrehungen schafft, wenn man ihm einen anständigen Schubs gibt und im Schneidersitz sitzt. Auf der Besucherseite sind zwei Stapelstühle aus Plastik nebeneinandergestellt, an die Wand ist ein altes Sofa geschoben mit einem dunkelblauen Überwurf, der die ausgeblichenen und fadenscheinigen Armlehnen verbergen soll. Direkt neben meinem Drehstuhl steht ein Aktenschrank, in dem wir alle Dokumente und Berichte in alphabetischer Ordnung verwahren. Wie gesagt: alles nichts Aufregendes.
Mein Schreibtisch – also mein Büro – wirkt wahrscheinlich deprimierend (und dieses Wort verwende ich keineswegs leichtfertig, wenn ich den Zustand meiner depressiven Freundin Carol bedenke). Wobei die Frauen, die hier hereinkommen, bis hin zu den dunkelblauen Blutergüssen unter ihren Augen sowieso schon tief in der Scheiße stecken. Wer hier durch die Tür kommt, hat mit Depression wahrscheinlich die geringsten Probleme. Dabei musst du nur aus dem Fenster schauen, um ein Stück Himmel zu sehen, die Geduld uralter Bäume, das ständige Sirren des Ökosystems, nichts ist da zu klein oder zu unbedeutend. Und dann das Meer … freche Wellen, die dich dusslig klatschen und auf dem ganzen Weg zurück darüber lachen. Draußen bist du Teil des großen Ganzen. Das Innere, mit seinen Wänden, den geschlossenen Türen und Wartezimmern bringt die Fröhlichkeit zum Ersticken.
Glücklicherweise haben wir Barbara, die an der Rezeption sitzt, ein strahlender menschlicher Jasminstrauch mit der Fähigkeit, die knallharten Gesetzmäßigkeiten in unserem Job zu unterbrechen, als da sind: Gebrochene Schienbeine, zerbrochene Träume. Gebrochene Rippen, zerbrochene Herzen. Kein Ort, an dem zwischendurch mal ein bisschen Freude aufkommt. Ganz anders als auf den Kinderstationen im Krankenhaus, wo immer irgendwelche Geschichten an die Wände geklebt sind, von Alice im Wunderland, von Pippi Langstrumpf oder vom kleinen Häwelmann, der in seinem Kinderbettchen zum Mond fliegt. Um vergessen zu machen, dass man an eine Dialyse angeschlossen ist oder auf eine Herztransplantation wartet. Oder dabei ist, an Mukoviszidose zu sterben, wie Joshua, der fast siebzehn Jahre alt geworden wäre. Nicht, dass Josh den Wandschmuck bemerkt hätte. Er war zu sehr auf meinen nichtexistenten Busen konzentriert. Carol behauptet, meine Idee, ihm zum sechzehnten Geburtstag meine Jungfräulichkeit zu schenken, sei der »Gipfel an armseligem Helfersyndrom, ganz zu schweigen von der Negierung jeglicher Romantik«. Aber ich bedaure das nicht. Was ist schon Romantik. Doch nur eine optische Illusion, bestenfalls eine Stimmung.
Ich erkläre Priscilla, dass wir in unserer Gewalt-gegen-Frauen-Arbeit das, was ihrer jüngeren Schwester Sanna geschehen ist, die zwei Kinder hatte (von neun Monaten, noch ein Stillkind, und vier Jahren, mit allen Milchzähnen), »Femizid« nennen. Priscilla nickt. Ich merke, dass diese Information ihr gerade nicht sonderlich nützt. Im Augenblick jedenfalls. Aber später vielleicht. Wenn Sanna in ihrer Erinnerung verblasst ist, wie es uns mit allen Verstorbenen passiert, und zu einem Teil der Geschichte wird, die Priscilla von ihrem Leben erzählt. Zu einem Erzählfaden, der sie zu anderen, vergleichbaren Geschichten führt, wenn sie ihm folgt. Dann wird sie begreifen, dass ihre Schwester eine von Tausenden war. Teil der Opferstatistik, ein kleines Rädchen in der Maschinerie der Gewalt zwischen den Geschlechtern. Aber wie soll man einer Frau sagen, dass ihre Schwester nur ein Rädchen ist? Manchmal muss man gerade solche Erkenntnisse für sich behalten.
»Warum?«, fragt sie mich. »Warum?«
Darauf antworte ich nicht. Die Frage war auch nicht direkt an mich gerichtet. Und die Antwort wäre auf jeden Fall zu unpersönlich, zu grausam.
Wenn du siebzehn bist und dir verzweifelt ein Date wünschst, dann sagt deine eigene Mutter so etwas wie: »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg«, und wählt die Nummer von Ron Hadley. Und Ron, der idiotischerweise die Valentinskarte, die er dir vor drei Jahren geschickt hat, mit »Dein heimlicher Verehrer Ron Hadley« unterschrieben hat, wofür du ihn seither mit Gleichgültigkeit strafst, antwortet ihr mit atemlosem Eifer, dessen Ursache nicht Asthma sein kann: »Sehr gern!« Zwar hoffst du, dass er nicht versucht, dich mit seinen Froschlippen zu küssen (nicht dass du irgendetwas gegen Amphibien hättest, ganz im Gegenteil), aber zumindest hast du jetzt eine Lösung gefunden. Ist das so viel anders als die Lösung mit der Schere, wenn einer jemand anderes unbedingt davon abhalten will, ihn zu verlassen?
Leute wie ich haben immer Schubladen für das Desaster: Verstorben. Multipler Missbrauch. Anhängiges Verfahren.
»Warum?«, fragt Priscilla wieder. Das macht dich traurig. Ist aber nichts Neues, es wiederholt sich. Ich könnte ihr sagen, dass häusliche Gewalt wie Rauchen und Trinken ist. Könnte ich, mache ich aber nicht, denn ihre Schwester ist erst seit siebenunddreißig Stunden tot. Es ist wie bei schlechten Angewohnheiten. Wenn sich da überhaupt etwas tut, dann nur graduell. Wie bei der Erderwärmung. Gewalt gegen Frauen wird nicht so bald aus der Mode kommen. Ganz anders als meine Schuhe, die, wie meine Schwester Liberty es ausdrückt, mir wirklich »keinen Gefallen tun«. Die sind ziemlich abgeschabt, die Absätze sind schief gelaufen und ich habe sie schon mehrfach kleben müssen. Vielleicht wirken sie ein wenig abstoßend. Libby meint, dass ich niemals ein Date kriege, wenn ich nicht begreife, dass der erste Eindruck eine entscheidende Rolle spielt und dass Mokassins so out sind wie die Bucks Fizz. Dann denke ich an Sannas Schuhe. Sie stehen jetzt in ihrem Schrank, ausgetreten nach dem genauen Maß ihrer Füße mit dem gesenkten Spann und allem anderen, bis sie in den Kleidersack kommen oder von einer Angehörigen benutzt werden, die keine Aversion gegen den Fußgeruch verstorbener Verwandter hat.
Priscilla trägt acht Zentimeter hohe Absätze an ihren dunkelbraunen Hush Puppies, die sie nicht aus dem Winterschlussverkauf eines Billigmarktes haben kann. Eher die Art Schuhe, wie die Mutter von Josh, Mrs. Miller, sie trug. Ich sehe Priscilla an und frage mich, ob Sanna und sie dieselbe Schuhgröße haben, so dass ihr die Schuhe ihrer Schwester passen. Und ich merke, dass ich hoffe, es möge so sein. Aber Hoffnung gehört nun wirklich nicht zu meinen Aufgaben.
Ich schicke Priscilla ein kleines trauriges Lächeln, wie man sie für die Mr. Williamse dieser Welt reserviert, die mit ihren Krücken vor dem Café an der Ecke sitzen und denen man zwei Dollar hinwirft, um klarzustellen, wer hier die Almosen verteilt. Das passende Lächeln dazu habe ich auf der Kinderstation im Krankenhaus perfektioniert. Josh hob dann seine Sauerstoffmaske an, um reden zu können, und sagte: »Komm mir nicht mit diesem Lächeln, Faith …« Ich wurde jedes Mal rot, wobei der hellrote Fleck in meinem Nacken anfing und von da bis über meine sommersprossigen Wangen kroch. Denn Josh hatte mich dabei erwischt, wie ich trauerte, noch bevor er gestorben war. Aber dieses Lächeln brauche ich, weil es in meiner Arbeit keine schnellen Antworten gibt, keine rasche Heilung und keine Zaubertricks. Meist kann ich nichts anderes als Schadensbegrenzung leisten. In den Scherben suchen. Eine Art fehlgeleiteter Privat-Archäologie.
Hier bei SISTAA ist unsere Aufgabe nur das Anbieten von Unterstützung und Rat. Reparieren und heilen sollen unsere Klientinnen sich eigentlich selbst. Theoretisch. Denn die meisten kommen, um gerettet und erlöst zu werden. Wer sich die Zeit nimmt, das Schild an meiner Tür zu lesen, der liest dort »Rechtsberatung«, nicht »Erlösung«. »Erlösen« ist in meinem Lebenslauf unter besonderer Berufserfahrung nicht verzeichnet. Ebenso wenig übrigens wie übersinnliche Fähigkeiten, denn das ist nichts, womit man wirbt. Wenn die Leute es aber herausfinden, dann stellen sie immer so blödsinnige Fragen wie »Soll ich meinen Ehemann verlassen?«, »Werde ich jung sterben?« oder »Können Sie auch Lottozahlen?«.
Ich bin vierunddreißig-und-unverheiratet (was, auch wenn meine Mutter mich immer so vorstellt, nicht mein zweiter Vorname ist). Mit einem Null-Karriere-Job. Für die vierunddreißig kann ich nichts – wir werden alle älter. Unverheiratet bin ich aus eigenem Entschluss, doch macht mich das offensichtlich in den Augen der zivilisierten Welt zu einer Art Alien, wahrscheinlich zu einer Lesbe. Glücklicherweise zählt sowieso nur die Meinung von Nonna, und die interessiert sich nur für eins, nämlich, dass ich sesso sfrenato (geilen Sex) haben möge, auch wenn es sesso prematrimoniale wäre. Habe ich aber nicht. Und was meinen Null-Karriere-Job angeht, so sah das vor acht Jahren, als ich hier anfing, noch ganz anders aus. Ich hätte auch meinen Vertrag in der Anwaltskanzlei Bergeron-Turcotte verlängern können. »Sie könnten bei uns Sozius werden, Mrs. Roberts«, hatte mir Edward Turcotte, ein Wichtigtuer im Nadelstreifenanzug mit blassem Schweißbart auf der Oberlippe, aus seinem Schreibtischsessel heraus bedeutet. »Wenn Sie Ihre Karten richtig ausspielen …« Und ich schwöre, er hat mir dabei zugezwinkert.
Nonna nennt das die Zuflüsterungen Gottes. Die sind üblicherweise mit Ärzten verbunden, mit Telefonanrufen zu nachtschlafender Zeit, ab und zu auch mit einem Sarg. Aber ein Zwinkern tut es auch. Als ich da in meinem gebügelten Hosenanzug vor Edward Turcotte stand, setzten sich das schicke Büro mit der teuren Einrichtung, die Memos zur Kleiderordnung und die abfälligen Bemerkungen über »hysterische Klientinnen« plötzlich zu einem klaren Bild zusammen, wie diese 3-D-Bilder, die man ewig anstarrt, und wenn man schon meint, einem Schwindel aufgesessen zu sein oder Augenkrebs zu haben, springt das Hologramm plötzlich aus dem Bild raus, zusammen mit der Berechtigung, alle Leute, die es nicht sehen, blöde zu nennen. In diesem Augenblick wusste ich, dass es mehr Sinn und Würde hat, Pferdemist auszufahren, als in einer Anwaltskanzlei Karriere zu machen, wo ein Lächeln »Ich kriech dir in den Arsch für jeden Cent, den du hast« bedeutet und den alleinigen Zweck hat, teure Restaurantbesuche oder ein BMW-Cabrio zu erwirtschaften.
Dad war ein wenig erschrocken, als ich die Kanzlei verließ. Nach zweiundvierzig Jahren bei der Golden-Life-Versicherung ist die Devise »Was schiefgehen kann, geht schief« über die Jahre zu so etwas wie dem abgewetzten Lieblingsohrensessel seines Seelenheils geworden. Ich kann nicht sagen, was für ein Mensch er war, ehe der Tod sich wie eine Perserkatze in unser Wohnzimmer einschlich und es sich dort wohnlich machte, bis er überall seine Haare verteilt hatte, ob hier nun jemand allergisch dagegen war oder nicht. »Ich hasse meinen Job«, erklärte ich. »Aber das geht doch außer deiner Mutter jedem so«, gab Dad zurück. »Arbeit muss keinen Spaß machen, denn sonst würde man sie Spaß nennen und nicht Arbeit.« Zufriedenheit im Job ist nicht das Wichtigste im GZD. Im »Großen Zusammenhang der Dinge«.
Ein Abstieg von einem fünfstelligen zu einem vierstelligen Gehalt ist »unverantwortlich und töricht«, meinte Dad sanft, womit er mir auf seine Art seinen Segen gab.
Ich hatte dieses dumpfe Gefühl, dass es mein Ding wäre, Menschen zu helfen. Das war mein erster Fehler. Bei SISTAA »helfe« ich nicht, sondern »erleichtere den Leuten ihren Umgang mit dem Unglück«. Dieser Ort ist ein Hospiz für das menschliche Herz, und die Schmerztherapie begleitet eher den Vorgang des Sterbens als das, was noch vom Leben übrig ist. Aber es war ein ehrenhafter Fehler. Abgesehen davon gibt es gerade mal so viel Geld dafür, wie eine alleinstehende Person, die keine Drogen- oder Spielprobleme hat, braucht. So sieht es jetzt aus.
Ich denke, wenn man die Alternativen betrachtet, ist mein Job bei SISTAA gar nicht so übel. Ich habe ein eigenes Büro. Mein Chef zwinkert mir nicht zu. Und mein Hefter klemmt weder, noch bohrt er sich unentschlossen nur durch einen Teil der Seiten, die ich ihm unterschiebe. Lachen Sie bloß nicht – mit Tod und Tragödie können wir alle umgehen. Es sind diese kleinen Dinge, an denen wir verzweifeln.
Der härteste Teil meines Jobs ist, den Frauen begreiflich zu machen, dass sie für sich selbst verantwortlich sind. Deshalb liegt ein Antistressball auf meinem Schreibtisch herum, und meine Fingernägel sind bis aufs Nagelbett heruntergekaut. Meine Klientinnen sind alle verdammt hilflos. Auch wenn ihr Leben davon abhinge, wären sie nicht in der Lage, eine Liebesgeschichte mit Happy End zustande zu bringen.
Mir fällt ein, dass ich alle Kontaktdaten von Priscilla abfragen muss, ehe sie heute geht. So hoffe ich, zumindest zu einer persönlichen Geschichte für unsere Hinterbliebenenaussagen zu kommen. Eine Schwester, die über ihre ermordete Schwester berichtet, ist ohne Frage ein Knüller, ganz gleich, von welcher Seite man es betrachtet.
Ich wiederhole das Wort Femizid. Ich biete es Priscilla an wie etwas, das sie an die Hand nehmen sollte. Doch das nimmt sie nicht wahr, wie eine Mutter, die vor postnataler Depression ganz gefühllos ist. Und wie ein vernachlässigter, ungeliebter Säugling zuckt und zappelt Priscillas Schmerz herum. Wenn ich nur die richtigen Worte in ihrer Muttersprache finden könnte. Aber ich kann nicht mal »mein herzliches Beileid« auf Somalisch sagen, oder was immer es ist, was sie in Somalia sprechen. Jedenfalls hat es das Erlernen dieser Sprache erstaunlicherweise noch nie auf meine To-do-Liste geschafft.
Die Haut auf meinem Gesicht spannt. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich heute Morgen Gesichtswasser benutzt habe. Die vergangenen zwölf Stunden sind verschwommen. Ich greife an meine Wange und spüre ein Stückchen trockener Haut. Ich versuche es abzuzupfen, aber ich habe keine richtigen Nägel. Also rubbele ich es irgendwie ab.
Draußen ist Herbst, und das erzähle ich Ihnen jetzt, weil ich auf der Website gelesen habe, dass ich mich auf etwas konzentrieren soll, was mich glücklich macht, wenn ich wieder den Drang verspüre, auf den Fingernägeln herumzukauen. Und der Herbst, der seine Blätter herumflattern lässt wie aus der Gefangenschaft befreite Schmetterlinge, macht mich ebenso glücklich, wie er andere Menschen traurig macht. Josh mochte den Herbst. Er meinte, der Herbst würde etwas Wirkliches über das Leben ausdrücken. Das Loslassen. Die Schönheit vor dem Winter. Josh hat gewissermaßen sein ganzes Leben lang in einem Herbst verbracht.
Ich schaue aus dem Fenster in die herbstlichen Zweige, als Priscilla ihren Kopf auf meinen Tisch legt.
Ich möchte über den Tisch greifen und die Akte wegnehmen, auf die sie weint.
Doch die Erfahrung hat mich ein paar Dinge gelehrt. Also lasse ich das.
2 Vogel
Es war ein Mittwoch.
Trauer hat ihre ganz eigene Erinnerung.
»Faith hat ein untrügliches Gedächtnis für kleine Details«, pflegte meine Mutter zu sagen. Manchmal denke ich, wir wachsen in die Beschreibungen unserer Mütter hinein, so wie wir in die Kleider hineingewachsen sind, die sie zu groß für uns gekauft haben.
Ich hatte gerade meinen ersten Zahn verloren und nicht damit gerechnet, dass das so ein Schock wäre. Aber wenn man einen Teil des eigenen Körpers verliert, ist man im Begriff zu verschwinden. So fuhr ich mit meiner Zunge in die seltsame neue Lücke zwischen meinen Zähnen und musste an Nonnas verlorenen kleinen Finger denken und wie sie ihn wahrscheinlich vermisste – als ich das Vögelchen fand. Es war aus einem Nest im Baum über mir gefallen. Ein schwarz und blau gefärbtes Vogelkind mit einem deformierten Flügel, den es sich vielleicht beim Fallen gebrochen hatte. Zitternd barg ich es in meinen Händen. Sein Herz flatterte, ein sanftes Kitzeln des Lebens in meiner Handfläche. Ich brachte es ins Haus, wo meine Mutter gerade Libby stillte, und fragte sie, ob wir das Vögelchen zum Tierarzt bringen könnten.
»Ich bin jetzt mit dem Baby beschäftigt«, sagte sie. Ich bettelte. Sie schüttelte den Kopf.
»Es wird sterben, wenn wir nichts tun«, flehte ich.
Ihre Hand griff mit fester Faust in meinen handgestrickten roten Pullover, auf den Nonna sowohl blaue als auch gelbe Schmetterlinge gestickt hatte, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche ich lieber mochte, und zog mich so nah zu sich heran, dass ich in das nach Mandarine und Geißblatt duftende Eau de Cologne eintauchte, das Dad ihr immer zum Geburtstag schenkte. Es brannte sich förmlich in meine Geschmacksknospen ein. Sie zwang mich, ihr in die Augen zu sehen, und mit einer Stimme, die mir Gänsehaut verursachte und meine Eingeweide zum Schleudern brachte wie Kleider in einer Waschmaschine, sagte sie, selbst wenn wir es täten, würde der Vogel doch niemals überleben. Hatte erst ein Mensch das Vögelchen berührt, dann würde die Mutter es zurückweisen und töten.
Ich wusste, dass sie log. Ich sagte ihr, eine Mutter würde niemals ihr eigenes Baby töten. Jedenfalls eine richtige Mutter nicht. Höchstens eine Stiefmutter, wie die böse Königin in Schneewittchen. Sie drückte fest mein Handgelenk und sagte mir, ich sei zu klein, um ihr zu widersprechen; wenn ich später mal auf der Universität gewesen sei und selbst eine Familie gegründet hätte, dann würde sie diese Diskussion nur zu gern wiederaufnehmen. Ich hätte das Vögelchen jedenfalls besser draußen gelassen. Ich brachte es dann raus, aber nur, weil ihr Schluchzen mich erschreckte, vor allem dieses tief aus der Kehle hervorkommende Zittern. Am nächsten Morgen lag das Vögelchen tot da, an derselben Stelle, wo ich es hingelegt hatte. Es lag auf dem Rücken, die kleinen Beinchen wie Babyfäuste eingerollt. Sie half mir, es zu begraben. Eine Wiedergutmachung mit dem Schaufeln von Erde. Aber sie sagte kein einziges Mal »Hab ich doch gesagt«.
Da habe ich begriffen, wie tödlich Liebe sein kann.
Manchmal können wir für das, was wir lieben, nichts Besseres tun, als ihm nicht zu nahe zu kommen.
3 Taschentücher
Ich werde Priscilla nicht auf Seite 67 unseres Diensthandbuchs hinweisen, in dem es heißt:
»Die gefährlichste Zeit in einer gewaltbetroffenen Beziehung ist, wenn die geschlagene Frau sich entschließt, den Mann zu verlassen. Wenn der gewaltbereite Mann begreift, dass sie es ernst meint, sind die Verletzungen, die er ihr zufügt, oft tödlich. Man nennt diesen Tatbestand Trennungsgewalt.«
Zum einen ist dieses Handbuch nur für uns gedacht. Und zum anderen ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um die Dynamik der Gewalt zu erläutern. Man muss wissen, wie eine Situation zu beurteilen ist, und dann die passende Hilfe anbieten.
Ich habe das durchaus kommen sehen. Schließlich habe ich Nonnas »Gesicht« geerbt, das sich in Magenkrämpfen äußert und einer Stille, die so absolut ist, dass sie in meinen Ohren kreischt. Die Bücher aus der New-Age-Ecke nennen so etwas Vorahnung. Doch wenn man nicht mit den Kräften eines Superhelden begabt ist und durch die Luft sausen, jemanden aus den Klauen des Bösen reißen oder über die Zeitgrenzen schießen kann, um dann mal eben die Uhr zurückzudrehen, dann ist es ein schales und eigenartiges Gefühl, schon im Voraus zu wissen, was für ein Ende etwas nimmt. Ziemlich sinnlos. Wie seine Zunge zu einer Blüte falten oder sich wie ein chinesischer Akrobat die Füße um den Kopf legen zu können. Hätte ich die Wahl gehabt, würde ich mich stattdessen bestimmt für Körbchengröße C entschieden haben, wenn man mal bedenkt, wie viel leichter es ist, mit Oberweite ein Date zu bekommen.
Die Regeln der SISTAA-Beraterinnen stellen klar, dass das Personal bestimmte Grenzen nicht überschreiten darf. Wir senden keine Truppen aus, wie zum Beispiel die Regierung in den Irak. All diese jungen, fähigen, sexuell verfügbaren Männer, die ihr Leben riskieren – und wofür? Das ist wahrscheinlich genau das, was Genevieve meint, wenn sie sagt, das einzig Gute am Patriarchat sei, dass es als Modell dafür dienen kann, wie etwas nicht funktioniert. Wir dürfen Klientinnen nicht unsere persönliche Handynummer oder unsere Adresse zu Hause geben. Jeglicher Kontakt mit Klientinnen muss über den SISTAA-Pieper geschehen, der jedes Wochenende wie ein elektrischer Aal von Hand zu Hand geht. Man kann sich darauf verlassen, dass das Ding immer zwischen zwei und vier Uhr früh losgeht, wenn die Männer betrunken nach Hause stolpern. Das ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was man den Reiz dieses Jobs nennen würde.
Es ist uns nicht erlaubt, das Professionelle persönlich werden zu lassen, denn das wäre nicht gut für uns. Und für unsere Klientinnen auch nicht, denn es »erzeugt Co-Abhängigkeit« und »verringert letztlich die Wirksamkeit der SISTAA-Arbeit«. Aber für mich ist es auch nicht gut, so schlecht wie ich mich gerade fühle. Mir ist heiß, und ich bin gereizt. Meine Haut fühlt sich an wie ein Surfanzug, aus dem ich mich nicht rauswinden kann, weil der Reißverschluss klemmt. Ich greife in meine Schublade und hole mein Asthmaspray heraus.
»Entschuldigung«, sage ich zu Priscilla und inhaliere tief. Und wieder.
Priscilla bemerkt es nicht. Sie ist von Trauer ausgezehrt, was, wie ich gleich sagen kann, ausgesprochen narzisstisch ist. Seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, vor sieben Tagen nämlich, als sie Sanna hierherbrachte, um eine Platzverweisung zu erwirken, ist ihr Gesicht abgemagert und von den Augen verschluckt worden.
»Sie hat es gewusst«, beginnt sie, »sie hat gewusst, dass er sie umbringen würde. Das hat sie mir immer wieder gesagt. Auch an dem Tag, als wir hier waren, hat sie gesagt: ›Dieses Stück Papier wird ihn nicht aufhalten können, im Gegenteil, er wird wütend sein und mich fertig machen.‹«
Ich nicke. Die Platzverweisung hatte es dem Freund untersagt, sich der Frau auch nur auf hundert Meter zu nähern.
Ich erinnere mich deutlich, wie Sanna (deren voller Name Sanna Najma Leta lautete, ein Drei-Wort-Gedicht, das sanft von ihrer Zunge rollte) auf dem Sofa an der Wand saß und sagte: »Er wird mich umbringen«, und dabei leise weinte. Priscilla hatte einen Arm um ihre Schulter gelegt und sie innig schützend umarmt, ohne zu wissen, dass ihre Schwester beim nächsten Mal, wenn sie sie umarmen würde, bereits in Totenstarre eingefroren und ihr Gesicht zur Unkenntlichkeit zugerichtet sein würde. Vorahnungen sollten mit leuchtenden Post-it-Zetteln markiert werden. Nicht zu verwechseln mit vagen Unterleibskrämpfen, die ihre Ursache genauso gut in einem soliden prämenstruellen Syndrom haben können.
Unsere Statistik zeigt, dass nur eine von zweihundert Klientinnen, die mit dem Tode bedroht werden, wirklich in echter Gefahr ist. Männer, die Gewalt gegen Frauen ausüben, sind Schläger, haben aber meist nicht das Zeug zum Mörder. Der Satz »Er wird mich umbringen« ist in den meisten Fällen so gemeint, wie wenn unsereiner sagen würde: »Ich habe ganz vergessen, meine Schwester zurückzurufen – die wird mich umbringen!« Übertreibungen, so dramatisch sie klingen, sind selten verlässlich. Ich muss die Tatsachen klar vor mir haben, um die Schlägertypen von den Psychopathen unterscheiden zu können. Und ich hoffe immer auf Schlägertypen. Die Psychopathen verursachen mir schlaflose Nächte.
Sannas Geschichte hört sich genauso an wie die jeder anderen missbrauchten Frau:
– J. hat S. in den vergangenen Jahren mehrmals vergewaltigt (mindestens fünf Mal, ihrer Erinnerung nach; keine Anzeige wegen Vergewaltigung erfolgt)
– S. mit gebrochenen Rippen ins Krankenhaus eingeliefert (Juni letzten Jahres)
– S. erstattet Anzeige wegen Gewalttätigkeit, zieht sie zwei Tage später aufgrund von Drohung von J. wieder zurück
– J. hat S. beschuldigt, »mit anderen herumzuficken«, hat S. gegen eine Glasscheibe geschleudert, ihr die Nase gebrochen und ihr Gesicht verletzt (Dezember letzten Jahres)
– keine Anzeige erfolgt
– S. wurde mit inneren Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert, erlitt eine Fehlgeburt (Mai dieses Jahres)
– keine Anzeige erfolgt
Es ist alles aufgelistet – die ansteigende Kurve der Gewalttätigkeiten, Fraktale eines Konflikts in perfekt gesteigerten Proportionen. Dieses Syndrom besitzt geradezu eine Art von Eleganz, wie eine Spirale oder die Springflut. Wir hatten nur eine Chance, nämlich den einzigen Faktor auszuschalten, über den wir Kontrolle hatten: die Gelegenheit.
Ich habe Sanna mehrfach gewarnt, sie müsse, sobald sie die Platzverweisung in Händen halte, das Haus verlassen und bei ihrer Schwester wohnen. Sie zog bei Priscilla ein. Doch dann (und hier bringt es nichts, über Geschehenes zu lamentieren oder auf unser Diensthandbuch hinzuweisen) ging sie nach Hause zurück, um ein paar ihrer Sachen zu holen. Sie nahm an, er sei bei der Arbeit. Und ging ohne Polizeibegleitung.
Trotzdem. Es ist immer hart, eine Klientin zu verlieren. Das passiert uns nicht oft. Wenn es in einem Jahr mehr als eine Handvoll ist, dann war das ein schlechtes Jahr.
Mein Vater hatte vor einiger Zeit eine große Versicherungssumme für eine Mine ausgezahlt. »Wie Spaghetti«, hatte der Gewerkschaftsvertreter gesagt. Diese Worte haben sich in meinem Kopf verhakt, wie eine scheußliche Eselsbrücke, die man für eine Prüfung erfindet und dann niemals wieder loswerden kann, egal, wie sehr man sein Gehirn auch schüttelt. Das Fahrstuhlseil war gerissen, und der Fahrstuhlkorb sauste unter der Erde ein paar Kilometer nach unten, so dass die Körper der zwölf Grubenarbeiter, als er schließlich am Boden aufschlug, »wie Spaghetti« durch das Drahtgitter des Korbs gequetscht wurden. Mein Dad zuckte nur mit den Achseln. »So was passiert«, sagte er.
Berücksichtigt man dieses »So was passiert«, dann muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass man seine Arbeit sorgfältig getan hat. Und das habe ich. Ich habe persönlich Mr. Mahmod auf dem Amtsgericht angerufen. Wir haben eine sehr eng angelegte Platzverweisung ausgearbeitet. Ich weiß, dass sie zugestellt wurde, denn ich habe eine Kopie des Zustellungsbescheids durch den örtlichen Sheriff in meinen Unterlagen. Wir haben einen Ausstiegsplan aus der Beziehung durchgesprochen, und ich habe für den Notfall einen Platz im Frauenhaus für sie besorgt, und zwar ab … genau, ab morgen, was eine gewisse Ironie hat. »Ironie« bedeutet in meinem Arbeitsbereich meist, dass es eine Leiche gegeben hat oder ein anderes schlimmes Ende. Vorige Woche waren alle Frauenhäuser belegt. Ja, vielleicht war sie Priscillas Schwester, aber für jeden anderen war sie eben nur ein Name auf einer Liste. Ich habe in ihre Akte mit dicken roten Buchstaben geschrieben: »Kontrolle dringend erforderlich«. Nun liegt diese Akte auf meinem Tisch und blickt mich an. Wenn Papier höhnisch sein könnte, würde es jetzt gemein grinsen. Wer es gern symbolisch hat, für den bilden die Worte, die ich in Rot schrieb, eine blutige Spur zu mir. »Dringend«. Es ist mir klar, wie schwach dieses Wort die stete Präsenz des Todes vermittelt. Ich schwöre, beim nächsten Mal zu schreiben: »Er wird sie umbringen«, auch wenn Genevieve einen Wutanfall kriegt, wenn sie das sieht. Sie hat es ziemlich mit der Professionalität, was manchmal bedeutet, das Bedürfnis, das so verdammt Offenkundige auszusprechen, besser zu unterdrücken.
Das Problem mit Statistiken ist, dass es immer mal wieder jemanden trifft, die »die eine« ist, bei »einer von zweihundert«.
Ich schlucke. Kopfschmerzen machen sich hinter den Augen bemerkbar. Aber man kann einen in Trauer befindlichen Menschen nicht drängen. Nicht wegen Koffeinentzugs. Man muss einfach warten.
Priscilla berichtet mir, dass der Leichnam ihrer Schwester aus einer fötalen Position befreit werden musste. »Ihre Hände bedeckten ihren Kopf …«
Ich höre zu. Es ist ein Teil meines Jobs, den Schrecken entgegenzunehmen, als wäre er ein Wechselbalg mit einer abscheulichen Verwachsung. Und es dann im Arm zu halten, einfach weil es ein menschliches Wesen ist und ich darum gebeten wurde, das zu tun. Eine muss es ja tun. Klärende Worte sind gut und notwendig. Und eine Überprüfung der Glaubwürdigkeit unerlässlich. Nicht dass die Frauen lügen würden. Neugieriges Herumschnüffeln ist allerdings nicht gefragt. Einiges muss man einfach wissen, anderes würde nur die Monster unterm Bett dick und fett werden lassen. Krankmachende Neugier ist ein Hai, der aus dem Wasser schießt und Stücke aus dir herausreißt. Du kannst dir lange vormachen, dieses Tier gezähmt und in den sicheren Hafen deiner Psyche gebracht zu haben, doch irgendwann musst du dir eingestehen, dass es dein eigener Hai ist. Er ist weder aus dem Nichts gekommen, noch hat er sich durch irgendeine Barriere durchgebissen. Er kommt aus dir selbst, nicht aus irgendeiner wilden Unterwelt, von der du versehentlich verschlungen wurdest.
Auf der Suche nach Inspiration lasse ich den Blick durch mein Büro schweifen, aber das einsame Poster mit der Aufschrift »Echte Männer missbrauchen keine Frauen« wirkt im Augenblick fast höhnisch. Nackte Wände wären besser, aber dazu hatte es schließlich dieses Memo von Genevieve gegeben.
Das wurde rumgeschickt, nachdem eine Innenarchitektin, die sich Anna Kay Li nannte, ihre schweren Parfümschwaden auf unseren heruntergekommenen Fluren verbreitet hatte. Wir weisen nur selten das Angebot eines kostenlosen Services ab, auch wenn der direkte Nutzen für unsere Klientinnen nicht immer klar ersichtlich ist. Es gibt Menschen, die haben mehr guten Willen als Gehirnzellen, wenn es ums Helfen geht. Sie hatte orientalische Augen, die von schwarzem Haar umrahmt waren, wie bei einer Bollywood-Schönheit. Ich musste ihr hinterherlaufen, als sie auf Stiletto-Absätzen über unsere Gänge klapperte, in einem Stakkato, das mir Kopfschmerzen verursachte, wie nach einer Portion Eis, die man zu schnell gegessen hat. Sie roch nach Honigmelone, reif wie der Sommer.
»Oh, mein Gott! Sie müssen! unbedingt! die Gitter von Kühlschrank und Regalen entfernen! Das ist ja wie im Gefängnis hier!« Selbst ihre Pausen waren gespickt mit Ausrufezeichen.
»Verzweifelte Menschen klauen, und unsere Klientinnen gehören zu den ganz Verzweifelten.« Genevieve hat einen Hang zur verbalen Ökonomie, wenn es ums Austauschen von Nettigkeiten geht.
»Hmmmmmm!« Sie kratzte sich die Wange mit ihren Nägeln, die – vielleicht täusche ich mich ja auch – aussahen, als wären Diamanten aufgeklebt. »Wie wäre es mit ein paar bunten Bändern?«
»Nicht gut. Zu leicht zu durchschneiden.« Genevieve schielte auf ihre Armbanduhr.
»Ich weiß, wo man ein paar großartige! bunte! Fahrradketten kaufen kann, es gibt sie in Lavendel, Barbadosblau und Hot Pink … Ist Hot Pink nicht einfach umwerfend?!«
Meine Schwester Libby wäre begeistert.
Genevieve zuckte die Schultern. »Okay, von mir aus.«
Und dann: »Wir müssen etwas mit den nackten Wänden machen! Da fühlt man sich so trostlos – und noch mehr missbraucht!«
Am nächsten Tag ließ Genevieve ein Memo rumgehen, das uns anwies, jede Wand mit »etwas Hellem und Inspirierendem« zu versehen. Carol hängte sogleich ihr Lieblingsposter von Annie Sprinkle auf, »101 Gründe, Sex zu haben«, unter anderem mit den Punkten:
• Sex bringt dich zum Lachen.
• Sex ist ein Antidepressivum.
• Sex heilt einen Asthmaanfall.
• Sex ist eine gute Tat. Schenk den Bedürftigen ab und zu einen gnädigen Fick.
Das Poster hing nicht mal vierundzwanzig Stunden, dann bestand Genevieve darauf, dass sie es wieder abnahm, und schrieb ihr eine Abmahnung wegen »provokativen Verhaltens« – ihre dritte Abmahnung in diesem Jahr. Aus Protest lässt Carol ihre Wände jetzt kahl. Ich hatte ein großes Poster aus dem National Geographic mit einer Trichternetzspinne aufgehängt, was Genevieve zu der Frage veranlasste: »Und in welcher Weise soll das missbrauchte Frauen inspirieren?« Deshalb liegt es jetzt eingerollt und mit einem Gummiband versehen im Schrank, ich habe es durch das übliche SISTAA-Poster in Grundfarben ersetzt. Aber man muss keinen Abschluss in Psychiatrie oder Feng-Shui haben, um zu wissen, dass man damit keine Preise in der Kategorie »politisch korrekte Muntermacher« erringt. Nicht an einem Tag wie diesem, wo dir die Toten im Kopf herumgeistern.
Ich nehme meinen Block vom Tisch und beginne Notizen zu machen. Das ist ein Reflex, der mir hilft, zu verarbeiten, aber vielleicht, wer weiß, vielleicht werden diese Fakten auch in irgendeiner Weise Bedeutung für die Anklageschrift haben. Ich schreibe Priscillas Namen in die linke obere Ecke. Mehr fällt mir nicht ein. Stattdessen kritzele ich eine astracantha minax hin, eine australische Radnetzspinne, die wirklich zu den schönsten Lebewesen überhaupt gehört, mit ihrem kleinen Ring von schwarzen Stacheln und gelben, weißen und schwarzen Flecken. Als würde die Natur hier so richtig dick auftragen wollen.
Plötzlich spüre ich, wie mein ganzes Gerüst zusammenbricht. Meine Arbeit ist beendet. Der Sieger steht fest: Sannas Freund mit der Schere im Schlafzimmer. Das hat so etwas Finales. Ich kann die Rücklauftaste nicht mehr drücken. Ich kann Sanna nicht wieder unversehrt machen oder sie zurückbringen. Ich kann nicht einmal mehr die Regeln der SISTAA missachten und ihr die ausziehbare Couch und frisches Bettzeug in meinem Wohnzimmer anbieten.
»Du hast alles getan, was du konntest.«
Diese Nachricht habe ich mehrmals abgespielt. Die Stimme von Genevieve auf meinem Anrufbeantworter klang fest. Äußerst professionell.
In Wirklichkeit hat sie gesagt: Vergiss, was du über das Rechtssystem weißt und den Wert, den das Leben einer alleinstehenden Frau (und dazu einer dunkelhäutigen) darin hat. Lass es hinter dir, damit du nicht darin steckenbleibst. Lass es hinter dir, damit du morgen früh zur Arbeit kommen kannst.
Aber wie kann man vergessen, was man weiß?
»Der Kampf, den wir kämpfen, geht über alle individuellen Tragödien und Rückschläge hinaus«, pflegt Genevieve immer zu sagen. Aber das glauben sowieso nur Menschen, die nichts zu verlieren haben.
Unten am Shoalgrove Beach kann man an sonnigen Tagen einen Typ mit Pferdeschwanz antreffen, der Sandskulpturen fertigt – Meerjungfrauen, Delphine, Schlösser mit Wällen und Türmchen. Einmal habe ich gehört, wie ein Kind ihn fragte, wie lange die Skulpturen hielten. »Bis die Flut kommt, Kleiner«, antwortete er, während er eine Wimper aus Sand formte. Auch wir müssen wie der Sandkünstler jeden Tag unsere Arbeit ganz neu beginnen. Erinnerung ist wie ein zartes Netz oder aber wie eine flatterhafte Hure, ich weiß es nicht. Ich würde diesen Gedanken ja gern mit Priscilla teilen, um sie zu trösten, nach dem Motto, die Zeit heilt alle Wunden und so weiter. Aber ich will nicht die Wächterin der Erinnerungen sein, und außerdem ist es noch zu früh.
Ich betrachte meine groben Hände und meine Finger, von denen jeder einzelne so aussieht, als sei er missbraucht worden. Ich räuspere mich. Meine Aufgabe ist wichtig und sinnvoll: Ich lege Zeugnis ab von der Ungerechtigkeit. So nenne ich es jedenfalls, wenn ich Notizen mache, nachdem wieder eine Klientin abgeschlachtet worden ist.
Ich sehe zu Priscilla hinüber. Sie sieht mich an mit einem Kummer im Blick, dem ich nichts entgegensetzen kann.
»Es wird doch eine Gerechtigkeit geben, nicht wahr?«, fragt sie.
Ich vermeide ihren bohrenden Blick.
Wieder muss ich schlucken.
»Für meine Schwester, meine ich. Das wird es doch, oder?«
»Wir tun, was wir können« ist alles, was ich zu bieten habe.
Und dann beginnt sie zu heulen. Ein hohes, tierähnliches Heulen, das mein deprimierendes kleines Büro erfüllt und mich umkreist, mich enger und enger einschnürt, mich würgt und meine Nerven erschüttert.
Ich schiebe ihr die Box mit Tüchern rüber.
Und merke, dass sie leer ist.
4 Libelle
Romeo und Julia« war sein Lieblingssong, deshalb ließ ich ihn den abspielen, während wir Sex hatten. Josh fand, das würde es »romantischer« machen, was bei mir allerdings nicht funktioniert hat. Ich mag die Dire Straits mit ihren quäkenden E-Gitarren nicht so gerne. Dann lieber die Rockband 10,000 Maniacs. Vor allem den Song »Trouble Me« – den mit der Textzeile über das Vertrauen, das alles ist, was wir zu bieten haben. Aber die Musik habe nicht ich ausgesucht.
Josh und ich waren schon zusammen im Kindergarten. Und weil ich Asthma hatte und er ständig Sauerstoff brauchte, wurden wir durch unseren gemeinsamen Kampf um Atemluft zu Freunden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn deine Brust immer enger wird und du das Gefühl hast zu ersticken, obwohl doch überall um dich herum Luft ist, die du bloß nicht einatmen kannst. Wie in diesem Gedicht von Coleridge, auch wenn es darin um das Meer und das Verdursten geht.
Nach dem Kindergarten landeten Josh und ich immer in derselben Klasse, was er »Schicksal mit ganz großem S« nannte. Für mich war es Zufall mit sehr kleinem z. Er meinte, das wären einfach nur zwei verschiedene Bezeichnungen für dieselbe Sache. Aber ich denke, das eine ist Bestimmung, während das andere halt so passiert, und es gibt doch wohl kaum etwas, was so wenig miteinander zu tun hat wie diese zwei Dinge. Wenn er aus dem Krankenhaus kam, lieh ich ihm meine Hefte, damit er aufholen konnte. Er fand meine Handschrift »perfekt«.
Josh hustete und schwitzte immer – er erklärte mir, das sei wegen seiner Krankheit, die auch daran schuld sei, dass er nicht größer wurde. Obwohl er fünf Monate vor mir Geburtstag hatte, sah er einige Jahre jünger aus als ich. Als wir ungefähr zwölf wurden, schoss ich in die Höhe, und er blieb klein zurück.
Einmal habe ich Mukoviszidose im Lexikon nachgeschaut. Dort stand ein Satz, der mich sechs Inhalationen kostete, ehe ich wieder normal atmen konnte:
»Mukoviszidose kann nicht geheilt werden. Die meisten Menschen mit dieser Krankheit sterben an Lungenversagen, viele von ihnen bereits im Alter zwischen zwanzig und vierzig.«
Ich nehme mal an, dass Josh das die ganze Zeit schon wusste, aber ich realisierte es in dem Moment zum ersten Mal.
Einmal habe ich ihn gefragt, ob er Angst vorm Sterben habe.
»Ja«, sagte er mit einem Achselzucken, »ich denke schon.«
»Wovor hast du Angst?«, fragte ich ihn.
»Dass ich sterbe, ohne vorher Sex gehabt zu haben«, erwiderte er mit einem Lächeln.
Das war der Moment, glaube ich, wo ich mich dazu entschlossen habe. Es war kein »gnädiger Fick«, wie es auf dem Poster von Carol heißt. Ich habe es getan, weil er mein Freund war.
Um seinen siebzehnten Geburtstag herum wurde er sehr krank. Aber im Krankenhaus habe ich zu ihm gesagt, dass ich ihm meine Jungfräulichkeit zum Geburtstagsgeschenk machen würde. »Das ist mit Abstand das coolste Geschenk, das ich je gekriegt habe«, sagte er.
Wenn man jemanden mag, dann findet man es nicht so schlimm, wenn was weh tut oder nicht so ist, wie man es sich erträumt hat. Es war nicht sonderlich »romantisch«, aber darum ging es ja auch nicht.
Er benutzte ein Kondom, das wir aus der Schublade seines Vaters im begehbaren Kleiderschrank der Eltern gestohlen hatten. Während Josh in der Schublade herumkramte, fiel mir auf, dass seine Mutter drei Paar genau gleicher Schuhe besaß. Olivgrüne Hush-Puppies. Mrs. Miller war Direktorin an einer Mädchenschule und sah immer amtlich und proper aus. Mr. Miller wirkte wie ein Siebzigjähriger, wenngleich Josh behauptete, er sei um die fünfzig. Er hatte eine dicke Wampe und so wenige Haare, dass man ihn durchaus als »Glatzkopf« bezeichnen konnte, ohne gleich Lügner genannt zu werden. Und der Gedanke, dass Mr. Miller ein Kondom brauchen könnte, ließ mich Dinge phantasieren, die ich mir lieber nicht vorstellte. Ich bemühte mich wirklich sehr, nicht an Mrs. Millers akribische Direktorinnenfinger beim Anlegen des Kondoms zu denken, was schwierig war, weil ich es gerade Josh überstreifte.
Wir mussten etwas Olivenöl vom Küchenregal dazu nehmen. Das war das einzige Gleitmittel, das wir auf die Schnelle finden konnten, und Josh war ein wenig peinlich berührt, aber ich beteuerte, ich würde den Geruch von Olivenöl wirklich mögen. Er ließ mich an Erde denken und Dinge, die wachsen. Josh berührte mein Gesicht, und ich glaube, da habe ich verstanden, was »sanft« bedeutet, nicht nach Wörterbuchart, sondern wie wenn irgendein kleiner Teil deines Herzens anfängt heftig zu flattern, wie eine Libelle auf einer Wasserlilie. Dann küsste er mich, und das war wohl das Überraschendste an dem Ganzen, denn im Laufe der Jahre hatte ich aus diesem Mund so viel Schleim kommen sehen, wenn Josh den schweren Auswurf auszuspucken versuchte, der seine Lungen verstopfte. Tat er das gerade nicht, dann erzählte er meist üble Witze oder machte irgendetwas von Monty Python oder den Goons nach. Und dann war dieses Lachen zu hören, das aus den Tiefen seines Brustkorbs rasselte und dich mitvibrieren ließ, so dass du unweigerlich mitlachen musstest.
Er küsste meine Brüste und hielt sie, als wären sie goldene Kugeln. Gut, dass er so kleine Hände hatte.
»Wo ist dein G-Punkt?«, fragte er.
Ich zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung.«
»Glaubst du, das ist er?«, fragte er und berührte meine Klitoris.
»Kann sein«, meinte ich.
Auch wenn es für mich ebenso wie für ihn das erste Mal war, erinnere ich mich vor allem daran, wie ich ihn dabei betrachtet habe, weil ich genau wie er wusste, dass es für ihn die einzige Chance war. Das verlieh dem Ganzen eine Art Bitterkeit. Solche Voraussetzungen haben Einfluss auf das Erlebnis selbst, denn du befindest dich nicht nur darin, sondern betrachtest es gleichzeitig auch von außen. Und es tut weh, das zu wissen. Ich hätte es für ihn gerne so lang hingezogen wie das längste Stück Kaugummi. Aber seine Biologie war stärker als meine Vorsätze. Ich habe zwar nicht auf die Uhr geschaut, aber ich bin mir sicher, dass es Fernsehwerbung für Flüssigwaschmittel gibt, die länger dauert.
Er schob seinen Penis in mich hinein. Ich hatte das Gefühl, als würde ein dicker Tampon ohne Applikator hineingehen. Es tat kaum weh. Er klammerte sich fest an mich, als ob ich ihm das Leben retten würde. Ich machte meine Augen ganz fest zu. Ein paar Sekunden später war schon alles vorbei. Ich öffnete die Augen wieder.
»Tut mir leid, dass ich nicht Tyler bin«, sagte er.
»Ich will gar nicht, dass du Tyler bist«, log ich.
Ich log, weil der Augenblick allein ihm gehörte, und den wollte ich ihm nicht verderben.
Keine Ahnung, ob er das wusste oder ob es ihm egal war, wahrscheinlich beides, denn als Nächstes sagte er:
»Ich liebe dich. Ich liebe dich, Faith Roberts, ich liebe dich.«
Es ist mir egal, ob Carol das lächerlich oder armselig findet.
Er war mein Freund.
Es war keine große Sache.
Außer für Josh natürlich.
Vielleicht war es das Netteste, was ich je getan habe. Könnte sein.
5 Spinne
Manchmal habe ich das Gefühl, verfolgt und beobachtet zu werden.
Nonna sagt, das sei Gott. Ich hoffe, sie hat recht, und es ist nicht der Ehemann einer meiner Klientinnen, wie damals, als Sheldon Stanmore mich eine Woche lang in seinem blauen Fließheck-Toyota verfolgte und hinter einer großen Sonnenbrille versteckt Rauchringe aus dem heruntergekurbelten Fenster blies. Missbraucher haben immer ein Kontrollproblem und sind hyperempfindlich, wenn sie in ebendieser Sache mal Contra kriegen. Die Polizei konnte nichts tun, weil er mich nicht physisch bedrohte. Jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, verrammelte ich meine Tür und kotzte dann ins Klo.
Mit gefällt der Gedanke, es könnte Josh sein, der ein Auge auf mich hat.
Heute hoffe ich, dass es nicht Josh ist, denn ich kann meinen Schmetterlingsanhänger nicht finden. Ich bin alle meine Wege zurückgegangen, habe meine Intuition bemüht, aber Vorahnungen gibt es nicht auf Bestellung.
Ein Schmetterling landete einmal auf Joshs Hand und starb dort. Er hat einfach seine Flügel auseinandergebreitet und dann keinen Mucks mehr gemacht. Josh hat ihn in Harz gegossen und daraus einen Anhänger gebastelt, den er mir zu meinem fünfzehnten Geburtstag schenkte. »Ein Fossil aus selbstgemachtem Bernstein«, so nannte er das. Solche Sachen konnte er gut. Er hat die tollsten Schätze entdeckt an Stellen, wo du geschworen hättest, es gäbe nichts zu sehen.
Ich wusste, dass das heute ein schlechter Tag für mich wird.
Als ich gestern Abend mit Milch und Brot für die ganze Woche aus Desai’s Café nach Hause kam und die leuchtend rote Eins auf meinem Anrufbeantworter blinken sah, zog sich mein Magen zusammen wie eine Seeanemone.
»Hallo, Faith, hier ist Genevieve. Ich dachte, ich sollte dir sagen …«, begann sie.
Manchmal ist in ein paar Worten alles enthalten. Leicht dahingesagte Bemerkungen bei einer ersten Verabredung sind wie Persönlichkeits-Mikrochips, in denen bereits alles drinsteckt, was du im Verlauf von Jahren herausfinden wirst, inklusive der Art und Weise, wie dir dereinst das Herz gebrochen wird. Das Erste, was Josh jemals zu mir sagte, während wir draußen vor dem Kindergarten in Reih und Glied standen, war: »Kann ich vor dir stehen? Ich gehe gern vorweg.« Genevieves ersten Worten konnte ich schon entnehmen, dass sie nicht wegen einer Gehaltserhöhung anrief oder wegen eines Meeresbiologen, der bei ihr im Haus wohnte und den sie mir gerne vorstellen wollte.
Ich verbrachte danach den größten Teil der Nacht auf dem Fußboden neben dem Telefon, wo ich in mich zusammengesackt war. Die Tüte aus dem Laden lag neben mir, die Milch war umgefallen und das Brot zerdrückt. Irgendwann muss ich eingedämmert sein.
Weil ich von Josh geträumt habe.
»Ich liebe dich, Faith Roberts«, sagte er in meinem Traum. »Weißt du, du bist einfach perfekt.«
Ich versuche, Priscilla zu verabschieden.
Es geht ihr keinen Deut besser als vor dem Termin hier. Ich weiß auch nicht genau, was sie sich erhofft hatte. Schon vorige Woche hatte ich keine Tricks auf Lager, und diese Woche ist es nicht anders, abgesehen davon, dass ihre Schwester jetzt mit so einem Zettel am großen Zeh im Leichenschauhaus liegt. Weiß ja nicht, ob die wirklich einen Zettel an die Zehen machen oder ob das nur die Version ist, die immer im Fernsehen gezeigt wird. Ich will nicht behaupten, Füße seien unwichtig, und Zehen schon gar nicht. Aber warum nicht den Daumen nehmen? Ist nur so ein Gedanke.
Priscilla will mich nicht verlassen.
»Ich werde jetzt gleich den diensthabenden Polizeibeamten anrufen, um sicherzugehen, dass er festgenommen wird«, versichere ich ihr. Das fördert aber nur eine weitere Kaskade von Schluchzern zutage. »Er muss sterben«, sagt sie nun. Das ist noch so was mit der Trauer – sie ist erschreckend rachsüchtig.
Ich nicke. »Er … er muss auf jeden Fall dafür zur Verantwortung gezogen werden.« Ich halte die Tür auf. Sie macht keinerlei Anstalten zu gehen.
»Ich werde ihn mit meinen eigenen Händen umbringen«, flüstert sie.
»Bitte, tun Sie das nicht«, versuche ich zu erklären, »dann werden Sie festgenommen und ins Gefängnis geworfen werden, und wer wird dann für Ihre Kinder sorgen? Und die von Sanna?«
»Er muss büßen«, sagt sie.
»Bitte, tun Sie nichts Unbeherrschtes.«
»Unbeherrscht?«, fragt sie, das ist offenbar ein Wort, das sie nur mit roten Striemen auf Haut verbindet.
»Nichts Dummes«, verbessere ich mich.
Sie zuckt die Schultern.
»Nichts Gefährliches«, sage ich. »Bringen Sie sich und Ihre Familie nicht in Gefahr. Ihre Familie braucht Sie. Und wir brauchen Sie hier bei SISTAA, damit Sie uns zu verhindern helfen, dass so etwas noch mal geschieht, mit jemand anders.«
Sie sieht mich mit einem seltsamen Blick an. »Jemand anders?«
Ich lächele. Ein kleines, trauriges Lächeln, das überhaupt nicht die erwünschte Wirkung zeigt.
»Jemand anders ist mir total egal, mich interessiert nur meine Schwester. Sie hätten sie beschützen sollen, deshalb sind wir hierhergekommen.«
»Es tut mir so leid«, stammele ich.
»Dafür ist es jetzt zu spät«, entgegnet sie und wendet sich von mir ab. Ich höre das Klickediklack der acht Zentimeter hohen Absätze ihrer schicken braunen Schuhe, als sie den Gang hinuntergeht.
Wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich in dem Augenblick gesagt, dass mein Tag gar nicht schlimmer werden könnte. Aber heute ist auch noch der Geburtstag meiner Mutter, und wir treffen uns am Abend alle im Papuzzi’s, ihrem Lieblingsitaliener am Kai. Im Moment bin ich in Bezug auf Geschenkideen noch völlig unbelastet, und nach dem Wartezimmer zu urteilen, das heute Morgen schon mit Frauen und Kindern dermaßen überfüllt war, als gäbe es Platzverweisungen zurzeit im Sonderangebot, steht in den Sternen, ob ich es schaffen werde, einen Besuch im Einkaufszentrum einzuschieben. Außerdem würde ich gern abchecken, wie es um meine eBay-Gebote auf die grüne Käfer-Kette und den Spinnen-Schlüsselanhänger aus Hämatit steht. Aber es fällt schwer, zwischendurch abzuschalten, wenn das Wartezimmer voll gebrochener Seelen ist, die alle darauf warten, von der gewohnten Verzweiflung, die sie Leben nennen, befreit zu werden. Das ist hier wie im Wartezimmer eines Arztes, Leute blättern sich durch die Regenbogenpresse, während sie auf Entscheidungen warten müssen, die ihr Leben vielleicht völlig auf den Kopf stellen. Ich habe mit Josh zusammen oft genug in Wartezimmern gesessen, um zu wissen, dass Ärzte ihrem Terminplan immer anderthalb Stunden hinterher sind. Das würde einen nicht weiter stören, wenn sie in dieser Zeit Notoperationen am Gehirn vornehmen würden. Aber – und das weiß ich nur, weil ich mal mit einem Arzt ausgegangen bin – Ärzte verbringen fünf Minuten mit der Untersuchung und weitere fünfundzwanzig Minuten damit, sich bei Patienten, mit denen sie Golf spielen, auf den neuesten Stand zu bringen. Warten ist als Foltermethode völlig unterschätzt – aber es ist definitiv Folter.
Ärzte wissen das entweder nicht, oder es ist ihnen egal.
Die Armut streicht hier durchs Büro wie ein Teenager, dem langweilig ist. Lungert missmutig in den Gängen herum und infiziert jeden, der hier sitzt und auf mich wartet. Nicht dass Wohlstand einem Immunität verleihen würde. Christina Bryant war vorige Woche schon wieder da, mit einem lustigen kleinen Stück Pappe über der Nase, vielleicht ein spezieller Nasenverband. Ich sah ihr vom Fenster aus zu, wie sie zurücksetzte und sich dann wieder zentimeterweise vorarbeitete, bis der nagelneue Offroad-Wagen perfekt parallel zur Bordsteinkante geparkt war. Ich habe die Fotos, die sie von ihren Gesichtsverletzungen brachte, eingeheftet. »Das neue Nokia«, erklärte sie. »Man sollte wirklich nichts anderes kaufen, das ist digitale Technik auf neuestem Stand.«
Wir haben alles durchgesprochen. Ich habe ihr sogar den Kreislauf der Gewalt aufgemalt. »Sie befinden sich hier«, habe ich erklärt und »Flitterwochen-Phase« umkringelt. Sie hat genickt. Dann habe ich meinen gelben Marker rausgeholt und »Aufbau von Spannung« und »Schläge« markiert. »Das kommt danach«, habe ich ihr gesagt. »Das ist immer so.« Sie hat wieder genickt. Das passiert immer wieder: Auch wenn man etwas genau benennen kann, wirkt dieser Umstand auf andere keineswegs so erhellend, wie man erwarten möchte.
Es muss schwer sein für sie. Wenn man Diener in Livree und Abendeinladungen mit Catering gewohnt ist, dann denkt man beim Thema Rechtsbeistand doch eher an die Kategorie Edward Turcotte, wie er im Nadelstreifenanzug in seiner Anwaltskanzlei sitzt. Man muss sich von seinem Stolz weitgehend verabschieden, wenn man durch unsere heruntergekommenen Türen geht und sich mit den anderen elenden Frauen, die abgesehen von ihren schäbigen Kleidern und den Bustickets kein bisschen anders sind als man selbst, in eine Schlange stellt.
»Wissen Sie, wer ich bin?«, fragte mich Doktor Bryant leise am Telefon. »Ich kann Ihnen nur raten, sie zu überreden, die Anzeige gegen mich fallenzulassen. Andernfalls wird es ihr leidtun, und Ihnen noch viel mehr«, riet er mir. Ich konnte hören, wie die Sprechstundenhilfe im Hintergrund nach ihm rief. Doktor Bryant ist einer der besten Herz-Lungen-Chirurgen. Es gibt Menschen, die ihm ihr Leben verdanken. Ich habe das mit Genevieve besprochen, und wir haben uns gegen Psychopath und für Schläger entschieden. »Schließ zu Hause und im Auto deine Türen ab«, sagte Genevieve noch einmal, und so habe ich meine übersteigerte Wachsamkeit noch ein Rädchen weitergedreht. Ich weiß genau, dass ich nicht sterben will, nur weil Doktor Bryant einen Killer auf mich angesetzt oder etwas ähnlich Sinnloses veranlasst hat. Das wäre wirklich eine lächerliche Todesart. Aber ich glaube nicht daran. Ich bin schließlich versichert – meine Eltern haben ihren Anteil an Kindestod schon abgekriegt, was mir in der Statistik den geradezu absurd unwahrscheinlichen Platz eines Blitzeinschlags verschafft, der zweimal an derselben Stelle niedergeht. Dennoch kann man nicht vorsichtig genug sein. Reiche Leute haben mehr Geld, als sie auf umsichtige Weise ausgeben können. Und ein reicher Mann, der in die Enge getrieben wird, kann auf unangenehm extravagante Weise, die ich mir nicht einmal auszumalen vermag, Geld für die Lösung eines Problems verwenden.
Jetzt, da Priscilla gegangen ist, werde ich mir trotz des schlechten Gewissens, das mir der Anblick dieser Frauen verschafft, einen Kaffee holen und meine eBay-Gebote checken. Genevieve redet andauernd davon, dass wir »uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern« sollen, und an diesem Morgen sind das meine Bedürfnisse. Diese Frauen sind schon so lange missbraucht worden, dass eine halbe Stunde her oder hin in ihrem Leben nichts ändern wird. Und irgendwann muss ich mich auch noch mal kurz rausschleichen, um ein Geschenk für meine Mutter zu kaufen. Das habe ich bisher verdrängt, aber die Deadline ist heute Abend, neunzehn Uhr. Und ich habe immer noch keine Idee, was ich ihr schenken könnte. Sie ist so ein spirituelles, völlig uneigennütziges Wesen – was für alle Lebenslagen eine herrliche Charaktereigenschaft ist, außer an Geburtstagen. Denn keiner von uns – weder Dad, Libby noch ich – weiß je, was er ihr schenken soll. Egal, was wir ihr mitbringen, sie sagt immer: »Ihr hättet nicht so viel Geld für mich ausgeben sollen. Ich wünschte, ihr hättet das den Aids-Waisen oder dem Tierheim gespendet.« Was dem Schenkenden mit seinem teuren Geschenk das Gefühl vermittelt, ein Stück Scheiße zu sein.
Barbara winkt mir zu. »Alles klar bei dir?«, fragt sie und nickt in die Richtung, in der Priscilla bei ihrem dramatischen Abgang verschwunden ist. Ich ziehe die Schultern ein und nicke.
Sie lächelt und entblößt dabei die weißesten Zähne überhaupt. Eines Tages wird irgendein Talentsucher sie uns für die neue Marketing-Kampagne von Colgate wegklauen, und dann sind wir endgültig erledigt. Dann rutscht der Empfangsbereich in denselben trostlosen Zustand wie der ganze Rest, und es gibt nichts mehr, was die Wirkung des Beistelltisches mit seinen künstlichen Blumen und dem Stapel National Geographic von der Heilsarmee auffangen könnte. Barbara verschränkt ihre Arme über dem beeindruckenden Riff ihres Busens, der aussieht, als könne er eine ganze Armee stillen. Ihre drei strammen Söhne, jeder über ein Meter achtzig, Übermut in Jeans, grinsen vom Familienbild auf ihrem Schreibtisch. Jai. Tyler. Bailey. Testosteron-Spitzenprodukte.
»Ich habe gerade frischen Kaffee gemacht«, sagt Barbara.
»Danke«, erwidere ich. Ich habe letzte Nacht nicht viel Schlaf abgekriegt.
»Und nimm dir doch einen von Daves Preiselbeer-Birnen-Muffins, sie stehen in der Küche«, fügt sie hinzu.
»Wenn du diesen Ehemann einfach klonen würdest, könntest du dich in Luxus zur Ruhe setzen.«
Barbara kichert. »Von solchen Männern gibt es jede Menge, du schaust nur nicht richtig hin.«
»Offensichtlich. Und Barbara, ich brauche eine neue Schachtel Tücher.«
»In deiner untersten Schublade«, erwidert sie.