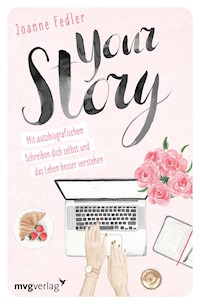12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mit ihrem Memoir "Ich bin nicht kompliziert, Mama, ich bin eine Herausforderung. Wie ich die Pubertät meiner Kinder überlebte" legt Spiegel-Bestseller-Autorin Joanne Fedler einen unwiderstehlich komischen und zugleich sehr informativen Erfahrungs-Bericht über ihr Leben als Mutter zweier pubertierender Kinder vor. Witzig und klug zugleich, dabei immer mitfühlend, berichtet Fedler vom alltäglichen Wahnsinn im Umgang mit Heranwachsenden, vom Zickenterror, der Telefonitis oder der Totalverweigerung. Zugleich gibt sie fundierte Hintergrundinformationen über Gehirn-Entwicklung und Hormonhaushalt von Teenagern und plädiert für Verständnis und liebevollen Umgang miteinander. Joanne Fedler macht Mut, klärt auf und zeigt in ihrem Erziehung-Rratgeber, dass diese schwierige Phase für Mütter auch Chancen bietet, mehr über sich selbst zu erfahren und sich neu zu erfinden. Gestern hieß es noch "Ich hab dich lieb!", heute ist "Jetzt chill mal, Mama!" noch als freundlicher Gruß zu verstehen. Mit einer großen Portion Selbstironie erzählt Bestsellerautorin Joanne Fedler vom Leben als Geächtete, als nervige, peinlich, "es auf keinem Augen blickende" Mutter. Die ihre Kinder trotzdem liebt. Wenn es sein muss, jetzt erst recht! Und etwas Positives hat auch diese Phase (abgesehen davon natürlich, dass sie vorübergehend ist): Man kann sie als Chance begreifen, etwas über sich selbst zu lernen. "Der Tag wird kommen, an dem ein Mensch, den du gestillt, dem du deinen Schlaf geopfert und dessen Hintern du abgewischt hast, dich mit einer Mischung aus Langeweile und Gereiztheit ansieht und fragt: "Hast du kein eigenes Leben, Mum?" Das ist dann ein guter Zeitpunkt, um sich vor Augen zu halten, dass 1.) Gewalt keine Lösung ist, 2.) Teenager noch kein voll ausgebildetes Gehirn haben, 3.) du hier immer noch die Erwachsene bist."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Joanne Fedler
Ich bin nicht kompliziert, Mama, ich bin eine Herausforderung!
Wie ich die Pubertät meiner Kinder überlebte
Aus dem Englischen von Katharina Volk
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die Mutation zum Teenosaurier, auch als Pubertät bekannt, macht aus »Hab dich lieb, Mami« quasi über Nacht »Lass mich bloß in Ruhe!«, und das ist noch als freundlicher Gruß zu verstehen. Mit einer guten Portion Selbstironie und locker eingestreuten Hintergrundinformationen zu Gehirnentwicklung und Hormonhaushalt erzählt die Bestsellerautorin Joanne Fedler vom Leben als Geächtete, als nervige, peinliche, »es auf keinem Auge blickende« Mutter. Die ihre Kinder trotzdem liebt. Wenn es sein muss, jetzt erst recht! Und etwas Positives hat auch diese Phase (abgesehen davon natürlich, dass sie vorübergehend ist): Man kann sie als Chance begreifen, etwas über sich selbst zu lernen.
Inhaltsübersicht
Vorwort
1 Kein eigenes Leben
2 Ganz neue Spielregeln
3 Unaussprechliches
4 Der Intimsphäre verwiesen
5 Alles schon erlebt
6 Das große »Warum?«
7 Klarheit ist Trumpf
8 Das Gehirn hinter dem Mundwerk
9 Mit ansehen, wie sie zerbrechen
10 Gefährliche Eltern
11 Teil dir deine Kräfte ein
12 Wer überlebt hier wen?
13 Immer die Verbindung halten
14 Die Klugscheißer
15 Unbestechlich
16 Eve wer?
17 Das Recht auf Rüpelhaftigkeit
18 Schlank gleich Liebe
19 You Drive Me Crazy
20 Der Hosenstall
21 Hinter verschlossenen Türen
22 Das »Nein«, das ich meiner Tochter mitgeben will
23 Coming-out
24 Die Schönheit des Riskanten
25 »Eine endgültige Lösung für ein vorübergehendes Problem«
26 Das gefährliche System
27 Der ganze spirituelle Scheiß
28 Der letzte Urlaub
29 Kein Grund zur Panik
30 Die Kinder schaffen das schon. Und wir?
Nachwort
Bibliographie
Quellenangaben
Danksagung
Vorwort
Ich habe da ein Problem …
Ich habe da ein Problem: Was Material fürs Schreiben angeht, sind Teenager die reinsten Goldgruben. Ihre Welt ist eine narzisstische, anarchische, paranoide Hölle aus Unsicherheit und Sorge um ihr Aussehen, ihre Beliebtheit (oder den Mangel daran) und die Frage, wie schnell oder langsam, groß oder klein sich ihre Geschlechtsteile entwickeln. Für eine Beobachterin ist das fantastisch. Manchmal todkomisch. Ergreifend, herzzerreißend. Großartiges menschliches Drama, denn vor unseren eigenen Augen spielt sich eine Verwandlung ab. Ein Junge wird zum Mann. Ein Mädchen wird zur Frau. Schriftsteller müssen sich gewaltig anstrengen, um sich solche Stoffe auszudenken.
Aber – Achtung, jetzt kommt der Haken – wir dürfen nichts von alledem preisgeben, wenn unsere Kinder uns je wieder vertrauen oder auch nur mit uns reden sollen. Denn abgesehen von Fahrdiensten und Taschengeld wollen sie vor allem eines: ihre Privatsphäre. Dieses Bedürfnis entwickelt sich schnell und heimtückisch lautlos, während wir die Wäsche sortieren. Es ist, als fänden sie von einem Tag auf den anderen plötzlich den Gedanken ekelhaft, dass wir ihnen so viele Jahre lang den Hintern abgewischt und die Unterhose wieder hochgezogen haben – und sie bunkern sich ein. Sie räuchern uns aus, errichten Mauern um sich, schließen ihre Zimmertür ab, erzählen uns überhaupt nichts mehr und treiben mit Stöpseln in den Ohren durchs Haus, gehüllt in einen Nebel aus Hormonen und Appetit. Ihr Leben, an dem wir bis vor kurzem noch teilhatten – manchmal detaillierter, als uns lieb war –, geht uns auf einmal »nichts an«.
Du kannst dir also sicher vorstellen, wie steil der Anlauf für mich war, über Dinge zu schreiben, über die ich nicht einmal reden darf. Außerdem habe ich nicht die geringste Lust, noch ein Buch zum übersättigten Markt der überanalysierenden Eltern-Ratgeber beizutragen, die uns darüber aufklären wollen, ob unsere Kinder hochbegabt, deprimiert, indigo, suizidgefährdet, hochsensibel, anders oder katatonisch sind oder an Legasthenie, ADHS, ADS, dem Asperger-Syndrom oder einer Angststörung leiden. (Wenn du genug solcher Bücher liest, bist du irgendwann selbst deprimiert, gestört, suizidgefährdet und katatonisch.) Ich bin zwiegespalten, was die theoretische Beschäftigung mit dem Thema Kindererziehung angeht. Während meiner ersten Schwangerschaft habe ich diese Bücher studiert, als müsste ich im Kreißsaal eine Prüfung darüber ablegen. Vor der Geburt hielt ich mich für eine Expertin in Sachen meines zukünftigen Babys. Inzwischen kann ich bestätigen, dass kein Text der Welt einen auf sechsunddreißig Stunden Wehen und anschließenden Kaiserschnitt vorbereiten könnte. Oder Mastitis. Koliken. Diese Bücher können einem im Wartezimmer der Gynäkologin die Zeit vertreiben, aber um drei Uhr früh mit einem brüllenden Baby und ausgetrockneten Brüsten nützen sie einem rein gar nichts.
Dasselbe gilt für die Erziehung von Teenagern – wie könnte uns irgendjemand darauf vorbereiten? Die Psychologie-Bücher deuten mehr oder weniger unverhohlen an, dass wir in den beiden ersten Lebensjahren unserer Kinder alles richtig gemacht haben müssen, denn sonst haben wir schon den Quellcode versaut. In dem Stadium, in dem unsere Kinder uns fragen, ob wir denn kein eigenes Leben hätten, ist es womöglich schon zu spät. Sich bis in diese Teenager-Jahre hinein selbst zu geißeln, weil man doch eine bessere Mutter, ein besserer Vater sein müsste, führt wohl eher in die Selbstperfektionierungsneurose, als irgendwelchen Nutzen für den Nachwuchs zu bringen.
Also bist du wahrscheinlich erleichtert zu lesen, dass dieses Buch kein weiterer Ratgeber ist. Ich fühle mich moralisch verpflichtet, dich schon hier im Vorwort darüber zu informieren, dass ich in keinster Weise dafür qualifiziert bin, ein Buch über die Erziehung von Teenagern zu schreiben. Abgesehen von ein paar juristischen Akademikertiteln habe ich kein Universitätsstudium vorzuweisen, mit dem ich dir eine gewisse Zuversicht einflößen könnte, dass du dein Geld nicht zum Fenster hinausgeworfen hast. Ich bin sogar ziemlich zuversichtlich, dass du am Ende dieses Buchs immer noch nicht wissen wirst, ob dein Teenager heimlich raucht, Drogen nimmt oder in der Pause hinter dem Speisesaal irgendwelchen Jungs einen bläst.
Vor einer Weile habe ich mich entschieden, keine Bücher über Kinder und Erziehung mehr zu lesen, sondern stattdessen Gitarre spielen zu lernen. Derzeit besteht mein Ziel als Mutter schlicht darin, meine Kinder durch die Schule und raus in ihr eigenes Leben zu bringen, damit ich meines wieder aufnehmen kann. Es wäre mir lieb, wenn sie sich als einigermaßen seelisch stabil erweisen, verantwortungsbewusst und nicht völlig bescheuert, was Geld angeht. Falls meine Wünsche irgendeinen Einfluss darauf haben sollten, zu was für Menschen sie werden, dann hoffe ich, dass sie an etwas glauben – irgendeine Art Gott, Geist oder sonst was –, dass sie acht auf ihren Körper geben und sich schützen, wenn sie mit dem Sex anfangen (irgendwann in ferner Zukunft).
Aber ich bin überzeugt davon, dass meine Wünsche nicht viel damit zu tun haben, zu was für Menschen meine Kinder werden. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass sie zu atheistischen Großkapitalisten heranwachsen wie zu veganen Tierrechtsaktivisten. Das wichtigste Manöver eines Teenagers besteht ja gerade darin, sich am Gegenpol von allem zu positionieren, was nach Autorität, Rationalität oder Vernunft riecht. Die umgekehrte Psychologie würde uns wohl nahelegen, dass wir wünschenswertere Nachkommen hinterlassen würden, wenn wir unser Leben in gewissenloser, untreuer Ausschweifung zubrächten und nicht als prinzipientreue, achtbare Samariter.
Was uns zu der gefährlichen Frage führt, ob jeglicher Versuch, einem Teenager ein guter, solider Elternteil zu sein, von vornherein Zeit- und Energieverschwendung ist. Noch haben wir keine schlüssige mathematische Formel dafür gefunden, wie viel Schuld an den Schwächen und Fehlern unserer Kinder angeborene beziehungsweise anerzogene Faktoren genau tragen. Ich würde sicherheitshalber davon ausgehen, dass die beiden Einflüsse gleich stark sind, und daher versuchen, irgendwelche seltsamen Macken in den biologischen Anlagen auszugleichen – indem wir unseren Kindern eine möglichst zivilisierende Umwelt schaffen.
Ich bin nicht kompliziert, Mama, ich bin eine Herausforderung! spricht einige dieser empfindlichen Fragen an, die sich mir gestellt haben, während ich zwei Heranwachsende in eine Richtung geführt und getrieben habe, die sich hoffentlich als sicherer Hort des Erwachsenseins entpuppen wird. (Ja, Erwachsensein fühlt sich oft eher nach Schützengraben als nach grüner Oase an, aber es ist unsere Aufgabe, unseren Kindern dieses Wissen vorzuenthalten. Denn sonst wären sie so entmutigt, dass sie gar nicht erst damit anfangen würden, wie Cormac McCarthy in All die schönen Pferde schreibt.)
In diesem Buch geht es um das unerforschte Neuland, in dem wir uns zurechtfinden, Wege finden müssen, einen Fuß in ihrer Welt zu behalten, während sie ständig versuchen, uns hinauszudrängen.
Als ich ins Teenager-Alter kam, gab meine Mutter mir das Buch Was ist mit mir los? von Peter Mayle zu lesen. Es war voller Karikaturen von Erektionen, feuchten Träumen, Monatsblutungen, Brüsten, Pickeln und all den anderen Beschwerden des pubertierenden Körpers. Die humorige Darstellung sollte einen wohl beruhigen und das Gefühl vermitteln: »Das ist doch zu schaffen.« Offen gestanden, lösten einige dieser Cartoons in mir eher den dringenden Wunsch aus, ich könnte diese entstellende Umwandlung zur Erwachsenen irgendwie überspringen. Was ich damit sagen will: Veränderungen sind beängstigend, vor allem, wenn man keinerlei Kontrolle darüber hat. Und erst recht dann, wenn diese Veränderungen eigene Körperteile betreffen, mit denen man noch nichts Richtiges anzufangen weiß. Ich will das Leid der Opfer nicht schmälern, aber es gibt noch zu wenige Bücher darüber, wie es sich anfühlt, Mutter oder Vater einer Person zu sein, der auf einmal Haare, Titten und Allüren sprießen. Es ist schon eine konfliktträchtige, ermüdende und komplexe Aufgabe, reif und vernünftig zu bleiben, während man jemanden darin unterstützt, erwachsen zu werden. Allermindestens konfrontiert es uns mit der Frage, ob wir selbst erwachsen genug geworden sind.
Gewisse Themen sind in einem Buch über Teenager schlicht nicht zu vermeiden. An Perioden, Pickeln und pubertären Stimmungsschwankungen führt nun einmal kein Weg vorbei. Ich muss da immer an den tapferen Mr. Davenport denken, den bedauernswerten Sportlehrer, dem die Aufgabe zufiel, uns in der fünften Klasse in Sexualkunde zu unterrichten – wahrscheinlich hat er bei einer Party im Lehrerzimmer den Kürzeren gezogen. Dieser große, stämmige Mann betrat das Klassenzimmer und sagte: »Okay, bringen wir das ganze Gekicher gleich zu Anfang hinter uns: Penis, Penis, Penis, Vagina, Vagina, Vagina, Hoden, Hoden, Hoden, Klitoris, Klitoris, Klitoris«, und wir alle brachen in pubertäres Gegacker aus wie ein Haufen Brausebonbons. In dieser Geisteshaltung ermuntere ich meine Teenager, die Erwähnung unaussprechlicher Körperteile nicht persönlich zu nehmen.
Dieses Buch hat nicht den Anspruch, das gesamte Spektrum der Erfahrungen von Teenager-Eltern abzudecken. Es gibt schon genug Bücher, die das versuchen. Ich kann nur aus meiner persönlichen, begrenzten Erfahrung sprechen. Betrachte dieses Buch also eher als Fotoalbum mit Schnappschüssen – und die Motive sind jene Themen, die für mich in den vergangenen Jahren eine besonders große Rolle gespielt haben. Ich habe mich bemüht, zu verstehen, was mit mir passiert, während meine Kinder zu begreifen versuchen, was mit ihnen passiert. Um die Vertraulichkeit zu wahren, habe ich einige Szenen »fiktionalisiert« und Stoff aus Gesprächen mit den Eltern anderer Teenager eingearbeitet. Aber ich versichere dir, dass ich mir nichts davon ausgedacht habe. Wenn es um Teenager geht, kann Fiktion niemals so beängstigend sein wie die Wirklichkeit.
Joanne Fedler
Wenn wir an einem Kind etwas ändern wollen, sollten wir zuerst prüfen, ob es sich nicht um etwas handelt, das wir an uns selbst ändern müssen.
C. G. Jung
braingraph / Shutterstock.com
1 Kein eigenes Leben
Der Tag wird kommen, an dem ein Mensch, den du durch deine Vagina hinausgepresst und an deinen Brustwarzen gestillt hast, dem du deinen Schlaf geopfert, dessen Hintern du abgewischt und dessen Rotze und Kotze du jahrelang weggeputzt hast, dich mit einer Mischung aus Langeweile und Gereiztheit ansieht und sagt: »Hast du kein eigenes Leben, Mum?«
Das ist dann ein guter Zeitpunkt, um sich vor Augen zu halten, dass
Gewalt keine Lösung ist,
Teenager noch kein voll ausgebildetes Gehirn haben (der präfrontale Kortex und mit ihm die Fähigkeit, zu differenzieren – wie etwa in der Frage, wer die Hoheit über das Taschengeld hat –, funktionieren erst mit etwa vierundzwanzig Jahren richtig) und
immer noch du hier die Erwachsene bist.
Außerdem wäre es ein Fehler, das persönlich zu nehmen. Unsere Kinder kannten uns ja gar nicht, als wir noch ein eigenes Leben hatten. Weißt du noch? Kiffen, per Anhalter fahren, Sex auf Motorhauben, durchgemachte Nächte, nackt baden gehen und auf Tischen tanzen … Diese Geschichten behalten wir besser für uns, glaub mir. Erstens wollen wir ja kein schlechtes Vorbild geben, und zweitens fänden sie es bloß eklig.
Ich persönlich habe es als harten Schlag für mein Ego empfunden, akzeptieren zu müssen, dass bestimmte Aspekte meiner tapfer erkämpften Identität – meine kreative, extrovertierte Persönlichkeit beispielsweise – für meine beiden Teenager Shannon (sechzehn) und Jordan (vierzehn) nur peinlich sind. Ich versuche nicht einmal mehr, im Vorfeld zu erahnen, was sie alles peinlich finden werden. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätte ich Tabledance für mich entdeckt oder wäre das Gesicht der Werbekampagne für extra saugfähige Slipeinlagen. Wir reden hier von einem winzig kleinen Nasenstecker. Von einem beiläufigen Schwätzchen, während ich meine Kinder und ihre Freunde von einer Party zur nächsten chauffiere, bis Jordan gereizt fragt: »Mum, musst du unbedingt mit meinen Freunden reden?«
Ich überlege mir inzwischen zweimal, ob ich dem Impuls nachgeben sollte, Popsongs im Radio mitzusingen oder Klamotten anzuziehen, die ich gekauft habe, als sie noch gar keine Meinung in Sachen Mode hatten – ja, ehe sie überhaupt auf der Welt waren. Gewisse Verhaltensweisen, die früher einmal meine waren, sind durch irgendeine Art fortpflanzungstechnischer Osmose zu ihren geworden (genau so, wie mein Make-up und mein Schmuck auf einmal Shannon zu gehören scheinen). Wenn ich mir die roten Segeltuchschuhe anziehe, sind die »spießig«. Wenn ich ein Buch oder einen Film empfehle, ist das »nicht mein Ding, lass mal«. Was ich gut finde, ist für sie praktisch gestorben. Meine Begeisterung hat es verseucht, wie ein Schadstoff. Da weiß man erst einmal nicht, was man mit all den Meinungen und Weisheiten anfangen soll, die man im Lauf seines Lebens gesammelt hat. Ich hätte die Erfahrung von siebenundvierzig Jahren zu bieten, die ich gern jemandem weitergeben wollte. Offenbar ist sie kaum gut genug für die Altkleidersammlung oder irgendein geneigtes Waisenkind.
Für Shannon und Jordan wäre es weniger traumatisch, von mir vollgekotzt zu werden, als sich vorzustellen, dass ich irgendwann einmal Sex hatte. Dass jemand mich mal sexy fand oder (Gott bewahre) irgendjemand mich jetzt sexy finden könnte. Ich selbst darf andere Leute nicht mehr sexy finden, weil das offenbar nur grotesk ist. Shannon ist in Snow White and the Huntsman allen Ernstes drei Kinositze weit von mir abgerückt, weil ich erwähnt habe, dass Chris Hemsworth »mich antörnt«. »Mum, das ist echt eklig«, sagte sie mit verzerrtem Gesicht. Dabei war das schon die für sie abgemilderte Version meiner Gedanken.
»Sieh’s doch endlich ein, Mum«, hat Jordan neulich gesagt. »Kein Mann schaut dich mehr an. Na und?« Was übrigens gar nicht wahr ist. Erst vor ein paar Wochen im Fitnessstudio hat mich während meiner Oberschenkel-Übungen ein Typ angesprochen, ob ich nicht mal »auf einen Drink« mit ihm ausgehen würde. Schön, George trägt einen Herzschrittmacher und hat mit »Darmgeschichten« zu kämpfen (was er launig bei seinem kleinen Flirt erwähnte), aber hey … er geht ins Fitnessstudio, oder?
Es gibt zwei Versionen von mir selbst. Zu meiner Version gehört auch meine Vergangenheit vor den Kindern – Zeiten, in denen ich als sexy bezeichnet wurde. Lustig. Intelligent. Lauter so coole Sachen. Und dann gibt es da ihre Version, die meiner Kinder. Diese beiden Versionen miteinander in Einklang zu bringen ist so, als versuche man, den Blick auf zwei verschiedene Bilder scharf zu stellen, während sich das Hirn abmüht, ein 3-D-Bild daraus zu machen. Schwindlig kann einem davon werden. Es ist einfacher, das eine Auge zu schließen und sich mit ihrer Version abzufinden.
Manchmal ist die Dissonanz zwischen ihrem Bild von mir und meiner Erinnerung an mich selbst unerträglich anstrengend. Also vergesse ich einfach, wer ich war, und lasse mich in die Rolle ihrer Mum fallen – einer Frau im mittleren Alter, die kein eigenes Leben hat. Die spiele ich schon, seit sie sich brüllend und zappelnd durch meine intimste Körperöffnung auf diese Welt gequetscht haben. Der Arzt hat mir nach der Geburt – ein Spaziergang, diese Wehen – nicht nur ein Neugeborenes in die Arme gelegt, sondern auch eine neue Identität.
Ich weiß noch, wie ich dieses winzige Köpfchen an meine Brust drückte und festzustellen versuchte, wie die Brustwarze in den Mund gehört. Ich erinnere mich an das vage Gefühl, dass mein Leben vor den Kindern (das Zeitalter v. K.) vorbei war – ein Leben, zu dem französische Spitzen-BHs nur für den Fall gehörten, eine aussichtsreiche Karriere, rasende Libido und ein hektisches Privatleben. Wenn man erst mal in Hausschuhen in den Supermarkt geht und das eine Woche alte Bäuerchen auf seinem T-Shirt nicht mal mehr bemerkt, denkt man sich: »Auch schon egal, ich könnte doch genauso gut noch eines bekommen.« Was ich auch tat. Manche bekommen sogar ein drittes. Und … ernsthaft jetzt? (Bei vier Kindern komme ich nicht mehr mit.) Also lehnt man Angebote ab, als Hauptreferentin auf irgendwelchen Kongressen aufzutreten, um stattdessen in der Spielgruppe herumzusitzen und »Old Macdonald Had a Farm« zu singen. Man lässt das Leonard-Cohen-Konzert sausen, weil ein kleiner Jemand plötzlich Fieber hat. Sagt einen geplanten Wochenendurlaub ab, weil da das Basketball-Endspiel der regionalen Jugendliga stattfindet. Aber was für Eltern wären wir denn, wenn wir darüber Buch führen würden, was wir alles geopfert haben? Stattdessen trösten wir uns damit, dass »es ja nicht für immer ist«, und finden uns damit ab.
Die Jahre vergehen, und wir werden immer besser darin, ihre Mutter zu sein. Wir brauchen nicht bewusst über diese Rolle nachzudenken – unsere Kinder sind ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Einkaufslisten, Sorgen, Hoffnungen und Träume. Wir nennen das nicht einmal mehr »opfern«. Eltern machen das so, Punkt.
Dann, eines Tages, urplötzlich, fällt uns auf, dass sie sich selbst die Schuhe zubinden, einen Toast machen, uns etwas über den natürlichen Lebensraum der Beutelmaus erzählen oder das menschliche Verdauungssystem erklären können. Wir treten einen Schritt zurück und atmen langsam aus. Dieser Augenblick des Durchatmens, wenn sich das Verhältnis zwischen ihrer Niedlichkeit und ihrem sich entwickelnden Selbst gerade umkehrt, ist eine Offenbarung. Obwohl wir schon seit ihrem ersten Lächeln diese keimende kleine Persönlichkeit bestaunen, wird uns jetzt erst richtig bewusst: Ganz egal, wie intelligent, witzig, einfallsreich oder begabt sie zweifellos sein mögen – Niedlichkeit ist nicht der vorrangige Wesenszug eines bestimmten Kindes. Stattdessen ist es aggressiv, introvertiert, launenhaft, schrill, melancholisch, ängstlich, feige … Eigenschaften, die wir womöglich gar nicht wahrnehmen oder nicht sonderlich anziehend finden. Daraus kann so etwas wie eine elterliche Dysphorie entstehen, wenn sie sich aus unseren Erwartungen herausschälen wie eine Banane. Es ist immer ein Schock, wenn wir wahrhaftig »kapieren«, dass sie ein bestimmter Jemand sind, jemand anders. Und unsere Beziehung zu ihnen wird wieder vollkommen rätselhaft.
Je nachdem, wie narzisstisch man ist, wird man das als riesige Erleichterung oder riesige Enttäuschung empfinden. Ob wir uns selbstzufrieden auf die Schulter klopfen oder von Ernüchterung niedergeschmettert werden, wenn ihre Individualität zutage tritt – vor dieser Herausforderung stehen wir alle. Dem Kilimandscharo, ein Kleinkind großzuziehen, folgt unweigerlich der Mount Everest der Pubertät, auf den einen niemand vorbereiten kann. Aber ich warne dich: Fang ja rechtzeitig an, dich dafür fit zu machen, vor allem, wenn du (so wie ich) etwas sentimental bist, was deine vermeintliche Rolle im Leben deiner Kinder betrifft.
Du wirst Ruhe bewahren müssen, während du erlebst, wie die Zuckerwatte im Lächeln deiner Tochter zu bissiger Gehässigkeit erhärtet. Du wirst eine ganz neue Standfestigkeit brauchen, wenn sich die Leidenschaft deines Sohnes von Pokémon auf Pornos verschiebt. Du wirst deinen mütterlichen Instinkt neu kalibrieren müssen, um die Tatsache einzurechnen, dass deine Kinder nicht nur scheißen und rülpsen, sondern auch masturbieren, trinken und rauchen. Während sich ihre Körper, ihr Hirn und ihre Welt neu ordnen, wirst auch du dich umstrukturieren müssen. Du wirst erkennen, dass du ihnen zwar das Leben geschenkt hast, sie aber diejenigen sind, die ein Leben haben. Sie haben 1700 Freunde bei Facebook. Sie haben einen Youtube-Kanal (mit Hunderten Abonnenten) und ständig irgendetwas vor. Sie haben Verabredungen zu Konzerten, Valentinstag- und Halloween-Partys. Für uns bleibt ein »Danke fürs Herbringen, Mum. Ruf mich nicht an, ich melde mich«, ehe sie die Autotür zuknallen und uns mit einer scheuchenden Handbewegung verabschieden.
Lass dich nicht so leicht abwimmeln.
Du wirst gebraucht. Jetzt mehr denn je. Nur auf andere Art, als du es gewöhnt bist.
braingraph / Shutterstock.com
2 Ganz neue Spielregeln
Neulich Abend wollte ich etwas für unsere »Beziehung« tun und rief Shannon und Jordan zu mir ins Arbeitszimmer. Sie sollten sich mit mir ein Youtube-Video von einem amerikanischen Vater ansehen, der seine Zornesrede über den »Ich hasse meine Eltern!«-Facebook-Post seiner pubertären Tochter damit krönte, dass er eine Schrotflinte auf ihren Laptop abfeuerte.
Ich hatte wohl gehofft, das würde ihnen klarmachen, dass ich gar keine so schreckliche Mutter bin, nur weil ich darauf bestehe, dass sämtliche Unterhaltungselektronik um neun Uhr abends ausgeschaltet wird und sie einmal pro Woche genau eine Aufgabe im Haushalt übernehmen. Stattdessen wechselten sie einen Blick und verdrehten die Augen. »Tja, das beweist ja wohl, was für ein Vollidiot von Vater er ist«, brummte Jordan angewidert. »Traurig«, seufzte Shannon und widmete sich wieder dem kunstvollen Muster aus Strichen, Herzen und Rauten auf ihrem Unterarm, an dem sie seit einer Woche arbeitete – in Edding. (Es ist nur eine Frage der Zeit, bis daraus ein echtes Tattoo wird.)
Nachdem ich jahrelang klaustrophobisch eng an sie gekettet war, ist die Erschöpfung dieser Jahre einem neuen Gefühl gewichen: Ich komme mir ein bisschen albern vor. Ich erwarte ja nicht, dass sie mich anbeten oder so. Nur respektieren. Ich wäre sogar damit zufrieden, nicht lächerlich gemacht zu werden. Das Problem ist, dass ich einfach nicht mehr beeindruckend bin. Früher haben sie mich nach allem Möglichen gefragt und mir aufs Wort geglaubt. Heute wissen sie über zu viele Dinge mehr als ich. Ich brauche ihre Hilfe im Umgang mit meinem iPhone und dem Pay-TV-Abo. Sie quittieren das mit einem höhnischen Schnauben, als wäre ich irgendeine alte Langweilerin, die bisher hinter dem Mond gelebt hat und gerade die ersten Schritte ins moderne Leben tut. Es ist nicht einfach, mit angemessener Autorität bestimmte Schlafenszeiten durchzusetzen, wenn man nicht in der Lage ist, Songs in iTunes herunterzuladen.
Als ich mir vor ein paar Jahren eine Gitarre gekauft habe, war mir bewusst, dass das Shannon peinlich sein könnte – sie ist eine hervorragende Gitarristin und Sängerin. Ich habe mich zu ihr gesetzt und ihr gesagt, dass ich mit dem Gitarrespielen anfangen würde. Sie zog die Augenbrauen hoch, und ihr Teenager-Gesicht spiegelte eine Mischung aus aufrichtiger Skepsis und Mitleid wider.
»Ich will dir keine Konkurrenz machen, keine Sorge«, versicherte ich ihr. »Es wird sehr lange dauern, bis ich so gut bin wie du.«
»Schon okay, Mum, du wirst nie so gut sein wie ich.« Sie zuckte mit den Schultern.
Das stimmt wahrscheinlich, aber … musste das sein?
Mit sechzehn war Shannon so groß wie ich. Wir konnten unsere Klamotten tauschen. Seither weigert sich Zed (mein Ehemann und ihr Vater), die Wäsche zusammenzulegen – auf einmal stand er mit einem Unterhöschen in der Hand da und fragte: »Ist das deines oder ihres?« Dann erklärte er: »Ich kann das nicht.«
Die Erwiderungen meiner Kinder können witzig und so vernichtend sein. Neulich mussten wir ein Fernsehverbot verhängen und dann wegen frechen Widerspruchs das Strafmaß noch erhöhen. Shannon sagte nur eiskalt: »Ist das hier jetzt ein totalitäres Regime?« und ließ uns stehen.
»Komm nicht rein, ich drehe«, ruft Jordan gelegentlich durch die geschlossene Tür, als sei er Spielberg persönlich. Ich habe keine Ahnung, was genau in seinem Zimmer vor sich geht, aber eine Weile später wird es wieder Youtube-Videos von seinen Computerspielen geben, die ich mir dann ansehen muss – das bringt ihm »Aufrufe«, an denen er derzeit seinen Selbstwert bemisst. Wir hatten eine fürchterliche Auseinandersetzung wegen Call of Duty, das ich in unserem Haus nicht erlauben wollte, obwohl ich ihn damit angeblich zur sozialen Isolation verurteilte. Ich blieb tapfer und beugte mich keinem noch so vernichtenden Druck. Jetzt gräbt er sich durch zombieverseuchte Minen. Ich kann nicht beurteilen, ob Minecraft ihm das Hirn zersetzt, statt die Bildung neuer Nervenbahnen anzuregen. Außerdem hat er seine Freunde rund um die Uhr bei sich in seinem Zimmer, per Skype. Ich vermisse die guten alten Spielkameraden, die irgendwann auch mal nach Hause gingen.
Zur Mutter von Teenagern wurde ich ganz plötzlich. Am einen Tag saß ich noch mit Eis am Stiel im Park oder schubste Schaukeln an, und am nächsten schnaubte Shannon: »Lass mich in Ruhe, ich hab PMS«, und Jordan erklärte mir: »Deoroller funktionieren besser, aber Deospray ist männlicher.«
Über Nacht sind Auszeiten und die »stille Treppe« nutzlos und lächerlich geworden. »Iss deinen Grünkohl« wird mit »Iss ihn doch selber« beantwortet – oder mit »Ich habe beschlossen, auf grünes Gemüse zu verzichten«. Ich versuche, darauf zu bestehen, und ein Teenager zitiert die UN-Kinderrechtskonvention und behauptet, das zu essen, was er will, sei sein völkerrechtlich geschütztes Grundrecht. Meistens bin ich zu müde, um weiter zu streiten, und da sich niemand mehr vor mir fürchtet, brauche ich gar nicht erst die Stimme zu erheben, denn dann stehe ich nur da, als hätte ich den kindischen Wutanfall.
Ständig muss ich meine Erziehungsmethoden updaten wie eine Facebook-Seite. Unsere Kinder verändern sich Abend für Abend im Schein ihrer Computerbildschirme, mit jedem Mausklick und jedem nächtlichen Tweet, und wir müssen Schritt halten, wenn wir im Spiel bleiben wollen. Irgendwo dadrin steckt sicher eine buddhistische Lektion über die Vergänglichkeit aller Dinge.
Manchmal sehe ich eine Mutter im Park ihr Kleinkind knuddeln und bekomme dieses Gefühl, als würde sich etwas in meiner Brust verdrehen wie eine Brezel. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie lange das letzte Mal bei mir her ist. Als Jordan noch klein war, hüpfte er mit Begeisterung zu mir in die Badewanne, und wir schwatzten über Dinosaurier oder Yu-Gi-Oh!, bis das Wasser kalt wurde. Manchmal veranstalteten wir richtige Schaumschlachten. Aber irgendwann in seinem neunten Lebensjahr war es damit abrupt vorbei. Etwa ein Jahr später, nach einem scheußlichen Tag in der Schule, versuchte ich ihn aufzumuntern: »Schaumschlacht?« Er zögerte, runzelte die Stirn, und ich konnte förmlich sehen, wie er innerlich abwog. »Ja …«, sagte er schließlich. »Genieß es noch mal richtig, Mum.«
Das war unser letztes Mal.
Seitdem musste ich mich gegen winzige Zurückweisungen wappnen, die sich zu einer wahren Lawine anhäufen. Neulich habe ich ihm vorgeschlagen, zum Strand zu fahren und schwimmen zu gehen.
»Nein danke.«
»Es ist so heiß. Komm schon, eine kleine Abkühlung.«
»Ich hasse meine Badehose. Sie ist viel zu eng.«
»Aber es ist so ein herrlicher Tag. Na los, gehen wir schwimmen.«
Er zögerte – ehrlich, ich schwöre es, er hat kurz gezögert – und rückte dann damit heraus: »Ich will aber nicht an den Strand … mit dir.«
Ich sah ihm an, wie mies er sich dabei fühlte, etwas so Verletzendes zu sagen – auch wenn es die Ehrlichkeit verlangte. Ich zwang mich zu einem Lächeln – »Verstehe schon, kein Problem« – und schlich davon, um bei der Katze Trost zu suchen. Lach nicht – ein bisschen Schmusen und Schnurren kann einem helfen, den Tag zu überstehen, wenn mehr Liebe eben nicht zu haben ist.
Zu solchen Zeiten stürzt man ab. Wir sinken auf der Zuneigungsskala unserer Kinder wie das Quecksilber im Thermometer bei einem Kälteeinbruch. Anscheinend tue ich nichts anderes mehr, als ihrem großen Vorhaben im Weg zu stehen: so anders als ich und so angepasst an ihre Altersgenossen zu sein wie nur irgend möglich. In seinem großartigen Buch Weit vom Stamm bezeichnet Andrew Solomon das als »horizontale Identität«. Sie haben bisher eine gemütliche alte Identität von Zed und mir aufgetragen (Religion, Gesellschaftsschicht, Gene und so weiter), aber die passt ihnen jetzt nicht mehr. Sie bürsten unseren Einfluss aus wie Knötchen im Haar.
Shannon fand es früher toll, wenn jemand sagte, sie sehe mir ähnlich. Jetzt verzieht sie das Gesicht, als hätte man sie mit Barney dem Dinosaurier verglichen. Wenn Jordan einen Dreipunktewurf schafft, sind ihm meine Jubelschreie nur noch peinlich. »Bleib cool, Mum«, sagt er genervt und schüttelt den Kopf.
Meine Würde, die vermisse ich.
Neulich habe ich mich auf einer Bar-Mizwa mit einer Bekannten unterhalten. Wir absolvierten das »Wie geht’s Noah? Was macht Lucy? Und Camilla?«-Ritual. Du weißt schon – »Ist Lucy wirklich schon bald mit der Schule fertig?« und »Nicht zu fassen, wie groß Jordan geworden ist. Und sprießen da etwa schon erste Barthaare?«
»Eine grässliche Phase«, bemerkte sie dann.
»Wie ist es denn bei euch zu Hause?«
»Na ja, ich komme mir vor wie im Boxring. Sie sind so … gemein. Vor allem mein Jüngster. Er kann wirklich ein unflätiger kleiner Mistkerl sein.« In meiner Erinnerung war es noch nicht lange her, dass sie ihren Jüngsten im Alter von drei Jahren immer noch gestillt hatte, weil sie das so schön fand und es einfach nicht aufgeben wollte.
»Neulich habe ich ihm gesagt, man könnte meinen, er leide am Tourette-Syndrom, so wirft er mit Schimpfwörtern um sich«, fuhr sie fort. »Und er fragt: Was für ein scheiß Syndrom?«
Da muss man doch schon wieder lachen. Ein robuster Sinn für Humor ist das Einzige, was einem hilft, das ständige Gemotze und die Beschimpfungen zu überstehen, die man übrigens nie persönlich nehmen sollte. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich ihnen immer versichert, dass sie keineswegs Streber oder dick seien, bloß weil irgendein Schulhof-Tyrann sie als »Streber« oder »Fettsack« bezeichnet hat. Nun ist es an der Zeit, dass ich mir meinen eigenen Rat zu Herzen nehme und pubertäre Äußerungen darüber, wie »blöd« oder »spießig« ich doch sei, nicht an mich heranlasse. Das sind die Blitzschläge und Hagelkörner, denen wir während dieser adoleszenten Stürme ausgesetzt sind. Aber wir wissen ja, dass unsere Kinder kaum Kontrolle über ihr seelisches Wetter haben. Und dass auch diese Verachtung irgendwann abziehen wird.
Ich versuche meine Rolle als ihre Mutter mit neuer Bedeutung zu erfüllen. Ihr Bedürfnis nach Unabhängigkeit macht es erforderlich, dass ich mich bis zum Zerreißen dehne. Ich muss ihnen in der Welt da draußen vertrauen und sie dieser Welt anvertrauen, wenn ich nicht riskieren will, sie mit meiner mütterlichen Neurose zu lähmen. Ich muss tapfer sein und lernen, mich nicht dafür zu schämen, dass ich jemanden, der ein Viertel so alt ist wie ich, nach der Bedeutung von »LMFAO« oder einem »Mem« fragen muss. Wenn sie dann sagen »Du weißt schon, das, was Kanye West mit Taylor Swift gemacht hat«, nicke ich nur. Manchmal muss man so tun, als ob. Ihre spitzen, coolen Widerworte treiben mich zu kindischen Reaktionen wie »Ich habe dich neun Monate lang in mir getragen, ist es da zu viel verlangt, dass du zwei Einkaufstüten in die Küche trägst?«.
Wappne dich dafür, dass Grenzen verschwimmen und du im Nebel tappen wirst. Manchmal könnte man schwer sagen, wer hier erwachsen und wer kindisch ist. Erst neulich bin ich ausgerastet, weil Jordan nicht wie versprochen den Müll rausgebracht hatte. Da tadelt er mich doch voll gemessener Autorität: »Würdest du dich bitte beruhigen?« Und weißt du, was? Das habe ich auch getan.
Sie bereiten mich auf eine Umwälzung meines Ego vor, die einem Schiffbruch gleichkommt. Wahrscheinlich ist es die Midlife-Crisis. Geschlossene Zimmertüren, höchst private Gespräche und Geheimnisse mit ihren Freunden sind ihre Art, mich loszulassen. Oder abzustreifen wie eine zu eng gewordene Haut. Hast du kein eigenes Leben, Mum? Ein Leben ohne Pausenbrote, Fahrdienste, Hockeyspiele und Basketball-Training. Ich weiß nicht, ob ich darauf vorbereitet bin, dass sich alles wieder nur um mich dreht … und Zed natürlich (sofern wir dann noch irgendetwas gemeinsam haben). Ihr Leben erscheint mir so viel interessanter. Im Moment bin ich schon froh, wenn ich eine kleine Rolle in ihrem Support-Team spielen darf und sie mich bei Facebook nicht entfreunden.
Ich bereue es nicht, dass ich sie sechzehn Jahre lang an die erste Stelle gesetzt und meine eigenen Vorlieben, Entscheidungen, Wünsche und beruflichen Möglichkeiten zurückgestellt habe. Nein, das ist es nicht – ich wollte Kinder und würde es wieder genauso machen. Ich jammere nur, weil meine Kinder diese Opfer nicht wahrnehmen und kein bisschen schätzen. Aber ich warne dich: Versuch gar nicht erst, das deinem Teenager klarzumachen. Da kommt nur nörgelndes Rauschen an.
Für mich ist der größte Schock, was man alles verliert. Das geht schleichend – diese unvergleichliche Nähe und Vertrautheit, dieses Gefühl, wenn man ein kleines Gesichtchen mit Küssen bedeckt, all das bröckelt langsam weg. Die Gutenachtgeschichten und das Zudecken. Die »Beste Mama der Welt«-Karte zum Muttertag, die nicht ironisch gemeint ist. Niemand hat mir gesagt, dass ich mich auf diese spezielle Art der Trauer gefasst machen muss, während meine Kinder aus Klamotten und Knete, Stofftieren und Comics und eigentümlichen Obsessionen wie Dinosaurier und Barbiepuppen herauswachsen.
Und diese seelische Qual ist erst der Anfang. Da kommt noch mehr. Zum Beispiel dieser verzehrende Neid, weil das, wonach sie greifen – das Leben vor ihnen, die vielen Möglichkeiten, die tiefe Konzentration auf das sich entfaltende Selbst –, genau das ist, was uns zu entgleiten droht.
Besonders hart wird es für uns Mütter, wenn die Teenagerzeit unserer Kinder mit den eigenen Wechseljahren zusammenfällt. Während wir vertrocknen und verdorren, schlaff und faltig werden und uns fragen »War das alles?« und »Bin ich eigentlich je meinem Traum gefolgt?«, strotzen unsere Teenager nur so vor Kollagen und Adrenalin, sprudeln über vor jugendlicher Schönheit, Elan und Träumen. Das wird einem gnadenlos unter die Nase gerieben – was sie schwungvoll ansteuern, davon müssen wir uns verabschieden. Kein Wunder, dass viele Väter müde der Midlife-Crisis entgegenwelken, wenn ihre jugendlichen Söhne vor Testosteron und prallen Muskeln nur so sprühen, während sie selbst sich morgens beim Rasieren fragen, ob sie ihre besten Jahre vergeudet haben und warum junge Frauen sich nichts dabei denken, vor ihren Augen im Fahrstuhl ihr Make-up aufzufrischen. Seit wann sind sie eigentlich unsichtbar?
Also wenden wir uns ab und verspüren einen Stich in der Magengrube. Wir mustern das Gesicht im Spiegel und wissen auf einmal nicht mehr so recht, wie wir das tun sollen, was wir doch schon so lange getan haben – ihre Eltern sein. Das Spiel hat sich gewendet, die alten Regeln gelten nicht mehr. Und in einem niederschmetternden Augenblick der Klarheit müssen wir erkennen, dass wir uns zwar oft darüber beklagt haben, wie sehr uns diese Elternrolle einengt, auslaugt, und dass es einem ja niemand dankt … aber eigentlich wollten wir nicht, dass diese Zeit je zu Ende geht.
Nicht so.
Nicht zu ihren Bedingungen.
Doch erst dann, wenn wir so weit sind, Herrgott noch mal.
braingraph / Shutterstock.com
3 Unaussprechliches
Also, ich behaupte ja nicht, dass ich ein besserer Elternteil bin als Zed. Er ist zum Beispiel in den meisten Situationen viel ruhiger als ich (außer, es geht um Unordnung). Er gerät nicht in Panik. Er ist entsetzlich ordentlich. Er zieht keine vorschnellen Schlüsse oder geht bei einem Husten gleich von Lungenkrebs aus oder bei Kopfschmerzen von einem Hirntumor. Er hat kein Problem damit, um Mitternacht durch die Gegend zu fahren, um ein Kind von einem Konzert abzuholen, während ich ja versuchen würde, ihm den Konzertbesuch ganz auszureden.
Aber als Shannon neun Monate alt war, musste ich beruflich ein paar Tage verreisen. Ich hinterließ Zed ein ganzes Lexikon von Anweisungen. Mehrmals täglich rief ich an, um mich zu erkundigen, was sie zu Mittag gegessen, wie lange sie geschlafen und wie oft er ihr die Windeln gewechselt hatte. »Alles bestens, mach dich nicht verrückt«, schalt Zed.
Für den Tag meiner Heimreise verabredeten wir uns zum Frühstück in einem Café. Ich sah Zed kommen, als er noch etwa zweihundert Meter weit weg war. Er schob Shannon im Kinderwagen vor sich her, und selbst aus dieser Entfernung erkannte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Mein Baby war krebsrot. Sie war schlaff. Ich eilte ihnen entgegen, und als ich Shannon endlich aus der Nähe sah, war sie fiebrig und verschwitzt.
»Sie ist krank!«, schrie ich.
»Es geht ihr gut.« Er zuckte mit den Schultern.
»Sieh sie dir an! Sie glüht ja, und sie kann den Kopf nicht gerade halten.«
»Sie ist ein bisschen schläfrig, aber sonst war sie sehr brav.«
Das war natürlich keine Quizshow, in der es darum ging, wer richtig lag und wer nicht, aber es stellte sich heraus, dass sie Dreitagefieber hatte.
Ein weiteres Beispiel für Zeds nicht immer optimales Urteilsvermögen: Letztes Jahr war ich fünf Tage in Bali, und als ich zurückkam, maunzte die Katze ganz schief. Zed war nichts aufgefallen, obwohl Tanaka in unserem Bett schläft. Der Tierarzt diagnostizierte Bellsche Parese, eine Gesichtslähmung – auf der betroffenen Seite konnte sie weder blinzeln noch mit dem Ohr zucken. Ich musste ihr sechs Wochen lang zweimal täglich Augentropfen geben, damit das Auge nicht austrocknete. Also, gut dass ich da bin.
Ich merke alles.
Es fällt mir auf, wenn meine Kinder einen blöden Tag haben, wenn sie ihr Frühstück nicht aufessen, zu viel fernsehen oder nicht schwimmen gehen wollen. Ich weiß, wann sie zuletzt auf Facebook gepostet haben und wer ihre Beiträge kommentiert.
Das ist nur die Fortsetzung einer langen Geschichte des überwältigenden Drangs, alles über meine Kinder wissen zu wollen. Sie begann schon mit den Neugeborenen, die ich gründlichst und detailgenau studierte: den Wirbel in Jordans Haar, wo es gegen den Uhrzeigersinn liegt, Shannons spitzen Haaransatz an der Stirn, der winzige Leberfleck an ihrer rechten Ferse und den ulkigen Winkel von Jordans kleinem Zeh, genau wie bei seinem Vater. Wie eine Wissenschaftlerin das Verhalten, die Entwicklung und den Lebensraum von Feldmäusen oder einer besonderen Schildkrötenart protokolliert, so habe ich meine Babys beobachtet. Jahrelang habe ich auf die Farbe und Häufigkeit ihres Stuhlgangs sowie die Flüssigkeitsaufnahme und -ausscheidung geachtet. Ich bin zur Expertin darin geworden, Textur und Zusammensetzung ihres Kummers und ihrer Faszination zu ermessen. Ich bin stolz darauf, dass ich zu wissen glaube, wer sie in ihren Alpträumen und auf dem Schulhof schikaniert. Die Form ihrer Zehennägel, der Schwung ihrer Wimpern und wie sie jeden einzelnen Milchzahn verloren haben, all das betrifft mich instinktiv und persönlich.
Und ich beobachte nicht nur, ich feuere sie auch an. Jeder Fingerbreit ihres Wachstums ist am Türrahmen ihrer Zimmer markiert, sämtliche verlorenen Zähne in genau beschrifteten Umschlägen verwahrt, jede Schramme, die sie vom Spielplatz mit heimgebracht haben, bekam ihr heilendes Pusten und ein Pflaster. Diese Liebe bezeugt, dokumentiert und dient damit als schützender Damm gegen die Unsichtbarkeit – meine Kinder sollen nie auf die Idee kommen, dass sie in dieser riesigen, gleichgültigen Welt unbemerkt untergehen könnten.
Doch vor einigen Jahren begann sich vieles zu verändern. Sie rannten nicht mehr nackt im Haus herum und hüpften einfach zu mir in die Badewanne. Immer seltener wickelte ich bibbernde kleine Schwimmer in Badelaken und half ihnen, Badeanzug oder -hose auszuziehen. Meine Vertrautheit mit ihren Körpern franste aus wie ein alter Faden. Ich hörte mich auf einmal Dinge sagen wie: »Was hast du da am Bein?«, »Woher hast du diesen blauen Fleck?« oder »Seit wann passen dir eigentlich diese Schuhe nicht mehr?«. Die einschlägige Literatur erklärte, meine Kinder »differenzierten« sich von mir und Zed. Tja, das ist dann wohl nur eine hochtrabende psychologische Bezeichnung dafür, dass sie uns zum Teufel schicken.
Und das geschah folgendermaßen: Sie hörten auf, mir alles zu erzählen. Sie zeigten mir nicht mehr alles. Ich durfte sie nicht mehr unbekleidet sehen. Natürlich war es eine Erleichterung, nur noch einen Hintern abwischen zu müssen und morgens Zeit für so etwas wie Make-up zu haben, statt jemandem die Socken anzuziehen. Doch dieser Luxus hatte seinen Preis. Ich war als Zeugin ausgeladen. Als Protokollantin entlassen. Jahrelang bekam ich nur noch das zu sehen, was ich ihrer Meinung nach sehen durfte.
Du kannst dir also den Schock ausmalen, wenn du beispielsweise, nur mal angenommen, ins Badezimmer platzt im Glauben, der eigene Ehemann stünde unter der Dusche, nur um anhand entsetzten »Raus!«-Geschreis festzustellen, dass es dein jugendlicher Sohn ist.
Ich gebe zu, darauf war ich dann doch nicht vorbereitet.
Die Haare da unten werden ein Schock für dich sein. Die können unmöglich an dein Kind gehören, davon wirst du fest überzeugt sein, obwohl dir gewisse Grundzüge der menschlichen Biologie und der fortschreitenden Reifung, die keinem von uns erspart bleibt, durchaus bekannt sind. Keine große Überraschung, dass das Wort »Pubertät« vom lateinischen pubescens abstammt, was wörtlich »haarig werden, sich mit Haaren überziehen« bedeutet. Kein Scherz.
Natürlich freut man sich riesig, dass in puncto »Einsetzen der Pubertät« alles normal verläuft. Vielleicht sind wir sogar irgendwie stolz darauf, dass dieser Organismus, den wir im eigenen Körper angezüchtet haben, so gut funktioniert. Wir sind froh, dass wir all die Folsäure-Tabletten geschluckt und all die Gläser Weißwein abgelehnt haben, während wir schwanger waren. Das ist der reife, erwachsene Teil von uns. Dem Rest ist nur schwindelig vor »Wie zum Teufel ist das so schnell gegangen?« und »Das da ist mein Baby«.
Ich bin nicht zimperlich, was meine Kinder angeht. In diversen Krankheitsfällen bin ich mit allen nur denkbaren Körperfunktionen klargekommen, und an meinen Kindern ist mir nichts zu eklig. Für ein gepflegtes Gespräch über Verstopfung, Blähungen, Missempfindungen beim Wasserlassen, eigenartige Ausschläge und Jucken am Hintern bin ich jederzeit zu haben. Ich war davon ausgegangen, dass sich das ganz natürlich bis in die Pubertät fortsetzen und die Konversation dann eben sprießende Körperteile, das Einführen von Tampons, Menstruationskrämpfe und Pickelmanagement beinhalten würde. Meine Kinder sollten nie glauben, es gäbe Unaussprechliches oder Themen, bei denen mir übel wird.
Doch mit dem Haarwachstum da unten kam die Zensur – auf einmal war es streng verboten, jüngste Entwicklungen in der Körperbehaarung, der Beförderung von Körbchengröße 75 B zu 80 DD oder plötzliche Veränderungen der Stimme a) zur Kenntnis zu nehmen oder gar b) anderen zur Kenntnis zu bringen.
Zu den Tabuthemen gehörten nun auch Gewicht, Körpergröße, Rocklänge, Frisur und Zustand derselben sowie das Wetter mit Bezug auf ihre Bekleidung (Nimm einen Pulli mit. Du wirst frieren in diesen Shorts. Musst du die Kapuze wirklich aufsetzen?), und zwar aus folgenden Gründen:
Wenn sie unsere Meinung wissen wollten, hätten sie uns gefragt.
Unsere Meinung interessiert sowieso keinen.
Was gucken wir sie überhaupt so an? Haben sie vielleicht darum gebeten, sie anzusehen?
Jeglicher Kommentar wird als Nörgelei, Schikane und Kontrolle empfunden. Diese körperlichen Verwandlungen mögen für uns als Eltern ein Schock sein. Aber eigentlich sind sie die Privatsache des Menschen, der sie durchmacht. Wie bei der Wandgestaltung in billigen Motelzimmern gilt: Wir müssen so tun, als hätten wir nichts gesehen.