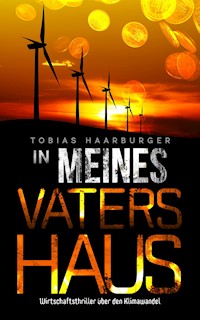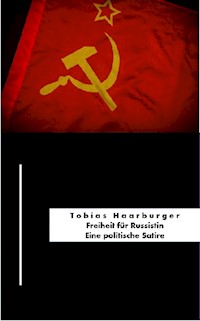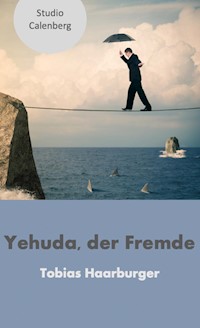
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Yehuda ist ein junger israelischer Manager. Ihm gelingt eine meisterhafte Investition in ein Pharma Start-Up. Er gelangt zu einem großen Vermögen. Ein Konkurrent, initiiert eine antisemitische Kampagne gegen Yehuda, die sich schnell verselbständigt. Für ein Sabbatical geht er nach Berlin. Er trifft die Psychologin Nurit Teitelbaum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tobias Haarburger
Yehuda, der Fremde
Roman
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Tobias Haarburger
Yehuda, der Fremde
Roman
Copyright © 2023, Tobias Haarburger
Impressum: Tobias Haarburger, Emdenstraße 2, 30167 Hannover
Herausgeber: Tobias Haarburger
Umschlaggestaltung, Illustration: Tobias Haarburger
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtig
Kapitel 1
Yehuda war von Natur aus schweigsam. Das hieß nicht, dass er sich nicht mitteilen würde, doch musste er einen Grund haben, um sich zu diesem oder jenem zu äußern. Von sich aus nahm er ein Gespräch nur auf, wenn er eine konkrete Sache zu klären hatte. Albernheiten oder Plaudereien mochte Yehuda nicht. Er trat bescheiden auf, auch war er höflich und rücksichtsvoll. Er beeilte sich äußerst ungern, sondern nahm sich die Zeit, die eine Erledigung eben in Anspruch nahm.
Vor allem war Yehuda ein scharfer Beobachter und guter Zuhörer. Er sah sich ein Gesicht, eine Körperhaltung, ja, die komplette Physiognomie eines Menschen genau an. Das tat er instinktiv, aus einem natürlichen Interesse heraus und das hatte er sich keineswegs abgeschaut. Yehuda las aufmerksam, was geschrieben war und wie es geschrieben war. Er fragte in einem beiläufigen Ton nach den familiären Verhältnissen, aus denen jemand stammte, und wenn es um sachliche Dinge ging, war er sorgfältig bis hin zu gelegentlicher Pedanterie, was seine Gesprächspartner bisweilen quälen konnte. Er drängte sich niemals auf, sondern hielt sich eher entfernt vom Geschehen und stand in einer der hinteren Reihen. Er war mit seinen dreißig Jahren sehr schlank, ja eigentlich asketisch. Yehuda trug eine runde Brille mit einem dünnen, metallenen Rahmen, hatte ein schmales, wohlgeformtes Gesicht, aus dem die Nase des Intellektuellen hervorstand, und schöne, kastanienbraune Augen.
Seine Hände waren kräftig und sein Kinn ließ vermuten, dass er nicht klein beigab, wenn es notwendig sein sollte. Er gab sich Mühe mit seinem Äußeren, hielt sein schwarzes Haar kurz, seine Hemden waren sorgsam gebügelt, seine modischen Schuhe befanden sich in einem guten Zustand und seine Hosen hatten eine sorgfältig aufgebrachte Bügelnaht.
Yehuda hatte einen sicheren Gang, der etwas gedehnt wirkte. Er setzte seine Schritte in einem gemessenen Tempo und man hatte das Gefühl, dass Yehuda jeden Schritt mit Bedacht machte. Seine Stimme war fest und angenehm, er sprach, mit unaufdringlicher Gelassenheit, langsam und verständlich und formulierte seine Worte aus. Für gewöhnlich trug Yehuda eine abgewetzte Tasche bei sich, die er bei einem Trödler auf einem Flohmarkt gekauft hatte. Die Tasche war das einzig Legere an seiner Erscheinung. Er mochte es nicht, Dinge wie sein Telefon, seine Schlüssel oder sein Portemonnaie umständlich in die Hosentasche stecken zu müssen. Yehuda nahm Anteil an seinen Mitmenschen und half, wenn es notwendig war.
Er kaufte mit Olga, seiner Frau, für die Familie ein und kümmerte sich ebenso um die Verpflichtungen des Alltags. Wenn er sich zurückzog, was bisweilen vorkam, tat er das nicht mit einem Vorsatz, der darin lag, dass er Olga aus dem Weg gehen wollte, sondern er benötigte gelegentlich Zeit für sich, um seine Gedanken zu ordnen und sich Notizen zu machen. Er verbrachte gerne Zeit mit ihren Kindern Ari und Yair, die ein und drei Jahre alt waren, vorwiegend las er seinem Dreijährigen sehr gerne vor.
Besonders gerne besuchte Yehuda seinen Nachbarn Pinchas Levy, einen sechzigjährigen Witwer und Professor für Literatur. Mit Pinchas konnte er unbefangen sprechen, hauptsächlich über die Dinge, die ihn wirklich interessierten. Sie saßen oft bis in die Nacht auf dem Balkon von Pinchas, tranken Wasser – und gelegentlich Wein – und besprachen die Weltlage und die Situation des Judentums im Besonderen. Pinchas hatte seinen Sohn bei einem Militäreinsatz verloren. Seine Tochter lebte in New York. Er war einsam und freute sich jedes Mal, wenn Yehuda bei ihm klingelte. Pinchas, welcher der Generation von Yehudas Vater angehörte und über eine besondere Allgemeinbildung verfügte, wurde zeitweise so etwas wie Yehudas Mentor. Dadurch hatte sich zwischen den beiden eine unausgesprochene Hierarchie ergeben.
Olga hatte Yehuda aus einer Haltung der Genügsamkeit heraus geheiratet. Es war ein Fehler gewesen. Er liebte sie nicht und sie interessierte sich nicht für ihn. Nachdem Olga ihre beiden Kinder geboren hatte, sah sie ihre familiären Pflichten als erledigt an. Sie war schwatzhaft und versuchte, ihn mit einer zunehmenden Engstirnigkeit herumzukommandieren.
Olga verbrachte am liebsten die Zeit mit ihrer Mutter. Sie waren unzertrennlich, besuchten sich täglich und schwatzten stundenlang. Meistens kam ihre Mutter zu ihr und Yehuda zog sich in sein winziges Arbeitszimmer zurück. Die Familie lebte in einem schmucklosen Hochhaus in Netanya. Zum Meer hin war es nicht weit, doch mochte Olga nicht zu Fuß gehen und man fand schwer einen Parkplatz, sodass Olga lieber ihre Zeit zu Hause verbrachte.
Eines Tages hörten sie auf, ihren Wocheneinkauf gemeinsam zu machen. Olga meinte, mit ihrer Mutter würde sich alles schneller erledigen lassen, was ein alberner Vorwand war. Sie mochte Yehudas Art nicht, die einzelnen Lebensmittel auf ihre Kalorien und überhaupt den Inhalt und die Preise zu prüfen, wobei sich Yehuda wehrte, wenn sie ihn dafür tadelte. Er würde dies nur selten und nur bei neuen Lebensmitteln tun.
Olga hielt ihn für langweilig, litt unter seiner Wortkargheit und dachte überhaupt, er sei ein einfacher und fantasieloser Mensch. Er war in ihren Augen zwar unkompliziert, aber auch ohne alle Ambitionen, die sie zwar selbst auch nicht hatte, von ihrem Ehemann erwartete. Allmählich hielt sie ihn für überflüssig und ließ ihn das spüren. Damit, dass er tatsächlich einmal die Wohnung verlassen würde, rechnete sie jedoch nicht.
Yehuda und Olga hatten sich beim Sanitätsdienst in der Armee kennengelernt. Sie passten von außen betrachtet zusammen und sie entwickelten eine oberflächliche Harmonie. Auch sahen sie sich nicht oft und besuchten sich während der langen Armeezeit nur einmal im Monat. Ihre Standorte lagen weit auseinander. Beide erwarteten nicht viel von der Liebe. Zu heiraten, gehörte zum Leben. Olga nahm gleichmütig die Dinge, wie sie kamen, und stellte nie grundsätzliche oder gar philosophische Überlegungen an.
Olgas Familie stammte aus Weißrussland. Sie hatte die Angewohnheit, nur von einem Tag zum nächsten zu denken, auch wenn das in Israel keineswegs der allgemeinen Mentalität entsprach. Vielleicht war sie auch einfach nur phlegmatisch und alles andere ergab sich um sie herum.
Olga war so groß wie Yehuda und sie war schlank, zumindest beim Beginn ihrer Ehe. Olga hatte ein fein gezeichnetes Gesicht, blaue Augen und langes feines Haar, bis sie es abschnitt, wie es Frauen über fünfzig zu tun pflegten.
Sie trug längliche, etwas aus der Mode gekommene goldene Ohrringe, die wahrscheinlich aus einem arabischen Souk stammten, vermutete Yehuda.
Sie arbeitete halbtags als Zahnärztin in einer Zahnklinik, kam und ging pünktlich und versah auch diese Tätigkeit ohne eine besondere Anteilnahme.
Yehuda hatte im Übrigen auch eine leichtfertige, ja, eine naive Seite. Intelligenz und Naivität sind ja bekanntlich kein Widerspruch. Das lag vielleicht an seiner jungenhaften Art, die sich auch in seinem Äußeren ausdrückte. Er fühlte sich in dem Einerlei der unternehmerischen Abläufe permanent unterfordert. Er vermisste die Freiheit, selbst zu agieren, auch graute ihm davor, das eintönige Familienleben mit seiner Schwiegermutter, die ihn keines Blickes würdigte, auf ewig fortzusetzen.
***
Yehuda erzählte Pinchas ausführlich seine Familiengeschichte. Bei Pinchas gab er seine Zurückhaltung auf, er fühlte sich verstanden. „Die Biografie meiner Familie entspricht in allen Höhen und Tiefen und mit der ganzen Tragik dem, was in Israel normal ist“, begann Yehuda an einem Abend, als Yehuda und Olga neu eingezogen waren, zu erzählen.
Sein Vater war Professor für Pharmazie. Vor zwanzig Jahren war er bei einem Verkehrsunfall verstorben. Yehuda war damals zehn Jahre alt und ein ganzes Jahr lang tieftraurig gewesen. Die Urgroßeltern seines Vaters waren in den 1880er-Jahren aus Russland nach Israel eingewandert und gehörten zu den ersten Kolonisten, wie man sie damals nannte, die Baron Edmond de Rothschild großzügig unterstützte. Sein Vater leitete daraus stets einen eigenwilligen Stolz ab und wenn die Sprache auf die Einwanderung kam, erzählte er wortgleich immer wieder die Geschichte seiner Vorfahren, was bei seiner Familie stets ein Augenrollen hervorrief.
Er holte weit aus und verlor sich in allen möglichen Details, welche die junge Generation überhaupt nicht interessierten.
„Meine Tochter ist auch oft gelangweilt, wenn ich etwas erzähl und mein Sohn war es früher auch“, sagte Pinchas mit einem Lächeln. Die Geschichte des modernen Israel begann lange, bevor der Baron mit großzügigen Spenden den Jischuw vor dem Scheitern bewahrte. Pinchas war in einem Alter, in dem das Monologisieren zur Gewohnheit geworden war. Er saß, mit seinem weißen Haupt, den Rücken der Brüstung des Balkons zugewandt und die Sonne genießend in aller Ruhe da und legte seinen linken Arm auf die Brüstung, die aus schlichtem Beton bestand.
Sein Gesicht war immer freundlich, manchmal machte er eine verschmitzte Gebärde, sein weißer Bart, der dieselbe Farbe wie sein Haar hatte, umsäumte seinen Mund. Er mochte die Wärme des Tages und genoss es, lange in der Sonne zu sitzen.
„Über Jahrhunderte gab es immer wieder Unternehmungen, heute sagt man wohl Projekte, zur Kolonisation von Palästina. In der Mitte des 19. Jahrhunderts verfestigten sich ernsthafte Versuche zur Besiedelung durch die Juden. Moses Montefiore förderte die Ausbildung der Einwanderer zu Handwerkern. Er veranlasste darüber hinaus den Bau von sauberen und gesunden Häusern, wie sie es damals nannten.
Es folgte August Ludwig Frankl, der eine Schule gegründet hat. In dieser Schule wurden profane Fächer wie Rechnen, Schreiben und Lesen unterrichtet. Die Alliance Israélite universelle errichtete in den 1870er- und 1880er-Jahren Schulen mit französischer Unterrichtssprache und eine Handwerkerschule, die allerdings auf Widerstand bei den strenggläubigen Juden gestoßen ist, die in den uralten, bei ihnen als heilig geltenden Städten wie Jerusalem, Hebron und Tiberias lebten.
Viele der Einwanderer, die in den 1880er-Jahren ankamen, waren den Bedingungen nicht gewachsen. Sie litten an Malaria und Schwarzfieber und es fehlte an Kapital und Kenntnissen, um von der Landwirtschaft leben zu können. Zehntausende kehrten wieder in ihre Heimat zurück. Es gab zwar Spenden aus Russland und England, etwa von Sir Laurence Oliphant, aber das reichte bei Weitem nicht aus. Erst das Eingreifen von Baron de Rothschild brachte eine Verbesserung der Situation.
Er hat die Anpflanzung von Eukalyptuswäldern in Hadera finanziert und den Anbau südfranzösischer süßer Weinsorten veranlasst. Vor allem initiierte er die Einrichtung von Lehrgärtnereien und den Bau großer Weinkeller in Rishon Le-Zion und Sichron-Jakob.“ Yehuda kannte manche, aber nicht alle Details dieser Schilderung. „Im Jahr 1917 endete die Herrschaft des Osmanischen Reiches über Palästina nach vierhundert Jahren. Die jüdischen Ansiedlungen gerieten unter die britische Krone, die das Land neben Jordanien und dem Irak als Mandatsgebiet zugesprochen bekam.“
Pinchas machte eine Pause. „Woher stammt denn die Familie deiner Mutter?“ Für einen Moment sah Pinchas abwendet auf das Meer hinaus. Dann räusperte er sich und trank einen Schluck Wein. „Meine Mutter wurde auch in Israel geboren. Ihre Mutter, meine Großmutter, stammte aus Straßburg. Sie wurde 1942 dort geboren, ihre Eltern wurden verschleppt und ermordet.“ Yehuda rückte seine runde Brille zurecht und fuhr fort. „Das Mädchen, das noch ein Kleinkind war, wurde von einem katholischen Priester in ein Kloster gebracht und blieb dort bis 1948, bis sie sechs Jahre alt war und die Jewish Agency sie gefunden hat.“ Yehuda stand kurz auf und schwenkte den Sonnenschirm, der sich auf dem Balkon befand, über seinen Kopf. Ihm wurde zu heiß und er verstand nicht, wie Pinchas das aushalten konnte. Dann erzählte er weiter.
„Als Soldatin diente meine Großmutter im Sechstagekrieg und im Jom-Kippur-Krieg. Sie war Geografin und wurde zur lokalen Heldin, weil sie in beiden Kriegen im Generalstab Fotoaufnahmen der Luftwaffe auswertete und sowohl Moshe Dajan als auch Itzhak Rabin praktisch täglich begegnete. 1960 war sie nach Israel ausgewandert. Sie war achtzehn Jahre alt und Waise. Sie heiratete nach wenigen Wochen einen jungen Kibbuznik und bekam meine Mutter als einziges Kind, während sie Geografie studierte. Das war 1962. Drei Jahre später, nach ihrem Studium, trat sie voller Stolz in die Armee ein. Den Jom-Kippur-Krieg erlebte sie als Reservistin mit einunddreißig Jahren. Sie meldete sich sofort freiwillig, als man einen Tag vor Ausbruch des Krieges fest damit zu rechnen hatte, dass Ägypten und Syrien angreifen würden. Die ganze Familie war stolz auf die Großmutter, die inzwischen in einem Seniorenheim lebt.“ Pinchas machte ein schmatzendes Geräusch, das seine Anerkennung für Yehudas Familiengeschichte ausdrücken sollte.
„Es stimmt, die Geschichte deiner Familie könnte man fast exemplarisch für die Entwicklung des Judentums und Israels in den letzten hundertfünfzig Jahren nennen“, nahm Pinchas den Faden wieder auf.
„Ich nehme an, das geht in der Generation deiner Eltern so weiter.“ Yehuda nickte.
„Stimmt, meine Mutter und mein Vater heirateten ebenfalls sehr jung, mit einundzwanzig Jahren. Sie dienten beide in der Armee, im Verteidigungsministerium in Tel-Aviv.“ Pinchas hörte gespannt dem Bericht seines Nachbarn zu. Solche Geschichten mochte er. Yehuda hatte eine Schwester namens Esther, die er liebte und die zeitweise eine wichtige Stütze für ihn wurde, weil sie die Einzige war, die nichts an dem damals sensiblen Jungen kritisierte.
Sie lebte mit ihrem Mann – einem freiberuflichen Historiker – und ihren beiden Kindern in Jerusalem und arbeitete, ebenfalls als Historikerin, im Israel-Museum. Mit seinem Schwager verstand sich Yehuda ebenfalls sehr gut. Sie sprachen über Politik und waren grundsätzlich einer Meinung.
„Ich habe ein geordnetes Leben“, beendete Yehuda seine Erzählung. Doch glücklich oder viel sprechend ist es nicht, dachte er für sich. Sie unterhielten sich noch eine Weile, kamen wie fast immer gegen Schluss von Yehudas Besuch auf das Weltgeschehen zu sprechen und stellten fest, wie gut es Israel ging. Nach zwei Stunden stand Yehuda auf und ging in seine Wohnung zurück.
***
Yehuda arbeitete bei einem israelischen Pharmakonzern. Er war Pharmazeut und nachdem er seinen MBA abgeschlossen hatte, wurde er Produktmanager für ein Antibiotikum, das als Generika in Indien hergestellt wurde. Man versprach sich sehr viel von dieser Investition und Yehuda musste einmal im Monat dem Geschäftsführer persönlich Bericht über den Fortgang des Projektes erstatten.
Das Unternehmen hatte viel investiert und Yehuda trug eine große Verantwortung. An einem warmen und etwas windigen Tag im Oktober nahm Yehuda den Zug zum Flughafen.
Sie hatten nur ein Auto, einen alten VW Passat, und den benötigte Olga. Die Fahrt dauerte nur eine Dreiviertelstunde und Yehuda genoss jedes Mal, wenn er sie antrat, die Ruhe, kaum dass er aus dem Haus war. Er erledigte am Flughafen die Formalitäten und fand sich nach kurzer Zeit unter der von einer runden Scheibe herabströmenden Wasserfall wieder, der das Zentrum der Abflughalle bildete. Als er dort bei einer Tasse Kaffee saß und versonnen die Menschen beobachtete, die aus aller Welt kamen, setzten sich zwei Franzosen zu ihm an den Tisch, die er am vorherigen Tag in seiner Firma kennengelernt hatte.
Man begrüßte sich freundlich. Sie hatten nicht ihn, sondern eine andere Abteilung besucht, waren aber beim Mittagessen in der Firma mit Yehuda an einem Tisch gesessen. Die Franzosen arbeiteten bei einem Anlagenbau-Unternehmen, das Prozessteuerungen für die Produktion in der Pharmaindustrie ausführte. Die beiden Ingenieure waren nicht mit strategischen Fragen, sondern unmittelbar mit Programmierarbeiten betraut. Sie führten während der Woche Verbesserungen an einer Produktionsanlage in Hadera durch. Es stellte sich heraus, dass sie denselben Flug nach Paris hatten wie Yehuda.
Yehuda sprach ein paar Brocken Französisch und wandte die nun an. Es waren nicht mehr als Höflichkeiten, die ausgetauscht wurden. Yehuda war erleichtert, dass sie ihm die üblichen Bemerkungen darüber, wie es denn mit den Palästinensern weitergehen würde und dergleichen ersparten. Sie waren schon oft in Israel und verhielten sich sehr natürlich. Später verabschiedete sich Yehuda, stand auf, kaufte sich zwei Zeitungen und ging zum Gate. Im Flugzeug stellte sich heraus, dass die Franzosen und er nur durch den Gang getrennt in derselben Reihe saßen. Man nickte sich freundlich zu.
Yehuda reiste zu einer Tagung der Europäischen pharmazeutischen Gesellschaft in Paris. Die beiden Programmierer unterhielten sich angeregt und Yehuda konnte nicht anders, als ihrem Gespräch zu folgen. Es ging um ein Unternehmen mit Namen Explizit-Pharmaceuticals. Yehuda sagte der Name nichts.
„Die Firma hat ein neues Antibiotikum auf den Markt gebracht“, sagte der eine Franzose. Yehuda wurde aufmerksam. Der Kern der Konversation lag darin, dass Explizit - Pharmaceuticals trotz der Phase-III-Zulassung und der Tatsache, dass es sich um ein Medikament gegen multiresistente Keime handelte, vor dem Bankrott stand.
„Sie haben alle liquiden Mittel verbraucht und stehen vor der Abwicklung“, erzählte der Franzose, der Yehuda am nächsten saß, seinem Kollegen. Vier Wochen würden die letzten fünf Mitarbeiter noch durchhalten. Yehuda entschuldigte sich höflich, dass er zugehört hatte, wofür er nichts könne, und fragte nach, wie die Firma genau hieße und wo sie lag. Der Franzose wiederholte den Firmennamen.
„Explizit - Pharmaceuticals und die sind in Boston“, war die Antwort. Sie war ein typisches Spin-off der Boston Harvard Medical School. Yehuda bedankte sich für die Auskunft und vertiefte sich wieder in seine Zeitung.
***
Das Conference Center Pierre Mendès France lag in der Rue de Bercy. Yehuda hatte zwei Monate vor der Tagung ein Hotel in der Nähe reserviert. Er checkte ein, setzte sich an den schmalen Schreibtisch seines Hotelzimmers und startete voller Neugier seinen Computer. Der Kurs von Explicit Pharmaceuticals lag bei 0,01 Dollar. Es waren 52 Millionen Aktien im Umlauf, sodass die Marktkapitalisierung auf 520.000 Dollar zusammengeschrumpft war. 40 Prozent der Aktien gehörten noch den Firmengründern, 60 Prozent waren im Streubesitz. Yehuda nahm eine Flasche Wasser aus der Mini-Bar, legte sich einen Notizblock zurecht und suchte in den Foren nach Nachrichten über Explicit Pharmaceuticals. Das Medikament war zugelassen, aber es waren im letzten Quartal nur fünfhundert Packungen verkauft worden. Was war der Grund dafür? Yehuda ging auf die Seite einer Online-Apotheke und gab den Namen des Medikamentes ein. Hundert Tabletten sollten 2.000 Dollar kosten, was mit Sicherheit ein Grund für das miserable Ergebnis war.
Yehuda suchte noch den ganzen Abend nach Informationen. Die beiden Firmenchefs, zwei Harvard-Professoren, die in ihren Siebzigern sein mussten, schienen von der Vermarktung eines Medikaments nichts zu verstehen. Die Jahresbilanzen zeigten, dass man nicht einmal besonders viel Geld verbrannt hatte, wie es sonst vorkam. Die Professoren waren sparsam, vielleicht zu sparsam.
Nach der Erstplatzierung, dem Initial Public Offering, schoss der Kurs auf 80 Dollar, was keine Seltenheit im Pharmamarkt war. Das war vor zehn Jahren. Damit hatte man erst einmal ausreichend Geld zum Arbeiten. Nach den üblichen Rückschlägen und Verzögerungen bei den klinischen Tests und der Zulassung fiel der Kurs fortwährend ab und hielt sich lange bei 70 Cent. Dann wurde das Medikament endlich zugelassen und der Kurs schoss noch einmal hoch auf 20 Dollar. Ab diesem Zeitpunkt waren die Erwartungen der Anleger an den Abverkauf hoch. Als die Zulassung eineinhalb Jahre zurücklag und ein Quartal nach dem anderen verging, ohne dass sich die Zahlen verbesserten, sackte der Kurs auf 0,01 Dollar, also einen Cent pro Aktie. Es war eine Katastrophe, für die Gründer und für die Anleger.
Nach den Regeln der amerikanischen Börsenaufsicht SEC durfte eine solche Firma überhaupt nicht existieren. Wahrscheinlich hatte man Kredite aufgenommen, vielleicht die Privathäuser verpfändet und alles flüssig gemacht, was man fand, einschließlich der Rücklagen für die Rente. Yehuda wusste sofort, was zu tun war: Er wollte in die Firma einsteigen. Was für ein glücklicher Zufall war es, dass er die Franzosen getroffen hatte und nun auf dieser Tagung war. Er musste jemanden finden, der die Interna der kleinen Firma kannte. Sobald er am nächsten Tag registriert sein würde, bekam er eine Teilnehmerliste.
Er öffnete im Internet ein Businessverzeichnis und suchte aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter. Er fand zwei: einen Vertriebsleiter und eine Mitarbeiterin aus der Entwicklung. Perfekt, dachte Yehuda. Er hoffte, dass sie oder er auf der Tagung sein würden. Yehuda war so versunken in seine Recherchen, dass er vergaß, was er sonst an diesem Abend gemacht hätte. Üblicherweise traf sich die israelische Delegation zu einem Abendessen in einem der Hotels. Daran dachte er überhaupt nicht mehr. Olga sollte er anrufen, doch sie würde nur missmutig antworten und unter einem Vorwand das Gespräch schnell beenden. Ihm war jetzt nicht danach.
Was ihm durch den Kopf ging, konnte er ohnehin nicht mit ihr besprechen. Sie interessierte sich nicht für seine Arbeit, würde sie ihm kaum folgen können und ihn für einen Fantasten halten, wenn er ihr von seiner Idee erzählte. Er sandte ihr eine kurze Mitteilung, um zu vermeiden, dass sie ihn doch anrufen würde. Sie antwortete sehr kurz und fragte nicht, wie die Reise gewesen wäre und dergleichen. Der Gedanke, in die Firma zu investieren, bewirkte, dass Yehuda munter wurde und die Müdigkeit, die ihn am Abend so einer Reise meist befiel, nicht spürte.
Es gab ein Fitnesscenter im Hotel, doch er entschied sich dafür, einen Spaziergang zu machen. Sein Hotel lag an der Seine. Er nahm seine graue Jacke von der Stuhllehne und ging am Quai de Bercy spazieren. Yehuda war das erste Mal in Paris. Er ging etwa einen Kilometer in jede Richtung und bewunderte, wie großzügig alles angelegt war. Der Charakter der Stadt war vollkommen anders als der von Tel-Aviv. Der Vergleich war wohl auch etwas naiv, dachte er mit einem Schmunzeln. Paris war über Jahrhunderte das kulturelle, wissenschaftliche und auch politische Zentrum Europas.
Tel-Aviv war eine Neugründung, jung und eine Stadt inmitten ihres Aufbaus. Als er nach einer Stunde zurück war, ging er in das Restaurant des Hotels, bestellte eine Suppe und verschwand, kaum dass er sie gegessen hatte, wieder auf seinem Zimmer. Er las wieder und wieder im Internet, was über die Firma zu finden war. Erst gegen ein Uhr legte er sich schlafen.
***
Am nächsten Morgen war Yehuda pünktlich um neun Uhr, gerade als der Einlass zur Tagung freigeben wurde, in dem großen Konferenzgebäude. Er registrierte sich als einer der Ersten und überflog hastig die Teilnehmerliste. Tatsächlich, der ehemalige Vertriebsleiter war unter dessen neuem Arbeitgeber angemeldet. Jetzt musste er ihn nur noch finden. Yehuda lehnte sich gegen einen Tisch, der sich unweit des Eingangs befand, und beobachtete jeden, der zur Anmeldung kam.
Nach einer halben Stunde glaubte er, den ehemaligen Mitarbeiter, sein Name war Mathew Brooks, zu erkennen. Er sprach ihn an und hatte den Richtigen gefunden. Er bat Mathew, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und sich mit ihm in die letzte Reihe des Konferenzsaales zu setzen. Die Tagung sollte eine weitere halbe Stunde später beginnen. Mathew verstand nicht unmittelbar, warum sich Yehuda für die Firma interessierte, doch beantwortete er bereitwillig seine Fragen. Er war vor einem Jahr aus der Firma ausgeschieden. Damals hatten sie, als einen der letzten Akte im Überlebenskampf, die Entwicklungsabteilung entlassen und nur zwei Vertriebsmitarbeiter behalten. Es blieben außerdem die beiden Gründer, eine Sekretärin und die Buchhalterin. Ansonsten war es so, wie Yehuda vermutete. Einer der beiden Eigentümer hatte sein letztes privates Geld, einschließlich seiner Rente, in die Firma gesteckt. Der andere war vorsichtiger und behielt sein Haus und seine Rentenansprüche.
Mathew saß vorn über gebeugt da, legte seine Arme auf seinen Knien ab und erzählte:
„Die Firma war hoch verschuldet und den sehr hohen Verkaufspreis für das Medikament haben die Geschäftsführer in der Annahme angesetzt, dass er wegen der besonderen Eigenschaften des Wirkstoffes am Markt akzeptiert würde. Natürlich war das Quatsch und ich hätte ihnen das gleich sagen können.“ Mathew sah immer wieder auf seine Uhr. Es war noch genügend Zeit.
„Zudem brauchten sie dringend Liquidität. Genau das gab dem Unternehmen den Todesstoß. Es ist keineswegs so, dass es keine Konkurrenz gibt. Das Medikament hat zwar mit Abstand die besten Eigenschaften, aber die Wettbewerber, es sind immer dieselben“, schob er ein, „haben behauptet, ihre Produkte besäßen dieselben Vorteile, und haben sogar von Großhändlern, zu denen sie langjährige Beziehungen haben, die Einstellung des Verkaufs des teuren, neuen Antibiotikums verlangt.“
Es war eine einfache und keineswegs untypische Geschichte. Auf dem amerikanischen Pharmamarkt herrschte ein äußerst harter Wettbewerb. Das Vorgehen der großen Pharmafirmen gegen kleine, innovative Unternehmen war hart am Rande der Kriminalität, darin waren sich Mathew und Yehuda einig. Mehr wollte Mathew auch nicht erzählen. Er gab Yehuda die Telefonnummern und Adressen der beiden Eigentümer und verabschiedete sich.
Yehuda las die aktuellen Nachrichten aus Israel. Weil er noch etwas Zeit bis zum Beginn der Tagung hatte, ging er wieder auf die Internetseite von Explizit-Pharmaceuticals. In einer Woche würde der nächste Quartalsabschluss sein. Es war üblich, dass das Unternehmen eine Telefonkonferenz ansetzte, um den Geschäftsbericht vorzustellen und zu erläutern. Yehuda kaufte noch am selben Tag hundert Aktien, um Zugang zu dieser Konferenz zu bekommen. Er war entschlossen, seine Ideen in die Tat umzusetzen. Schließlich, nach drei Tagen endete die Tagung und Yehuda flog zurück nach Israel, nahm wieder den Zug nach Netanya und war am Abend zu Hause.
***
Yehuda dachte Tag und Nacht über sein Projekt nach, wie er es fortan nannte. Nüchtern betrachtet war es ein Irrsinn, was er vorhatte. Doch eine solche Gelegenheit zu nutzen, entsprach der allgemeinen Mentalität, in der er aufgewachsen war. Er selbst neigte ohnehin dazu, eine Sache, die ihm unbekannt war, in einem positiven Licht zu sehen.
Yehuda prüfte die Möglichkeiten und wog die Risiken in ihren jeweiligen Kategorien ab. Was sich bei Explizit - Pharmaceuticals zeigte, war ein klassisches Vertriebs-Problem und es war genau genommen einfach zu lösen. Am Abend seiner Rückkehr, nachdem er kurz seine Kinder und Olga begrüßt hatte, schrieb er eilig eine E-Mail nach Indien. Dass er das tun sollte, war ihm während des ganzen Rückfluges durch den Kopf gegangen. Er hatte vor einem halben Jahr mit einem Hersteller, mit dem sein Unternehmen seit Jahren zusammenarbeitete, die neuen Bedingungen für das Medikament vereinbart, für das er zuständig war. Die Frage war, wie viel Stück des Medikamentes der Amerikaner abgenommen werden mussten, um einen Verkaufspreis von 150 Dollar zu erhalten.
Yehuda nahm an, dass sich das Medikament mit diesem Preis häufig verkaufen lassen würde. Am nächsten Tag, es war ein Freitag, ging er am Nachmittag wieder zu seinem Nachbarn Pinchas Levy. Er musste sich mit ihm beraten.
Sie saßen wie üblich auf dem kleinen Balkon, von dem aus man den schönen Blick auf das Meer hatte. Nachdem Yehuda von seiner Reise nach Paris erzählt hatte, ließ er Pinchas zu Wort kommen. Er hörte sich gerne dessen Neuigkeiten aus der Universität an, bei denen es meistens um Berufungen von Professoren oder Fragen des Budgets ging. Anschließend berichtete Yehuda, was er im Flugzeug von den französischen Programmierern gehört und weiterverfolgt hatte. Dabei gab er zunächst seine Idee nicht preis und sagte nicht, was er vorhatte. Pinchas kannte ihn gut und ahnte, was Yehuda plante.
„Ich nehme an, du möchtest in die Firma investieren?“ „Ja, stimmt, das überlege ich mir“, erwiderte Yehuda.
„Welchen Sinn hat das, wenn sie kurz vor der Abwicklung stehen?“
„Ich möchte nicht einfach investieren, ich möchte die Mehrheit übernehmen, mindestens 51 Prozent.“ Pinchas formte seinen Mund zu einem O, wie er es immer zu tun pflegte, wenn er überrascht war. Dann sagte er:
„Und du hast ein Konzept, was du mit der Firma machen möchtest, nehme ich an? Eine weitere Frage ist, nach dem, was du erzählt hast, benötigst du 255.000 Dollar oder fast 900.000 Schekel, woher willst du die nehmen?“
Pinchas stand auf, nachdem er die Fragen gestellt hatte, schlüpfte in seine verblichenen Schuhe und ging in die Küche, um eine Flasche Wein und eine angefangene Packung salziger Kekse zu holen. Es schien ein interessanter Nachmittag zu werden. Als er zurückkam, sagte Yehuda:
„Ich habe so viel Geld“ und lächelte kurz.
„Olga weiß es nicht, wir haben eine Gütertrennung vereinbart. Das schließt natürlich alles ein, was man vor der Ehe besessen hat. Ihr gehört unsere kleine Wohnung und sie hatte Sorge, dass sie mich im Fall einer Scheidung ausbezahlen müsste. Du weißt ja, wie sie ist. Also, mein Ururgroßvater, der 1888 aus Russland eingewandert ist, Nathan Itzhak Rosenberg hieß er, hat im Laufe seines Lebens Grundstücke um Tel-Aviv herum gekauft. Das heißt, als Tel-Aviv 1909 gegründet wurde, war es natürlich ein winziger Flecken neben Jaffa. Heute sind die Grundstücke mehr oder weniger im Stadtzentrum. Es sind alles Parkplätze, acht, zum Teil große Flächen. Die Stadtverwaltung will sie nun zu Bauland machen. Der Verkauf der Grundstücke bringt 2,5 Millionen Schekel, die Hälfte steht allerdings meiner Schwester zu.“
Yehuda schenkte sich Wasser nach und goss eine kleine Menge Wein dazu.
„Puh“, machte Pinchas, „dann bist du ja ein wohlhabender Mann. Und deine Frau weiß von all dem nichts?“
„Nein, überhaupt nichts. Sie wollte es so – denke ich.“ Yehuda zuckte mit den Schultern. Pinchas musste das erst einmal auf sich wirken lassen. Dann sagte er:
„Es dürfte die gewagteste Anlage sein, die du finden kannst. Warum investierst du nicht in ein Start-up? Eines, das für die Autoindustrie arbeitet, autonomes Fahren und so. Da vermehrt sich dein Geld schneller und vor allem sicherer.“ Yehuda dachte ruhig über Pinchas‘ Einwand nach und antwortete:
„Weil die Sache mit dem Antibiotikum eine einmalige und viel größere Chance ist. Außerdem hätte ich mein eigenes Unternehmen, das war schon immer mein Traum.“ Yehuda nippte an seinem Glas und stellte es auf den Tisch zurück.
„Das hast du nie erwähnt“, wandte Pinchas ein.
„Es ist aber so“, bestätigte Yehuda. „Der zweite Grund ist, dass der Wert der Aktie, wenn alles klappt, zehntausendfach steigen kann. Überlege doch mal. Ich hätte Milliarden Dollar. Das ist es, was mir keine Ruhe lässt. Es geht mir nicht um Luxus, es geht mir um diese gewaltige Summe an sich und vor allem, was ich mit dem Geld machen könnte. Das zieht mich magisch an. Ich kann seit Tagen an nichts anderes mehr denken, Pinchas. Das ist wirklich eine einmalige Chance“, wiederholte Yehuda.
Entgegen seiner sonstigen Ruhe begeisterte er sich und redete schneller als gewöhnlich.
„Diese gewaltige Zahl, stell dir doch mal vor. Ich wäre einer der reichsten Israelis, wobei mir das wirklich auch nicht wichtig ist, nicht, was den Luxus betrifft, du kennst mich. Ich hätte etwas geleistet, was so noch nie jemand fertiggebracht hat.“ Pinchas musste lächeln angesichts der plötzlichen Euphorie Yehudas.
„Dann erklär doch mal, wie du das hinbekommen willst“, sagte er trocken und wischte mit seiner Hand Krümel der salzigen Kekse vom Tisch.
„Es ist ganz einfach“, erwiderte Yehuda nun wieder in seinem sachlichen Ton. „Es geht um Skaleneffekte. Das Medikament lässt sich natürlich deshalb nicht verkaufen, weil es viel zu teuer ist. Es passt nicht in den Markt. Die wollen 2.000 Dollar für eine Packung mit hundert Tabletten haben. Ich habe mit meinem indischen Lieferanten gesprochen. Wir sind beide überzeugt, dass 150 Dollar angemessen sind. Außerdem verstehen die Professoren nichts von E-Commerce.“
„Und wie viele Schachteln musst du verkaufen, um profitabel zu werden?“, fragte Pinchas, der das eigentliche Problem verstand.
„Das sage ich dir lieber nicht, sehr viele jedenfalls.“
„Du gehst also ein gewaltiges Risiko ein“, stellte Pinchas nachdenklich fest.
„Was überwiegt, das Risiko oder die Möglichkeiten?“ Pinchas trank einen Schluck Wein und machte Yehuda ein Zeichen, er möge auch noch etwas nehmen. In seiner Begeisterung hatte Yehuda vom Wein bisher nur einen kleinen Schluck genommen.
„Sei ehrlich zu dir. Du weißt noch nicht genug. Ist der hohe Preis der einzige Grund, warum sich das Medikament nicht verkaufen lässt? Und außerdem, wie willst du das machen, ganz allein? Die Firma hat doch nur noch fünf Leute, sagtest du.“ Yehuda wurde wieder engagierter.
„Du weißt besser als ich, durch welche Wunder dieses Land entstanden ist.“
„Was meinst du jetzt mit Wunder?“, wiederholte Pinchas und sah Yehuda fragend an. Er atmete tief durch. Was sollte ihm Yehuda nun antworten? Bei dem Thema waren sie nie einig.
„Durch Visionäre, durch ungewöhnliche und ehrgeizige Menschen, die alles hinter sich gelassen haben, um ein Land aufzubauen, von dem sie nicht wissen konnten, welche Grenzen es haben würde, wovon seine Einwohner leben sollten, wie es sich verteidigen sollte und überhaupt, wie sie es jemals formell gründen könnten.“
Yehuda wollte weit ausholen und über das Ende des Osmanischen Reiches und über Herzl sprechen, über die Staatsgründung, die unendlich vielen Errungenschaften in Israel und darüber, dass es nur noch arabische Apotheker gäbe, doch Pinchas unterbrach ihn. Er stand politisch noch weiter links als Yehuda. Pinchas hatte den Monolog, der kommen würde, von Yehuda ein paarmal gehört. Sicher hatte die israelische Gesellschaft viele Herausforderungen bewältigt, doch für Pinchas stand die Palästinenserfrage im Vordergrund des gesamten politischen Geschehens. Solange die nicht gelöst war, hielt er den Staat für nicht fertig, für nicht etabliert. „Lassen wir das“, sagte Pinchas und wischte sich mit der Hand über seinen Mund.
„Reden wir von deinem Vorhaben. Du bist dir also sicher, dass es dir gelingen wird, die Firma aufzubauen.“ Yehuda nickte.
„Ich dachte in den vergangenen Tagen so intensiv über meinen Plan nach, dass es fast einer Autosuggestion gleichkommt. Ich muss das Wagnis jetzt eingehen.“ Pinchas sah Yehudas jungenhafte Neugierde und Unerfahrenheit, aber was sollte er sagen?
„Wenn es scheitern wird, wäre es keine grundsätzliche Katastrophe. Na schön, versuche es, vielleicht gelingt dir das Wunder.“
Yehuda ging zufrieden zurück in seine Wohnung, nahm den einjährigen Ari auf den Arm und setzte sich mit ihm in sein Arbeitszimmer. Er dachte über alle Facetten seiner weitreichenden Entscheidung nach. Ja sicher, was wäre, wenn alles scheitern würde? Es wäre wirklich keine Katastrophe für sein unmittelbares Leben, aber er würde sich entsetzlich blamiert haben und müsste sich sein Leben lang Vorwürfe über seine Leichtfertigkeit anhören. Er setzte den Kleinen ab, der munter durch das Zimmer und hinaus auf den Flur robbte. Nun musste er den ersten Teil seines Plans vorbereiten.
***
Yehuda rief am nächsten Tag von seinem Büro aus bei der Stadtverwaltung an und fragte nach, wie der Stand bei den Baugenehmigungen für die Parkplätze wäre. Der Beamte im Bauamt antwortete am nächsten Tag. Ihm wurde zu seiner Überraschung mitgeteilt, dass die Genehmigungen bereits vorlägen und er das Amt aufsuchen könnte, um die Verträge zu unterschreiben.
Tel-Aviv benötigte dringend Bauland und die Parkplätze waren der Verwaltung willkommen. Die neuen Hochhäuser würden Stellplätze in ihren unteren Geschossen haben, sodass keine Parkflächen verloren gingen. Yehuda ließ sich Kopien der Vertragsentwürfe schicken und sandte sie an einen Rechtsanwalt weiter. Der Anwalt hatte nur wenige kleine Änderungen, die sofort akzeptiert wurden und so kamen Yehuda und Esther in den Besitz von jeweils 1,25 Millionen Schekel, was 357.500 US-Dollar entsprach. Yehuda ließ sich Olga gegenüber nichts anmerken, was ihm jedoch nicht leichtfiel.
***
Zwei Tage später wählte sich Yehuda etwas nervös in den Call für Analysten von Explizit - Pharmaceuticals ein. Es war sein erster Kontakt mit der Firma. Yehuda konnte nicht sehen, wie viele Teilnehmer sich eingewählt hatten und welche Analysten teilnahmen.
Das letzte Quartal war für das Unternehmen eine Katastrophe gewesen, wie alle anderen auch. Man sprach es nicht aus, doch es war klar, dass die Firma am Ende war. Als der Call zu Ende war, wartete Yehuda eine halbe Stunde, dann rief er Professor Nicos Papadopulos an, einen der beiden Gründer von Explizit - Pharmaceuticals.
Er stellte sich als Aktionär vor und fragte vorsichtig, wie man die Firma noch retten könnte. Papadopulos hatte jede Hoffnung verloren und sagte mit finsterer Stimme nur zwei Wörter:
„Überhaupt nicht.“ Warum der Anrufer das wissen wolle? Yehuda stellte sich in seiner Funktion als Produktmanager für ein Antibiotikum vor und fragte geradeheraus, ob nicht ein Verkaufspreis von 150 Dollar den Absatz stark verbessern würde.
„Das weiß ich nicht“, sagte Papadopulos abweisend und begann, sich über den Anruf zu wundern. „Wir haben 2.000 Dollar angesetzt, weil wir damit gerechnet haben, dass die verkaufte Menge sehr niedrig bleiben würde und wir benötigten dringend Geld.“ Dann dachte er nach und sagte:
„Natürlich kann man wesentlich mehr verkaufen für einen niedrigeren Preis. Aber wie lange wird es dauern, bis sich ein günstigerer Preis durchsetzt?“
„Man wird schnell die Verkaufszahlen steigern können“, sagte Yehuda mit einer Spur Optimismus und fügte hinzu, er wisse, wovon er rede.
„Na schön“, rief Papadopulos, inzwischen schlecht gelaunt, ins Telefon: „Kaufen Sie die Firma und machen Sie damit, was Sie wollen.“
„Genau das habe ich vor“, entgegnete Yehuda. „Wann können wir darüber reden?“ Papadopulos, der ihn einfach nicht ernst nehmen konnte, sagte:
„Kommen Sie sofort vorbei. Wir haben die Räume noch bis zum Ende des nächsten Monats gemietet. Dann fliegen wir hier raus.“ Yehuda war sofort einverstanden.
„Gut, ich bin in zwei Tagen bei Ihnen.“ Als das Gespräch beendet war, lachte Papadopulos erst, dann rief er seinen Kompagnon Professor Francesco Moretti an.
„Eben hat hier so ein Verrückter angerufen, der will in zwei Tagen hier sein und die Firma kaufen.“ Beide lachten und machten Scherze, doch sie hofften insgeheim, dass es ein ernsthaftes Ansinnen wäre. Yehuda war es ernst. Er nahm sich drei Tage frei und machte sich am nächsten Morgen wieder auf den Weg zum Flughafen. Olga sagte er nur kurz, dass er in die USA fliegen müsse. „Gute Reise“, antwortete sie.
Kapitel 2
Morten Wilson trug wenige sympathische Züge. Er war selbstbezogen und suchte in allem seinen Vorteil. Mit zweiunddreißig Jahren hatte er es zum Vertriebsleiter einer Geschäftseinheit eines der weltweit größten Pharmaunternehmen gebracht. Was ihn dorthin gelangen ließ, war seine dreiste Unaufrichtigkeit und dass er keine Scheu davor hatte, jeden Widersacher – und er sah in jedem Kollegen einen solchen – kaltschnäuzig zu verleumden. In dem amerikanischen Unternehmen herrschte eine Betriebskultur, die gerade ein solches Verhalten förderte. In der englischen Stadt Manchester, wo Morten lebte, hatte die Firma ihre Basis für Europa. Sein großes Verkaufstalent beeindruckte den Vorstandsvorsitzenden des Gesamtkonzerns so sehr, dass ihm Morten als unentbehrlich erschien.
Er schätzte vorwiegend, wie sich Morten nach oben geboxt hatte. Dieser Geschäftsführer sah sowohl über Mortens unaufrichtige Art hinweg als auch über die Extravaganzen, die er sich selbstherrlich herausnahm. Dazu zählten Flüge in der ersten Klasse, das Anmieten von Luxusfahrzeugen, Hubschrauberflüge und Betreuungsfeste für Kunden, bei denen alle Schranken fielen.
Morten sammelte in seiner Laufbahn, wie konnte es anders sein, viele Freunde, aber vor allem Feinde. Der Vorstandsvorsitzende, bei dem die Abrechnungen landeten, welche die Buchhaltung durchaus nicht akzeptieren wollte, redete ihm bisweilen sanft ins Gewissen und strich ihm die eine oder andere Quittung, doch hatte es Morten innerhalb eines Jahres geschafft, sowohl den Umsatz als auch die Marge um jeweils 10 Prozent zu steigern und das war es, was zählte. In Mortens Privatleben herrschte hingegen einige Unordnung. Er war zweimal geschieden und musste für zwei Kinder Alimente bezahlen, wogegen er sich mit allen Mitteln sträubte. Seine Kollegen vermuteten, dass ihm trotz seines stattlichen Einkommens alles weg gepfändet wurde. Deshalb wohnte er wohl bei seiner Mutter. Er neigte dazu, laut Musik zu hören, die man nur als maximal disharmonisch bezeichnen konnte, und besuchte mit Leidenschaft Rockkonzerte. Manchmal war er tagelang nicht aufzufinden und erschien dann in einem erbärmlichen Zustand zu den Sitzungen. Der Aufsichtsrat versuchte Morten seit Langem loszuwerden, doch wehrten sich der Betriebsrat gegen sein Ausscheiden, da auch sie von seinen Eskapaden profitierten. Morten setzte seine Verkäufer unter Druck, verteilte aber auch großzügige Boni und die Firma bezahlte Besuche in gewissen Einrichtungen. Morton hatte sehr viel Energie, worin seine größte Stärke lag. Er redete überzeugend und eloquent und konnte sich mit einem feinen Lächeln in den charmantesten Unterhalter verwandeln. Auch hatte er ein gutes Produktwissen und rechnete auf seinem übergroßen Taschenrechner, der auf seinem Schreibtisch stand, Rabattsätze aus, welche die Marktsituation treffend widerspiegelten.
Wenn es sein musste, erschien er auch in einem exzellent passenden Anzug und sah überhaupt sehr stattlich aus, was auf seinen regelmäßigen Besuch in einem Fitnessstudio zurückging. Morten war nicht klassisch intelligent, sondern hatte diese Bauernschläue, die sich Menschen aneignen, wenn sie blind ihrem Instinkt folgten und ein gewisses Maß an emotionaler Intelligenz besitzen.
Wegen seiner Unberechenbarkeit und seiner Intrigen war er sehr unbeliebt, aber seine Kollegen wagten nicht, sich mit ihm anzulegen. Die einen meinten, mit halbem Ernst, man würde ihn eines Tages mit einem Kopfschuss in seinem Bürostuhl kreisend vorfinden. Andere trieben seine Versetzung nach Russland oder in den Kongo voran, was aber bisher noch jedes Mal scheiterte.
***
An einem Morgen im Oktober wurde Morten Wilson in das Büro seines Chefs, des Leiters der Geschäftseinheit, gebeten. Albert Taylor verfolgte eine Sache, bei der er Mortens Eigenschaften gewinnbringend einsetzen konnte.
„Schließ die Tür“, bat er ihn als Erstes und setzte ein wichtiges Gesicht auf.
„Hast du schon einmal von einer Firma namens Explizit - Pharmaceuticals gehört?“, fragte Albert Taylor. Morten verneinte. Er hatte sich nicht auf einen Besucherstuhl gesetzt, sondern lehnte an einem Nebentisch, auf dem die Kaffeemaschine stand.
„Die Firma ist praktisch pleite“, erklärte Albert Taylor, mal auf seinen Computer, mal zu Morten blickend.
„Sie ist eines der vielen Start-ups, die aus der Harvard Medical School hervorgegangen sind. Die Leute haben es tatsächlich geschafft, eine Zulassung für ihr Produkt zu bekommen. Es ist ein Antibiotikum gegen multiresistente Keime.“ Albert Taylor erklärte weitere Einzelheiten.
„Die Firma gehört zwei Alten, die beide nicht aus Amerika stammen. Ein Grieche und ein Italiener. Nicos Papadopulos und Francesco Moretti heißen sie, beides Professoren. Vielleicht haben sie einfach keine Ahnung, wie man eine Firma führt. Es sind beides bekannte Wissenschaftler, die inzwischen im Ruhestand sind. Unser Vertrieb in den USA hat es geschafft, dass das Medikament bisher von keinem Großhändler aufgenommen wurde. Was die Firma aber interessant macht, sind die Rechte an den Wirkstoffen, das heißt an dem Know-how. Natürlich haben die alles patentiert und das ist genau, was wir brauchen: ihre Patente“.
Albert stand auf, ging an die Kaffeemaschine, schob Morten zur Seite, goss sich Kaffee ein, ohne Morten etwas anzubieten, und sagte etwas boshaft:
„Vermutlich sind das die letzten Werte, die ihnen geblieben sind.“
„Okay, und was wäre meine Aufgabe dabei?“, fragte Morten, der seine Arme vor dem Oberkörper verschränkte und ungeduldig auf seine Uhr sah.