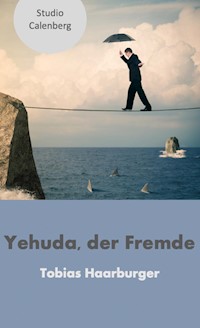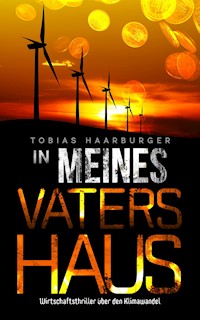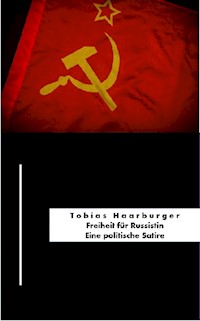4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ashanti Laura Hennesy ist Rechtsanwältin in Berlin. Sie bearbeitet nur kleine unbedeutende Fälle und verdient wenig Geld. Ashanti möchte eine bekannte und erfolgreiche Anwältin sein. Sie liebt ihre Tochter und kümmert sich um ihre schwierige Mutter. Der Vater ihrer Tochter hatte sie vor der Geburt des Kindes verlassen so wie es ihr eigener Vater auch mit ihrer Mutter gemacht hatte. Ashanti bekommt einen ungewöhnlichen Fall angetragen. Mit Härte und Klugheit setzt sie sich durch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ashanti Laura Hennesy
Titel SeiteTitel Seite
Tobias Haarburger
Ashanti Laura Hennesy
Die Anwältin
Roman
Copyright: © 2021 Tobias Haarburger
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
.
Kapitel 1
Ashanti Laura Hennesy wurde allgemein als schöner Name angesehen. Er klang wie eine Melodie, oder ein kleines Gedicht, oder wie ein Flüsschen, das sich durch sattes grünes Gras in einem Tal entlang schlängelt. Ashanti liebte ihren Namen. Ihre Mutter, die aus Südafrika stammte und eine Vorliebe für die Afrikanische Kultur und allerlei afrikanische Gebräuche besaß, gab ihr diesen Namen - Ashanti. Der zweite Vorname Laura war der Name einer südafrikanischen Politikerin, die eine Rolle bei der Überwindung der Apartheit spielte. Es war ein Ehrenname. Der Familienname Hennesy, gehörte ihrem Vater, über den im Allgemeinen nicht gesprochen wurde. Der Name Ashanti bedeutete große, starke Frau – und das traf zu. Ashanti war ein Meter und Sechsundachtzig groß, schlank und muskulös. Sie trug ihr Haar kurz und ihr Gesicht erschien entgegen ihrem Wesen mitunter hart. Regelmäßig ging sie Joggen, Schwimmen und im Winter in ein Fitnessstudio, wo sie ausgiebig trainierte. Vor allem liebte sie den Kampfsport Krav Maga und hatte den Brown Belt G5 erworben. Ashanti besuchte jeden Dienstag gegen Abend und jeden Samstag, das Training.
An diesem Samstagmorgen, es war ein warmer Junitag, spazierte sie munter und gut gelaunt mit ihrer Tochter den Kurfürstendamm entlang. Es war Ashantis achtunddreißigster Geburtstag. Salomé, die zehn Jahre alt war und nach den Sommerferien auf ein Gymnasium wechseln würde, war seit einigen Tagen in einer besonderen Laune Fragen zu stellen.
An diesem Morgen interessierte sie sich für ihre Großmutter. Ashanti, die sommerlich gekleidet war und eine Sonnenbrille trug, suchte ein bestimmtes Geschäft. Es hatte nichts Besonderes damit auf sich. Sie wollte eine bestimmte Lampe, die sie im Internet gesehen hatte, aber eigentlich verbrachte sie gerne Zeit mit Salomé in der Stadt. Salomé war aufgefallen, dass ihre Großmutter während der letzten drei Jahre vier Mal umgezogen war. Was es damit auf sich habe, wollte sie nun wissen. Ashanti war nicht sicher, wie sie antworten sollte.
»Da muss ich weit ausholen, um das zu erklären«, antwortete Ashanti, die sich einerseits über die wachsende Neugier ihrer Tochter freute, aber ausgerechnet das Thema Anne, mit vollständigem Namen hieß ihre Mutter Anne Abena Salomé Wilson, war nicht einfach zu erklären. Sie wollte Anne keinesfalls in einem schlechten Licht darstellen. Während des Gehens war es zusätzlich nicht einfach die ganze komplexe Persönlichkeit ihrer Mutter zu erklären. Ashanti entschied die Frage nicht direkt zu beantworten, sondern das Thema auf Zuhause zu verschieben.
Dann, nach einem Moment, erklärte sie doch:
»Anne hat eine Art, sich schnell zu verlieben. Sie mag nicht alleine sein, nimmt sich aber zu wenig Zeit, einen Mann kennenzulernen. Das ist so eine Eigenart von ihr, so wie sie noch einige andere Eigenarten hat. Sie lernt jemanden kennen, zieht sofort bei ihm ein und nach einiger Zeit bemerkt sie, dass das nichts wird und sucht sich genauso überstürzt jemanden anderen. Das war schon immer so.« Ashanti, die keine besonders dunkle Haut und schwarzes Haar hatte, dachte daran, dass sie einen Sonnenbrand bekommen würde, wenn sie nicht Creme auftragen, oder eine Bluse anziehen würde.
»Aber warum macht sie das? Sie kann doch auch bei uns wohnen?« fragte Salomé und die Frage war sehr naheliegend.
»Nein!« Ashanti konnte ein Lachen nicht unterdrücken. »Das geht bestimmt nicht.« Sie unterbrach die Unterhaltung und sah auf das Display ihres Mobiltelefons. Direkt da vorne musste das Geschäft sein.
»Warum geht das nicht?«, bohrte Salomé nach.
»Na zum Beispiel, weil sie dauernd Cannabis raucht und das möchte ich nicht in der Wohnung haben. Nun fragte Salomé was Cannabis wäre.
»Das ist eine Droge, die den Verstand betäubt und süchtig machen kann«, war Ashantis knappe Antwort. Sie standen vor dem Geschäft.
»Ich verstehe nicht, erkläre es mir, was heißt den Verstand betäubt?« Ashanti mochte das jetzt während des Betretens des Geschäftes nicht erklären.
»Später«, sagte sie »Ja?« Salomé lies ihre Schultern hängen, hob ihren Kopf und imitierte ein Trotten, wie unter einer Last. Dabei sagte sie mit gekünsteltem Jammer:
»Och, immer später, nie jetzt.« Ashanti sah sie kurz an und amüsierte sich über die schauspielerische Einlage, fügte jedoch nichts hinzu. Sie sprach mit einem Verkäufer, der ihr nach längerer Suche die gewünschte Lampe brachte.
Als sie bezahlte und sich noch kurz umsah, sprach sie jemand an. Es war ein Kollege, ein Rechtsanwalt, den sie eigentlich nur flüchtig kannte. Sein Name war Magnus Bode-Königstreu, Doktor Magnus Bode-Königstreu, auf seinen Titel legte er wert. Er war von gedrungener, rundlicher Gestalt, trug ein bordeauxrotes Poloshirt und ein helle, beige Freizeithose, wie sie bei Männern in seinem Alter sehr beliebt geworden war und gelbe, mutmaßlich teure Mokassins und eine Brille, welche einen auffälligen Goldrahmen hatte. Seine fünfundsechzig Jahre versuchte er durch Sonnenbräune und einen schmissigen Haarschnitt zu übertünchen. Er sah zu Ashanti auf. Man wechselte ein paar Belanglosigkeiten. Dann allerdings sagte Herr Dr. Bode-Königstreu zu Ashantis Überraschung:
»Ich habe sie zufällig hier hineingehen sehen und würde gerne etwas mit ihnen besprechen.« Ashanti fragte worum es ginge und ob man das wirklich hier in dem Geschäft besprechen könne. Sie nahmen in einem Café, das sich in der Nähe befand Platz.
»Wie sie vielleicht wissen, ist unsere Kanzlei auf Strafrecht spezialisiert, wie sie ja auch«, begann Dr. Bode-Königstreu.
»Ich kann übrigens nicht so lange bleiben, meine Frau ist in dem Geschäft gegenüber.« Er wies auf einen teuren Damenausstatter, verzog aber keine Miene dabei, sondern sah Ashanti mit einem merkwürdigen und bedeutungsvollen Ernst an. Seine Hände lagen mit verschränkten Fingern auf dem Tisch.
»Wir bearbeiten einen Fall, bei dem fünf bulgarische Staatsbürger angeklagt werden. Im Moment sitzen sie in Moabit in Untersuchungshaft.« Herr Bode-Königstreu wechselte nun zu einem missmutigen Gesichtsausdruck.
»Es geht um das Delikt, das uns am meisten Sorgen macht, Geldwäsche.« Er sah Ashanti kurz an, als wolle er ihre Reaktion prüfen. Ashanti sah jedoch stur und ausdruckslos zu ihm hin.
»Jeder der fünf Angeklagten muss einen eigenen Strafverteidiger haben wie sie wissen. Uns ist jemand ausgefallen und als ich sie eben in das Geschäft gehen sah, dachte ich ob sie für den Kollegen vielleicht einspringen wollen. Die Mandanten bezahlen sehr gut und gegen Vorkasse, was in solchen Fällen üblich ist. Hätten sie denn Zeit, einen neuen Fall zu übernehmen?« Ashanti kam die kleine Geschichte merkwürdig vor. Es war jemand abgesprungen, gut, aber man kannte sich nicht.
Sie war seit elf Jahren Anwältin, seit acht Jahren Fachanwältin für Strafrecht. Die Kanzlei hatte sie von einer Frau übernommen, die in den Ruhestand gegangen war. Eine Angestellte konnte sie sich nicht leisten. Was ihr übrig blieb, waren 50.000 EUR im Jahr, vor Steuern. Der Fall hörte sich komplex und schwierig an. Geldwäsche hatte sie bisher nicht bearbeitet. Sie verteidigte kleine Drogendealer, Hooligans, Autodiebe, notorische Schwarzfahrer und Ladendiebe, Internetbetrüger einfache, gestrandete Menschen aber mit der organisierten Kriminalität hatte sie noch nicht zu tun.
»Kann ich den Kollegen sprechen, der Abgesprungen ist?« Fragte sie aus einer spontanen Überlegung heraus. Salomé, die dasselbe schwarze Haar wie ihre Mutter hatte und ihr im Übrigen sehr ähnlich sah, blieb ganz still neben ihr sitzen und drückte sich ein paarmal an sie und legte ihren Arm um Ashantis Hüfte und Ashanti legte ihren Arm um sie.
»Naja, das wird nicht möglich sein, der Kollege ist leider verstorben«, sagte Dr. Bode-Königstreu, breitete die Arme kurz aus und lies sie sein Bedauern untermalend auf die Knie fallen. »Sie müssten sich schnell entscheiden, am Montagnachmittag ist die nächste Anhörung vor dem Haftrichter.
Ashanti zögerte, ihre Instinkte sagten ihr, dass sie mit Schwerkriminellen nichts zu tun haben sollte.
»An was ist der denn gestorben, der Kollege?«
»An einer Gehirnblutung, ganz plötzlich.« Dr. Bode-Königstreu sagte das traurig, wie man kondolierte. Er sah, wie Ashanti zögerte und auf was die Unterredung hinauslaufen würde. Nun nahm er einen distinguierten Habitus an, richtete sich auf und sagte,
»Die Vergütung beträgt siebzigtausend Euro im Jahr.« Ashanti staunte. Das gab ihr wiederum, die sie seit Jahren von der Hand in den Mund lebte und nie etwas zurücklegen konnte, weil sie ihre Mutter unterstütze und einfach wenig verdiente, zu denken. Warum ausgerechnet sie für den Fall in Frage kam, verstand sie noch immer nicht. Aber was soll‘s, dachte sie. Viel machen konnte sie sowieso nicht.
»Ich vertrete den Angeklagten Bulgaren. Die Strategie, die Schriftsätze, die Einvernahme von Zeugen vor Gericht und alles andere müssen sie machen.«
»Einverstanden«, sagte Herr Bode-Königstreu und konnte eine Erleichterung nicht verbergen, was Ashanti wiederum zu denken gab. Man verabredete sich für den kommenden Montagvormittag in Herrn Bodes Kanzlei, um die Einzelheiten zu besprechen.
Die Begegnung war keinesfalls das Ergebnis eines Zufalls an einem Samstagmorgen in einem Lampengeschäft auf dem Kurfürstendamm. Frau Bode weilte auf Sylt und Dr. Bode-Königstreu hatte Ashanti einem Auswahlverfahren entnommen, das von seinen Angestellten mit einigem Aufwand durchgeführt worden war. Ashanti war genauso wie Herr Bode sich es gewünscht hatte. Naiv, unerfahren, fragte nicht nach, was man unbedingt hätte erfragen müssen, verbrachte ihre Zeit mit ihrer Tochter und sie wäre überfordert und seiner Kanzlei ausgeliefert. Die siebzigtausend Euro waren wenig, im Vergleich zu dem, was er selbst verlangte.
***
Ashanti setzte Salomé bei einer Schulfreundin ab. Sie hatte ein Date. Seit der Vater ihrer Tochter sie am Tage nach der Geburt, ohne ein Wort zu sagen verlassen hatte, lebte sie alleine. Das war nun zehn Jahre her. Sie hatte als Mutter, die ihr Kind alleine erzog, eigentlich keine Zeit und keine Muße sich auf ein neues Abenteuer einzulassen. Das hielt bis vor einem Jahr. Dass der Vater sie verließ, war eine Katastrophe, ein Trauma für sie. Es hatte sich genau das wiederholt, was ihrer Mutter widerfahren war. Auch deren Mann, Malcom Hunter Hennesy verlies seine Frau, den sie gegen ihren Willen ein paar Tage vor der Geburt heiratete. Anne, ihre Mutter war schon damals überfordert darin sich zu binden und begann ihr Leben zwischen politischem Protest und versuchen irgendwie auf die Beine zu kommen. Sie gründete immer wieder kleine Läden doch noch an keinem Tag in ihrem Leben war sie ohne Schulden und verzweifelten finanziellen Verhältnissen. Sie hatte die große Fähigkeit sorglos und an der Realität vorbei in den Tag hinein zu leben, wobei sie in den letzten Jahren, nachdem sie die fünfzig überschritten hatte, was nun sechs Jahre zurück lag, Ashanti hatte sie mit achtzehn Jahren bekommen, etwas mehr Ruhe fand und den letzten Laden, den sie gründete mit Sorgfalt und Ernsthaftigkeit betrieb. Sie war mit siebzehn Jahren aus Südafrika nach Berlin gekommen.
Anne hatte schon immer einen Hang zu leichten Drogen und lies, seit sie sechzehn Jahre alt war, keinen Tag aus, ohne sich in den sie beglückenden Zustand zu versetzen und Joints zu rauchen. Sie fand das cool und ließ sie alles verdrängen, was sie belastete. Das ging mit erotischen Erlebnissen einher was zu einem Kreislauf des Verlangens mal nach dem einen und mal dem anderen führte. Eines Tages bekam die junge Frau einen Tip.
Ein junger Mexikaner, den es irgendwie nach Südafrika verschlagen hatte, erzählte, während man an einem Feuer am Strand Joints kreisen lies, dass man in Mexiko gerne auf junge Frauen zurückgriff, um sie mit dem Transport von Drogen in die USA zu betrauen. Hierbei handelte es sich nicht um harmloses Cannabis, sondern um Heroin. Das mit den jungen Frauen war ein dümmliches Gerücht, an dem nichts dran war. Vielleicht wollte sich der Mexikaner gegenüber den Mädchen, die um ihn herum saßen, wichtigtun. Jedenfalls war die junge, naive Anne wie elektrisiert. Die Gefahr, die darin lag, sich mit solchen Leuten einzulassen und den ganzen Irrsinn dieser Idee sah sie nicht. Sie sah überhaupt nichts, sie war wie blind. Sie wollte ihrem Elternhaus, dem sonntäglichen Kirchgang und der sterilen Ordnung, in der sie lebte, entkommen. Also machte sie sich mit ihren siebzehn Jahren tatsächlich auf nach Mexiko.
Es war die zentrale Dummheit ihres Lebens. Für sie war es in dem Moment vor allem ein Abenteuer. Der Mexikaner gab ihr eine Adresse. Naiv und voller Tatendrang traf sie in Mexiko ein. Die Polizei nahm sie noch am Flughafen fest, verhörte sie kurz und nahm das junge, ausgebückste Mädchen fest. Unter Tränen gestand sie was sie vorhatte. Sie wäre nun auf einer Liste mit internationalen Drogenkurieren, sagte man ihr grob. Man gab ihr vierundzwanzig Stunden Zeit, das Land zu verlassen, kümmerte sich aber ansonsten nicht um sie, indem man die südafrikanische Botschaft, oder ihre Eltern informiert hätte. Diese irrwitzige Geschichte endete schließlich in Berlin. Nach Südafrika wollte Anne nicht mehr. Sie hatte Angst vor ihren biederen und religiösen Eltern. England würde sie vielleicht ausliefern, was natürlich Unsinn war. Das war im Jahr 1981. Berlin galt damals schon als bunte Stadt, die jeden aufnahm, der vor etwas flüchtete und bot grenzenlose Toleranz und die Freiheit für ein Leben jenseits aller bürgerlichen Gepflogenheiten. Drogen gab es in Hülle und Fülle. Dort wollte Anne hin.
Sie schaffte es auch hin zu kommen. Aufgewühlt von dem Ereignis in Mexiko, einsam und ängstlich und ohne Geld, lebte sie vier Wochen in Berlin. Dann traf sie einen jungen Amerikaner. Der hieß Malcom Hunter Hennesy. Er war beim Militär, was für Anne so fremd war, wie die Rückseite des Mondes. Anne, die hübsch, schlank und groß gewachsen war, jobbte seit einigen Tagen in einem Eiscafé. Sie sprach nicht Deutsch und wusste am Anfang nicht im Geringsten was zu tun war. Der Pächter des Eiscafés jedoch hatte ein Nachsehen mit dem exotischen Mädchen, das alleine aus Südafrika nach Berlin gekommen war. Er selbst stammte aus Rumänien und wusste wie es war mit nichts in einer fremden Welt anzukommen. Dort in diesem Eiscafé fand sich der Amerikaner nun täglich ein. Mit seinem kantigen, wohlgenährten Gesicht und seinem breiten, aber mitunter falschen Lächeln sah er Anne sehnsuchtsvoll an und redete mit ihr, wann immer es der Ansturm der Kunden erlaubte. Er war einfach und ohne Bildung und stammte aus einem winzigen Ort in Montana, dessen Name sich niemand merken konnte. Er hatte allerdings das Talent in einer Art von Überschwänglichkeit und Euphorie Menschen anzustecken und sie mit sich zu reisen. Anne, die noch kein Wort Deutsch sprach malte es sich aus, wie es wäre mit diesem energischen jungen Amerikaner in die Staaten zu ziehen. Es wäre ein Traum, der wahr würde und könnte ihr eine Perspektive geben. Was für ein schlichtes Wesen er hatte und dass er, außer mit Schraubenschlüsseln zu hantieren nichts konnte, abgesehen davon, dass er daher fabulierte, viel ihr zwischen ihren Träumen nicht auf. Nach wenigen Tagen war sie Schwanger. Was sie nicht wusste und nie danach fragte, weil sie davon einfach nichts verstand, war, dass er noch genau neuneinhalb Monate in Berlin sein und dann aus der Armee ausscheiden würde. Er bat sie inständig zu heiraten, was sie eigentlich überhaupt nicht mochte. Es machte ihr Angst, sich eng zu binden, ja, es widerstrebte ihrer ganzen Natur. Sie musste sich frei fühlen. Andererseits war sie unsicher, fühlte sich verloren und hatte mit ihrem Bauch, der wuchs, plötzlich die Sehnsucht nach einem Zuhause. Sie willigte ein. Was Malcom Hunter bewog zu heiraten, konnte sie sich hinterher nicht erklären. Vielleicht war es eine seiner spontanen euphorischen Ideen, die für ein paar Tage anhielt.
Tatsächlich war Malcolm Hunter Hennesy ein verantwortungsloser, gewissenloser und selbstsüchtiger junger Mensch, der keinen Tag vorausdachte und der sie, ohne Anteil an ihrem Schicksal zu nehmen, einfach sitzen ließ. Das war zwei Wochen nach der Geburt, als seine Dienstzeit endete. Er reiste einfach ab. Anne hatte nicht einmal seine Adresse. Nun saß sie da in Berlin, hatte ein Kind, kein Geld, sprach nicht Deutsch und war völlig alleine. Sie wurde wütend auf die Welt, auf sich selbst und einfach auf alles und jeden. Dann wurde sie verzweifelt. Sie hätte sich an die amerikanische Botschaft wenden und nach der Adresse und dem Verbleib ihres Mannes fragen können, doch darauf kam sie nicht und sie hätte sich erbärmlich gefühlt, wenn sie um Unterstützung hätte betteln müssen. Wie schrecklich und ungerecht war das Leben. Sie war achtzehn Jahr alt, ohnehin labil und mehr verunsichert denn je. Sie kehrte in die ein Zimmer Wohnung zurück, die sie von ihrem Geld, dass sie im Eiscafé verdiente gemietet hatte. Im übernächsten Monat musste sie ausziehen. Nun ergab sich aber ein glücklicher Zufall.
Ihre Nachbarin, eine ältere Dame mit Namen Heidemarie, den Nachnamen nahm Anne gar nicht wahr, kümmerte sich um sie. Sie hatte eine winzige Rente und konnte sich ebenfalls nicht mehr als die Einzimmerwohnung in diesem von manchen befremdlichen Menschen bewohnten Hochhaus leisten. Zunächst kaufte sie für Anne ein. Dann kümmerte sie sich um Sozialhilfe und um Wohngeld. Schließlich bot sie an auf Annes Tochter, die den witzigen Namen Ashanti Laura bekommen hatte aufzupassen, so dass Anne weiterhin in ihrem Eiscafé arbeiten konnte. Anne war der Frau unendlich dankbar. Heidemarie, die sehr einsam war, bekam eine Aufgabe, eine die sie glücklich machte.
Anne lernte nach und nach Deutsch und eröffnete gleich mit achtzehn Jahren ihren ersten Laden. Eigentlich bot sie ihr Leben lang immer dieselben Dinge an. Afrikanische Kunst, darunter afrikanische Kultgegenstände und unter dem Ladentisch verkaufte sie Cannabis und Zubehör aller Art. Anne blieb für immer verschroben. Sie lebte mit eigentümlichen Vorstellungen, das menschliche Beisammensein betreffend. Nach dem Trauma mit dem Amerikaner konnte sie sich nicht mehr binden, konnte aber auch nicht alleine sein. Sie blieb immer wieder ganze Nächte weg, ohne der besorgten Heidemarie zu sagen wo sie war und überhaupt, dass sie nicht nach Hause kommen würde.
Sie begann sich für Politik zu interessieren und fand einen Gefallen daran, gegen die Nachrüstung zu demonstrieren und für freie Abtreibung, was für sie, weil sie sich mit ihren achtzehn Jahren auf den Amerikaner verlies, nicht in Frage gekommen war. Das blieb für sie ein besonders wunder Punkt. Sie hatte ohnehin schon eine Neigung sich selbst im Mittelpunkt zu sehen, oder besser gesagt, sie hatte deutliche narzisstische Anwandlungen. Jedenfalls entwickelte sie eine immer größere Fahrlässigkeit ihrer Tochter gegenüber. Sie wollte Leben und Spaß haben und nicht die biedere Mutter sein. Sie war in Berlin, bekam einen stetig wachsenden Freundeskreis und manches Mal, wenn sie in den Armen irgendeines Fremden einschlief, vergaß sie vollkommen, dass sie die kleine Ashanti hatte. Wenn sie irgendwann nach Hause kam, musste sie sich hinlegen und brauchte mehrere Stunden Schlaf. Sie kleidete sich bisweilen in einem damals bei jungen Menschen populären Punk Stil, ließ sich das Haar grün, oder blau Färben oder ganz abschneiden. Sie trug Ringe und Stecker im Gesicht, war plötzlich tätowiert und die brave Heidemarie, die unter der Verantwortung zu leiden begann, suchte eines Tages eine Lösung für ihr Problem.
Ashanti war ein halbes Jahr alt und bedurfte der völligen Zuwendung, als Heidemarie Anne eines Tages zu sich in die Wohnung bat, als sie aus ihrem Laden nach Hause kam. Es saßen zwei merkwürdige graue Menschen in ihrer Wohnung. Die Gestapo, dachte Anne. Den Begriff hatte sie während der Demonstrationen gelernt. Die beiden waren vom Jugendamt. Ein Mann, Mitte Vierzig, Cordhose, Pullunder und Knebelbart, sowie eine Frau, die fünfzig sein mochte und irgendwie apathisch wirkte, es schien kein Leben in ihr zu sein, sie sagte jedenfalls während der ganzen Unterredung kein Wort. Die Beiden führten aus, was sie schon hunderte Male gemacht hatten. Man bot freundlich an, Anne zu helfen. Ihr Töchterchen könne doch vorübergehend bei eine Pflegefamilie unterkommen. Man sähe offen gestanden nicht, dass Anne die notwendige Sorgfalt und Hingabe aufbringe, die ein Kleinkind nun einmal benötigte. Anne empörte sich und fühlte sich vor allem bevormundet und das vertrug sie überhaupt nicht. Sie schwieg einen Moment und dachte was Heidemarie doch für eine Denunziantin war. Die arme Heidemarie aber, saß befangen und unsicher in ihrem tiefen Sesel und walkte nervös ein Taschentuch. Was hätte sie auch machen sollen? Sie gehörte einer Generation an, die für das Auftreten und das leichtfertige Leben von Anne, so sah sie es jedenfalls, nicht das geringste Verständnis hatte, ja ihr war es ein Rätsel, wie man sich so kleiden und gehen lassen konnte.
Wie Anne aber da so saß, mit ihrem kahlgeschorenen Kopf, den riesigen runden Ohrringen, den Piercings und den schwarz lackierten Fingernägeln, fühlte sie sich plötzlich unwohl gegenüber diesen sorgsam angepassten Menschen.
»Nein, ich gebe Ashanti nicht weg«, sagte sie bestimmt. »Ich werde mich um sie kümmern.«
»Das wäre schön, wenn sie das hinbekommen würden. Sie müssen wissen, dass wir ansonsten das Mädchen von uns aus unterbringen müssten.« Anne verstand nicht den geringsten Sinn darin. Sie fühlte sich nur drangsaliert und konnte diese Einmischung in ihr Leben nicht akzeptieren.
»Ich nehme sie mit in meinen Laden, das ist kein Problem.«
»Ein Laden ist kein Ort für das Aufwachsen eines Kindes. Sie müssen schon eine passende Umgebung finden, oder selbst Zuhause bleiben«, sagte der Mann mit Bedauern, aber dennoch bestimmt. Anne beherrschte sich zu sagen, was sie dachte.
»Gut, antwortete sie, ich suche eine Tagesmutter, oder einen Hort.« Man stellte die Antwort amtlich fest und kündigte an in vier Wochen wieder vorbei zu kommen. Anne solle die Adresse der Tagesmutter, oder des Hortes zusenden, sobald sie fündig geworden war.
Anne fand Jemanden, eine Kundin, die selbst recht wankelmütig war und sich mit esoterischen Ideen und ausschließlich in Pumphosen bekleidet, was zu jener Zeit eine Besonderheit und ein Ausdruck von Eigenwilligkeit war, meistens Barfuß ging und in einem allseits verschrobenen Weltbild lebte, aber, am Ende, es funktionierte. Die Kundin hatte selbst zwei Kinder und kümmerte sich eben auch um Ashanti, die man nur wickeln und der man nur etwas zu essen geben musste. Anne kleidete sich wieder angepasster, lies ihr Haar wachsen und das Bedürfnis wöchentlich zu protestieren lies nach. Schließlich blieb es aber so, dass Anne ihre kleine Tochter versorgte, aber mehr auch nicht tat. Sie mochte sie nicht und sie liebte sie nicht, aber sie wollte sie auch nicht hergeben, weil das eben eine Einmischung in ihr Leben war. Sie beschäftige sich kaum mit Ashanti, die ihr eine Last war, um die sie nicht gebeten hatte und die sie mit dem bösartigen Verschwinden ihres Vaters verband. Sie selbst, traf keine Schuld. Sie gab Ashanti weder Wärme noch Mutterliebe.
Ashanti blieb sehr viel alleine in der kleinen Wohnung und je älter sie wurde, um so mehr bekam sie Furcht. Ashanti hatte keine Verwandten, keine Großeltern und niemand las ihr am Abend vor, ging mit ihr in den Zoo, blödelte mit ihr herum und gab ihr die Körperlichkeit, die Umarmungen, die Küsse, die Kinder für ihre Festigung, und die Bildung von Vertrauen brauchen. Anne wurde im Gegenteil immer härter. Dann jedoch, nach vier Jahren wurde Anne wieder schwanger. Im ersten Moment konnte sie nicht sagen von wem. Dann aber grenzte sie die Möglichkeiten ein. Sollte sie das Kind bekommen? Genau zu jenem Zeitpunkt hatte sie aber Freunde, die es cool fanden Kinder zu haben. Inzwischen kannte sie viele Menschen in Berlin. Anne nahm sich vor in eine große WG zu ziehen. Dort würden ihre beiden Kinder von selbst aufwachsen. Sie bekam einen Jungen und nannte ihn ganz schlicht Thomas. Das war der Anfang von Ashantis Leben.
***
Ashanti hatte sich in einem Park verabredet. Inzwischen hatte sie ein paar Sachen über das Daten gelernt. Ohne ein bestimmtes Ziel zu haben, das heißt, ohne eine feste Erwartung daran zu knüpfen, tatsächlich einen Partner zu finden, traf sich Ashanti immer wieder mit Männern, die sie auf einer bestimmten Plattform kennenlernte. Diejenigen, die sie traf, machten bisweilen einen professionellen Eindruck, was das Dating anging. Offensichtlich waren sie seit Jahren aktiv und trafen Frauen mit verschiedenen Absichten. Ashanti nahm die meisten von ihnen nicht ernst. Dass sie dazu überging sich in einem Park und nicht an einem anderen Ort traf, hatte damit zu tun, dass sie sich spontan aus der Verabredung entfernen wollte. Sie musste nicht auf einen Kellner warten, was sich irgendwann einmal als wichtig herausstellte. Manche Männer waren auch Grünschnäbel, die nervös mit einer Blume in der Hand warteten. Das ganze Dating bekam über die Zeit einen unterhaltsamen Wert. Ashanti pflegte diese Treffen inzwischen als Abwechslung, weil sie wegen Salomé und ihrer Arbeit kaum Zeit fand, überhaupt Menschen zu kennenzulernen. Die Verletzung, die ihr Salomés Vater zufügte, saß noch immer tief. Es war ein schwererer Schock für sie verlassen zu werden, kurz bevor das Mädchen auf der Welt war. Dass ihr dasselbe wie ihrer Mutter passierte, ließ ihr Vertrauen in eine Partnerschaft eigentlich erlöschen. Grundsätzlich war Ashanti misstrauisch, auch wenn sie das Dating als Zeitvertreib mochte. Die lieblose Art, wie Anne sie in ihren ersten Jahren behandelte, tat ihr übriges. Sich wirklich binden, konnte und wollte sie nicht. Es blieb ein Spiel mit der Möglichkeit.
Ashanti ging auf den Brunnen zu, an dem man sich verabredet hatte. Sie wartete zwei Minuten, dann trat ein Mann auf sie zu. Er war groß und schlank und sah gut aus, das heißt er war etwas auffällig blass. Sein Gesicht war länglich und wohlgeformt und zeigte schmeichelhafte Falten an den Wangen. Er trug ein blaues Hemd und eine weiße Jeanshose, die ihm etwas Leichtlebiges gab. Er trug braune Bootsschuhe. Auf seiner Stirn steckte eine Sonnenbrille. Sein Haar war voll, etwas grau und kurz geschnitten. Er hatte blaue Augen und sah Ashanti neugierig und mit einem gewinnenden Lächeln an. Er schien etwas unsicher zu sein, denn er machte mit seinen Armen eine entschuldigende Bewegung und sagte:
»Hier bin ich, ich heiße Florian.« Ashanti machte die Begegnung mit diesem attraktiven Mann für einen Moment ganz benommen. Sie wurde unsicher und verstolperte sich als sie antwortete und sagte:
»Ich bin Salomé.« »Salomé?«, fragte Florian und steckte dabei seine Hände, nicht wissend was er mit ihnen tun sollte, in seine Hosentaschen. »Äh, nein, Ashanti natürlich, Salomé ist meine Tochter.« Sie lachten beide kurz. ”Ich heiße Ashanti.« Dann schlenderten sie den Kiesweg entlang. Die Junisonne lies die Blüten der Blumen erstrahlen und das Gras und die Blätter der Bäume waren satt und grün. Ashanti kam sich vor, wie in einer Szene von Rosamunde Pilcher. Das war mit Abstand der bestaussehne Mann, den sie bisher getroffen hatte.
Sie hatten vor dem Treffen über das Portal nur wenige Nachrichten ausgetaucht. Florian antwortete stets in einem Abstand von zwei Tagen. Er war Arzt, Sportmediziner. Ashanti war sein Nachname nicht bekannt, sonst hätte sie ihn vorher gegoogelt. Sie unterhielten sich über dies und das und Ashanti spürte nach einiger Zeit, dass Florian etwas bestimmtes sagen wollte, jedenfalls kürzte er seine Sätze merkwürdig ab und er wurde immer wieder nervös. Ashanti war konzentriert, wie sie es meistens war, wenn sie Gefallen an einer Sache fand. Sie ließ Florian reden und fragte immer wieder höflich und etwas neugierig nach. Sie sah ihn dabei verstohlen an und versuchte zu verstehen was für ein Typ er war. Nach einer Weile viel ihr auf, dass er es vermied über sich zu sprechen. Immer wieder gestikulierte er mit seinen Händen. Er schien wirklich nervös zu sein, was aber nichts Ungewöhnliches war, sagte sich Ashanti. Sie setzten sich nach einiger Zeit auf eine Bank und Florian fragte Ashanti was sie beruflich machen würde und wo sie wohne und auch woher ihr Name käme. Ihren Beruf als Rechtsanwältin hatte er ihrem Profil entnommen, nur nicht ihre Spezialisierung. Als sie zunächst antwortete Anwältin für Strafrecht zu sein, spürte sie eine noch größere Unruhe bei ihm.
»Du hast auch mit Strafrecht zu tun, irgendwie?« Florian blickte auf.
»Du bist sehr aufmerksam«, antwortete er, um sich dann mit seinen Unteramen auf die Knie zu stützen. Wollte er sich ihrem Blickfeld entziehen?
»Strafrecht, so kann man es nennen«, fügte er hinzu. Er war froh, dass Ashanti den Punkt von sich aus ansprach.
»Ich muss dir etwas sagen Ashanti, der Name ist übrigens sehr schön.« Er machte eine Pause, atmete tief durch und sah für einen Moment müde und hilflos aus. Dann presste er seine Lippen aufeinander: »Ich bin im Gefängnis, in der JVA in Tegel. Heute habe ich Urlaub, das heißt ich bin sowieso im offenen Vollzug. Während der Woche arbeite ich in meinem Beruf als Sportmediziner, wobei das nicht ganz stimmt, ich arbeite in der Sozialpädiatrie und Jugendmedizin beim Bezirk Mitte.« Florian blickte Ashanti kurz an, als ob er um Entschuldigung bitten und als ob er seinen Scham verbergen wollte. Dann sah er wieder auf den Boden. Ashanti brauchte einen Moment, um die Situation zu verdauen. Es war eine kalte Dusche für sie. Dieser gutaussehende, große Mann, der einen interessanten Beruf hatte und für den sie sich im ersten Augenblick interessierte, saß im Gefängnis, was ihr wiederum nicht unbekannt war. Sie kannte die JVA Tegel gut.
»Ja und verheiratet bin ich auch noch«, fügte er hinzu, diesmal ohne aufzusehen. Das traf Ashanti allerdings noch mehr. Niemand, keine Frau und kein Mann, die bei Verstand waren, begannen ein Verhältnis mit jemandem, der verheiratet war. Was nun folgte, war die kurze Zusammenfassung dessen, was geschehen war.
»Mein vollständiger Name ist Florian Stiegler-Schulz. Vielleicht hast du von mir gehört, oder gelesen, wenn du auf Strafrecht spezialisiert bist.
»Nein, das habe ich nicht«, antwortete Ashanti mit einer Stimme, die in dem Moment heißer wurde und in einem distanzierten Ton endete.
»Ich habe Sportlern beim Doping geholfen, das heißt das Gericht sah es so, dass ich sie angestiftet hätte, was aber nicht stimmte. Meine Motivation sei es gewesen Geld zu machen, ganz schnöde - Geld. Zusätzlich zu den zwei Jahren haben sie mir eine Geldstrafe von zweihunderttausend Euro aufgebrummt. Die Sportler waren keine Profis, es waren Amateursportler, die es höchstens zu einer Landesmeisterschaft brachten, manche jedenfalls. Von den zweihunderttausend Euro habe ich Einhunderttausend bezahlt. Das waren meine Ersparnisse. Wenn ich rauskomme, in sechs Wochen wird das sein, kann ich beim Bezirksamt weiter arbeiten. Mein Gehalt wird aber gepfändet. Wenn ich keinen besseren Job finde, werde ich in fünfeinhalb Jahren schuldenfrei sein.« Florian schwieg und sagte dann noch: »Ja, so sieht es aus.« Ashanti überlegte.
Irgendwie Tat ihr dieser Florian leid. Dann aber fragte sie, was ihn denn zu dem Doping angetrieben hätte. Florian sah Ashanti an. Das war die Frage, die er erwartete und die man einfach stellen musste. Was sollte er antworten? Dass er es wegen des Geldes, wegen dem Nervenkitzel und einfach deshalb getan hatte, weil er die Mittel für harmlose Medikamente hielt, was er sich fälschlicherweise einredete. Damit hatte er es vor dem Gericht begründet, was aber nicht lange standhielt.
»Ich war Spielsüchtig machte Pferdewetten«, antwortete er wahrheitsgemäß. »Pferdewetten du kennst ja den Hoppegarten. Da hat mich ein Kollege einmal mitgenommen und das war der Anfang.« Ashanti dachte nach. Dann fragte sie sich einen Moment lang ob das alles stimmen würde, so abenteuerlich war die Geschichte. Wollte er sie auf den Arm nehmen? War er überhaupt Arzt, oder ein Blender, ein Hochstapler, oder jemand der sich einen Spaß mit Frauen machte, die er traf? Andere hatten ebenfalls schon verrückte Menschen beim Daten getroffen. Sie verschränkte ihre Arme vor dem Köper, streckte ihre Beine aus und spitzte ein wenig ihre Lippen und sah Florian etwas ärgerlich werdend an.
»Ich bin jetzt Einundvierzig«, sagte er. Dass ich kein Geld mehr habe ist bitter, du kannst es dir vorstellen.« Sie schwiegen wieder.
»Und wann hast du mit dem Doping begonnen?«
»Das war vor sechs Jahren.« Antwortete Florian bereitwillig. »Ich verlor so viel Geld auf der Rennbahn, dass ich etwas machen musste. Meine Bank hatte eine Prüfung der Innenrevision und die setzten mir prompt die Pistole auf die Brust. Doping ist nichts Schwieriges. Ich wurde sowieso schon immer wieder darauf angesprochen. Im Breitensport ist das üblich geworden.« Ashanti mochte nicht mehr sitzen. Sie stand auf und sie schlenderten weiter.
»Und das ist alles wahr, was du erzählst? Du bist kein Journalist, oder ein verrückter Romeo, der Geld braucht und bunte Geschichten erfindet?« Florian lachte.
»Nein, du kannst es in der Zeitung nachlesen. Google meinen Namen. Die ganzen Berichte sind einfach zu finden. Ashanti ging weiter. Dann drehte sie sich abrupt zu Florian und fragte:
»Was willst du denn von mir? Wusstest du, dass ich auf Strafrecht spezialisiert bin?«
»Nein, überhaupt nicht. Ich suche einfach eine nette Frau, eine Freundin. Ich bin alleine, wenn sie mich entlassen. Meine Freunde haben sich abgewandt über die Jahre, wie das so ist. Am Anfang kam ab und zu noch jemand, dann hat mir niemand mehr geschrieben, mich nie besucht. Ich will keinen Sex, keine enge Beziehung, ich brauche einfach irgend Jemanden.«
Ashanti überlegte was sie tun sollte. Sie wusste nur zu gut, dass nicht alles perfekt lief im Leben. Was dieser Florian, zu dessen Äußerem diese Geschichten überhaupt nicht passten, aber wirklich wollte, war ihr nicht klar. Er war zweifellos haltlos, irgendwie ohne Orientierung hatte sich nicht im Griff, war darüber hinaus auch noch verheiratet.
»Ich werde sehen, ob ich mich noch einmal melde. Wie lange bist du denn noch auf der Plattform?«
»Zwei Monate«, antwortete Florian, der über diese Antwort, die ihm etwas Hoffnung gab, schon glücklich war.
Sie gingen zusammen an den Eingang des Parks und verabschiedeten sich mit wenigen Worten. Florian sah Ashanti, als sie ging, mit einem fordernden und finsteren Blick, der sie ängstigte nach.
Was war das für eine merkwürdige Begegnung, fragte sich Ashanti auf dem Weg nach Hause. Was hatte diesen Mann, der auf sie intelligent und im Leben verankert und etabliert wirkte, so werden lasen? Es war ihr Geburtstag und bisher hatte sich schon vieles ereignet. Wenigstens war er ehrlich, sofern die ganzen Geschichten stimmten. Am Ende war sie sehr enttäuscht von der Begegnung. An ihm war etwas Beunruhigendes.
Kapitel 2
Lorenzo Bianchi gehörte zu den kultivierten Angehörigen jener Sizilianischen Organisation, die es zu weltweiter Berühmtheit brachte und die zum Synonym für die Erwirtschaftung großer Vermögen wurde, in dem man die Schwächen menschlichen Verhaltens ausnutzte, die uns nun einmal innewohnen. Lorenzo gehörte nicht zum Kern der Organisation. Insbesondere, was ihre Methoden anging, stand er ihnen fern. Er mochte kein Blut und mochte keinen unfeinen Eifer, bei denen Menschen körperlich Schaden nahmen. Er hatte an der zwanzigjährigen Renovierung der Oper von Palermo mitgewirkt und dafür viele Huldigungen erfahren. Außerdem verdiente er sehr gut an diesem Projekt und besuchte nun so viele Aufführungen, wie es seine eng begrenzte Zeit erlaubte.
Die Oper war gleichwohl eine Sache, die nur am Rande eine Rolle spielte. Lorenzo ging mit der Zeit. Neben einem ausgeklügelten System der Bestechung, dessen Früchte er weiter veräußerte und das zu den alten Methoden gehörte, hatte Lorenzo zwei moderne Standbeine für sein Unternehmen errichtet. Er betrieb eine Bank in Prag, welche der Geldwäsche in großem Umfang diente und er betrat Neuland, in dem er Kontobuchungen abfischte und sich Zugang zu zahlreichen Firmenkonten sicherte. Dort richteten seine Mitarbeiter Daueraufträge mittlerer Größe ein, die nur selten auffielen. Das Geschäft wuchs und versprach eine aussichtsreiche Zukunft zu haben. Die Geldwäsche war jedoch bei weitem sein wichtigeres Standbein. Lorenzo war neunundvierzig Jahre alt und fühlte sich im besten Alter und ausgestattet mit der nötigen Erfahrung, um sein Geschäft weiter auszubauen. Er gehörte nicht zu den ganz Großen in Palermo. Das interessierte ihn aber auch nicht. Sich in der Organisation aufzureiben kostetet nur Zeit und brachte viel Ärger. Lorenzo akzeptierte, dass andere über ihm standen und führte pünktlich Anteile an die entsprechenden Empfänger ab. Innerhalb seiner Welt war er geschätzt, aber nicht ganz so gefürchtet, wie es vielleicht hilfreich gewesen wäre.
Lorenzo lebte in der Regel in Palermo, wo er einen alten Palazzo besaß, den er liebevoll und unter der Mithilfe der Denkmalschutzbehörde, welche zu einem großen Teil die Kosten übernahm, renovieren lies. Neben diesem Anwesen besaß er mehrere Wohnungen, von denen niemand etwas wusste und in die er sich schnell zurückziehen konnte. Außerdem besaß er ein Haus in Bergen von Monti di Trapani, namentlich eben in der Stadt Trapani, die eineinhalb Autostunden von Palermo entfernt lag. Lorenzo lebte in einer Phase großer Zufriedenheit. Er kleidete sich elegant, achtete auf seine Ernährung und unterzog sich einmal jährlich einer Ärztlichen Visite. Er sah ausgesprochen gut aus, hatte ein markantes Gesicht, wie es nur südländische Männer haben, buschige Augenbrauen, volles Haar und pflegte einen bisweilen graziösen Gang. Ohne ein weißes Hemd und eine Krawatte, wurde er nie angetroffen. Er hatte sich bei Tolstoi ein Motto entliehen. Das lautete: Müßiggang und Aberglaube sind dem Dasein besonders abträglich, wohingegen die Tugenden Fleiß und Klugheit zu einer besonderen Bestimmung führten. Lorenzo Bianchi sah sich als Mann von Welt.
Lorenzo hatte, einem Menschen, den er eigentlich nicht kannte, aber der ihm von Nutzen war, einige Schwierigkeiten bereitet. Marian Daslakow war Bulgare und befand sich in Moabit in Untersuchungshaft. Marian war das exakte Gegenteil von Lorenzo. Sein Habitus und sein Äußeres waren schlicht. Seine Umgangsformen besonders uneitel, wenn man es so ausdrücken wollte, und sein Verstand reichte nicht allzu weit, doch glich er das mit einer Bauernschläue aus, die Menschen zu eigen ist, die blind ihren Instinkten folgten und von einem einmal gefassten Urteil, so voreilig es auch war, nicht mehr abwichen. Letztere Eigenart ordnete jemand wie Marian seiner vermeintlich schnellen Auffassungsgabe zu. Marian war ebenfalls in das vielversprechende Geschäft der Geldwäsche eingestiegen.
Diese Geldwäsche kannte drei Phasen.
Phase eins war die Platzierungsphase. Das wie auch immer gewonnene Geld musste zurück in den legalen Wirtschaftskreislauf. Dabei wurden große Summen Bargeld bei Banken einbezahlt. Diese Phase war insofern riskant, dass die Banken größere Summen unbekannter oder fragwürdiger Herkunft durchleuchten. Deshalb war es ratsam, eine solche Bank auszuwählen, die sich über die Herkunft des Geldes hinwegsah. Natürlich konnte das mit besonderen Gebühren verbunden sein.
Phase zwei war die Verschleierungsphase. Hierbei wurde das Geld möglichst lange in Bewegung gehalten. Das Ziel war es den Ursprung des Geldes, vor allem die Identität desjenigen, der es einbezahlte, zu anonymisieren. Dazu wurden Scheinfirmen gegründet, Konten eröffnet und gelöscht, in andere Währungen getauscht, Beteiligungen erworben und abgestoßen und die Summen ständig verändert. In dieser Phase musste man besonders kreativ sein. Im Einzelnen wurde das Geld in gewöhnliche Firmen und Güter investiert. Dazu gehörten Aktien, direkte Investitionen in Unternehmen, große Investmentfonds aller Art sowie der Handel mit Rohstoffen, wie Öl, Edelmetalle, Orangensaft, oder Schweinehälften und dergleichen. Phase zwei machte viel Arbeit und bedurfte eines gekonnten Managements und man durfte sich nicht verzetteln, sondern musste akribisch eine Buchhaltung führen, um die Übersicht nicht zu verlieren.
Phase drei war die Integrationsphase. Diese Phase führte das Geld zurück zu seinem Ursprung, das heißt zu dem, der es sozusagen erwarb. Seine legale Herkunft musste offensichtlich sein. Wenn das erreicht war, konnte das Geld offiziell reinvestiert werden.
***
Lorenzo Bianchi hatte vielleicht den Bogen überspannt, als er Marian Daskalow in die Sache hineinzog. Sie kannten sich nicht einmal und sie würden sich auch nie kennenlernen.
Die Sache war so: Ein Minister mit Namen Dr. Armando Gama aus Angola hatte es fertiggebracht, den Inhalt eines kompletten Öltankers privat zu verkaufen.
Dr. Gama war Minister für Außenhandel. Der Abnehmer war eine nordkoreanische Staatsfirma die allerlei verschiedene Geschäfte abwickelte. Dazu gehörte es gefälschtes Geld in Umlauf zu bringen, ebenso gefälschte Markenzigaretten zu veräußern und dasselbe tat man mit Whisky. Das erwirtschaftete Geld verwandte man zum Wohle des nordkoreanischen Volkes, in dem man unter Anderem Schweröl einkaufte, das einem Embargo der Vereinten Nationen unterlag. Man brauchte dieses Öl, welches man mit Diesel mischte dringend, um große Dieselaggregate betreiben zu können. Das Stromnetz war arg ausgedünnt in Nordkorea und die Regierung behalf sich mit jenen Dieselaggregaten. Es war ein reger Handelsaustausch zwischen den Ländern Nordkorea, Iran, Kuba, Venezuela und eben Angola im Gange. Der Tanker, der im Übrigen in keinem seetüchtigen Zustand war, bunkerte drei Millionen Barrel Schweröl. Minister Gama erreichte es, diese Menge für fünfzig US$ pro Barrel, anstelle von 20 US$, dem Marktpreis, zu verkaufen und erzielte einnahmen von 150 Millionen US$. Davon führte er 50 Millionen US$ an inländische Geschäftspartner ab. Das Schiff mit Namen Proud of Luanda legte im Mai des Jahres in Luanda ab und erreichte tatsächlich den nordkoreanischen Hafen Namp’o. Dort wurde es gelöscht und legte wieder ab. Es passierte die Tsushimastraße und Taiwan, fuhr in das Südchinesische Meer ein, weiter durch die Straße von Malakka und fuhr dann in den Indischen Ozean ein, wo es Kurs auf den indischen Abwrackhafen Alang nahm. Es wurde aus dem Schiffsregister ausgetragen und ward auf immer verschwunden.
Die einhundert Millionen US$ bezahlte Dr. Gama auf eine Bank in Singapur ein, wo sie allerdings sofort wieder wegmussten. An dieser Stelle kamen Lorenzo Bianchi und Marian Daskalow ins Spiel. Dr. Armando Gama hatte eine Vorliebe für Schweizer Nummernkonten. Doch er konnte die gewaltige Summe dort nicht eben mal so einbezahlen. Auch in der Schweiz gab man sich inzwischen leidlich Mühe, die Herkunft großer Summen zu prüfen, zumal Dr. Gama klar war, dass er das Geld aus Nordkorea ebenso schnell wieder verlieren würde, wie er es gewonnen hatte, sollten die Amerikaner erfahren, woher es stammte. Er wandte sich also an jene zwei Experten, die in der Sache einen gewissen Ruf genossen. Der erste, Lorenzo Bianchi konnte auf ein bestehendes Geflecht aus Firmen verweisen, die aus dem Stand die große Summe versickern lassen konnten. Nach einem, oder zwei Jahren würde man das Geld wieder zusammenfassen und auf die Schweizer Konnten einbezahlen. Das überzeugte Dr. Armando Gama, doch wie konnte er diesem Italiener vertrauen? Überhaupt nicht. Die Firma Bianchi würde keine Bankbürgschaft oder dergleichen stellen, was gewöhnliche Geschäftspartner tun würden.
Um sich kennenzulernen und ein Vertrauen aufzubauen, trafen sich Dr. Gama und Lorenzo Bianchi auf Zypern. Der verabredete Ort war einen nobles Hotel in Limassol. Der Minister war ein zierlicher Herr Anfang der Siebziger. Er trug einen gepflegten, schmalen Oberlippenbart, agierte in jeder Hinsicht souverän und trat mit großer Gelassenheit auf. Sein Anzug saß tadellos und er war sehr gut vorbereitet. Er redete mit einer angenehmen Baritonstimme, die einen Raum füllen konnte und die im Widerspruch zu seiner schmächtigen Erscheinung stand und ihm eine besondere Präsenz und Würde gab. Der Minister und Lorenzo verstanden sich auf Anhieb gut. Sie saßen ganz hinten, im großen Foyer der Lobby, die mit einem Marmorfußboden belegt war. Von den wenigen Gästen wurde eine natürliche Stille gehalten, welche intuitiv wegen der Weite und Kühle der großen Halle nicht durchbrochen wurde. Der Minister war mit fünf Begleitern erschienen, die sich vorne, bei der Rezeption in einer Sitzgruppe niederließen und warteten. Lorenzo war alleine erschienen. Er breitete vor Dr. Gama ein Schema aus, dass den Verlauf des Geldes darstellte. Das gefiel diesem außerordentlich. Es war alles akkurat zu sehen und nachvollziehbar.
Es wurde ein Memorandum of Understadning aufgesetzt. In diesem konnte man allerdings schlechterdings die einzelnen Schritte auflisten. Es stand nur ganz allgemein darin, dass Herr Lorenzo Bianchi, Passnummer sowieso, Wohnort Palermo… im Namen von Dr. Armando Gama, Passnummer sowieso, Wohnort Luanda… bis zum soundso vielten, den Betrag von einhundert Millionen US$ verteilt auf fünfzehn verschiedene Schweizer Bankkonten einbezahlen würde. Das Geld könne danach in den offiziellen Geldkreislauf zurückgeführt werden, was gleichwohl nicht in dem Memorandum of Understadning erwähnt wurde. Der Minister hatte nicht mehr in der Hand als die Reputation von Lorenzo und die Tatsache, dass er über die Mittel und Möglichkeiten verfügte, dessen Lebenslicht auszulöschen, sofern das notwendig werden sollte. Das musste genügen. Das Memorandum of Understanding wurde von beiden Seiten erst mit Druckbuchstaben und dann mit den jeweiligen Unterschriften versehen und weil es Dr. Gama so gewohnt war, beziehungsweise er es nicht anders kannte, entnahm er seiner Tasche einen Stempel, der eine Art von Wappen und seine Adresse enthielt und ein Stempelkissen und drückte den Stempel über seinen Namen.
»Man muss sorgfältig sein«, sagte er zu Lorenzo und lächelte, während er die beiden Dinge wieder einsteckte.
Dr. Gama hatte vorher sein Anliegen mit dem zweiten potentiellen Auftragnehmer besprochen und das war Marian Daskalow. Daskalow hatte sich in kurzer Zeit ebenfalls den Ruf erworben ein Netzwerk zu haben, über das große Summen verschwinden und wiederauftauchen konnten. Diese Auskunft war allerdings recht übertrieben. Nun war es außerdem so, dass Marian Daskalow dem Minister vorschlug, das Geld würde in Russland geparkt werden und über die dortige Börse gewaschen werden. Das leuchtete dem Minister nun überhaupt nicht ein. Er hatte in jungen Jahren in Russland Maschinenbau studiert, sprach Russisch und fragte sich, wie man ausgerechnet dort Geld waschen wollte, schließlich wollte er alles am Ende in der Schweiz haben. Es wäre ganz und gar umgekehrt, die Russen suchten westliche Kanäle, widersprach er Marian. Die Antwort Marians war, dass russische Eigentümer inzwischen namhafte Schweizer Banken kontrollieren würden. Das war Unsinn, befand der Minister und schloss deshalb mit Lorenzo Bianchi den Vertrag.
Irgendwann erwähnte der Minister im Verlaufe ihrer Unterredung gegenüber Lorenzo, dass er mit einem Marian Daskalow ebenfalls über dieses Thema gesprochen, nun aber sehr mit sich zufrieden sei, dass er sich mit ihm, Lorenzo eingelassen habe. Lorenzo fragte interessiert nach.