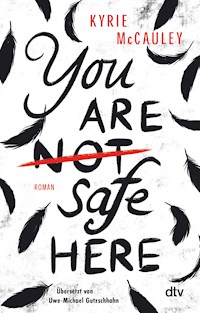
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wenn die größte Bedrohung für dein Leben dort lauert, wo du dich am sichersten fühlen solltest – in deinem Zuhause Tausende Krähen belagern die Kleinstadt Auburn, Pennsylvania, und es werden immer mehr. Alle Einwohner empfinden dies als Bedrohung – alle außer der 17-jährigen Leighton und ihren beiden jüngeren Schwestern. Denn die größte Gefahr lebt in ihrem Zuhause: ihr Vater, der immer wieder gewalttätig wird – und ihre Mutter, die schweigt und ihn nicht verlässt. Und die Nachbarn, die konsequent wegschauen. Leighton würde nichts lieber tun, als der Stadt den Rücken zu kehren, aber sie kann und will ihre Schwestern nicht zurücklassen. Denn eins ist klar: Irgendwann wird die Situation eskalieren...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Stell dir vor, der eigentlich sicherste Ort der Welt ist der gefährlichste von allen – dein Zuhause
Tausende Krähen belagern die Kleinstadt Auburn, Pennsylvania, und es werden immer mehr. Alle Einwohner empfinden dies als Bedrohung – alle außer der 17-jährigen Leighton und ihren beiden jüngeren Schwestern. Denn die größte Gefahr lebt in ihrem Zuhause: ihr Vater, der immer wieder gewalttätig wird. Leighton würde nichts lieber tun, als der Stadt den Rücken zu kehren, aber sie kann und will ihre Schwestern nicht zurücklassen. Denn eins ist klar: Irgendwann wird die Situation eskalieren …
Nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2021
Für meinen kleinen Bruder Jackson, der wie ein Stern ist, weil er das Weltall erleuchtet (und weil er so viel größer ist als ich).
Für Kayleigh und Katharyn, die nie zögern, sich mit mir der Dunkelheit zu stellen, Taschenlampen in der Hand.
Und für die Überlebenden häuslicher Gewalt und die, die es noch durchstehen. Vielleicht fühlt es sich an wie das Ende der Geschichte, doch es ist nur der Anfang und der Rest gehört euch allein.
1. KAPITEL
Es passiert in den Ausdehnungen der Stille, dass ich mich frage, ob sie ganz einfach tot ist.
Mein Fenster steht offen, die hölzernen Läden sind weit aufgerissen, um den Luftzug hereinzulassen, den es nicht gibt. Ich sauge die Luft ein, die schwer ist von all der Schwüle, und schaue hinauf in den nächtlichen Himmel. Tiefe Wolken, aber kein Regen.
Mutter Natur, du kannst so unfair sein.
Unsere ganze Stadt wartet auf Regen, dass er die Dürre beendet. Auf Regen, der den Schweiß wegspült, den Schweiß, der uns Tag für Tag am Körper klebt, sobald wir das Haus verlassen. Auf Regen, der auf die harte trockene Erde zwischen den verdorrenden Getreidehalmen der Felder trommelt. Regen ist Leben. Regen ist Vergebung.
Regen wäscht schneller sämtliche Sünden fort, als es ein Pfarrer je könnte.
Ich höre es erneut: ein tiefes Grummeln. Aber das täuscht, das ist kein Donner. Seine Stimme ist so laut wie die Stimme Gottes und so böse wie die des Teufels. Ich versuche, sie auszublenden, doch dann höre ich das leise Tappen kleiner Füße auf dem Teppich im Flur. Im nächsten Moment geht die Tür auf und die Mädchen kommen herein. Wir drei setzen uns unter das Fenster – die eine Schwester links, die andere rechts unter meinen Armen zusammengekauert.
Als ob ich sie beschützen könnte.
Meine Arme schlingen sich um ihre Schultern: »Alles gut«, flüstere ich, für sie und für mich.
Ein Schrei erfüllt das Haus. Das ist nicht Mom. Es ist der Anfangsschrei eines klassischen Rocksongs. Als die Bassdrum loswummert, erzittert die Tür zu meinem Zimmer.
Es ist eine Nacht mit voller Dröhnung.
Ein schwacher Lufthauch dringt durch das offene Fenster über uns. Die dünnen Muskelstränge in den Armen meiner Schwestern spannen sich vor Angst. Ich schaue hoch und sehe die dunkle Silhouette eines Vogels auf der gegenüberliegenden Zimmerwand.
»Ist nur Joe«, sage ich und löse mich aus ihrer Umklammerung. Ich drehe mich um und schaue in ein wildes, schimmerndes schwarzes Auge. Der Schnabel des Vogels wirkt aus dieser Nähe boshaft scharf. Gewöhnlich kommt er nicht bis ans Fenster. Gern hockt er auf unserem Briefkasten, dem Zaun bei der Bushaltestelle an der Ecke oder auf dem untersten Ast des Baums im Vorgarten. Joe ist einzigartig unter den anderen schwarzen Vögeln, er unterscheidet sich durch die grauen Federn an Bauch und Rücken. Und auch durch seinen Willen, in unserer Nähe zu sein – ständig.
Joe krächzt. Er schüttelt prahlerisch seine Flügel und dreht sich um.
»Tschüs, Joe«, sagt Juniper, als er davonfliegt.
Unten kracht etwas zu Boden.
»Mom«, sagt Campbell. Ich male mir aus, dass Mom verletzt ist. Und weint. Ich sehe Cam in die Augen und finde meine Angst in ihnen gespiegelt.
»Ich schau mal nach ihr.« Es hat keinen Sinn, bei der Musik zu flüstern, deshalb brülle ich fast. Ich drücke die knochigen Hände der zwei, ein einzelner Drumbeat der Beschwichtigung, und stehe auf.
Als ich die Treppe erreiche, spielt er die Greatest Hits von Guns N’ Roses so laut, dass es mir in den Zähnen wehtut, und trotzdem höre ich ihn. Ich werfe einen Blick übers Geländer und sehe, er ist in der Küche. Wenn ich es nicht wüsste, hätte ich Sorge, die dunkelrote Färbung seiner Haut deute auf einen medizinischen Notfall. Doch es ist Wut. Schiere, unkontrollierte Wut. Das Pulverfass heute Nacht war eine anstehende Hypothekenzahlung. Der zündende Funke eine Stromrechnung, doppelt so hoch wie sonst. Es war ein heißer August und die Klimaanlage hatte zu viel zu tun.
Ich kann das abgerundete graue Metall oben auf dem Kühlschrank nur gerade so eben erkennen. Er hat seine Pistole immer in Griffweite. Er sagt, sie nützt nichts, wenn er sie bei einem Überfall erst lange suchen muss, doch gerade in Momenten wie diesem denke ich an sie. Es ist immer dieselbe Frage, die in mir hochkommt. Ist es heute Abend so weit, dass er nach ihr greift?
Mom taucht in meinem Blickfeld auf. Ihre langen roten Haare hängen lose und zerzaust herab. Sie ist auf dem Weg zur Stereoanlage.
Er rennt hinter ihr her, jeder Schritt ein winziges Beben in dem alten Haus. Er selbst ist eine schwere Abrissbirne und prescht durch den Raum, Mom hinterher, als ihre Hand den Lautstärkeregler berührt.
Er stößt sie gegen die Tür des Hi-Fi-Schranks, die mit voller Wucht nach hinten gegen die Wand fliegt. Ein Stück Putz löst sich dort, wo sie einschlägt. Mom reibt sich die Schulter, sagt aber nichts.
Meine Angst sitzt gefangen in meinem Brustkorb. Sie schlägt mit ihren nutzlosen, verängstigten Flügeln, während ich wieder zurück nach oben schleiche.
»Sie ist okay«, erkläre ich den Mädchen. »Aber ich muss die Polizei rufen.«
»Das Telefon ist tot«, erinnert mich Campbell. Wenn die Ausbrüche losgehen, reißt er das Kabel aus der Wand. Er platziert es auf dem Küchentisch – gut sichtbar, aber nutzlos.
»Ich muss Hilfe holen.« Ich werfe einen Blick zum Fenster. Cam merkt es.
»Ist das nicht zu hoch?«, fragt sie. Falls sie Angst hat, hört man es ihrer Stimme zumindest nicht an. Mit ihren dreizehn Jahren ist Campbell ein Musterbeispiel für Ruhe und Gelassenheit. Sie begreift die Gefahr, in der wir sind. Und sie weiß auch, wann es besser ist, dies vor Juniper zu verbergen.
»Überhaupt nicht.« Ich klettere aus dem Fenster hinaus auf das Dach über unserer Veranda. Die Luft ist immer noch schwer von Feuchtigkeit getränkt, belastet von Dingen, die sie nicht allzu lange mehr tragen kann. Ich weiß nur zu gut, wie sich das anfühlt. Bald wird der Himmel aufbrechen.
Als ich draußen bin, warte ich einen Moment und checke die Lage. Vielleicht wird er sie hier draußen nicht finden. Zumindest nicht gleich.
»Kommt raus«, sage ich zu ihnen und deute auf das andere Ende des Dachs, wo es auf das Haus trifft und einen kleinen Winkel bildet. »Alles gut. Das wird ein Abenteuer.«
Campbell schwingt sofort ihre Beine über die Fensterbank und kriecht in den Winkel, aber Juniper zögert.
»Ich hab Angst, Leighton«, sagt sie. Ein verschrobener kleiner Teil in meinem Kopf ist dankbar, dass Juniper Angst hat. Dass sie mit ihren neun Jahren schon so viele Nächte in Schatten wie diesem versteckt zugebracht hat und immer noch weiß, es ist nicht normal.
»Hey, Schatz, schau mich an. Alles ist gut. Du kuschelst dich einfach an Campbell. Warte, nimm Ava-Bär mit.«
Ich greife ins Zimmer, baumele über der Fensterbank und taste nach meinem Bettende. Etwas, das weich ist wie Flaum, erfüllt meine Hand, als ich den Teddy erreiche. Ich beuge mich zurück aus dem Fenster und strecke Juniper meinen geliebten Stoffbären entgegen.
Junie schüttelt ablehnend den Kopf.
Etwas grollt von unten und ist nicht die Musik. Mein Magen zieht sich zusammen. Er ist so wütend an diesem Abend.
Ich lasse den Teddy fallen, hocke mich an das Fenster und sehe die Tränen in Junipers dunklen Augen.
»Wie groß ist dein Mut?«, frage ich sie.
Ich habe den Satz geklaut, direkt aus unserer Vergangenheit. Ich habe ihn aus meiner schöneren frühen Kindheit herausgeschnitten, aus der Zeit, als Mom ihn zu mir sagte, um mich auf ein Fahrrad oder ein Karussell zu locken. Und ich habe ihn hierhergebracht, in diese schreckliche Nacht. Doch ich brauche den Satz – für Juniper.
»So groß«, sagt Juniper und klettert aus dem Fenster. Ich führe sie zu Cammy hinüber.
Der Baum in unserem Garten schwankt, obwohl kein Wind geht.
Krähen.
Vögel hocken dicht an dicht auf den Ästen. Es müssen fast hundert sein. Mehr. Junipers leises Gewimmer drängt die Krähen aus meinem Kopf. Ich schwinge die Beine über die Dachkante und lasse mich fallen, bevor ich es mir doch noch anders überlege. Es ist ein kurzer Fall, doch ich schlage hart auf und verliere das Gleichgewicht. Meine Hände streifen den Gehweg, auf dem ich mich fange. Sie bluten. Ich schaue nach oben und sehe, wie Campbell herabspäht. »Alles okay«, zisch ich ihr zu. »Geh zurück!« Ich verschwimme mit dem Dunkel des Gartens, wohin das Verandalicht nicht reicht – gerade als er am Küchenfenster vorbeikommt.
Als er sich umdreht, renne ich los. Es gibt nur ein weiteres Haus an unserer Straße. Wenn wir uns je sicher in unserem Haus fühlen würden, könnte man sagen, es ist malerisch hier, mit den Bergen im Hintergrund und nichts als der endlosen Weite idyllischer Felder.
Aber wir fühlen uns nicht sicher, weshalb ich das Haus eher abgelegen nennen würde. Isoliert.
Alcatraz.
Doch es gibt eine Nachbarin. Die alte Mrs Stieg. Höchstens hundert Meter entfernt in einem Farmhaus, das locker ein halbes Jahrhundert älter ist als unser Haus, aber perfekt instand gehalten. Während ich die Straße entlangjage, schaue ich kurz zurück. Ich suche nach zwei Schatten auf dem Verandadach, doch mein Blick wird weiter nach oben gezogen.
Krähen bedecken unser Hausdach. Dunkle Schindeln, verhüllt von noch dunkleren Federn.
Als ich das Haus unserer Nachbarin erreiche, schließe ich die Finger über der noch vom Sturz brennenden Handfläche und schlage mit der Faust gegen die Tür. Oben flackert ein Licht auf und in mir schwillt die Hoffnung an.
Das Licht geht wieder aus.
Ich klopfe fester, doch ich weiß schon, sie wird nicht kommen.
Angst krampft sich in meiner Brust zusammen, will raus. Niemand sonst wohnt in der Nähe. Ich kann meine Schwestern nicht so lange allein lassen, um ein paar Meilen bis in die Stadt zu laufen. Ich überquere wieder die Straße. Als ich zurück in unserem Garten bin, versuche ich den Dutzenden Krähen auf unserem Rasen auszuweichen. Genau in dem Moment fliegt die Haustür auf.
»Verdammte Scheiße, was soll das?« Er füllt den gesamten Türrahmen aus. Gute zweihundert Pfund Wut, die jetzt auf mich gerichtet sind. Ich überlege mir mögliche Antworten, spiele, so schnell ich nur kann, im Kopf ihre Folgen durch. Welche Antwort ist die sicherste?
»Ich hab die Polizei gerufen«, lüge ich und es ist eine große Lüge. In ein paar Minuten wird er wissen, dass es nicht stimmt.
Einen Moment lang starrt er mich nieder, als wenn er mich zwingen wollte, die Wahrheit zu sagen. Dann kehrt er ins Haus zurück. Endlich setzt die Musik aus, die plötzliche Stille wirkt irreal. So als wenn alles vorher ein Albtraum war und ich gerade aufgewacht bin.
Wenn es nur so wäre.
Ich beobachte, wie er in der Küche auf und ab läuft. Vögel staksen um mich herum und krächzen leise. Oder vielleicht auch laut und es wirkt nur leise im Kontrast zu dem Lärm der Musik gerade eben.
»Nach allem, was ich für euch Mädchen tue«, sagt er, während er sich seine wesentlichsten Dinge schnappt: Portemonnaie, Schlüssel, Pistole. »So verflucht undankbar.«
Er geht zu seinem Wagen und knallt die Tür zu. Sekunden später verschwindet er und ich weiß, warum. Es gefällt ihm, herumzubrüllen und uns Angst zu machen, aber er achtet darauf, sich nicht selbst ins Gefängnis zu bringen. Es ist ein schmaler Grat, doch er beherrscht ihn gut.
Ich gehe den Gartenweg entlang, durch das Gras, und bleibe am Straßenrand stehen. Morgen wird er zurückkommen, doch für heute Nacht sind wir in Sicherheit. Ich stehe da, bis er um die Kurve biegt und ich ihn nicht mehr sehen kann. Und genau in diesem Moment bricht der Himmel über mir auf.
Regen strömt herab und jagt die Krähen in der Dunkelheit auseinander.
2. KAPITEL
Am Morgen sind die Krähen immer noch hier. Und mit hier meine ich überall. Krähen auf jedem Ast des Vorgartenbaums, bis sie so dicht hocken, dass es mehr Federn als Blätter sind.
Ich stehe am Fenster meines Zimmers und beobachte, wie die Vögel auf den Ästen rascheln und zucken. Auf dem Dach von Mrs Stieg sind sie auch und stolzieren die Regenrinnen entlang.
Unsere Haustür schlägt zu.
Er ist zurück.
Ich laufe aus meinem Zimmer und jage unter die Dusche, verzweifelt darum bemüht, den Morgen zu normalisieren, ihn da unten zu erinnern, dass wir Schule haben. Manchmal, wenn wir alles richtig machen, passt er sich unserer Ruhe an. Bewegt sich in Richtung unserer Normalität. Während das kochend heiße Wasser auf mich niedergeht, spreche ich ein Stoßgebet, dass dies einer jener Tage sein möge.
Ich liebe die Schule, doch dieses Jahr ist es anders. Es ist mein letztes Jahr. Mein Countdown hat offiziell begonnen und die letzte Nacht war ein unheilvollerer Beginn, als ich erhofft hatte. Noch ein Jahr. Ich habe noch ein Jahr, um herauszufinden, wie ich meine Schwestern weiter beschützen kann, wenn ich zur Uni will.
Als ich in die Küche komme, ist er nicht da, nur Mom. Sie zuckt zusammen, als ich eintrete. Kaffee schwappt über den Becherrand und spritzt ihr auf die Finger. Sie scheint es gar nicht zu merken.
»Guten Morgen, Leighton«, sagt sie. Sie lächelt mich an, aber es ist kein Mom-Lächeln. Es erreicht nicht so richtig ihre Augen. Früher lächelte Mom uns an, als ob wir alle denselben Witz kennen würden. Inzwischen ist das Lachen genauso leer, wie wenn sie jemand Fremden anlächelt.
»Morgen«, sage ich leise.
Er hat Mom Blumen geschenkt – leuchtend rote Rosen, die in einer angeschlagenen Vase neben dem Spülbecken stehen. Dad liebt es, sich mit kleinen Gesten zu entschuldigen, die nie dem Gewicht dessen gerecht werden, was er getan hat.
Doch es scheint zu funktionieren.
Ich zögere einen Moment, frage mich, ob es ein Morgen ist, an dem ich sie provozieren will, oder ob ich besser den Mund halten soll. »Ist er wieder da?«, frage ich.
Jetzt ist sogar die Leere in ihrem Lächeln verschwunden.
»Lass es, Leighton«, sagt Mom.
Also ist es ein Morgen, an dem ich besser den Mund halte.
»Er hat im Büro geschlafen. Was willst du noch?«
Ich rattere im Kopf die Liste runter. Seine Verhaftung, seine Entschuldigung, seine Freundlichkeit, seinen Tod. Hängt vom Tag ab, von der Uhrzeit, vom Moment, von meiner Stimmung, aber auf jeden Fall verlange ich mehr, als dass er im Büro übernachtet.
»Ich muss heute arbeiten«, sagt Mom. Sie hat schon immer jede Woche ein paar Schichten als Kellnerin im Diner übernommen, aber in letzter Zeit werden es immer mehr. Sie versucht, das Geschäft des Bauunternehmens auszugleichen, das nicht besonders gut läuft.
»Kommst du wegen der Mädchen gleich nach der Schule zurück?« Ich ignoriere den abrupten Themenwechsel. Während ich ins Wohnzimmer gehe, hebe ich gerahmte Fotos vom Boden auf und hänge sie zurück an ihre Nägel.
Es ist, als ob das Haus weiß, wann diese Nächte kommen. Wenn man genau drauf achtet, gibt es deutliche Hinweise: ein dezentes Dunklerwerden in den Zimmerecken, die schief an den Nägeln hängenden Bilderrahmen – bei der kleinsten Erschütterung bereit zum Sturz –, der plötzliche Drang zu flüstern, als ob ihm das Haus unsere Geheimnisse zutragen würde. Der Druck im Innern wächst über Wochen, bis er so gegenwärtig ist, dass ich ihn geradezu auf der Zunge schmecken kann – metallisch und beißend. Wie Blut. Der Geschmack der Wut.
Ich kehre zurück in die Küche und hebe den letzten Rahmen auf. Es ist ein Foto von zwei Teenagern mit Kronen auf dem Kopf. König und Königin des Balls. Ich betrachte das Mädchen auf dem Foto, mein Blick wird angezogen von dem, was wir gemeinsam haben. Die gleiche blasse Haut mit ein paar kupferfarbenen Sommersprossen auf der Nase. Das gleiche breite Lächeln. Ich frage mich, worin wir uns unterscheiden. Ihre Haare sind leuchtend rot, während meine heller sind, rotblond. Und was ist mit dem, was man nicht sieht? Zum Beispiel ihrer Fähigkeit, so viele Verletzungen zu verzeihen. Habe ich das auch in den Knochen, so wie die Form ihres Kiefers?
Statt das letzte Foto auch wieder aufzuhängen, lege ich es auf die Arbeitsplatte neben die Rosen.
Soll sie selbst entscheiden, ob sie es wieder an der Wand sehen will.
Als Letztes greife ich knapp an Mom vorbei, um den Telefonstecker zurück in die Dose zu stecken, bevor ich meine Schwestern aus dem Haus und zur Bushaltestelle scheuche. Dieses dämliche, nutzlose Festnetztelefon. Letztes Jahr hat er Mom und mir gesagt, wir könnten ein Handy haben. Aber dann wurde ihm klar, dass man mit dem Handy die Polizei rufen kann und dass Mobiltelefone Geld kosten, deshalb haben wir nie welche gekriegt. Es gibt nur das Festnetzgerät mit der Schnur, das uns keine Hilfe ist, wenn er sie aus der Wand reißt.
Ich knalle meinen Finger auf die Tasten und halte den Hörer ans Ohr.
»Telefon geht wieder«, sage ich.
3. KAPITEL
Für alle andern an der Auburn High bedeutet Sommer Freiheit.
Für mich nicht.
Hier an der Schule weiß ich wenigstens, was ich zu erwarten habe. Ich weiß, wer ich bin. Für die nächsten acht Stunden weiß ich Campbell und Juniper sicher in ihren Klassen. Ich kann so tun, als wenn alles normal wäre. Das heißt, als ich an unserem ersten Schultag nach den Ferien aus dem Bus steige, mich umdrehe und den Mädchen noch einmal zuwinke, während der Bus wieder anfährt, weiß ich, dass sie dasselbe denken wie ich: Gott sei Dank ist der Sommer vorbei.
Sofia entdeckt mich vor der ersten Stunde. Sie jagt den Flur entlang und schlingt ihre Arme um meinen Körper. »Leighton! Du wunderschönes Wesen, wo hast du gesteckt? Wir haben seit einer Woche nicht mehr miteinander gequatscht!«
»Tut mir leid, Sof.« Ich hatte den absoluten häuslichen Albtraum. »Ich war … total im Rückstand mit meiner Sommerlektüre. Deshalb musste ich die letzten paar Tage ein bisschen aufholen.« Wir gehen zusammen über den von Schülertrauben bevölkerten Flur und stoßen mit so vielen Leuten zusammen, dass es albern wird, dauernd Entschuldigung zu sagen. Es ist ein Auflauf staunender Neuzugänge und wir stecken mittendrin.
»Ja, ich auch. Aber wir hätten doch zusammen leiden können«, antwortet Sofia und ihre zum Cheerleader-Pferdeschwanz zusammengebundenen dunklen Haare hüpfen hin und her. Sofia ist der fröhlichste Mensch, den ich kenne, und ich weiß nicht, wieso, aber sogar ihre Gesichtszüge wirken fröhlich. Sie hat runde rosafarbene Wangen. Ihre Augenbrauen sind dramatisch nach oben gewölbt, wobei sie sie natürlich wachsen lässt, was das Dramatische im echten Sofia-Stil nur noch weiter unterstreicht. Ihr Lächeln wirkt ein wenig schief – die rechte Seite des Mundes verzieht sich ein bisschen weiter nach oben. Das sieht immer aus, als ob sie gerade erst aufgehört hat zu lachen. Was auch meistens stimmt. Nach Nächten wie der letzten bin ich total dankbar, dass sie meine Freundin ist.
»Und was hast du in der ersten Stunde?«
Sofia faltet ihren Plan auseinander und kräuselt die Nase. Sie hält das Blatt von sich weg, als wenn es verseucht ist. »Sport.«
»Wow. Das ist Pech. Dann musst du ja danach gleich wieder duschen.«
»Und hab den ganzen Tag nasse Haare.«
»Die Götter der Stundenpläne haben es echt nicht gut mit dir gemeint, Sofia.«
Sofia stöhnt und lehnt ihren Kopf gegen meine Schulter.
»Und du?«
Ich ziehe meinen Plan raus und schaue noch einmal nach.
»Erste Stunde Uni-Vorbereitungskurs Englische Literatur.«
»Toll, dann liest du täglich als Erstes von Leuten, die sich aus dämlichen Gründen umbringen.«
»Immer noch besser als Sport.«
»Stimmt. Blöd, dass sich unsere Stunden in diesem Halbjahr in keinem Punkt überschneiden.«
»Kannst du wohl sagen. Aber wir haben die Zeitung. Und die erste Wahl bei allen Sparten, jetzt, wo wir in der Abschlussklasse sind. Willst du weiter Sport? Wehe, sie geben die Sparte an Chris, nur weil er ein Junge ist –«
Sofia bleibt abrupt stehen, sodass ich mit ihr zusammenstoße. Wir haben eines der großen Fenster erreicht, die auf den Fußballplatz schauen.
»Verdammt.« Sofia flucht eigentlich nicht und das »Verdammt« kommt mehr als Seufzer heraus und klingt, als wenn sie es nicht laut sagen wollte.
Krähen bedecken jeden Zentimeter des Platzes.
»Hast du sie noch gar nicht bemerkt?«, frage ich.
»Ein paar hier und da wie üblich, aber nicht so viele wie die da.«
Wir bleiben vor den Fenstern stehen und lassen es zu, dass uns die Neuen aus der neunten Klasse anrempeln in ihrem Stress, vor dem zweiten Klingeln ihr Ziel zu erreichen. Auf der anderen Straßenseite liegt das Footballstadion und ich erkenne kleine dunkle Schemen, die die Tribüne belagern. Die Krähen sind ständig in Bewegung, fliegen auf und landen, kreisen am Himmel. Es müssen Tausende sein. Und sie haben sich alle entschieden, hierherzukommen.
Weiß der Himmel, wieso sich irgendein Wesen ausgerechnet Auburn aussucht.
Noch dazu eines, das wegfliegen kann.
4. KAPITEL
Erst nach der zweiten Stunde gelingt es mir, meinen Spind zu finden. Er ist nicht im Bereich für die Zwölftklässler. Ich folge den Zahlen abwärts und biege um die Ecke in den Gang der Elftklässler.
Warm.
Wärmer.
Heiß.
Na super. Ich werde mein letztes Schuljahr auf den Elftklässler-Gang verbannt zubringen. Offenbar haben sie nicht mehr genug Spinde für die Abschlussklasse frei gehabt. Was bedeutet: nicht an der Zwölftklässler-Wand abhängen können, wo in den Pausen im wahrsten Sinne des Wortes nur Leute aus der Abschlussklasse stehen, sich anlehnen und jüngere Schüler anblaffen, die der Wand zu nahe kommen. Jedes Jahr dekoriert die Abschlussklasse die Wand mit einem riesigen Banner Klassevon und dem Jahrgang und jeder verewigt dort Schimpfwörter und schmutzige Botschaften, bis die Schulverwaltung es abreißt, weil das Ganze zu vulgär ist. Eine Klasse hat es mal nicht bis zum Homecoming geschafft.
Das Einzige, was ich am Ende der Zwölften wirklich brauche, ist ein Abschlusszeugnis. Doch ich spür trotzdem den Schmerz, schon wieder etwas zu versäumen, das zum normalen Highschool-Leben dazugehört. Ich habe schon so viel verpasst. Nächte, in denen ich vorgezogen habe, zu Hause zu bleiben, weil er in schlechter Stimmung war. Geburtstagspartys, die ich nie gewagt hätte, mir zu wünschen.
Ich öffne den Spind – einen von den halbgroßen. Ich stopfe meine Schulbücher rein und versuche mir immer noch einzureden, dass die Zwölftklässler-Wand sowieso eine alberne Tradition ist, als mich plötzlich jemand von hinten packt.
Also nicht packt, sondern kitzelt. An den Rippen.
»Verdammt!«, schrei ich und wirble herum.
»Oh Shit.« Die Hände sind weg und derjenige tritt ein Stück zurück. Liam McNamara steht da, als wenn er wüsste, er hat es verbockt. »Tut mir echt leid. Ich dachte, du wärst Lyla Jacobs.«
»Wer?«
»Lyla. Aus der Elften. Die hat auch rote Haare und ist mein Cheerleader.«
»Wusste gar nicht, dass Cheerleader jemandes Eigentum sind.« Ich weiß genau, was er meint. Sofia ist seit Jahren Cheerleader. Aber ich will ihn sich winden sehen.
»Sind sie auch nicht.« Er fährt sich mit der Hand über den Kopf. »Ich vermassel es gerade richtig, oder?«
»Ja, so ein bisschen.« Ich kenne Liam. Oder ich weiß zumindest, wer Liam ist, sollte ich vielleicht besser sagen. Wir bewegen uns in unterschiedlichen Kreisen. Oder richtiger: Er bewegt sich in einem Kreis, während ich mehr ein einsamer Punkt bin.
Liam McNamara: auch Abschlussklasse, stellvertretender Vorsitzender des Schülerrats, Mitglied der Footballschulmannschaft. Die Liste der Superlative sollte enden mit: kriegt wahrscheinlich bald einen Modelvertrag, während er sich gleichzeitig für den Congress aufstellen lässt. Liam hatte immer jede Menge Freundinnen und jede Menge Charme. Aber durch mein Zuhause kenne ich auch die Kehrseite der schönen Münze und die zeigt keinen Prinzen.
»Lyla ist die Cheerleaderin, die ich respektiere und absolut nicht als Eigentum betrachte, in welcher Hinsicht auch immer, und die mir diese Saison zugeteilt wurde. Sie … na ja, gestaltet meinen Spind und backt Plätzchen für mich und so.«
Ich verdrehe nicht die Augen. Echt nicht. Doch es kostet mich ziemlich viel Mühe, es nicht zu tun.
»Ja, okay. Alles klar. Du hast mich bloß erschreckt.«
»Tut mir auch wirklich leid. Lyla ist meine Freundin. Ich schwöre, ich laufe nicht rum und begrapsche fremde Mädchen. Nicht dass du mir fremd bist, ich meine nur –«
»Schon gut, Liam. Wir sehn uns.«
»Also, mein Spind ist … ähm –« Er deutet auf den Halbspind direkt unter meinem. Natürlich. Lass uns diese Peinlichkeit auf das ganze Schuljahr ausdehnen.
Ich trete zur Seite und lasse Liam sich vor seinem Spind niederhocken.
»Wir sollten sie wenigstens fragen, ob wir wechseln können. Will ja nicht, dass sich unser Starspieler noch was am Rücken holt, wenn er nach seinen Büchern kramt.«
»Ach, danke, aber das wär nicht sehr Gentleman-like von mir. Außerdem, ist ja nur Football.«
»Hast du gerade nur Football gesagt? In dieser Stadt ist das fast Blasphemie.«
»Ja, klar. Gibt ja nicht viel anderes hier, außerdem macht es sich gut bei der Uni-Bewerbung.« Unser Gespräch hat eine überraschende Wendung genommen und ich versuche, die Neugier im Zaum zu halten, die ich plötzlich spüre.
Weitermachen, hier gibt es nichts zu sehen. Aber Liam macht nicht weiter. Er steht vor unserem geteilten Spind und lehnt sich an meine Tür.
»Wir haben die erste Stunde zusammen, oder, Leighton?«
Leighton.
»Wusste gar nicht, dass du meinen Namen kennst, Liam. Ganz zu schweigen davon, wie man ihn ausspricht.«
»Leighton. Wie Peyton. Wie Peyton Manning. Ziemlich einfach zu merken.«
»Erinner ich dich an einen Profifootballspieler?«
Er lacht.
»Nein. Du bist ein Zwerg. Auf einem Footballfeld würdest du glatt niedergewalzt. Aber ernsthaft, sind ja bloß um die zweihundert Leute in der Abschlussklasse. Ich weiß genau, wer du bist.«
»Nur nicht von hinten.«
»Das vergisst du mir wahrscheinlich nie, was?«
»Wahrscheinlich nicht. Aber ist ja erst gerade mal fünf Minuten her. Lass mir ein bisschen Zeit.«
»Leighton ist ein cooler Name«, sagt Liam.
Ich antworte nichts darauf, sondern ziehe nur meine Tasche zurecht.
»Danke, war mein Geburtstagsgeschenk.«
Ein Dad-Witz. Echt jetzt? Aber Liam lacht und ich spüre, wie ich langsam ein bisschen lockerer werde.
Komm runter, Leighton. Nicht jeder hat es auf dich abgesehen.
»Also gut. Uni-Vorbereitungskurs Englische Literatur. Könnte lustig werden«, sage ich mit einem Sarkasmus, der aus jeder Silbe dringt.
»Ja, kein Witz. Unsere Sommerlektüre war ziemlich depri. Aber Menschenkind hat mir gefallen. Wolltest du hier lang? Wir sollten langsam mal aufbrechen.«
Liam schnappt sich mein schweres Mathebuch und zieht los. Ich brauche einen Augenblick, eh ich begreife, er will es nicht klauen, sondern bloß für mich tragen. Ich blinzle ein paarmal dümmlich, bevor ich ihn einhole.
»Du mochtest Menschenkind? Ich fand es ziemlich traurig.«
»Klar, aber wichtig. Geschichten sind wichtig. Kulturelle Repräsentanz ist wichtig. Außerdem immer noch besser als Romeo und Julia in der Neunten. Gibt schon genug über reiche weiße Kids.«
Ich lache erstaunt. Liam ist einer der wenigen schwarzen Schüler an unserer Schule und seine Offenheit überrascht mich.
»Zugegeben«, antworte ich. »Die Romantik war also nicht so deins?«
»Das hatte doch nichts mit Romantik zu tun. Das war Dummheit. Ich weiß nicht, von wem der Satz stammt, dass in der Liebe und im Krieg alles erlaubt ist. Für mich ist das Bullshit. Wenn du jemanden liebst, behandelst du ihn doch nicht so. Du stirbst doch nicht.«
Ich weiß, wir sprechen über ein Buch, doch in meinem Kopf hör ich das Krachen der Tür, mit dem sie gestern Nacht gegen die Wand flog. Und ich sehe dieselbe Wand heute Morgen, völlig in Ordnung, als wenn nie der Verputz aufgeplatzt wäre. Ich erinnere mich, wie meine Augen dran vorbeigeschaut haben, während ich Bilderrahmen wieder aufhängte, so als ob sie nicht bereit wären zu akzeptieren, dass unser seltsames Haus jeden seiner Gewaltausbrüche tilgt.
Ich bin stehen geblieben, und als Liam es merkt, hält auch er an. Die Luft um uns herum wirkt kalt.
Ich erinnere mich nicht, was lustig, süß oder charmant war an unserem Gespräch.
»Kann ich mein Buch wiederhaben?«, frage ich und klinge kühl und frostig, so kontrolliert, wie es nur geht. Ich kann nichts dagegen machen. Die Alternative zu kühl wäre weinen und ich will nicht zerbrechen. Nicht in der Schule.
»Äh, ja klar, natürlich, Leighton«, antwortet Liam und reicht mir meine Sachen. »Ist das wegen vorhin? Weil … tut mir echt leid …«
»Hab nur ein Heft vergessen. Bis gleich in der Klasse«, murmle ich und bin weg, gehe so schnell wie möglich den Gang zurück, ohne eine Rüge wegen Rennens zu riskieren. Ich versuche, das Brennen in der Kehle und das Stechen in den Augen zu ignorieren, damit es aufhört. Verhalte mich normal.
Normal.
Normal.
Da.
Das Wort hat jede Bedeutung verloren.
5. KAPITEL
Wenn es je eine andere Version von Campbell Grace Barnes gegeben hatte, dann hatte ich sie verpasst. So weit meine Erinnerung zurückreicht, war sie schon immer die Ernste. Ich bin die Leserin, klar, aber Cammy war immer die Nachdenkliche. Sie denkt, während sie sich die Haare kämmt und ihre Finger rabiat die Knoten in den glatten, glänzend roten Strähnen entwirren. Sie denkt, während sie ihr Müsli isst und mit der einen Hand den Löffel hält und die andere gegen die Tischplatte trommelt. Ein Stakkatorhythmus, der ihre Gedanken begleitet. Sie denkt, wenn er schreit und mit Dingen um sich wirft.
Meistens habe ich keine Ahnung, was Campbell denkt. Ich kenne sie besser als jeden anderen Menschen, aber ihr Verstand ist der reinste Marianengraben und es gibt Tiefen, die ich nie erreichen werde. Das ist schon in Ordnung. Sie kann von mir aus sämtliche Geheimnisse des Universums bewahren, solange sie wenigstens manchmal noch Kind bleibt. Mehr will ich ja gar nicht. Und genau das ist sie, wenn sie mit ihrem Fahrrad loszieht.
Campbell liebt Mom, Juniper, mich und ihr Fahrrad – und ich weiß nicht, ob das Fahrrad bei ihr auch an vierter Stelle kommen würde, wenn sie eine Rangordnung angeben müsste. Sie ist besessen von ihrem Rad. Jeden Tag nach der Schule kommt sie nur nach Hause, um ihren Rucksack in die Ecke zu schmeißen, und schon ist sie wieder weg, fährt die Frederick Street lang und biegt an der Ecke nach links ab. Sie verschwindet in eine bessere Gegend – eine, die man fast als Vorstadt bezeichnen könnte, auch wenn zwischen den Häusern immer noch jede Menge Platz ist. Sie fährt mit ihren Freunden herum, jagt von einer Straße in die nächste und ignoriert sämtliche Helmregeln. Campbell auf ihrem Rad denkt nicht. Und das ist gut.
An unserem vierten Tag in der Schule ist Cammy schon eine halbe Stunde aus dem Haus, als es an der Haustür klopft. Ich springe vom Küchentisch auf, wo ich unter Stress ein paar Uni-Broschüren studiert und mich gefragt habe, ob ich wohl jemals einen Fuß auf einen dieser efeubewachsenen Campusse setzen werde.
Mrs Stieg steht auf ihrer Veranda. Mrs Stieg ist in etwa Mitte siebzig und ich weiß nicht, wie lange sie schon Witwe ist, aber ich habe ihren Mann nicht gekannt. Sie ist nett und grau und großmütterlich. Sie winkt uns gern von ihrer Veranda aus zu, wenn wir zur Bushaltestelle gehen. Mrs Stieg liebt Rosen und sie blühen jeden Sommer in Hülle und Fülle in ihrem Garten. Mrs Stieg ignoriert gern ihre Haustür, wenn mitten in der Nacht jemand klopft.
»Kann ich Ihnen helfen?«, frage ich und überlege, wieso ich mich genötigt fühle, zu jemandem höflich zu sein, der nicht bereit ist, für mich die Polizei zu rufen – weshalb ich verpasse, was sie erwidert. Irgendwas wegen Campbell.
»Wie bitte?«
»Mein Garten auf der Rückseite des Hauses. Deine Schwester und ihre Jungs sind da gestern durchgefahren und haben meine Mister Lincolns zerstört.«
Ihre Jungs. Campbells Fahrradfreunde sind zufällig hauptsächlich Jungs. Mrs Stieg hat schon immer gern deutlich gemacht, wie sehr ihr das missfällt.
»Mister Lincoln?«, wiederhole ich.
»Meine Rosen. Sie haben ein Rosenbeet kaputt gemacht.«
»Oh, das tut mir leid«, antworte ich. »Aber das klingt überhaupt nicht nach Cammy.«
Doch, tut es.
»Das habe ich mir auch gedacht, meine Liebe. Es sind diese Jungs, mit denen sie die Nachmittage verbringt. Sollte ein Mädchen in ihrem Alter nicht Freundinnen haben?«
»Ich finde, ein Mädchen in Cammys Alter sollte ganz einfach Freunde haben, egal ob Mädchen oder Jungen.«
Mein Widerspruch erntet einen strengen Blick.
»Tut mir leid wegen der Blumen. Können wir helfen, sie wieder in Ordnung zu bringen? Ich komme gleich morgen als Erstes mit Campbell vorbei, dann beseitigen wir, was immer da passiert ist.«
Mrs Stieg denkt über das Friedensangebot nach, von dem ich weiter nicht sicher bin, ob sie es nach vorgestern Nacht verdient hat. Doch ich versuche, ihr zu vergeben. Vielleicht hatte sie Zweifel, was sie gehört hatte. Vielleicht hatte sie Angst.
»Also gut. Dann morgen früh um sieben. Und ihr zwei solltet Handschuhe mitbringen.«
#
Wir erscheinen um Viertel nach sieben mit Gartenhandschuhen in der Hand, die wir in der Garage gefunden haben, und großen Kaffeebechern. Campbell ist eigentlich überhaupt keine Kaffeetrinkerin, aber so ein frühmorgendliches Dornengemetzel verlangt nach ein bisschen Koffein.
Als ich sie gestern Abend wegen des Gartenunglücks ansprach, meinte sie, es sei ein Versehen gewesen. Ihre Freunde seien mit ihr auf dem Rückweg gewesen und hätten den Berg runter nicht mehr rechtzeitig bremsen können, weshalb sie in den Rosenbusch gekracht seien. Sie zog die Hosenbeine hoch und zeigte mir ihre Dornenkratzer.
»Wieso sollte ich freiwillig in irgendwelche Dornen fahren, Leighton? Das hat echt wehgetan.«
Ich lenkte, wenig überzeugt, ein. Campbell war Sonntagnacht draußen auf dem Dach gewesen. Sie hatte auch gesehen, wie bei Mrs Stieg das Licht an- und wieder ausging. Und wenn irgendeine Dreizehnjährige auf der Welt an Selbstjustiz glaubt, dann Campbell Grace.
Ob es mit Absicht passiert ist oder nicht, wir verbringen als Folge den Morgen mit Gartenarbeit. Wir bekommen Anweisungen von Mrs Stieg und tauchen in das Dickicht aus Zweigen und zerstörten Blüten, das einmal eine Pflanze war.
»Ihr habt das Teil echt niedergemacht«, sage ich und zerre an einem hartnäckigen Strunk. Mrs Stieg will, dass wir alle kaputten Pflanzenteile entfernen, und dann schauen, ob das Ding noch zu retten ist. Wenn nicht, schulden wir ihr einen neuen Busch. »Seid ihr wirklich nur ein Mal da durch?«
Campbell hört mich nicht – oder tut zumindest so. Sie hat ihre Arme in dem Busch vergraben und ich sehe kleine blutige Linien, wo sie die Dornen erwischt haben. »Wieso läufst du nicht heim und ziehst was Langärmeliges an, Cam? Du bist ja völlig zerkratzt.«
»Schon okay«, antwortet sie.
»Wenn du meinst«, knurre ich genervt zurück. Das hier ist ihre Sache. Ich versuche ja bloß zu helfen.
Wir arbeiten schweigend, Blut und Schweiß vermischen sich auf unseren Armen und Beinen, dort, wo die Dornen zustechen.
Wieso gerade Rosen? Von allen Pflanzen, für die man Leidenschaft entwickeln kann – wieso ausgerechnet eine mit einem eingebauten Abwehrsystem? Das wäre doch gerade so, als ob man einen Garten voll Campbells versuchen würde zu bändigen – ein ständiger Kampf und einer, der wahrscheinlich blutig endet.
Gegen neun Uhr sind wir schließlich mit dem Auseinanderziehen des zerstörten Buschs fertig und holen Mrs Stieg, damit sie entscheidet. Der Busch sieht nicht gut aus. Ihm fehlen große Bereiche an Zweigen. Doch sie betrachtet, was übrig ist, und schiebt und zerrt dran herum. Überprüft die Wurzeln.
»Er wird überleben«, sagt sie. »Obwohl wir abwarten müssen, wie zerrupft er bei der nächsten Blüte aussieht.«
Nächste Blüte heißt nächstes Frühjahr, nehme ich an.
»Super. Danke, Mrs Stieg.« Ich muss Campbell in die Rippen stoßen.
»Danke«, sagt sie halbherzig.
»Und hier, bringt die eurer Mutter mit«, sagt Mrs Stieg und reicht mir einen frisch geschnittenen Strauß von einem nicht zertretenen Rosenbusch. Die Rosen sind leuchtend gelb und riechen noch stärker als die Mister Lincolns.
»Junges Fräulein«, sagt Mrs Stieg, während sie sich zu Campbell umdreht und ihre Handschuhe an der Gartenschürze abwischt. »Wie wild durch die Straßen zu ziehen wird dich nicht sehr weit bringen. Du musst die Älteren um dich herum achten.«
»Das tu ich«, antwortet Campbell, doch ich knirsche mit den Backenzähnen bei dem Satz. Nicht alle Älteren verdienen unsere Achtung.
»Wusstet ihr Mädchen, dass mein Mann und ich vierzig Jahre verheiratet waren?«
Es ist nur ganz leicht zu spüren, aber plötzlich herrscht eine Spannung, die vor einem Moment noch nicht da war, und sie hallt auch in meinem Innern wider.
»Das ist super«, murmel ich.
»Mein Mann war nicht perfekt, versteht ihr?«, redet Mrs Stieg weiter. »Männer sind nicht perfekt. Doch es ist ihre Aufgabe, für die Familie zu sorgen, und das bedeutet Stress für sie. Und wisst ihr, was die Aufgabe der Frau ist?«
Campbells Hände ballen sich in der Taille, während ich die Arme vor der Brust verschränke.
Wir wissen genau, worauf das hinausläuft, und es hat nichts mehr mit den Rosen, Cammys Fahrrad oder ihren Freunden zu tun, sondern mit dem, was vorgestern Nacht war. Als ich daran denke, wie groß unsere Angst war, wird mir übel. Ich schmecke Galle und Rosen und die Verbindung von beidem ist das Allerschlimmste.
»Sie sollen ihre Männer unterstützen«, fährt Mrs Stieg fort und weiß nicht, wie nah dran ich bin, mich in ihre Rosenbeete zu übergeben. »Ihnen vergeben. Damit sie den Stress aushalten. Und all das still und leise. Ohne die Männer in Verlegenheit zu bringen oder einen Wirbel zu veranstalten. Versteht ihr, Mädchen?«
Und das ist der Moment, in dem die stille, immer nachdenkliche Campbell beschließt, etwas zu sagen.
»Das ist alles dämlicher Bullshit, Mrs Stieg.«
Und sie dreht auf dem Absatz um, marschiert über die Straße in unser Haus und knallt hinter sich die Tür zu.
Mrs Stiegs Mund steht vor Schock offen. Sie wendet sich mir zu und ich weiß, sie wartet auf meine Entschuldigung. Oder vielleicht sogar meine Entschuldigungen, Plural.
Tut mir leid wegen des Lärms.
Tut mir leid wegen der Störung.
Tut mir leid, dass Campbell geflucht hat, und tut mir leid, dass ich gewagt habe, an Ihre Tür zu klopfen.
»Danke für die Rosen«, sage ich stattdessen und folge Campbell nach Hause.
Ein Teil von mir weiß, dass es dumm ist. Wir haben uns einen Feind geschaffen, wo wir einen Verbündeten bräuchten. Doch ein anderer Teil in mir weiß, dass die süße, alte, großmütterliche Mrs Stieg uns niemals helfen würde. In ihrer Generation hat man gelernt, dass der äußere Schein alles ist. Dass eine gute Ehefrau zu sein wichtiger ist, als glücklich zu sein. Oder sicher.
Mom stellt die gelben Rosen in einer Vase auf einen Tisch am Treppenabsatz, neben die von unserem Vater vom Anfang der Woche. Sie riechen so stark, während sie welken und sterben, dass ich jedes Mal fast würgen muss, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Ich rieche die Rosen und denke an Frauen, die von anderen Frauen im Stich gelassen werden. Frauen, denen gesagt wird, dass ihr Gehorsam wichtiger ist als ihr Leben – und das nicht von ihren Männern, sondern von ihren Müttern und ihren Freundinnen. Von Frauen, die bereit sind, einander zuzusehen, wie sie aufgrund von Traditionen und überkommenen Vorstellungen verletzt werden.
Nach ein paar Tagen halte ich es nicht länger aus. Ich trage beide Vasen zu den Mülleimern und werfe die Rosen obendrauf. Ich will sie dort lassen, damit Mrs Stieg sieht, wie sie im Abfall verrotten, doch das tue ich nicht. Ich vergrabe sie unter einem Beutel und selbst der Müll riecht angenehmer als die Süße dieser verdammten Rosen.
6. KAPITEL
Am Montag gehen wir wie immer an Mrs Stiegs Haus vorbei, um zur Bushaltestelle zu kommen, doch plötzlich springt mir etwas aus ihrem Garten ins Auge. In der anderen Ecke ist ein weiterer Busch dezimiert. Nicht nur ein bisschen abgebrochen, sondern vollkommen pulverisiert. Es sind Erde und Reste blutroter Blüten zu sehen, aber nichts ist mehr intakt.
Als ich es Campbell zeige, zuckt sie mit den Schultern, doch irgendwas ist da. Irgendwas in Cammys großen braunen Augen schimmert und strahlt vor Stolz. Und ich weiß, wenn ich jetzt ihr Fahrrad kontrollieren würde, würde ich sicher die passenden roten Blütenreste an ihren Reifen finden.
Ich kontrolliere es nicht.
7. KAPITEL
Manchmal scheint es, als ob ich an einem Abgrund stehe und es unter mir nichts gibt, was meinen Sturz auffangen könnte.
Wenn ich mich so fühle, greife ich nach den Worten von jemand anderem, um mich vom Abgrund wegzuziehen. Um mich daran zu erinnern, dass die Welt größer ist als mein Zuhause. Größer als Auburn. Es ist das Beste, was ich von Mom geerbt habe – ihre Liebe zu Wörtern. Sie liebt klassische Literatur und Lyrik und alle Erinnerungen an meine Kindheit riechen nach Stapeln von Taschenbüchern, die sie überall im Haus bunkerte. Sie machte Bücher auf eine Weise zu unserem Heim, wie es unser Haus niemals war.
Doch inzwischen ertrage ich die Klassiker nicht mehr. Sie hat immer gesagt, dass sie romantisch seien, doch jedes Mal gibt es am Schluss jemanden mit gebrochenem Herzen oder jemanden, der stirbt. Oder jemanden mit gebrochenem Herzen, der deshalb stirbt. Als ob die Tragödie das einzige Ende wäre, das überhaupt von Belang ist.
Heute ziehe ich Journalismus der Literatur vor. Ich ziehe die Wahrheit der Trauer vor. Romantik soll draußen bleiben, ich bin ein Zeitungsmensch.
Trotzdem muss ich Literatur belegen und wir lesen Tess von den d’Urbervilles, insofern bin ich doch noch nicht vollständig durch mit den Tragödien. Ich schlüpfe frühzeitig in den Klassenraum und blättere die Kapitel durch, die wir an diesem Wochenende zusammenfassen sollten. Als Liam hereinkommt, nehmen wir kurz Blickkontakt auf und er nickt mir zu.
Ich schaue schnell wieder zurück in mein Buch.
Doch als er hinten Platz genommen hat, muss ich mich einfach noch mal zu ihm umdrehen. Er sitzt natürlich mit den beliebten Leuten zusammen, aber im Uni-Vorbereitungskurs ist das eine besondere Gruppe. Die superklugen beliebten Leute. Sie sitzen mit zusammengerückten Tischen neben ihrem Freund oder ihrer Freundin, immer knapp am Rande dessen, was noch erlaubt ist. Alexis und Brody haben eine On-off-Beziehung, doch heute stehen ihre Tische so eng wie nur möglich zusammen und er hat seinen Arm um ihre Schulter liegen. Beide sind groß und blond, mit langen Beinen und sehr athletisch. Es wird immer behauptet, dass Leute, die beliebt sind, dumm seien, aber das stimmt nicht. Sie sind einfach Leute mit besserer sozialer Kompetenz. Warum bei der Wahl zum Homecoming-Hofstaat aufhören, wenn sie Harvard haben können? Besonders ohne irgendwelche Hindernisse, die einen abhalten, wirklich zur Uni zu gehen.
Auf der anderen Seite von Brody sitzt Amelia. Sie ist definitiv für Harvard gemacht. Sie hat perfekte Zähne und Eltern, die Chirurgen sind. Und sie kann wahrscheinlich sowohl Jane Austen als auch die neueste Glamour zitieren. In Wahrheit bin ich immer ein bisschen eifersüchtig auf Amelia gewesen. Es ist, als ob sie mit jedem befreundet ist. Man kann auf sie zugehen. Selbst wenn ich warmherzig und einladend sein wollte – ich wüsste nicht, wie ich mich aus dem ganzen Stacheldraht befreien sollte, den ich um mich herum errichtet habe. Es zeigt sich schon in der Haltung meines Kiefers. In der Art, wie ich meine Schultern von anderen abwende. Nur mit Vorsicht nähern, schreit meine ganze Körpersprache und es ist die einzige Sprache, die ich noch kenne.
Als mein Blick zu Liam zurückkehrt, wirkt sein Schreibtisch wie eine Insel. Er kann nicht wirklich ein Einzelgänger sein, denke ich mir, wenn er jemand ist, der ständig eine Freundin hat, und doch wirkt er irgendwie allein. Abgesondert. Als wenn er einen kleinen Puffer um sich herum hätte. Ich denke, in so einer kleinen Stadt laufen unsere sozialen Beziehungen spätestens im Abschlussjahr auf Autopilot. Es ist lange her, dass irgendwer von uns mal hochgeguckt hat. Oder zumindest gilt das für mich. Was wahrscheinlich der Grund ist, wieso ich Liam überhaupt nicht wahrgenommen hätte, wenn ihm nicht die Verwechslung mit Lyla Jacobs passiert wär.
Mrs Riley beginnt unsere Tess-Stunde und ich versuche, nicht mehr an Liam zu denken, sondern mich ganz auf sie zu konzentrieren. Mrs Riley unterrichtet mit einer Begeisterung fürs Lernen, die Magic-School-Bus-Niveau hat. Sie ist exzentrisch und laut. Sie gibt übrigens auch die Zeitung heraus, deshalb bin ich an ihre Verrücktheiten gewöhnt, doch es ist ein bisschen schräg, wenn wir über Geschlechterungleichheit im 19. Jahrhundert sprechen.
»Der Sozialkommentar wird als seiner Zeit weit voraus angesehen, besonders wenn es um Frauen geht … irgendwelche Meinungen dazu?«
»Was war Thomas Hardy, ein Feminist? Können Männer überhaupt Feministen sein?«, fragt Brody von hinten. Er lehnt sich auf seinem Stuhl zurück und spreizt die Beine so weit, dass er den ganzen Gang zwischen den Tischen blockiert.
Und er sagt »Feminist«, als ob es ein Schimpfwort wäre.
»Wie würdest du Feminismus denn definieren?«, fragt Mrs Riley.
»Hm, frigide Zick… ähm, Tussen mit rosa Mützen?«, antwortet Brody und in der Klasse bricht Gekicher aus. Ich mache mit meinem Tess-Buch rum und knicke die Ecken der Seiten um, als wenn ich die Stellen für irgendwas brauchen würde. Wenn mich Mrs Riley fragt, werde ich sagen, ich habe alle Passagen markiert, an denen ein eingebildeter, Ansprüche erhebender Arsch versucht, Tess’ Leben kaputt zu machen.
»Sonst noch jemand?«, gibt Mrs Riley die Frage an die Allgemeinheit weiter. »Leighton?«
»Klar, fragt die Ice Queen«, murmelt Brody.
Mein kühles, gefasstes Äußeres geht mir voraus. Ice Queen. Letztes Jahr hab ich Brody für den Juniorball abblitzen lassen, seither macht er immer spitze Bemerkungen über mich, dass ich zu kalt bin, um für einen Jungen aufzutauen. Er hat mich damals nicht wirklich gefragt, sondern gleich überfallen, indem er in der Kantine vor mir auf die Knie ging mit einem Kästchen in der Hand, in dem die Karte für den Ball lag. Und ich hab Nein gesagt. Vor allen andern. Öffentliche Zurückweisung kam nicht gut an bei Brody, deshalb bezeichnet er mich seither immer als Ice Queen.
»Männer können durchaus Feministen sein«, antworte ich und dreißig Augenpaare drehen sich in meine Richtung. Ich bin heute ziemlich gereizt, deshalb füge ich noch hinzu: »Aber wahrscheinlich eher die höher entwickelten.«
»Wie ich«, sagt Liam McNamara. »Ich bin Feminist.«
»Okay, gut«, sagt Mrs Riley. »Dann definier mal das Wort.«
Er stockt. »Äh. Lohndifferenz. Wonder Woman. BH-Verbrennung?«
»O Gott, bitte hör auf«, sag ich.
»Danke«, sagt Liam. »Mehr hätte ich auch nicht.«
»Du bist wahrscheinlich trotzdem ein Feminist. Es bedeutet einfach, du glaubst, Frauen sollen die gleichen Rechte haben. Ist nicht so kompliziert oder beängstigend. Die Mützen sind nicht zwingend«, antworte ich.
»Klingt bescheuert«, sagt Brody.
»Bescheuert ist zu glauben, dass ein Mädchen verpflichtet ist, mit dir auszugehen, nur weil du sie gefragt hast.«
»Zieh deine Krallen wieder ein, Mieze, das hier ist keine Protestveranstaltung«, antwortet Brody, kräuselt die Lippen und wirft mir einen Kuss zu.«
»Fahr zur Hölle, Brody«, fauche ich.
»Okay, das reicht«, sagt Mrs Riley. »Kommen wir wieder zu Tess zurück.«
Die Diskussion wechselt zurück ins 19. Jahrhundert, doch hinten in der Klasse herrscht immer noch Unruhe. »Lass sie in Ruhe«, sagt Liam und tritt gegen Brodys ausgestrecktes Bein, sodass er es unter den Tisch zurückzieht.
Liam.
Ich werfe noch einen kurzen Blick auf ihn.














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














