
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Young Bond
- Sprache: Deutsch
Atemberaubende Spannung, mitreißende Action – das dritte explosive Abenteuer über den coolsten Geheimagenten der Welt aus Steve Coles Young-Bond-Serie! Er ist jung. Er ist ein Rebell. Er ist auf dem Weg zur Legende. Der fünfzehnjährige James Bond beobachtet einen schrecklichen Vorfall im Labor seines Colleges. Einer seiner Mitschüler kommt bei einem Experiment ums Leben. War es wirklich ein Unfall? Als James den mysteriösen Todesfall aufklären will, gerät er ins Visier internationaler Waffenschmuggler und Kriegstreiber. Eine riskante Jagd quer durch Europa beginnt. Kann er die Wahrheit ans Licht bringen und den skrupellosen Kriminellen das Handwerk legen? Ein packender Action-Krimi für junge und alte Bond-Fans! Alle Bände der Serie: Young Bond – Der Tod stirbt nie Young Bond – Tod oder Zahl Young Bond – Schneller als der Tod Weitere Bände sind in Vorbereitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Steve Cole
Young Bond
Schneller als der Tod
Über dieses Buch
Er ist jung.
Er ist ein Rebell.
Er ist auf dem Weg zur Legende.
Der fünfzehnjährige James Bond beobachtet einen schrecklichen Vorfall im Labor seines Colleges. Einer seiner Mitschüler kommt bei einem Experiment ums Leben. War es wirklich ein Unfall? Als James den mysteriösen Todesfall aufklären will, gerät er ins Visier internationaler Waffenschmuggler und Kriegstreiber. Eine riskante Jagd quer durch Europa beginnt. Kann er die Wahrheit ans Licht bringen und den skrupellosen Kriminellen das Handwerk legen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Steve Cole wurde 1971 geboren und studierte an der University of East Anglia, England. Er war Herausgeber einer Zeitschrift, Lektor für verschiedene Verlage und ist heute ein erfolgreicher Autor. Er ist schon sein Leben lang großer Fan von James Bond und führt nun die Young-Bond-Serie weiter, auf deren Fortsetzung Fans weltweit sehnsüchtig gewartet haben. Mehr Informationen über Steve Cole und den James-Bond-Erfinder Ian Fleming gibt es unter www.stevecolebooks.co.uk und ianfleming.com
Folgende Young-Bond-Bände von Steve Cole sind bisher bei Fischer KJB erschienen:
Young Bond – Der Tod stirbt nie
Young Bond – Tod oder Zahl
Young Bond – Schneller als der Tod
Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendbuchprogramm der S. Fischer Verlage finden sich auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel ›Young Bond – Strike Lightning‹ bei Doubleday, an imprint of Random House Children's Publishing, London.
Copyright © Ian Fleming Publications Limited 2016
The moral rights of the author have been asserted.
JAMES BOND and YOUNG BOND are the registered trademarks of Danjaq, LLC, used under licence by Ian Fleming Publications Ltd.
All rights reserved.
Ian Fleming and the Ian Fleming logo are both trademarks owned by The Ian Fleming Estate, used under licence by Ian Fleming publications Limited.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: atelier seidel verlagsgrafik nach einer Idee von Blacksheep.
Mit freundlicher Genehmigung von Random House Childrens's Publishers UK, einem Unternehmen der Random House Group Ltd
Umschlagabbildung: Blacksheep unter Verwendung von Motiven von Getty Images und Shutterstock
Satz:
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-0210-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Prolog Das Tote Land
Kapitel 1 Ganz egal, welche Aufgaben das Leben dir stellt
Kapitel 2 Anweisungen befolgen
Kapitel 3 Ein Sturm zieht auf
Kapitel 4 Der Blitz schlägt zweimal ein
Kapitel 5 Im Dunkeln
Kapitel 6 Eine gedrehte Klinge
Kapitel 7 Konfrontation
Kapitel 8 Verbündete und Feinde
Kapitel 9 Ermittlungen
Kapitel 10 Die Nacht der Entdeckung
Kapitel 11 Die Frau in der eisernen Rüstung
Kapitel 12 Ganz unten
Kapitel 13 Fremde in einem fremden Land
Kapitel 14 Es beginnt mit einem Einbruch
Kapitel 15 Verrat
Kapitel 16 Zähne und Klauen
Kapitel 17 Ein Haus voller Fallen
Kapitel 18 Bedroht von allen Seiten
Kapitel 19 Blinde Passagiere
Kapitel 20 Die Schattenfabrik
Kapitel 21 Auf der falschen Seite der Gleise
Kapitel 22 Mensch und Maschine
Kapitel 23 Blutbanner
Kapitel 24 Seitenwechsel
Kapitel 25 Schicksalhafte Begegnungen
Kapitel 26 Countdown zum Gemetzel
Kapitel 27 Leben und sterben lassen
Kapitel 28 In der Hölle
Kapitel 29 Frieden und Wohlgefallen
Danksagung
Anmerkungen des Autors Der Blitz schlägt dreimal ein
Stählerne Schatten
Flemings phantastische Geschichten
Örtlichkeiten
Äussere Hüllen
Die Young Bond-Serie bei FISCHER KJB
Für Amy
PrologDas Tote Land
Ein neuer Tag, ein neues Spiel. Duncan zwängte sich durch die winzige Lücke im Zaun, vorbei an dem Schild mit der Aufschrift LEBENSGEFAHR. Die anderen Jungen rechneten bestimmt niemals damit, dass er sich auf das Tote Land wagte, aber genau darin lag ja das Geheimnis des Sieges: Nur durch wagemutiges Handeln kannst du deine Feinde überrumpeln.
»Duncan, du bist der deutsche Scharfschütze, und wir sind die britischen Soldaten, die dich jagen.« Die älteren Kinder hatten ihn, wie jedes Mal, zum Feind gemacht, zur Zielperson. Nur deshalb ließen sie ihn überhaupt mitmachen, wenn sie die Schule schwänzten. »Wir lassen dir zehn Minuten Vorsprung, dann verfolgen wir dich und schießen dich in Stücke.« Und wenn sie ihn dann aufgestöbert hatten, kannten sie kein Erbarmen und bewarfen ihn mit Steinen – entweder mit vielen auf einmal (das waren die Maschinengewehre) oder mit einzelnen (das waren die sorgfältig gezielten Revolverschüsse). So oder so, es tat jedes Mal verdammt weh.
Dieses Mal nicht, dachte Duncan. Dieses Mal würde er ihnen in den Rücken fallen und sie zuerst bewerfen. Dieses Mal würden sie seine »Kugeln« zu spüren bekommen, und dann würden sie ihm endlich einmal ein kleines bisschen Respekt entgegenbringen. Und das nicht nur, weil er gesiegt hatte, sondern weil er sich auf das Tote Land gewagt hatte, und das mit gerade einmal dreizehn Jahren!
Zahllose Geschichten rankten sich um dieses Land: seltsame Lichter am Himmel … Felder voller toter Tiere … ein fauliger Gestank, der über die Highlands hinwegweht … Geistersoldaten, die bei Nacht durch die Wälder marschieren …
Duncan huschte so lautlos wie nur möglich durch die unberührte Landschaft. Zwischen den Büschen und Bäumen waren Felsen jeder Form und Größe zu erkennen, aber der mächtige Binean, der »Berg der Vögel«, überragte alles. Trotz des schönen Sommerwetters war jetzt kein Vogelgezwitscher zu hören. Früher war dieses Land Teil eines gepflegten Parks gewesen, es hatte zum Anwesen eines Generals gehört, doch dieser General war aus dem Ersten Weltkrieg nicht mehr zurückgekehrt. Jetzt patrouillierten bestimmt keine Wildwächter mehr durch den Wald, da war Duncan sich sicher – es gab keine Fasane und Rebhühner mehr, keine Schädlingsfallen und keine Schlingen, mit denen Hermeline oder Wiesel gefangen wurden. Er war noch keine fünfzig Meter auf das Gelände vorgedrungen, da waren schon keine Trauerbirken mit ihren tiefhängenden Ästen und umherwehenden, geringelten Zweigen mehr zu sehen, sondern nur noch nackte Erde und verkohlte Baumstümpfe.
Offensichtlich trug das Tote Land seinen Namen völlig zu Recht.
Duncan traute dieser unnatürlichen Stille nicht. Es kam ihm vor, als ob der Boden vergiftet sei und die ganze Umgebung gleich mit. Vögel und Tiere mieden das Land, als spürten sie genau, dass hier eine tödliche Gefahr lauerte.
Früher vielleicht, dachte Duncan. Aber jetzt ist hier gar nichts mehr.
Schnell wurde ihm klar, dass er, wenn er sich immer am Rand des Toten Landes hielt, nicht weit kommen würde. Hier war der Wald einfach zu dicht. Gestrüpp und dornige Zweige griffen nach seinen Armen und Beinen und fügten ihm zahlreiche Kratzer zu. Entweder kehrte er um, oder er wagte sich noch weiter auf dieses unbekannte Territorium vor, ehe er versuchte, seinen Mitschülern in den Rücken zu fallen.
Duncan malte sich seinen Triumph aus, stellte sich vor, wie seine Steine auf die Hinterköpfe der anderen Jungen prasselten. Wie ihre Mienen bisher unbekannten Respekt ausdrückten. Er kämpfte sich noch etliche Minuten lang weiter, begleitet vom regelmäßigen Knacken dürrer Zweige.
Aber als er dann schweißgebadet und mit brennenden Muskeln stehen blieb, verstummten die Geräusche in seinem Rücken keineswegs.
Zitternd vor Angst hörte Duncan, wie Gestrüpp und Unterholz niedergewalzt wurde, als würde eine kleine Armee sich hastig durch das tote Gehölz kämpfen. Und dann war da noch ein anderes Geräusch. Es wirkte seltsam fremd in dem leblosen Wald: ein zischendes, sirrendes Blubbern, das Duncan sich beim besten Willen nicht erklären konnte.
»Die Geistersoldaten …«, stieß er atemlos hervor.
Von tödlichem Entsetzen gepackt, stürmte er los, ohne auf die Zweige zu achten, die schmerzhaft gegen seinen Körper schlugen. Er musste sich keine Mühe geben, leise zu sein, denn was immer ihm auf den Fersen sein mochte, es machte einen Höllenlärm. Mittlerweile hörte es sich auch nicht mehr an wie ein Soldatentrupp, sondern wie ein gewaltiges, mechanisches Ungetüm, das sich erbarmungslos mit immer gleichem Tempo vorwärtsfraß.
Duncan prallte gegen einen Zaun und kletterte, ohne nachzudenken, darüber hinweg. Als er sich über die Spitze schwang, verfingen sich seine Kleider in dem rostigen Stacheldraht. Mit zusammengebissenen Zähnen rappelte er sich auf und rannte über ein Feld mit langen Grashalmen. Die Stängel waren bräunlich verfärbt, und über allem hing ein beißender Chemiegestank. Es stimmt also tatsächlich, dachte er mit tränenden Augen, während er seine blutigen Hände zu einem verzweifelten Gebet faltete. Alles hier ist tot. Bitte, lass mich hier wieder rauskommen. Bitte.
Er sank auf die verdorrte Grasfläche und lauschte. Das unwirkliche Knirschen und Krachen im Wald war etwas schwächer geworden. Es entfernte sich von ihm, so dass Duncan jetzt auch das leise Rauschen eines Wasserlaufs hören konnte. Er stieß einen tiefen Seufzer aus. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er Schmerzen am ganzen Körper hatte. Der Stacheldraht hatte ihm zahlreiche tiefe Schnitte zugefügt, und sein Hemd war blutgetränkt.
Duncan biss auf die Zähne und taumelte dem Wasserrauschen entgegen. Wie tief war er schon in das Tote Land vorgedrungen? Du kommst hier bestimmt wieder raus, sagte er sich, als ein kleiner, strudelnder Bach in Sicht kam. Aber zuerst Wasser. Etwas trinken. Die Wunden ausspülen. Wasser.
Allerdings war das Wasser trüb und roch faulig. Dazu kam der ölige Film auf der Oberfläche. Duncan wagte nicht einmal, die Hand hineinzustecken, geschweige denn, etwas davon zu trinken.
Er hüpfte auf das andere Ufer und bahnte sich einen Weg durch das vertrocknete Unterholz, bis er eine Art Schlucht vor sich liegen sah. Ich muss hier raus. Riesige Felsblöcke versperrten ihm den Weg, höchstwahrscheinlich die Überreste eines Steinschlags. Und wenn er auf einen dieser Felsen kletterte? Vielleicht konnte er ja von dort oben den besten Ausweg erkennen?
Doch noch bevor er das versuchen konnte, hörte er ein lautes Zischen, wie einen Pressluftstoß, und dann das sirrende Pfeifen eines Projektils. Im nächsten Augenblick wurde er in einer Wolke aus Steinen und Staub zu Boden gerissen. Er rollte sich zu einer Kugel zusammen, kniff die Augen zu und atmete in hastigen Stößen, während unzählige kleine Steine auf ihn herabregneten.
Das letzte Echo der Explosion verhallte, und eine kräftige, gebieterische Stimme ließ sich vernehmen. Allerdings waren die Worte nicht so leicht zu verstehen, da der Sprecher lispelte. »Der BR-12-Mörser schießt mit speziellen, hochexplosiven Projektilen, Herr Generalleutnant.« Das kam von der anderen Seite der Felsbrocken. »Die Granate besitzt einen Raketenantrieb in Miniaturformat. Damit prallt sie gewissermaßen von der Oberfläche des Zielgebietes ab. Die Explosion erfolgt in der Luft und führt so zu sehr viel größeren Schäden …«
Nachdem die Staubwolke sich gelegt hatte, sah Duncan eine kleine Menschengruppe in der Schlucht stehen. Ein großgewachsener, wettergegerbter Mann betrachtete gerade die Auswirkungen der Granate auf den Felsblock. Neben ihm stand …
Duncan schauderte, als er die gebeugte Gestalt in Augenschein nahm, die immer noch über den Granatwerfer sprach wie ein stolzer Vater über sein Kind. Obwohl es sehr warm war, trug der Mann einen schweren, schwarzen Mantel. Seine Gesichtszüge wurden durch eine Kapuze verdeckt, und seine behandschuhte Hand umklammerte einen Spazierstock. Zwei kräftige Männer standen hinter ihm und schienen jederzeit bereit, ihn aufzufangen, falls er stürzen sollte.
»Das ist eine außerordentlich zufriedenstellende Waffe, Mr Blade, wenn auch ein wenig konventionell.« Der Mann im Anzug sprach ein etwas umständliches Englisch. Das muss der Generalleutnant sein, dachte Duncan. Ein deutscher Offizier. Was hatte der denn hier zu suchen, mitten in den schottischen Highlands? »Wie war noch einmal die Mindestbestellmenge? Helfen Sie mir …«
»Wollen wir sagen … dreißigtausend?«
Duncan machte die Augen zu. Dreißigtausend Mörser? Das hier waren keine Gespenster eines vergangenen Krieges. Diese Männer bereiteten, nach allem, was er jetzt gehört hatte, einen neuen vor, und zwar hier, mitten auf dem Toten Land.
»Aber zuerst müssen Sie mir noch etwas verraten«, entgegnete der Deutsche. »Dieser so hochentwickelte und durchdachte Granatwerfer, den Sie mir anbieten … Können seine Geschosse auch den Stählernen Schatten zerstören?«
»Sie würden ihm kaum einen Kratzer zufügen«, erwiderte der Buckelige mit heiserem Lachen. »Wir gehen bei der Erschaffung des Stählernen Schattens an die Grenzen des technisch Machbaren. Sobald mein Mitarbeiter den Geschwindigkeitstest abgeschlossen hat, können Sie den Apparat persönlich mit dem Mörser unter Feuer nehmen. Danach sprechen wir uns dann wieder.«
Duncan kauerte immer noch auf dem steinigen Untergrund. Plötzlich blickte er sich um. Bildete er sich das nur ein oder …?
Nein. Da war dieses Krachen wieder. Jetzt ertönte ein lautes Platschen, als das Ding – was immer es sein mochte – den trüben Bach durchquerte, gefolgt von dem Rumpeln und Jaulen seltsamer Motoren. Das Ding, das er vorhin schon gehört hatte, war auf dem Weg hierher, um weitergetestet zu werden.
Vollkommen außer sich vor Angst brach Duncan aus der Deckung hervor und rannte los, so schnell ihn seine schmerzenden Beine trugen.
»Erschießen Sie den Eindringling!«
Darauf ertönten Schüsse. Kugeln pfiffen und schlugen rings um Duncan in die Erde ein oder prallten gegen die Felsen. Die wollen mich umbringen!, dachte er und rannte nach links, weg von der Schlucht. Er musste so schnell wie möglich wieder zurück zum Zaun, zurück zu den anderen. Sie würden ihm niemals glauben, was sich hier abspielte. Es gibt tatsächlich einen deutschen Scharfschützen, und er hat einen Mörser, und dann war da noch ein …
Duncan blieb ruckartig stehen und erkannte, dass das zischende, blubbernde Ding irgendwo zu seiner Rechten sein musste und jetzt durch ein Waldstück brach. Er sah Metall zwischen den abgestorbenen Zweigen aufblitzen.
Schneller! Lauf schneller! Mit blutverschmierten Händen schlug Duncan das dichte Unterholz beiseite und schlängelte sich kreuz und quer durch das Gestrüpp. Endlich erreichte er mit brennenden Lungen ein freies Feld. Hoffnung keimte in ihm auf. Dort, am hinteren Ende, war wieder Wald zu sehen, dort würde er Deckung finden. Er rannte los, ohne das umgekippte Schild ganz in seiner Nähe zu beachten. Vielleicht konnte er sich ja im Unterholz verstecken und der unheimlichen Bedrohung entkommen, die da auf ihn zu…
Die Explosion hüllte ihn in eine Wolke aus Feuer und Hitze und schleuderte ihn in die Luft. Duncan landete auf dem Rücken, blutig und zu Tode entsetzt. Dann fiel sein Blick auf das verblasste Schild: BETRETEN VERBOTEN! MINENFELD!
Im ersten Moment war seine größte Sorge, dass der Lärm der Explosion seine Verfolger direkt zu ihm locken würde. Duncan wollte aufstehen, aber er konnte sich nicht bewegen. Verständnislos starrte er die Fleischbrocken an, die ihn umgaben. Der Schock und das Adrenalin ersparten ihm wohl den Schmerz.
Doch vor dem rumpelnden, zischenden Ding, das mitten durch den Rauch und mit erstaunlichem Tempo auf ihn zukam, gab es kein Entrinnen. Ein klobiger Schatten fiel auf Duncan, und endlich drang auch ein lauter Schmerzensschrei aus seiner Kehle.
Ein gespenstisches Echo hallte durch die Schlucht.
»Was ist denn los?« Der deutsche Generalleutnant wirkte besorgt. »Blade, dieser Eindringling …«
»Diese verdammten Kinder.« Die gebeugte, wütend vor sich hin murrende Gestalt schob die Kapuze zurück, so dass ein schiefes, verzerrtes Gesicht mit scharfen, habichtartigen Zügen zum Vorschein kam. »Sie hören alle möglichen Geschichten über unser Versuchsgelände und machen dann Mutproben. Diese kleinen Narren.«
»Ein höchst bedauerlicher Zwischenfall. Was wollen Sie unternehmen?
»Bedauerlich, in der Tat, aber wir können nicht zulassen, dass unsere Arbeit gefährdet wird. Wir müssen den Leichnam irgendwohin schaffen, wo er nie gefunden wird …« Blade schnaubte. »Und dann brauchen wir einen höheren Zaun.«
Kapitel 1Ganz egal, welche Aufgaben das Leben dir stellt
James Bond flog durch die Luft und erhaschte dabei einen Blick auf die hohe Decke mit den dicken Balken. Dann landete er mit dem Rücken auf dem Holzfußboden. Der krachende Aufprall hallte laut durch die ganze Turnhalle. Kaum hatte er ein erstes Stöhnen hervorgebracht, da sprang sein Gegner ihm auf die Brust, bohrte ihm links und rechts die Knie in die Seiten und wollte ihn am Kragen packen.
Wenn er mich jetzt in den Schwitzkasten nimmt, dachte James, dann ist es vorbei. Er riss die Arme hoch, so dass sein Angreifer keinen festen Griff zustande brachte, und versuchte, ihn mit einem kräftigen Hüftstoß abzuwerfen. Gleichzeitig drehte er sich nach rechts. Da sein Gegner sich nicht festhalten konnte, landete der jetzt auf dem Fußboden, rollte sich jedoch blitzschnell ab und war wieder auf den Beinen. James kam gleichzeitig mit ihm in die Senkrechte, schlug zu und streifte den anderen mit der Faust am Kinn.
»Hab ich kaum gespürt.« Sein Gegner keuchte und grinste über das ganze Gesicht. Seine Wangen waren genauso rot wie seine dichten Locken. »Schwächelst du etwa, Bond?«
»Das wirst du gleich sehen, Stephenson.« James wollte seinen Gegner verunsichern und täuschte einen Angriff an, aber Marcus Stephenson wich ihm einfach aus und startete seinerseits einen Scheinangriff. Beide Jungen versuchten fieberhaft, irgendwie einen Griff anzusetzen, um ihren Gegner zu besiegen.
Die eine Hand am Jackenaufschlag seines Gegners, die andere an seinem Ellbogen, zog James Marcus zu sich heran und hob ihn gleichzeitig ein wenig hoch, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Doch dann landete Marcus einen Schlag an James’ Kinn, so dass sein Gegner rückwärtstaumelte, und setzte einen Uchi Mata ein, einen Oberschenkelwurf, mit dem er James aus dem Gleichgewicht brachte.
Unmittelbar bevor er auf dem Boden landete, wurde James klar, dass es ein sehr harter Aufprall werden würde. Dann krachte er mit dem Kopf auf die Holzbretter, sah Sterne und schnappte nach Luft. Behutsam betastete er seinen dichten, schwarzen Haarschopf und den darunterliegenden Schädelknochen. Alles intakt, soweit er das beurteilen konnte. Also dann, aufstehen. Aufgeben kam jedenfalls nicht in Frage.
Aufgeben kam niemals in Frage.
»Hast du immer noch nicht genug?«, wollte Marcus wissen.
Langsam rollte James sich auf die Seite. Staubflusen umschwebten ihn im Schein der Wintersonne, die zu den hohen Fenstern hereinschien. Er stemmte die Handflächen auf den Boden und verdrängte mit aller Macht den Schmerz. Ihm war klar, dass er diesen Kampf nur gewinnen konnte, wenn er hundertprozentig konzentriert war.
Marcus wartete, bis er sich aufgerappelt hatte. Dann begann der Wettkampf von neuem. James machte einen Schritt auf ihn zu, wich wieder zurück, täuschte einen Ausfallschritt nach links, dann einen nach rechts an. Seine Finger streiften zwar Marcus’ Jacke, aber noch bevor er richtig zupacken konnte, wurde ihm schwindelig.
Eine Hand packte ihn am Ärmel. Er schüttelte sich, um den Nebel aus seinem Kopf zu vertreiben, und hatte plötzlich eine Ahnung, was als Nächstes kommen würde. Marcus’ Fuß schnellte zur Seite. Er wollte James das Standbein wegschlagen und ihn erneut auf die Bretter schicken. James wartete bis zum letzten Augenblick, dann drehte er sich blitzschnell und unerwartet um die eigene Achse und packte Marcus an dessen linkem Oberarm und am Handgelenk. Er bekam Sehnen und Muskelfasern zu fassen und bückte sich nach vorne, so dass sein Gegner wie eine Wippe quer über seinen Rücken fiel. Mit einem lauten Aufschrei segelte Marcus durch die Luft und landete flach auf dem Rücken.
Jetzt bin ich dran, dachte James. Er hockte sich mit gespreizten Beinen auf seinen Gegenspieler, packte mit überkreuzten Händen dessen Jackenaufschläge und drückte die Unterarme nach innen, um Marcus’ Hals von beiden Seiten zuzudrücken. Marcus wollte sich aus seinem Griff winden, stöhnte und spannte alle Muskeln an …
Schließlich klopfte er zweimal auf den Boden.
James ließ los und sprang auf. Er atmete schwer und fühlte sich großartig. »Na? Wie war das?«
»Du Schwein!« Marcus grinste zu ihm hinauf und reichte ihm die Hand. »Mit einem Kata Juji-jime habe ich nicht gerechnet.«
»Wende ich immer wieder gerne an. Aber frag mich nicht, wie man das buchstabiert.« James reichte Marcus die Hand und half ihm aufzustehen. »Du bist aber nicht ernsthaft verletzt, oder?«
»B-b-bloß sein Stolz!« Am Rand der Turnhalle des Fettes College, auf einem großen Haufen Sprungmatten, saß Perry Mandeville und klatschte in die Hände. »Wenn man bedenkt, dass ihr gute Freunde seid, dann war das ein wirklich erbitterter Kampf. Zumindest für das Auge des ungeübten B-B-Betrachters.« Er lehnte sich ein Stückchen zurück, wie um das Gesagte noch einmal zu unterstreichen.
»Für das Auge des faulen Betrachters, meinst du wohl.« James fuhr sich mit den Fingern durch die schweißnassen Haare, aber trotzdem rutschte ihm eine starrsinnige, schwarze Locke immer wieder quer über die Stirn. »Wir haben dich nicht nur zum Zuschauen eingeladen, Mandeville. Wenn wir wirklich einen vernünftigen Judoclub gründen wollen, dann brauchen wir Leute, die mitmachen.«
»Und ein paar neue Kampfanzüge für unsere Mitglieder.« Marcus, ein schlaksiger Junge von siebzehn Jahren, zog mit einem spitzbübischen Grinsen an James’ alter, zerschlissener Judojacke. Sie hatte früher einmal ihm gehört, aber mittlerweile war sie ihm zu klein geworden. »Du hast zwar gesiegt, aber wohl kaum besonders stilvoll.«
»Ich versuche, die Oberschwester zu überreden, dass sie mir noch einen besorgt«, erwiderte James. »Und den hier überlasse ich Perry, sobald er sich uns angeschlossen hat.«
»Sehr interessant, alter Freund, aber so weit wird es nicht kommen.« Perry lächelte. »Ich suche die Gefahr. Ich genieße das Risiko, womöglich auf dem Rücken zu landen. Aber wenn es von Anfang an klar ist? Das kann mich nicht locken.«
»Judo ist immerhin gesünder, als eine Schafherde ins Zimmer des Direktors zu treiben«, neckte Marcus ihn. »Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du das tatsächlich gemacht hast, Mandeville. War doch klar, dass das schmäh-äh-äh-ählich enden musste.«
»Ja, ja, ja. Warum listest du nicht gleich m-m-meine ganze kriminelle Vergangenheit auf? Habe ich nicht schon genug erduldet, indem sie mich aus Eton weggejagt und g-g-gezwungen haben, bei Leuten wie euch zu wohnen?« Perry sprang auf und nahm Fechthaltung ein. »Wenn ich jetzt m-m-mein geliebtes Florett bei mir hätte, dann würde ich meine Ehre sofort wiederherstellen, das kann ich euch versichern.«
»Ach, tatsächlich?« Marcus hob eine Augenbraue. »Du scheinst die Gefahr ja wirklich zu lieben.«
»Sonst wäre das Leben nicht lebenswert, nicht wahr?« Perry lächelte James zu. »Hier, frag doch m-m-meinen guten Freund. Alles, was er kann, habe ich ihm beigebracht.«
James schnaubte gutmütig. In Eton war Perry tatsächlich ein guter Freund gewesen, und außerdem Mitbegründer der »Gefahren-Gemeinschaft«, einer geheimen Vereinigung von Schülern, die gegen die Autoritäten aufbegehren wollten. James hatte keinen Wimpernschlag lang gezögert und war Mitglied geworden. Und obwohl er in der Zwischenzeit etliche Abenteuer erlebt hatte, die das heimliche Ausbüchsen aus dem Schafsaal, um eine verbotene Zigarette zu rauchen, ziemlich harmlos aussehen ließen, dachte er gerne an jene weit unschuldigeren Tage zurück.
Jetzt höre ich mich schon an wie ein Kriegsveteran, wurde es James bewusst.
»Also, meine Freunde, hört mal zu. Jetzt, wo ihr mit eurem ach so wunderbaren japanischen Gegrapsche fertig seid …« Perry senkte die Stimme und winkte James und Marcus näher zu sich heran. »Natürlich sind wir George und M-M-Marina von Herzen dankbar, dass sie sich an einem Donnerstag das Jawort geben wollen. Aber das bedeutet gleichzeitig, dass wir die heilige Pflicht haben, unsere kostbare Freizeit nicht zu verplempern …«
James lächelte. Heute, am 29. November 1934, würde Seine Königliche Hoheit Prinz Georg, der Herzog von Kent, seine Cousine zweiten Grades, Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Marina von Griechenland, heiraten. Daher hatte der König einen landesweiten Feiertag angeordnet. Gewöhnlich rückte der Schuldirektor erst am Samstag einen Shilling pro Schüler heraus, was zur Folge hatte, dass der Kiosk sonntags von einer gewaltigen Masse Jugendlicher überrollt wurde, die sich mit Schoko-Vanille-Mokka-Biskuits eindecken wollten. Aber anlässlich der königlichen Hochzeit hatte er das Geld bereits heute Morgen ausgespuckt, damit die Schüler in den lebhaften Straßen von Edinburgh angemessen feiern konnten – wenn auch nur an ausgewählten, von der Schule genehmigten Orten.
»Also, was machen wir?«, sagte James. »Wollen wir uns wirklich ins Kings Cinema in der Home Street setzen und uns einen lehrreichen Film anschauen, wie es die Lehrer gerne hätten?«
Perry lächelte. »Ich würde sagen, wir machen uns selbständig und gehen ins Coliseum auf der West Fountainbridge. Dort läuft der neue Tarzan-Film.«
»Mit Johnny Weissmüller als Tarzan. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich ihm im Sommer persönlich begegnet bin.«
»Das ist doch nicht wahr, Bond!«, rief Marcus. »Wie, um alles in der Welt …«
»Auf einer Party in Los Angeles …« James ließ den Satzanfang in der Luft hängen, und es lief ihm eiskalt den Rücken hinunter. Es war besser, wenn seine Erlebnisse in Hollywood begraben und vergessen blieben. »Aber nur ganz von weitem, ganz kurz.«
»Wie b-b-bescheiden!« Perry klopfte ihm auf den Rücken. »Da du so ein enger persönlicher Freund des Hauptdarstellers bist, willst du doch bestimmt sein Werk unterstützen, oder? Ich habe gelesen, dass es schon im ersten Teil zu gewaltigen Auseinandersetzungen mit eingeborenen Dschungelbewohnern …«
»Ich bin dabei«, unterbrach ihn James.
»Aber mit unseren Ausgehuniformen fallen wir doch viel zu sehr auf. Wenn sie uns erwischen …« Marcus fuhr sich mit den Händen durch die roten Locken. »Ach, was soll’s. Der Mensch lebt nicht von anständiger Körperertüchtigung und naturwissenschaftlicher Forschung allein, stimmt’s?«
»So spricht ein wahrer Philosoph.« Perry sprang auf. »Also dann, wer kann mir die drei Pence für den Eintritt zur Verfügung stellen, hmm? Ich habe mein Tascheng-g-geld an einen Jungen verloren, der viel zu g-g-gut Karten spielen konnte. Und jetzt bin ich bankrott.«
»Natürlich«, sagte James.
»Ich stelle hiermit fest«, fügte Marcus hinzu, »dass ein Freund in Not in erster Linie eine Plage ist.«
Kapitel 2Anweisungen befolgen
Es war kurz vor zwölf Uhr mittags, als James, Perry und Marcus die Turnhalle verließen, um sich für ihren Ausflug fertig zu machen. Da der Nachmittagsunterricht ausfiel und James’ Muskeln durch das Judo schon ausgiebig zu tun bekommen hatten, wurde er von einem Gefühl großer Zufriedenheit ergriffen. Das war ungewöhnlich, und er hatte nicht damit gerechnet.
»Du machst gute Fortschritte im Judo, Bond«, sagte Marcus. »Vielleicht solltest du in den Weihnachtsferien mal richtig trainieren … Vielleicht sogar einen Gürtel in Angriff nehmen.«
James musste an das Landhäuschen seiner Tante denken. »Ich weiß nicht, ob sie in Pett Bottom überhaupt schon mal das Wort Judo gehört haben. Aber wenn ich bei Mandeville in London …«
»So wie letztes Jahr?« Perry grinste. »Das würde meine Ferien in der Tat gewaltig aufwerten.«
Das Ende des ersten Trimesters war in Sicht, und James konnte es immer noch kaum glauben. Zu frisch waren die Erinnerungen an seine ersten Wochen hier am Fettes College und an das niederschmetternde Gefühl, dass sie nie zu Ende gehen würden – das Gefühl der Fremdheit, der auf die Minute genau durchgeplante Tagesablauf, der durchaus vertraute, aber bedrückende Mangel an Privatsphäre. Doch jetzt, hier und heute, konnten er und seine Freunde machen, wonach ihnen der Sinn stand.
»Treffpunkt in der Einfahrt? In zwanzig Minuten?«, rief James, als Perry bereits mit schnellen Schritten auf das Haus Carrington zulief, in dem er untergebracht war. James wohnte im Haus Glencorse, zusammen mit fünfzig anderen Jungen, und jedem stand nur ein winzig kleines, privates Abteil zur Verfügung. Das oberste Gebot lautete hier, sich einzufügen, während »Standesdünkel« oder Allüren als das schlimmste Laster überhaupt galten. Die Hauspräfekten, die so etwas wie der verlängerte Arm des Hausvorstandes waren, standen nur allzu gerne bereit, einem jeden noch so kleinen Hauch von Überheblichkeit auszutreiben. Marcus, der die vorletzte Klasse, die sogenannte Unterprima, besuchte, war auch ein Präfekt, aber einer von der netteren Sorte. Er hatte das Hausmotto Numquam Onus, »Keine Mühe ist zu groß«, wirklich verinnerlicht. Durch ihr gemeinsames Interesse für den Judosport – Marcus besaß den blauen Gürtel, und James wollte es unbedingt lernen –, hatte es nicht lange gedauert, bis die beiden Freundschaft geschlossen hatten.
James zog sich in seinem kleinen Abteil im Erdgeschoss um. In der Trennwand steckten drei Nägel. Am ersten hing der Frack für den Sonntagsstaat, am zweiten sein Mantel und am dritten die Uniform des Kadettenkorps. Seine Schuluniform lag fein säuberlich zusammengefaltet auf dem Tisch am Fenster: ein schwarz-grauer Anzug aus dichtgewobenem Fischgrät-Tweed, ein Flanellhemd, eine schwarze Krawatte und ein gestärkter Kragen mit altmodisch abgerundeten Spitzen, wie ihn sein Großvater vielleicht auch schon getragen hatte. Spitze Kragen waren allein den Präfekten vorbehalten.
Doch die Hemdkragen waren nicht das einzig Großväterliche hier an der Schule. Als »Frischling« hatte James sich zunächst mit einer Menge uralter Traditionen und Gewohnheiten vertraut machen müssen, genau wie in Eton. Um Punkt sieben Uhr klopfte der Hausdiener in Gestalt des unförmigen und stets unwillkommenen Watson an jede Tür und schellte mit seiner Glocke. Dann hieß es, hastig die obligatorische kalte Dusche zu ertragen und sich, immer noch feucht, in die Uniform zu zwängen.
Um 7.20 Uhr trank James zusammen mit den anderen eine Tasse Kakao, und um 7.25 Uhr läutete es schon zum Beginn der Frühstunde. James nahm seinen Platz in einer langen Reihe von Jungen ein, die sich von Glencorse über die grünen, baumbestandenen Hänge auf das wunderschöne, inmitten einer ausgedehnten Parklandschaft gelegene Schulgebäude zubewegten. Das auffällige Bauwerk mit seinen Türmen und Erkern, seinen Wasserspeiern und den vergoldeten Eisengittern sah eher aus wie ein gewaltiges Märchenverlies. Und oft genug kam es James auch genau so vor.
Während der Herbst allmählich in den Winter überging, konnte nur die Kälte verhindern, dass James im Lauf der langweiligen, staubbedeckten dreißig Minuten der täglichen Frühstunde wieder einschlief – sie und der Frühstücksduft, der bereits durch das Gebäude zog. Die Andacht bot die Möglichkeit, in Ruhe die Gedanken schweifen zu lassen und sich auf das anschließende Frühstück zu freuen: heiße Schokolade und Brötchen mit Butter und Zucker.
Dann kam der morgendliche Unterricht. Die Klassiker – das Griechisch der Antike und römische Literatur – dominierten den Stundenplan, was James überhaupt nicht gefiel. Warum konnten sie nichts wirklich Nützliches lernen? Marcus, der sich sehr für Physik und Biologie interessierte, hatte ihm einmal erzählt, dass einer der Lehrer sogar versucht hatte, die Naturwissenschaften ganz abzuschaffen, weil »die Beschäftigung mit der Naturwissenschaft im Widerspruch zur lateinischen Verskomposition steht.«
James fand die naturwissenschaftlichen Fächer durchaus auch interessant, aber sein Lehrer war ein merkwürdiger, exzentrischer Tyrann: Dr. Randolph Whittaker, allgemein nur Captain Hook genannt. Es war ein naheliegender Spitzname, da Whittaker seine rechte Hand durch eine Explosion im Krieg verloren hatte und wegen seiner diktatorischen Art bei allen unbeliebt war. Erst im September war er an die Schule gekommen, und zwar mit der Aufgabe, die naturwissenschaftliche Bildung in Fettes voranzutreiben. Niemand wusste genau, woher er so plötzlich aufgetaucht war, aber nach seinem Rolls-Royce zu urteilen, schien er mehr als genügend Geld zur Verfügung zu haben. Whittaker sei ein echtes Genie, hieß es. Er verhielt sich sehr zurückgezogen und unnahbar und ließ sich außerhalb der Schulstunden kaum irgendwo blicken. James fragte sich, wo er wohl vorher unterrichtet hatte. Oft begegnete er seinen Schülern mit Verständnislosigkeit oder offener Ablehnung und verteilte wahllos Strafen für »schwerwiegende Vergesslichkeit« oder »Ignoranz im Umgang mit dem Stofftaschentuch«. In jeder Stunde hatte man den Eindruck, als wäre er am liebsten irgendwo anders gewesen. Das konnte James sehr gut nachempfinden.
Außerdem war die Fettes eine Rugby-Schule. Nach dem Mittagessen wurden die Spiele des Nachmittags an dem Schwarzen Brett vor dem Speisesaal ausgehängt. Regelmäßig kam es zu Tumulten, weil jeder zuerst erfahren wollte, ob, auf welcher Position und in welchem Team er spielen durfte. James ließ die Spiele eher über sich ergehen, als dass er Spaß daran hatte. Mannschaftssport war einfach nichts für ihn, er war lieber ganz auf sich allein gestellt. Daher wurde er zwar manchmal für das Team der Schwächeren eingeteilt, aber noch öfter tauchte sein Name auf der Liste gar nicht auf. Man konnte aber auch Squash spielen oder ganz auf den Schläger verzichten und beim Hand-Tennis den Ball mit der flachen Hand an die Wand schlagen, aber am liebsten waren ihm die traditionellen Querfeldeinläufe – der Fünfmeilenlauf oder der kürzere und weniger befriedigende sogenannte Quarry Circle.
Der Nachmittagsunterricht begann um 16.00 Uhr, und um sechs wurde Tee getrunken. Dann folgten die Hausaufgaben, das Abendgebet und, endlich, das Abendessen, bei dem der Hausvorstand, der alte »Ho« Cooper, große Klumpen traditionelles, schottisches Porridge an alle verteilte. Anschließend ging es zu Bett, das Fenster in der winzigen Kammer zur Belüftung etwa dreißig Zentimeter nach oben geschoben, die Tür weit geöffnet. Dann lauschte er den Lauten der nachtaktiven Vögel und dem verbotenen Flüstern der jüngeren Jungen im Schlafsaal, das allmählich von Schnarchgeräuschen oder gänzlicher Stille abgelöst wurde. Und am nächsten Morgen ging das Ganze dann wieder von vorne los.
James zog seine gestreifte Hose an, schlüpfte in den Mantel, griff nach seinem Hut und seinem Schirm und ging die Treppe hinunter, wo Marcus ihn schon erwartete. Er hatte den Hut bereits aufgesetzt und den Schirm aufgeklappt. Mit den roten Locken, die unter seiner feierlichen, schwarzen Hutkrempe hervorlugten, machte er eher eine ungewollt komische Figur, anstatt, wie es ihm eigentlich vorgeschwebt hatte, weltmännisch und elegant zu wirken.
Perry trug identische Kleidung und erwartete sie an dem roten Geländer am Ende der Einfahrt. Dann machten die drei sich auf den Weg.
»Das ist doch mal eine willkommene Abwechslung«, sagte Perry. »Praktisch zwei Sonntage in einer Woche.«
»So können wir sogar zweimal unseren Sonntagsstaat ausführen«, fügte Marcus ein wenig kläglich hinzu. »Jippie.«
James zuckte nur mit den Schultern. In Eton hatte er ganz ähnliche Sachen getragen und war an die neugierigen Blicke gewöhnt, die er und seine Schulkameraden bei ihren Ausflügen »in die Stadt« auf sich zogen. Er war einfach nur froh, dass er die Enge der Schule gegen die lebhaften, pulsierenden Straßen von Edinburgh eintauschen konnte, umhüllt vom Rauschen des Verkehrs und dem Geplapper der Menschenmenge. Was für ein Unterschied zu dem stillen Dörfchen Pett Bottom, wo seine Tante Charmian lebte und das in den letzten Jahren, seit dem Tod seiner Eltern, auch seine Heimat gewesen war. Aber war Heimat wirklich das richtige Wort? Schließlich brachte er den größten Teil des Jahres im Internat zu und unternahm darüber hinaus zahlreiche Reisen. Manchmal hatte James das Gefühl, als hätte er nicht nur seine Eltern, sondern auch seine Wurzeln verloren. In seinem Inneren brannte eine große Unruhe, eine Gier nach Abenteuern. Manchmal fragte er sich, ob er sich nur dann zu Hause fühlte, wenn die Gefahr ihm auf den Fersen war.
Hör endlich auf, so viel nachzudenken, sagte er sich dann. Selbstanalyse war reine Zeitverschwendung. Du bist, wer du bist. Und jetzt im Moment war James Bond mit zwei Freunden unterwegs, um den Duft der Freiheit zu schnuppern. Es war ein kühler Tag, obwohl die Sonne ihre kräftigen Strahlen auf die prachtvollen Straßen scheinen ließ. James sog die Luft tief in seine Lungen ein. Wie immer man über das Leben dachte, letztendlich zählte allein die Gegenwart.
Marcus, der einen halben Kopf größer war als James und Perry, ging zwischen den beiden. »Ihr wisst doch, dass die Schulabgänger ihre Hüte und Schirme immer in den Inverleith Pond werfen«, sagte er zu seinen Freunden. »Und genau das habe ich auch vor, wenn es so weit ist, 1936.«
James malte sich aus, wie er seinen Schirm erst zu Tode prügelte, bevor er ihn in das schwarze Wasser warf, und musste lächeln. »Du Glücklicher«, sagte er. »Wir hängen hier fest bis zum bitteren Ende der Dreißigerjahre.«
Perry nickte. »Wie die Welt dann wohl aussehen wird?«
»Wenn es stimmt, was ich in meinem Detektorradio über die Nazis und ihre gewaltige Aufrüstung höre, dann wird vermutlich die Armee draußen vor dem Schultor stehen, um euch alle zu rekrutieren.« Marcus schüttelte den Kopf. »Herr Hitler macht ja kein Geheimnis daraus, dass er den slawischen Völkern Land wegnehmen will. Ich bin mir sicher, dass das über kurz oder lang zum Krieg führen wird.«
»Endlich mal ein bisschen Abenteuer«, warf Perry dazwischen.
»Ich glaube, ich würde lieber einem Soldaten in die Schlacht folgen, als von irgendeinem Lehrer eine Einführung in die klassische Literatur zu bekommen«, sagte James in bedauerndem Tonfall. »Da kann man wenigstens etwas bewirken.«
»Süß und ehrenvoll ist der Tod fürs Vaterland, was?«, murmelte Marcus. »Wie sagt doch gleich der Dichter? Die alte Lüge.«
»Solange man überzeugt ist, dass der Kampf sich lohnt, ist es keine Lüge«, widersprach James.
»Die Politiker behaupten, dass es ein lohnenswerter Kampf sei, aber die Angehörigen der Soldaten, die nie wieder nach Hause kommen … Wie würden sie das wohl sehen?« Marcus steckte die Hände in die Taschen, während sie nach rechts in den Coates Crescent mit seinen hübschen Stadthäusern abbogen. Die Menschen waren anlässlich der königlichen Hochzeit gerade dabei, die Bäume in den gepflegten öffentlichen Parks mit Union-Jack-Wimpeln zu schmücken. »Würdest du nicht auch lieber hier in diesem herrlichen, grünen Land leben, als in einer Ecke des vergessenen Feldes zu verrotten, wie der Dichter sagt?«
»Selbstverständlich würde ich das«, stimmte James ihm zu. »Aber ich könnte nicht zulassen, dass andere für meine Freiheit kämpfen, ohne selbst meinen Beitrag zu leisten.«
»Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man seinem Land dienen kann.« Marcus legte die Stirn in Falten. »Ich habe zum Beispiel erfahren, dass ich nicht eingezogen werde, weil ich in einer Stellung arbeiten werde, in der ich unabkömmlich bin.«
»Interessant!«, sagte Perry. »I-i-ich dachte, so was gibt es b-b-bloß für Bauern und Bergwerksarbeiter.«
»Es ist eine Stellung in der Wissenschaft«, erklärte Marcus. »Ich habe ein Angebot für einen Posten in der Elektronikindustrie bekommen, sobald ich mit der Schule fertig bin. Forschung und Entwicklung.«
»Ich gratuliere!«, sagte James und meinte es auch so. »Über die Karrieremesse?«
»Äh, nein, nicht direkt …« Marcus zögerte kurz. »Über Dr. Whittaker.«
James zog die Augenbrauen in die Höhe. »Du sollst Captain Hook unterstützen?«
»Aha!« Perry tippte sich mit wissendem Grinsen an die Nase. »Der missmutige Hüter der M-M-Mysterien von F-F-Fettes. Na los, raus mit der Sprache.«
»Ich war ihm nur ein-, zweimal bei etwas behilflich«, sagte Marcus ausweichend. James spürte genau, dass er jede weitere Frage möglichst schnell im Keim ersticken wollte. »Ihr wisst schon, dieses und jenes eben.«
Perry grinste gehässig. »Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, einen Stecker einzustecken, wenn man nur eine Hand hat.«
»Das ist unter deiner Würde, Mandeville.« Mit wütendem Gesichtsausdruck bog Marcus auf die Canning Street ab. »Whittaker hat die Hand verloren, als er einem verwundeten Soldaten in der Schlacht von Neuve-Chapelle zu Hilfe geeilt ist. Er ist ein guter Mensch, trotz seines aufbrausenden Temperaments.«
»Ich habe da g-g-gewisse Informationen.« Perry zeigte keinerlei Anzeichen des Bedauerns. »Arbuthnot – ihr kennt doch Arbuthnot aus der Untersekunda? Wohnt in Haus Carrington? Jedenfalls hat er v-v-vor ein paar Wochen in Algebra etwas falsch gemacht, und Hook hat ihn zum Direktor geschickt, damit der ihm ein paar Stockschläge verpasst. Arbuthnot hat also draußen vor der T-T-Tür gewartet und gehört, wie der Direktor sich bei irgendjemandem am Telefon über den guten alten Hook beschwert hat. Er wollte, dass Hook die Schule verlässt. Als Arbuthnot dann r-r-reingegangen ist und gesagt hat, dass Hook ihn geschickt hat, da hat der Direktor ihn praktisch nur gestreichelt.«
Marcus schnaubte. »Arbuthnot redet nur Müll.«
James war geneigt, ihm zuzustimmen. »Mit wem könnte der Direktor denn telefoniert haben? Letztendlich entscheidet er doch ganz alleine, wer eingestellt und wer entlassen wird.«
»Irgendetwas stimmt nicht mit ihm, d-d-das könnt ihr mir glauben«, beharrte Perry. »Ich habe vor Beginn des Schuljahres mitbekommen, wie die Pedells gestöhnt haben, weil sie die D-D-Dachkammer ausräumen mussten, damit Hook dort sein geheimes Laboratorium einrichten kann.«
»Ganz da oben?«, wunderte sich James. Die Dachkammer befand sich an der Spitze eines Turmes in der Mitte des Gebäudes. Normalerweise wurden dort die Koffer der Internatsschüler aufbewahrt. »Was ist mit den Schullaboratorien?«
»Veraltet.« Marcus war rot angelaufen. »Whittaker hat seine eigenen Geräte mitgebracht. Ich bin ihm bei einem … einem Projekt behilflich. So etwas wie eine Vorführung.«
»Schwarze M-M-Magie?« Perry hielt inne, blieb plötzlich ruckartig stehen und packte Marcus am Arm. »Gerade haben wir noch vom Teufel gesprochen, und jetzt hast du ihn mit deinem Gerede heraufbeschworen!«
James blieb ebenfalls stehen. Ein elegantes Automobil, ein mitternachtsblauer Rolls-Royce 20/25, war an den Straßenrand gerollt. Der Chauffeur war nicht zu erkennen, weil die Sonne sich in der Windschutzscheibe spiegelte, aber den großgewachsenen, hageren Mann, der jetzt von der Rückbank ins Freie kam, kannten sie alle.
»Captain Hook höchstpersönlich«, murmelte James, während das Herz ihm in die Kniekehlen rutschte.
Dr. Randolph Whittaker sah aus wie ein ausgemergelter, viktorianischer Patriarch: Sein bleiches Gesicht stand im krassen Gegensatz zu seinen tiefschwarzen Haaren, Augenbrauen und Koteletten. Auch sein Mantel und seine Hose waren schwarz. Seine künstliche, rechte Hand bestand aus emailliertem Holz, Metallfedern mit ledernen Spitzen bildeten die Finger. Die einzige farbliche Abwechslung bestand in der schweren Goldkette, die quer über seiner Weste hing.
Er kam auf das kleine Grüppchen zu, und James wappnete sich innerlich bereits gegen das unausweichliche Donnerwetter: Er, Perry und Marcus waren von der erlaubten Strecke zum Lichtspieltheater abgekommen, und Whittaker würde sie teuer dafür bezahlen lassen. Heute Abend, nach ihrer Rückkehr an die Schule, würden sie entweder den Pantoffel oder den Rohrstock zu spüren bekommen …
Aber Whittaker beachtete James und Perry gar nicht. Sein Zorn war ausschließlich auf Marcus gerichtet. »Wir haben schon ganz Edinburgh nach dir abgesucht, du verantwortungsloser kleiner Idiot. Wenn du dich schon fürs Lichtspieltheater eingetragen hast, wie ich vom Pedell erfahren habe, warum bist du dann nicht auf dem vorgeschriebenen Weg geblieben, hmm?«, fuhr er ihn mit gepresster, näselnder Stimme an. »Deine Leiterplatte ist fehlerhaft, Junge, und nun stehst du hier, vollkommen und auf geradezu abscheuliche Weise ahnungslos. Sie muss so schnell wie möglich fertiggestellt werden.«
James und Perry tauschten ein paar unbehagliche Blicke aus und warteten, dass Whittakers Zorn auch über sie hereinbrach. Aber allem Anschein nach handelte es sich um ein Drama, das nur den Lehrer und Marcus etwas anging.
»Sir, der Direktor hat uns heute frei gegeben, wegen der Hochzeit, und ich habe gedacht, ich könnte …«
»Glaubst du etwa, wir machen das alles nur zum Spaß? Wir liegen hinter dem Zeitplan zurück. Laut Vorhersage soll der Gewittersturm heute Nacht losbrechen, und wir müssen die Anweisungen unseres … unseres Geldgebers strikt befolgen.«
Marcus wurde blass. »Aber, Sir, ich dachte, das Risiko …?«
Whittaker hob seine hölzerne Hand. »In Abwägung mit den höheren Zielen …« Dann wurde ihm klar, dass er von den Passanten neugierig beäugt wurde. Er blickte sich gebieterisch um. »Was denn? Das Schicksal hat mich dazu verdammt, diese verabscheuungswürdigen Missgeburten zu unterrichten. Steig ein, Stephenson. Es gibt noch viel zu tun, bevor der Sturm kommt.«
Marcus widersprach nicht. Mit aschfahlem Gesicht hastete er zu dem wartenden Rolls-Royce und setzte sich auf die Rückbank. Ohne James oder Perry noch eines Blickes zu würdigen, drehte Whittaker sich um, stolzierte ihm hinterher und zwängte seinen knochigen Körper in das Automobil.
»Ich kann gar nicht fassen, was wir für ein Glück gehabt haben!«, sagte Perry, während er und James davonrannten. »Los, verdünnisieren wir uns, bevor der alte Hook noch mal zurückkommt.«
James drehte sich um. Der dunkelblaue Rolls-Royce fuhr gerade los und reihte sich in den Verkehr ein. Am Steuer saß eine junge Gestalt mit blonden Haaren. Ob das auch ein Schüler war, den der alte Tyrann zum Mitmachen gezwungen hatte?
»Es gibt noch viel zu tun, bevor der Sturm kommt …«, murmelte James vor sich hin. »Was wohl?«
Dann blickte er dem Wagen hinterher, bis er nicht mehr zu sehen war.
Kapitel 3Ein Sturm zieht auf
Rechtzeitig zum Beginn von Tarzans Vergeltung

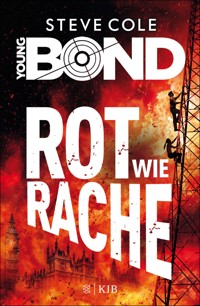
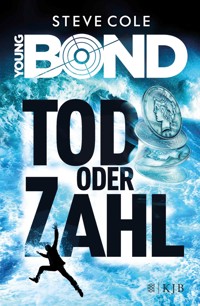
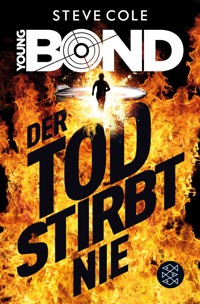













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











