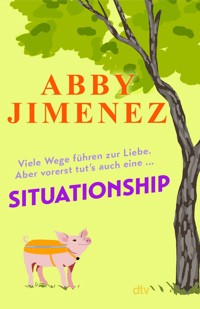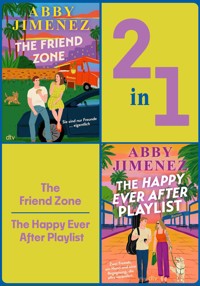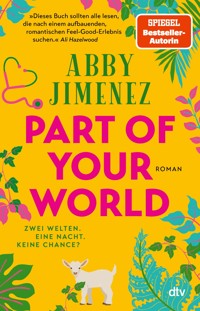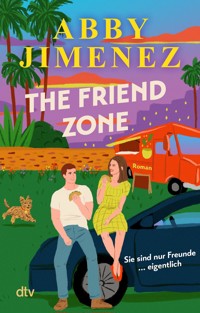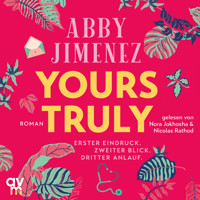
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Das Royaume-Northwestern-Universum
- Sprache: Deutsch
Mr. Darcy meets ›Grey's Anatomy‹ Erster Eindruck. Zweiter Blick. Dritter Anlauf. Briana Ortiz' Leben könnte besser laufen: Sie steht kurz vor der Scheidung, ihr kranker Bruder braucht eine Organspende und um die Beförderung zur Chefärztin muss sie mit Neuankömmling Jacob Maddox konkurrieren. Sie will ihn hassen. Anstatt die Situation zu entschärfen, tritt Jacob von einem Fettnäpfchen ins nächste … Bis Briana einen Brief von ihm bekommt. Einen sehr, sehr netten Brief, in dem sich herausstellt, dass er nicht der Teufel höchstpersönlich ist – sondern introvertiert, witzig und immer mehr ein guter Freund. Doch das ändert sich, als Jacob auch noch bereit ist, Brianas Bruder eine Niere zu spenden. Briana beginnt sich zu fragen: Ist Jacob nur das Match für ihren Bruder oder auch für sie selbst? Weitere Bücher von Abby Jimenez – all sind unabhängig voneinander lesbar: - ›The Friend Zone‹ - ›The Happy Ever After Playlist‹ - ›Life's Too Short‹ - ›Part of Your World‹ - ›Just for the Summer‹ - ›Situationship‹ – Kurzgeschichte zum Kennenlernen von Maddie und Doug aus ›Just for the Summer‹ - ›Say You'll Remember Me‹ - ›Der schlechteste Wingman aller Zeiten‹ – Kurzgeschichte in der Sammlung ›The Unexpected Meet Cute‹ »Abby Jimenez stellt erneut ihr Können unter Beweis: große Gefühle und sensible Themen in schönster Slow-Burn-Romance.« Elle Canada »Abby Jimenez beweist immer wieder, dass sie eine Must-Read-Autorin ist.« Cosmopolitan »Ein Buch über schlechte erste Eindrücke, witzige zweite Chancen und die Freude, wenn man das perfekte Match eines ›wahren Talents‹ findet.« Emily Henry »Ihre Wörter sind wie Feenstaub ... Sie bestäuben mein Leben mit Humor und Herzlichkeit.« Ali Hazelwood Für Leserinnen von Ali Hazelwood, Elena Armas und Emily Henry.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Brianas Leben könnte besser laufen: Sie steht kurz vor der Scheidung, muss ihren kranken Bruder pflegen und die Beförderung zur Chefärztin? Die liegt wegen Neuankömmling Jacob auf Eis. Sie will ihn hassen. Aus tiefstem Herzen. Doch dann bekommt sie einen Brief von ihm. Ein Brief, der beweist, dass er nicht der Teufel höchstpersönlich ist – sondern witzig und introvertiert. Briana hat keine andere Wahl, als sich mit ihm anzufreunden. Doch als Jacob ihr in einer schwierigen Situation zur Seite steht, bittet er sie im Gegenzug um einen kleinen Gefallen. Einen Gefallen, der die freundschaftlichen Gefühle, die die beiden gerade füreinander entwickeln, auf die Probe stellt …
Abby Jimenez
Yours Truly
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Urban Hofstetter
Für meinen wunderbaren Ehemann Carlos, der mich durch so manche schwere Zeit begleitet hat. Danke, dass du mir niemals wehtust.
Hinweis der Autorin
Dieser Roman liegt mir aus vielen Gründen sehr am Herzen, doch vor der Lektüre möchte ich noch auf ein paar Dinge hinweisen – auf eine Protagonistin, die in einer vergangenen Beziehung betrogen worden ist, auf eine Rückblende zu einer Schwangerschaftskomplikation, auf einen im Buch erwähnten Suizid und auf einen Protagonisten, der an einer Angststörung leidet. Trotz dieser gewichtigen Themen gibt es in dieser Geschichte jedoch auch viel zum Lachen und Wohlfühlen. Weitere inhaltliche Hinweise finden sich auf meinem Goodreads-Profil. Vielen Dank fürs Lesen! Ich wünsche gute Unterhaltung bei der Lektüre.
Mit besten Grüßen
Abby
1
Briana
»Sie nennen ihn Dr. Death.«
Jocelyn erhob sich von ihrem Platz hinter der Empfangstheke des Schwesternzimmers und sah mich entrüstet an.
Ich hob den Blick von meinem Computermonitor und verdrehte die Augen. »Gebt ihm eine Chance«, sagte ich und öffnete das nächste Krankenblatt. »Der Typ ist gerade mal elf Stunden hier. Heute ist sein erster Tag.«
»Das ist es ja«, flüsterte sie. »Er hat eine hundertprozentige Tötungsrate.«
Ich schnaubte. »Der Spitzname geht gar nicht. Was sollen denn die Patienten denken, wenn sie euch über einen Dr. Death reden hören?«
»Können wir ihn Dr. Dödel nennen?«
»Nein.«
»Wieso nicht?«
»Weil Dr. Dödel nach einem Peniswitz klingt.«
Nun schnaubte Jocelyn. »Okay, aber mal ernsthaft. Irgendwer sollte sich das mal anschauen. Ich meine: sechs tote Patienten?«
Ich sah auf die Uhr. »Wir arbeiten in der Notaufnahme, Jocelyn. Da kann so was schon mal vorkommen.«
»Du bist doch die Leiterin der Notfallmedizin. Ist es da nicht deine Aufgabe, solchen Dingen auf den Grund zu gehen?«
Ich machte einen letzten Mausklick und sah wieder zu ihr auf. »Die Geschäftsführung hat bislang keinen Nachfolger für Dr. Gibson bestimmt. Außerdem arbeitet er noch. Also nein, es ist nicht meine Aufgabe.«
»Aber früher oder später wirst du dich um diese Sachen kümmern müssen, weil du den Job garantiert bekommst. Meinst du nicht, da wäre es gut, wenn du jetzt schon mal zeigst, was in dir steckt, und diesem Gemetzel ein Ende bereitest?«
Ich fühlte die Blicke von mehreren anderen Pflegern und Schwestern auf mir ruhen. Sie hatten Jocelyn als Verhandlungsführerin vorgeschickt. Sobald sie sich mal in was verbissen hatten, ließen sie nicht mehr locker. Der arme Kerl. Es würde ihm hier nicht gefallen.
Ich stieß einen tiefen Seufzer aus. »Die erste Patientin war eine Sechsundneunzigjährige mit einem schwachen Herzen. Der zweite, ein Neunundachtzigjähriger, hatte einen massiven Schlaganfall und wollte laut Patientenverfügung nicht reanimiert werden. Der dritte hatte sich bei einem Autounfall schwerste Quetschungen zugezogen. Ich habe die Röntgenbilder gesehen und kann dir sagen, dass nur Gott ihn hätte retten können. Patient Nummer vier hatte einen Kopfschuss, und du weißt genauso gut wie ich, dass so eine Verletzung in neun von zehn Fällen zum Tod führt. Er war bei seiner Einlieferung komatös, und es gab keinen Hinweis auf Stammhirnfunktionen. Nummer fünf war eine Hospizpatientin mit Krebs und der sechste so septisch, dass er bei seiner Ankunft schon so gut wie tot war.« Ich sah Jocelyn in die Augen. »Nichts davon war seine Schuld. Manchmal häufen sich solche Fälle einfach.«
Sie presste die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen. »Manchmal«, gab sie zu. »Aber nicht gleich am ersten Arbeitstag.«
Dem konnte ich nicht widersprechen. Das war ziemlich unwahrscheinlich. Aber nicht unmöglich. »Schick ab jetzt einfach alle Neueinweisungen zu mir, okay?«, sagte ich erschöpft. »Er hat nur noch eine Stunde Dienst. Und bitte kein Dr. Death mehr.«
Jocelyn kniff die Augen zusammen. »Er ist unhöflich.«
»Inwiefern unhöflich?«
»Er hat zu Hector gesagt, dass er sein Handy in den Spind legen soll. Von dir haben wir so was noch nie zu hören bekommen.«
»Ist Hector nicht gerade überraschend von seinem Freund verlassen worden? Wahrscheinlich checkt er sein Handy alle fünf Sekunden auf Nachrichten. Ich hätte ihn sicher auch gebeten, es wegzulegen.«
Die Tür zu Raum Nummer acht glitt auf, und ein Mann mit rotbraunen Haaren und einem schwarzen Arztkittel kam heraus. Da er rückwärtsging, konnte ich sein Gesicht nicht erkennen. Ich beobachtete, wie er seine Handschuhe abstreifte und in einen Sondermüllbehälter fallen ließ. Anschließend kniff er sich in den Nasenrücken, holte tief Luft und schleppte sich mit gesenktem Kopf zu den Umkleideräumen.
Hector trat hinter ihm in den Korridor und sah zu uns herüber. Er hielt sieben Finger in die Höhe und saugte zischend Luft ein.
Jocelyn bedachte mich mit einem vielsagenden Blick, doch ich schüttelte den Kopf. »Ich will nichts mehr von Dr. Death hören. Geh jetzt und mach dich irgendwo nützlich.«
Sie schürzte die Lippen und stapfte davon.
Mein Handy pingte. Es war eine Nachricht von Alexis:
ALEXIS: Ich komm dich am 19. besuchen.
Es geht mir gut, tippte ich als Antwort.
Das war eine Lüge. Aber ich wollte auf keinen Fall meine schwangere beste Freundin aus ihrer kuscheligen Flitterwochenphase herausreißen und in das einsame Spukhaus locken, in das sich mein Leben verwandelt hatte. Dafür hatte ich sie viel zu lieb.
Im nächsten Moment klingelte mein Handy.
Ich stand auf, lief schnell in einen leeren Raum und ging ran. »Ich habe dir doch gesagt, dass es mir gut geht.«
»Nichts da. Ich werde kommen. Wann hast du Dienstschluss?«
»Alexis«, stöhnte ich. »Ich würde gern so tun, als wäre der Neunzehnte ein Tag wie jeder andere.«
»Es ist aber kein Tag wie jeder andere. Es ist der Tag, an dem deine Scheidung rechtsgültig ist. Das ist eine große Sache.«
»Ich werde schon nichts Dummes anstellen, werde mich nicht dermaßen volllaufen lassen, dass ich ihn anrufe oder meine Haare vollkotze …«
»Ich mache mir eher Sorgen, dass du Molotowcocktails durch seine Fenster werfen könntest.«
Ich schnaubte. »Die Sorge ist wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt.«
Ich war nicht gerade dafür bekannt, ruhig und besonnen zu handeln, wenn es um Nick ging. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte großmütig und gelassen reagiert, als ich endlich herausfand, dass er fremdging – ein Musterbeispiel, wie man trotz gebrochenem Herzen Würde bewahrt. Tatsächlich flippte ich total aus. Ich spülte meinen Ehering im Klo runter und goss seine Pflanzen mit Bleichmittel. Anschließend rief ich seine Mutter an und erzählte ihr, was für ein Früchtchen sie großgezogen hatte. Und das war erst der Anfang. Es hatte mich selbst schockiert, wie unbeschreiblich fies ich sein konnte. Der finale Tiefpunkt meines Rachefeldzugs war so peinlich gewesen, dass ich Alexis noch immer verbot, darüber zu reden.
»Wenn du kein Date hast, werde ich zu dir kommen«, sagte sie.
»Ha, als ob.« Ich setzte mich auf eine Behandlungsliege und stützte die Stirn in die Hand.
Seit der Trennung von Nick hatte ich ein paar der schlimmsten Online-Dates in der Geschichte des Internets hinter mich gebracht. Im Vergleich zu den Männern, mit denen ich es ein Jahr lang auf Tinder zu tun bekommen hatte, wirkte sogar Nick wie ein absoluter Märchenprinz.
»Immer noch kein Glück gehabt?«, fragte sie.
»Letzten Monat bin ich mit einem Typen ausgegangen, der so oft betrunken am Steuer erwischt wurde, dass ein Richter ihn dazu gezwungen hat, ein Alkoholtestgerät in seinem Auto zu installieren. Er hat mich gebeten, hineinzublasen, damit er den Motor anlassen konnte. Ein anderer hatte ein Hakenkreuz-Tattoo am Hals. Und bei meinem letzten Date ist plötzlich die Ehefrau des Typen, von der ich nichts gewusst hatte, an unserem Tisch im Restaurant aufgetaucht und hat gefragt, ob er für unser Essen das Geld gebraucht habe, von dem er angeblich Schulsachen für ihre Kinder hatte kaufen wollen. Und nein, er hat mir auch nicht gesagt, dass er Kinder hat.«
»Widerlich.«
»Du machst dir gar keine Vorstellung, wie froh du sein kannst, dass du Daniel gefunden hast. Ernsthaft. Du solltest den Dating-Göttern eine Opfergabe für ihn darbringen.« Ich sah auf die Uhr. »Ich muss jetzt aufhören. Meine Schicht läuft noch. Ich ruf dich nach der Arbeit an.«
»Okay, aber vergiss es nicht.«
»Werde ich nicht.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, starrte ich einen Moment lang die Schmerzskala an, die vor mir an der Wand hing. Über der Null war ein kleiner grüner Smiley abgebildet, über der Zehn ein rotes Weingesicht.
Ich hielt den Blick auf die Zehn gerichtet.
Ich hatte es geschafft, nicht allzu viel über den Neunzehnten nachzudenken. Mit etwas Glück würde ich vielleicht erst ein paar Tage später merken, dass er bereits hinter mir lag. Es war ja auch nicht so, dass sich durch den Vollzug der Scheidung groß was ändern würde. Nick und ich lebten schon seit einem Jahr nicht mehr zusammen. Nach dem Neunzehnten würde unsere Trennung nur aktenkundig sein.
Und dennoch.
Vielleicht hatte Alexis ja recht, und ich sollte an diesem Tag wirklich nicht allein sein. Nur für den Fall, dass es mich doch mehr umhaute, als ich erwartete.
Während der letzten Stunde meiner Schicht passierte nicht mehr viel. Ich kümmerte mich um den einzigen Notfall, der in dieser Zeit reinkam, und schaffte es, ihn am Leben zu erhalten. Fairerweise muss ich jedoch zugeben, dass es sich bloß um einen unserer Stammkunden handelte, den Nunchaku-Meister, der sich wieder mal eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte.
Ich wollte mich gerade ausstempeln, da kam Jocelyn um die Ecke. »Hey, Gibson will mit dir sprechen, bevor du gehst.« Ihre Augen funkelten. »Es ist so weit!«, sang sie. »Er gibt dir die Position.«
Gibson war der derzeitige Leiter der Notfallmedizin im Royaume Northwestern Hospital. Er würde sich in diesem Monat zur Ruhe setzen. Streng genommen hatte er den Job bereits vor knapp einem Jahr an den Nagel gehängt. Damals war Alexis seine Nachfolgerin geworden. Doch einen Monat später hatte sie gekündigt und war in den kleinen Heimatort ihres frisch angetrauten Ehemanns gezogen, um dort ihre eigene Klinik zu eröffnen. Also war Gibson zurückgekommen.
Ich erwiderte Jocelyns Blick. »Das bezweifele ich. Die Geschäftsführung hat bestimmt noch nicht über die Nachbesetzung abgestimmt«, entgegnete ich. »Aber ich weiß deine Zuversicht zu schätzen.«
Andererseits, schoss es mir durch den Kopf, würde er mir die Position vielleicht wirklich übertragen.
Niemand außer mir hatte an dieser Stelle Interesse bekundet. Musste die Geschäftsführung überhaupt darüber abstimmen? Worüber sonst würde Gibson mit mir sprechen wollen?
Ein wenig aufgeregt ging ich durch den Korridor zu Gibsons Büro. Der neue Job würde mir einiges abverlangen – ich würde achtzig Stunden oder mehr pro Woche arbeiten müssen –, aber dazu war ich bereit. Schließlich spielte sich ohnehin mein ganzes Leben hier im Krankenhaus ab. Da konnte ich genauso gut auch mein volles Potenzial ausschöpfen.
Ich klopfte an seinen Türrahmen. »Hallo, Sie wollten mich sprechen?«
Gibson hob den Kopf und lächelte mich gutmütig an. »Kommen Sie herein.« Er saß hinter seinem Schreibtisch. Mit seinen ordentlich zurückgekämmten grauen Haaren sah er wie ein freundlicher Großvater aus. Er war allseits beliebt und arbeitete schon seit Ewigkeiten in dieser Position.
»Schließen Sie die Tür«, sagte er und signierte ein Dokument.
Ich nahm auf dem Stuhl ihm gegenüber Platz.
Er schob den Papierstapel, mit dem er sich gerade beschäftigt hatte, zur Seite und lächelte noch breiter. »Wie geht es Ihnen, Briana?«
»Gut«, erwiderte ich strahlend.
»Und Ihrem Bruder, Benny?«
Ich wackelte leicht mit dem Kopf. »Den Umständen entsprechend gut.«
»Das freut mich. So eine dumme Sache. Aber er bekommt die bestmögliche medizinische Betreuung.«
Ich nickte. »Das Royaume Northwestern ist das beste Krankenhaus. Apropos: Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen … Auch wenn ich mich natürlich nicht darauf freue, Sie gehen zu sehen.«
Er lachte leise.
»Wird es eine Abstimmung geben?«, fragte ich. »Außer mir hat sich niemand beworben.«
Er verschränkte die Finger vor dem Bauch. »Nun, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie sollen es von mir persönlich erfahren. Ich habe beschlossen, meinen Ruhestand noch ein paar Monate aufzuschieben.«
»Oh.« Ich versuchte, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Und was ist mit der Villa in Costa Rica, in die Sie und Jodi ziehen wollten?«
»Das haben wir noch immer vor, aber der Dschungel kann warten. Ich will, dass vor der Abstimmung alle genug Zeit haben, Dr. Maddox kennenzulernen. Das ist nur fair.«
Ich sah ihn verdutzt an. »Wie bitte? Wen?«
Er nickte in Richtung Notaufnahme. »Dr. Jacob Maddox. Er hat heute hier angefangen. Während der letzten Jahre hat er die Notfallmedizin im Memorial West geleitet. Großartiger Mann. Sehr qualifiziert.«
Ich brauchte einen Moment, um die Sprache wiederzufinden. »Sie verschieben die Abstimmung? Für ihn?«
»Um dem Team die Chance zu geben, sich mit ihm vertraut zu machen.«
»Um ihm einen Vorteil zu verschaffen«, erwiderte ich tonlos.
Er sah mich überrascht an. »Nein, um das Ganze fair zu gestalten. Ich muss Ihnen ja nicht erzählen, dass solche Auswahlverfahren etwas von einem Beliebtheitswettbewerb haben, und er verdient eine echte Chance.«
Ich starrte ihn ungläubig an. »Dann stimmt es also. Sie vertagen die Abstimmung, damit er es leichter hat, Sie zu beerben? Ich arbeite schon seit zehn Jahren hier.«
Gibson machte ein ernstes Gesicht. »Ich muss tun, was für die Station am besten ist, Briana. Und ein größerer Bewerberpool ist immer besser. Es liegt keine Ehre darin, einen Job mangels Konkurrenz zu bekommen …«
»Ich würde ihn nicht mangels Konkurrenz bekommen, sondern weil ich ihn mir verdient habe. Und zwar seit zehn Jahren.«
»Sie wissen doch, dass Alexis sich auch gegen andere Bewerber durchsetzen musste«, erwiderte er geduldig. »Konkurrenz belebt das Geschäft. Wenn Sie die am besten geeignete Person für diese Stelle sind, werden Sie das auch in drei Monaten noch sein.«
Ich versuchte, ganz ruhig durch die Nase zu atmen, und presste mit aller Kraft die Lippen zusammen, damit mir nicht »Die Schwestern und Pfleger nennen ihn Dr. Death!« rausrutschte.
»Es sind nur drei Monate«, fuhr Gibson fort. »Dann stimmen wir ab, und ich werde an irgendeinem Strand Drinks aus Kokosnüssen schlürfen, und Ihre Wünsche werden sich hoffentlich ebenfalls erfüllen. Genießen Sie bis dahin die Ruhe vor dem Sturm und machen Sie es sich schön. Verbringen Sie Zeit mit Benny.«
Ganz langsam stieß ich den Atem aus.
Wahrscheinlich kannte Gibson diesen Dr. Death. Vermutlich waren sie Freunde, Golfpartner oder so was in der Art. Das Ganze roch verdächtig nach Vetternwirtschaft. Aber das half mir auch nicht weiter. Wenn Gibson entschieden hatte, seinen Job noch nicht an den Nagel zu hängen, konnte ich nichts dagegen tun.
»Danke, dass Sie mich darüber informiert haben«, sagte ich steif, erhob mich vom Stuhl und verließ sein Büro.
*
Im Auto rief ich sofort Alexis an. »Ich hasse den Neuen«, sagte ich, sobald sie ranging.
»Äh, hallo.«
»Sie nennen ihn Dr. Death. Er hat heute sieben Patienten kaltgemacht. Sieben. An seinem ersten Tag.«
»Na ja, so was kommt schon mal vor.« Alexis klang abgelenkt.
»Und jetzt halt dich fest: Gibson verschiebt seinen Ruhestand um drei Monate, damit der Neue eine bessere Chance auf den Chefposten hat. Ist das nicht total der Macho-Scheiß?«
»Mm-hm«, machte sie nur.
Ich hörte einen Moment lang zu, was am anderen Ende der Leitung vor sich ging, und erschrak. »O mein Gott! Macht ihr beide etwa miteinander rum, während ich am Telefon bin?«
Alexis und Daniel gingen sich ständig gegenseitig an die Wäsche und lösten die Lippen höchstens für kurze Essenspausen voneinander.
Ich rieb mir die Stirn. »Kannst du bitte kaltes Wasser über ihn schütten und mit mir sprechen? Ich habe gerade eine Krise!«
»Entschuldige. Warte mal kurz.« Sie flüsterte etwas, das ich nicht verstand, und kicherte. Daniel kicherte ebenfalls.
Ich verdrehte die Augen und wartete ab. Dieses Jahr mutierte ich eindeutig zum Superbösewicht.
Im Hintergrund wurde eine Tür geschlossen, und ich hörte, wie Alexis das Handy wieder in die Hand nahm. »Okay, jetzt bin ich ganz Ohr. Erzähl mir alles.«
»Also, der Neue ist offenbar so eine Art Toptransfer vom Memorial West. Laut Gibson war er dort der Chef der Notaufnahme. Deswegen wird die Abstimmung verschoben, damit ihn alle besser kennenlernen können. Der Typ ist ein Vollidiot. Die Schwestern und Pfleger hassen ihn.«
»Tja, wenn die ihn nicht mögen, musst du dir ja keine Sorgen machen.«
»Darum geht es doch gar nicht! Glaubst du, Gibson würde auch so eine Nummer abziehen, wenn der Neuzugang eine Frau wäre?«
Ich hörte Alexis die Knöpfe einer Mikrowelle drücken. »Äh, ja. Durchaus. Gibson ist ziemlich fair. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden aufgrund seines Geschlechts bevorzugt.«
»Du solltest eigentlich auf meiner Seite sein.«
»Ich bin auf deiner Seite. Du wirst den Job auf jeden Fall bekommen. Gibson hat dir einen Gefallen getan. Jetzt kannst du noch mal den Sommer genießen, ohne achtzig Stunden pro Woche in der Notaufnahme festzuhängen. Benny braucht dich in den nächsten Monaten. Es ist gut, wenn du für ihn da sein kannst, während er sich auf die neue Situation einstellt.«
Ich schwieg. Wenn ich bedachte, wie sich Bennys Zustand entwickelte, würde ich ihn wahrscheinlich genauso oft in der Notaufnahme sehen wie zu Hause. Ich schluckte gegen den Kloß in meinem Hals an, der sich immer bildete, wenn ich über meinen kleinen Bruder nachdachte.
»Wie sieht dieser Neue eigentlich aus?«, wechselte Alexis das Thema.
»Keine Ahnung«, nuschelte ich. »Er ist wie ein Phantom. Jedes Mal, wenn ich einen Raum betrete, verlässt er ihn durch die andere Tür. Bisher habe ich nur ein paarmal seinen Hinterkopf gesehen.«
»Hast du dich ihm denn nicht vorgestellt?«
»Das wollte ich ja, aber zu Beginn meiner Schicht war dafür zu viel los, und als es ein bisschen ruhiger wurde, konnte ich ihn nirgends finden. Vielleicht verkriecht er sich ja in irgendeinem Vorratsraum, wenn er gerade niemanden für tot erklärt.«
»Hör mal«, sagte Alexis. »Alle lieben dich. Du wirst die Stelle auf jeden Fall bekommen, egal, wer gegen dich antritt. Dem Neuen gebe ich höchstens einen Monat. Das Pflegepersonal wird ihm bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Wenn der Sommer zu Ende geht, wirst du die erste salvadorianische Oberärztin in der Geschichte des Royaume sein. Te lo prometo.«
Alexis beherrschte drei Sprachen – Englisch, Spanisch und die amerikanische Gebärdensprache. Sie war brillant, eine weltbekannte Philanthropin aus einer angesehenen Familie und obendrein eine unerschütterliche Optimistin.
Ich hörte, wie sie die Mikrowelle öffnete. »Wenn ich komme, mache ich dir Scones.«
Uuund jetzt hatte sie offenbar auch noch angefangen zu backen. Trotz meiner schlechten Laune konnte ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Dass Alexis Scones backte, war, als würde ich mal schnell das Haus verlassen, um Holz zu hacken. Vorher würde die Hölle zufrieren. Seit sie Daniel kannte, hatte sie sich merklich verändert – und das nicht zum Schlechteren.
Ich stützte den Ellbogen auf die Autotür, legte den Kopf in die Hand und spürte, wie ich mich entspannte. Meine beste Freundin schaffte es immer, mich zu beruhigen. Doch in Momenten wie diesen – wenn mir nur noch der Zorn Kraft gab – hasste ich sie ein bisschen dafür. Gerade während des letzten Jahres war ich froh darüber gewesen, richtig lange wütend bleiben zu können. Zorn ist ein mächtiger Treibstoff. Er kann sehr motivierend und stärkend wirken.
Das Problem ist nur, dass er zwar schnell und heiß brennt, das aber nicht lange durchhält.
Trauer und Enttäuschung sind wesentlich hartnäckiger.
Und genau deswegen fürchtete ich mich vor dem Neunzehnten. Wenn meine Scheidung abgeschlossen war, würde mein Zorn erlöschen, und ich würde auf das zurückgreifen müssen, was von mir übrig war.
Und das war nicht viel.
2
Jacob
Nachdem ich eingeparkt hatte, starrte ich eine Zeit lang durch die Windschutzscheibe und dachte darüber nach, einfach wieder zu fahren.
Amy und Jeremiah wollten mit mir reden.
Dafür konnte es eigentlich nur einen Grund geben. Ich rechnete schon seit Monaten damit und war beinahe erleichtert, dass wir es nun endlich hinter uns bringen würden. Missmutig betrachtete ich das Schild über der Eingangstür.
BAD AXE GRILL.
Eine Bar, in der man Äxte werfen konnte. Ausgerechnet hier wollten sie die Bombe platzen lassen? Dieses Lokal war für mich fast genauso schlimm wie die Neuigkeit, die sie mir gleich mitteilen würden.
Um diese Uhrzeit war es da drin sicher laut und voll von Betrunkenen. Dazu Leute mit Hochzeitsschleiern und Geburtstagshüten, die johlend und grölend die Musik übertönten. Es würde sich anfühlen, als säßen alle aufeinander. Fremde würden mich anrempeln, die Toiletten waren mit Sicherheit dreckig und die Tische klebrig. Wie eine Erwachsenenversion eines Indoorspielplatzes, mit Schnaps und nervigen Studenten.
Ich merkte, wie mein Herz zu pochen begann, als ich mir vorstellte, wie ich in diesem Getümmel stand.
Ich ging nie in Bars, außer jemand zerrte mich hinein. Von Jeremiah hätte ich eigentlich mehr erwartet. Er war mein Bruder und wusste, dass mir die Reizüberflutung in so einem Laden viel zu viel sein würde. Aber wahrscheinlich hatte er einfach Amy den Treffpunkt aussuchen lassen. Denn diese Bar entsprach ihr total. Sie hatte mich oft an Orte wie diesen geschleift und es gar nicht glauben können, wenn ich so schnell wie möglich wieder gehen wollte. »Aber die haben ganz tolle Hähnchenflügel! Du liebst doch Hähnchenflügel. Deswegen wollte ich mit dir hierher!« Als ob fettiges Fritteusen-Essen alles drum herum irgendwie erträglicher machen würde.
Kein Wunder, dass sie mich verlassen hatte.
Ich war langweilig, in mich gekehrt und selbst nach zweieinhalb gemeinsamen Jahren unmöglich für sie zu verstehen gewesen.
Unruhig rutschte ich auf meinem Sitz hin und her. Ich sollte einfach fahren und ihnen schreiben, dass wir uns ein andermal unterhalten würden. Ich war so ausgelaugt, dass ich kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte. Heute hatte ich jeden einzelnen Patienten verloren, der in die Notaufnahme eingeliefert worden war.
Müde rieb ich mir die Schläfen. Ich kam mir wie der Todesengel vor. Dass Leute starben, war in meinem Beruf unvermeidlich. Schließlich konnte ich sie nicht alle retten und auch nicht beeinflussen, wer durch die Schiebetüren hereinkam. Aber doch nicht ausgerechnet an meinem ersten Tag!
Die Schwestern und Pfleger hatten während der ganzen Schicht keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr sie mich verabscheuten. Und von den anderen Ärzten ist kein Einziger gekommen, um mich zu begrüßen.
Während der letzten zwölf Stunden hatte ich Zweifel bekommen, ob es wirklich eine gute Entscheidung gewesen war, meine Führungsposition im Memorial West aufzugeben und woanders neu anzufangen. Im Grunde fand ich es noch immer richtig, aber ich hatte offenbar meine Anpassungsfähigkeit überschätzt. Es war, als triebe ich steuerlos auf hoher See und würde von mächtigen Wellen hin und her geschleudert werden, während die Kapitäne der vorüberfahrenden Schiffe mich verhöhnten, anstatt mir eine Rettungsleine zuzuwerfen.
Und nun würde mir dieses Höllenloch von einem Restaurant auch noch den letzten Rest Energie aus meiner erschöpften Seele saugen.
Vielleicht sollte ich die beiden lieber morgen treffen. Doch wenn ich nun ging, würden Amy und Jeremiah glauben, ich wäre noch immer verletzt und könnte nicht mit der Situation umgehen. Selbst wenn ich ihnen erklären würde, dass es am Ort und nicht an ihrer Neuigkeit lag, würden sie mir niemals glauben. Ich war zweieinhalb Jahre mit Amy zusammen gewesen und hatte es in dieser Zeit nicht geschafft, ihr meine Ängste begreiflich zu machen. Wieso sollte sie mich also jetzt plötzlich verstehen?
Ich wünschte, es gäbe für Treffen wie dieses eine Art Autopilot, auf den ich schalten könnte, wie ich es bei der Arbeit oft tat. Ein Muskelgedächtnis, das die einzelnen Schritte ohne mein Zutun absolvierte. Aber so weit war ich leider noch nicht. Diese Sache hier würde ich selbst meistern müssen.
Seufzend stellte ich den Motor ab, stieg aus und ging in die Bar. Am Empfangstisch stand eine junge Frau mit Nasenring. Sie führte mich zu einer Nische im hinteren Bereich des Raums, wo meine Ex-Freundin und mein jüngerer Bruder nebeneinander an einem Tisch saßen.
Sie lagen sich lachend in den Armen, ließen aber sofort voneinander ab, als sie mich bemerkten.
Bei ihrem Anblick wurde mir flau im Magen.
Da sie vom allmonatlichen Familienabendessen im Haus meiner Eltern ausgeladen worden waren, hatte ich sie bis jetzt noch nicht zusammen sehen müssen.
Ich nahm Platz und gab mir die größte Mühe, entspannt zu wirken. »Hallo. Entschuldigt bitte die Verspätung.«
Amy kaute auf der Unterlippe, wie sie es immer tat, wenn sie nervös war. »Schon okay. Wir sind davon ausgegangen, dass du mit deinen neuen Kollegen noch einen trinken gegangen bist, um deinen ersten Tag zu begießen.«
Ich musste ein Schnauben unterdrücken.
»Danke, dass du gekommen bist«, fügte sie hinzu.
Ich nickte.
Pock.
Pock.
Pock, pock, pock.
Das Geräusch von Äxten, die in die Wand einschlugen.
Ich merkte, wie eine beginnende Panikattacke mein Sichtfeld einengte, und fragte mich, wie lange es wohl noch dauern würde, bis ich aufstehen und gehen musste, egal, ob es angemessen war oder nicht.
Die beiden sahen mich an, als wäre ihnen nicht klar, wie sie anfangen sollten.
»Ich habe morgen Frühschicht …«, log ich und blickte auf die Uhr.
Amy nickte. »Okay. Entschuldige.« Sie strich sich die Haare hinter die Ohren. »Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll …«
»Ihr beide werdet heiraten«, kam ich ihr zu Hilfe.
Ihr reumütiger Gesichtsausdruck verriet mir, dass ich ins Schwarze getroffen hatte.
Sie nickte. »Wir werden heiraten.«
Pock. Pock, pock, pock.
Gelächter, laute Rufe, Gabeln, die auf Tellern klirrten. Jemand ließ ein Glas fallen. Es zerbrach, und alle jubelten. Die Wände schienen von allen Seiten auf mich zuzukommen, doch ich schaffte es, mir ein Lächeln abzuringen, das sich für mich authentisch anfühlte.
»Ich gratuliere«, sagte ich. »Habt ihr schon ein Datum festgelegt?«
Amy sah Jeremiah an, der ihren Blick lächelnd erwiderte. »Wir dachten an Juli«, sagte er.
Ich nickte. »Gut, das ist ein schöner Monat«, meinte ich, erstaunt, wie gefasst ich klang. »Ich freue mich darauf, dabei zu sein.«
Amy befeuchtete die Lippen. »Wir, ähm … Sonst weiß noch niemand Bescheid. Wir fanden, dass du es als Erster erfahren solltest.«
»Danke«, sagte ich. »Aber das war nicht nötig. Ich bin sicher, dass alle begeistert sein werden.« Ich sah erneut auf die Uhr, immer noch um einen milden Gesichtsausdruck bemüht. »Hier drinnen ist es ein bisschen zu laut für meinen Geschmack. Ich gehe jetzt besser. Glückwunsch noch mal. Und sagt Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann.«
Sie sahen mich dankbar an. Ich wusste nicht, womit sie gerechnet hatten. Bislang hatte ich mich zwar in jeder Hinsicht entgegenkommend verhalten, aber vielleicht hatten sie ja befürchtet, dass dies der Tropfen sein könnte, der das Fass zum Überlaufen brächte. Doch ich würde auf keinen Fall von meinem Standpunkt abrücken. Es würde nichts ändern, wenn ich Stress machte oder mich aufregte. Außerdem wollten mich die beiden nicht verletzen.
Auch wenn sie es taten.
Ich stand auf und bemühte mich, die Bar in normalem Tempo zu verlassen. Die Pocks, die mich auf dem Weg nach draußen verfolgten, klangen, als würde jemand auf meine Fersen schießen.
Als ich die Tür aufstieß und in die kühle Aprilluft hinaustrat, hatte mich die Panikattacke fast eingeholt. Ich stützte mich auf die Knie und rang nach Atem.
Nun war es also so weit. Die Frau, die ich liebte, war endgültig weitergezogen und würde bald jemand anderen heiraten.
Und dieser andere Jemand war mein Bruder.
*
Am nächsten Tag im Krankenhaus klingelte zwischen zwei Patienten mein Handy. Es war meine große Schwester, Jewel. Mit resigniertem Entsetzen starrte ich ihren Namen auf dem Display an.
Die Neuigkeit des Vorabends hatte erwartungsgemäß mehrere Schockwellen ausgelöst, die noch eine ganze Weile auf mich einstürmen würden. Zuerst in Form meiner eigenen Gefühle und dann durch die Empörung der übrigen Familienmitglieder, die sie wie Eiswasser eimerweise über mir ausschütten würden.
Ich schlüpfte in den Vorratsraum und ging ran.
»Hi, Jewel.«
»Das ist totaler Schwachsinn«, sagte sie. »Nur damit du’s weißt: Ich werde nicht hingehen. Der Teufel soll die beiden holen.«
»Ja, der Teufel soll sie holen!«, wiederholte ihre Frau, Gwen, im Hintergrund.
Müde rieb ich mir über die Stirn. »Es ist schon okay, Gwen.«
»Man darf es ruhig zugeben, wenn es einem nicht gut geht, Jacob.« Das war Moms Stimme.
»Ich werde auch nicht hingehen«, rief jemand dazwischen. Meine andere große Schwester, Jill.
»Ich auch nicht!«, stimmte meine jüngere Schwester, Jane, in den Kanon ein.
Amy und Jeremiah hatten es unserer ganzen restlichen Familie offenbar in einem Aufwasch gesagt.
»Dein Vater ist auch hier«, sagte Mom.
»Ich bin für dich da, wenn du reden willst, Jacob«, kam Dads Stimme von etwas weiter weg. Er war offensichtlich dazu gezwungen worden, an diesem Telefonat teilzunehmen. Dramatische Erklärungen waren nicht sein Stil.
»Diese Grube haben sie sich selbst gegraben«, sagte Jewel. »Von unserer Familie wird niemand zur Hochzeit gehen.«
»Ich werde hingehen und freue mich für sie.« Letzteres war gelogen. »Ich habe vor, voll und ganz hinter ihnen zu stehen«, fügte ich aufrichtig hinzu. »Und ich hoffe, dass ihr dasselbe tun werdet.«
Wie aus einem Mund schnappten alle entrüstet nach Luft. »Wie kannst du dich damit nur abfinden?«, fragte Jewel. »Sie sind keine drei Monate nach eurer Trennung zusammengekommen. Das ist widerlich.«
»Das ist wirklich voll übel, Mann.« Das war Walter, Jills Ehemann.
Na super. Es war also tatsächlich die ganze Gang zusammengekommen.
Ich setzte mich auf eine Packung Toilettenpapier. »Mir geht’s wirklich gut«, sagte ich und kniff mir in die Nasenwurzel.
»Dir geht’s nicht gut«, beharrte Gwen. »Die beiden haben sie doch nicht mehr alle! Wie können sie nur von dir erwarten, dass du kommst? Oder sonst irgendwer von uns?«
»Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas erwarten«, sagte ich erschöpft. »Aber es wird nichts ändern, wenn ihr gegen sie seid. Wenn sie mich bei ihrer Hochzeit dabeihaben wollen, werde ich auf jeden Fall hingehen. Selbst wenn ihr es nicht tut.«
»Jacob«, sagte Mom behutsam, »du bist schon immer sehr versöhnlich gewesen. Das liebe ich an dir, aber du musst dir das nicht antun. Es ist vollkommen in Ordnung, Grenzen zu setzen.«
»Mir geht’s wirklich gut, Mom. Ich bin darüber hinweg. Mein Leben geht weiter.«
»Inwiefern geht es denn bitte weiter?«, fragte Jewel. »Seit sie dich verlassen hat, hattest du noch keine einzige Verabredung.«
»Vielleicht findet er gerade zu sich selbst«, flüsterte Jill im Hintergrund. »Er kann mit dieser Sache auch abschließen, ohne mit jemandem zusammen zu sein …«
»Doch, er muss mit jemandem zusammen sein!«, zischte Jewel. »Solange er nicht mit einer anderen Sex hat, bleibt er von ihr besessen …«
»Wir wissen doch gar nicht, dass er keinen Sex hat«, sagte Mom. »Dass er niemanden mitbringt, muss nicht unbedingt heißen, dass er keinen Geschlechtsverkehr hat. Aber, hör mal, Jacob … Ich find es zwar gut, wenn man nach einer Trennung sein Selbstwertgefühl mit Sex aufpäppelt, aber ein traumatisches Beziehungsende kann auch zu riskantem Sexualverhalten führen. Du denkst doch immer daran, dich zu schützen, wenn du Geschlechtsverkehr hast, nicht wahr? Du weißt ja, was ich von Kokosöl als Gleitmittel halte. Es ist zwar gut für die Vagina, lässt aber womöglich Kondome reißen …«
»Was ist mit Traubenkernöl?«, ertönte Dads leise Stimme. »Ist das auch schlecht für Kondome? Ich mag Traubenkernöl. Es ist so schön seidig.«
»Oh bitte, können wir das Thema wechseln?«, fragte Jewel.
»Euer Vater und ich sind nun mal sexuelle Wesen«, sagte Mom. »Lasst uns bloß nicht so tun, als wüssten wir nicht, wie ihr Kinder entstanden seid.«
Ich kniff die Augen zusammen. Kaum zu glauben, aber das Ganze wurde tatsächlich immer schlimmer.
»Hast du denn Sex mit jemand anderem?«, fragte Jill. »Das ist doch die Frage, um die es hier geht.«
Ich warf eine Hand in die Höhe. »Wisst ihr was? Ja, habe ich.«
Die Lüge war mir so unvermittelt über die Lippen gekommen, dass ich im ersten Moment glaubte, jemand anders hätte sie ausgesprochen. Aber weshalb hatteich gelogen? Doch die Antwort darauf wurde mir schnell klar.
Es war eine dieser Unwahrheiten, die ich mir ausdachte, damit andere sich besser fühlten. So, wie ich gelegentlich Sterbenden wider besseres Wissen erklärte, alles würde gut werden. Es war ein Gnadenakt. Für alle Beteiligten.
Im Grunde wollte jeder in meiner Familie mit dieser Hochzeit im Reinen sein. Sie liebten Amy, und sie liebten Jeremiah und ärgerten sich nur aus Prinzip und um meinetwillen über ihre Beziehung, nicht weil sie etwas gegen einen von beiden gehabt hätten. Ihnen allen war lediglich die Vorstellung zuwider, wie ich mich wegen alledem fühlen musste. Solange ich Single blieb, würden sie mich weiterhin als den sitzen gelassenen Ex betrachten, der ihren Schutz und ihre Empörung benötigte. Aber wozu sollte das gut sein? Amy und ich würden nie wieder zusammenkommen. Wieso waren sie bloß so wild darauf, meine Ehre zu verteidigen? Ich wollte das gar nicht.
Amy und Jeremiah würden mit oder ohne den Segen meiner Familie heiraten. Und sie würden Kinder bekommen, die für all das nichts konnten. Wenn ich also zu einer Notlüge greifen musste, um die Aufmerksamkeit von mir abzulenken, dann bitte schön.
»Du triffst dich mit jemandem?«, fragte Jill. »Wer ist sie?«
»Nur jemand von der Arbeit«, sagte ich, in der Hoffnung, dass sie nicht weiter nachbohren würden.
»Sie arbeitet im Royaume?«, fragte Jewel jedoch. »Hast du deswegen am Memorial West gekündigt?«
»Äh …«
»Wir haben nämlich alle geglaubt, du hättest deinen Job nur hingeschmissen, weil es dich traurig macht, weiter mit Amy zusammenarbeiten zu müssen«, warf Jill begeistert ein. »Dabei hast du gekündigt, weil du dich verliebt hast und deiner Neuen nahe sein willst?«
Ich stutzte. »Ja …?«
Alle machten Ooooooooh.
»Wann lernen wir sie kennen?«, fragte Jane.
»Ich … ich weiß nicht«, stotterte ich. »Ich bin noch nicht so weit, sie irgendwem vorzustellen. Es ist alles noch ganz frisch.«
Ich konnte durchs Handy spüren, wie aufgekratzt sie alle waren. Verdammt. Sie würden diese Sache niemals auf sich beruhen lassen.
»Hört mal«, sagte ich und hielt mir das Handy ans andere Ohr. »Ich habe kein Problem mit dieser Heirat. Ich bin über Amy hinweg, und ich freue mich wirklich für die beiden.«
»Wirst du deine Freundin zur Hochzeit mitbringen?«, fragte Gwen. Ich hörte, dass sie lächelte.
»Äh … vermutlich ja. Wenn wir dann noch immer zusammen sein sollten.«
Jemand kicherte.
»Okay«, sagte Jewel und seufzte dramatisch. »Wenn du wirklich nichts gegen diese Hochzeit hast, ist sie für mich auch weniger schlimm. Toll finde ich sie aber trotzdem nicht.«
»Ich mag Hochzeiten«, platzte es aus Jill heraus. »Aber mir geht es wie Jewel«, fügte sie rasch hinzu. »Ich bin auch nach wie vor sauer auf die beiden.«
Ich schüttelte den Kopf. »Seid nicht zu hart zu ihnen. Okay Leute, ich muss jetzt Schluss machen. Ich bin mitten in der Schicht.«
»Sehen wir dich am Neunzehnten zum Abendessen?«, fragte Mom. »Ich dachte an Lasagne, aber dein Vater macht vielleicht Schweinebraten.«
»Ja, ich werde zum Abendessen kommen«, erwiderte ich.
»Kannst du eine Flasche Wein mitbringen?«
»Klar.«
»Okay. Hab dich lieb.«
Wir verabschiedeten uns alle. Als das Telefonat beendet war, legte ich das Handy auf den Oberschenkel und hielt mir die Augen zu.
Irgendwann würde ich mit meiner fiktiven Freundin Schluss machen müssen. Und in der Zwischenzeit würden sich hoffentlich alle entspannen und mich nicht mehr ansehen, als könnte ich jeden Moment zu Staub zerfallen.
Die Trennung von Amy war zugegebenermaßen wirklich übel gewesen. Aber immerhin hatte ich den Hund behalten können.
Ich stemmte mich hoch und öffnete die Tür zum Korridor. Als ich hinaustrat, knallte jemand gegen mich. Der Aufprall trieb mir die Luft aus der Lunge und ließ mein Handy über den Fliesenboden schlittern.
Die Ärztin, die mich gerammt hatte, rannte ungebremst weiter in Richtung der Patientenzimmer.
»Was zum Teufel«, murmelte ich und hob mein Handy auf. Das Display war gesplittert. »Machen Sie doch die Augen auf«, rief ich verärgert hinter ihr her.
Sie beachtete mich gar nicht. Eine Krankenschwester bedachte mich mit einem finsteren Blick, als hätte ich mich völlig danebenbenommen.
Waren hier denn alle so unhöflich? Was stimmte bloß nicht mit diesem Krankenhaus?
Mürrisch sah ich auf mein Handy. Es funktionierte zwar noch, aber die Risse sahen übel aus. Das war nun wirklich das i-Tüpfelchen auf der schlimmsten Woche meines Lebens.
Ich mahlte mit den Zähnen und ging in die Richtung, in der die Frau verschwunden war. Was ich vorhatte, war mir selbst nicht klar. Wollte ich ihr sagen, was ich vom Rennen im Korridor hielt? Oder verlangen, dass sie für die Reparatur des Displays aufkam?
Ich spähte in alle Patientenzimmer, bis ich die Ärztin schließlich entdeckte. Sie stand, mit dem Rücken zu mir, an einem Bett und sprach mit dem Patienten, der darin lag.
Der junge Mann sah gräulich aus und aus seiner Brust ragte ein Dialysekatheter. Um die Injektionsstelle herum war die Haut rot und geschwollen.
»Warum hast du mich nicht angerufen? Das ist total infiziert.« Sie lief um ihn herum und inspizierte seine Vitalfunktionen. »Du hättest eine Blutvergiftung bekommen können. Damit ist überhaupt nicht zu spaßen.« Er hatte ein Thermometer im Mund. Sie nahm es heraus und schüttelte den Kopf. »Du musst besser auf dich aufpassen, Benny, und es mir sagen, wenn etwas nicht stimmt.«
Ich merkte, dass ich in etwas geplatzt war, das mich nichts anging, und wollte gerade gehen, als hinter mir eine Schwester mit einer riesigen Dialysemaschine in der Tür auftauchte und mich dazu zwang, vor ihr den Raum zu betreten. Ich trat zur Seite und stellte mich an die Wand, während sie die Apparatur zum Bett schob.
»Es tut weh …«, sagte Benny leise.
»Ich weiß«, sagte die Ärztin, etwas sanfter. »Ich werde dir ein Antibiotikum und etwas gegen die Schmerzen geben.« Sie legte ihm eine Hand auf den Kopf. »In ein paar Minuten wirst du wieder sechzehn sein und bis oben hin voll mit Jägermeister in einem Maisfeld liegen.«
Sie hörte mich schnauben und fuhr zu mir herum. »Äh, kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
Mein Gott, war sie hübsch. Ich vergaß augenblicklich, weshalb ich ihr hinterhergelaufen war.
Sie hatte lange braune, zu einem lockeren Dutt gebundene Haare, große braune Augen und lange dichte Wimpern.
Panik durchströmte mich, denn mit einem Mal fühlte ich mich wieder wie ein Zehntklässler, der mit pochendem Herzen mit einem hübschen Mädchen zu reden versuchte. Außerdem stresste es mich, in dieser feindseligen Arbeitsumgebung einer neuen Kollegin zu begegnen. Noch dazu in einem Raum, in dem ich nichts zu suchen hatte. All das führte dazu, dass ich erstarrte.
Bei der Arbeit hatte ich mich normalerweise besser im Griff. Ich wusste, dass ich ein guter Arzt war, und kommunizierte entsprechend selbstsicher und souverän mit meinen Kollegen und den Schwestern und Pflegern. Die Ärztin mit ihrem genervten und ungeduldigen Blick brachte mich jedoch völlig aus der Fassung. »Äh …«, begann ich und räusperte mich unbehaglich. »Sie haben mich dahinten im Korridor angerempelt.«
Ihre Miene sagte deutlich, dass ich sie mit der unwichtigsten Information aller Zeiten belästigte. »Okay. Sorry?«
»Sie, äh, sollten in Fluren nicht rennen.«
Sie starrte mich nur an.
Schlagartig wurde mein Mund trocken. »Ich sage das nur, weil ich bis vor Kurzem der Leiter der Notfallmedizin im Memorial West war und weiß, wie schnell Unfälle geschehen …«
In ihren Augen blitzte Wut auf. »Ja, ich bin mir Ihres Lebenslaufs durchaus bewusst, Dr. Maddox. Vielen Dank für den heißen Tipp. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre ich jetzt gern mit meinem Patienten allein.«
Sie, Benny und sogar die Krankenschwester durchbohrten mich mit Blicken.
Ich merkte, wie mir die Schamröte den Nacken hochkroch, und verließ rückwärts den Raum. Was hatte ich mir bloß dabei gedacht, einfach so in diesen Raum zu stürmen? Im Ernst, Jacob!
Zurück in meinem Bereich der Notaufnahme ließ ich mir die peinliche Begegnung immer wieder durch den Kopf gehen und überlegte fieberhaft, was ich hätte sagen oder anders machen sollen.
Das, was ich gesagt hatte, war einfach nur dumm gewesen.
Vor allem hätte ich sie in Anwesenheit ihres Patienten nicht belehren dürfen und ihr besser gleich sagen sollen, dass sie mein Handy kaputt gemacht hatte. Dann wäre ihr klar gewesen, dass es mir nicht nur darum ging, ihr eine Standpauke zu halten.
Vielleicht hätte ich es einfach komplett sein lassen sollen.
Ja, das wäre das Beste gewesen. Dann wäre es nämlich gar nicht erst zu diesem unangenehmen Aufeinandertreffen gekommen. Ich hätte einfach nur »Falsches Zimmer« sagen und gleich wieder verschwinden sollen.
Was war ich für ein Idiot. Mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit entwickelte ich mich immer mehr zur meistgehassten Person im Royaume Northwestern.
In meiner langjährigen Therapie hatte ich gelernt, dass ich zum Grübeln neigte. Während mir die Begegnung mit meiner Kollegin wie der peinlichste Moment meines ganzen Lebens vorkam, hatte sie den Vorfall vermutlich längst wieder vergessen. Ich dagegen würde in zehn Jahren aus dem Schlaf schrecken und mich an den ungläubigen Blick erinnern, den sie mir zugeworfen hatte – dem Kerl, der es gewagt hatte, in ihr Behandlungszimmer zu marschieren und ihr zu erklären, es sei falsch gewesen, zu einem Patienten zu laufen, der ihr ganz offensichtlich lieb und teuer war und sich in einem kritischen Zustand befand.
Mühsam quälte ich mich durch die zweite Hälfte des Tages. Meine Haut kribbelte, als hielte ich zwei offene Stromkabel in der Hand, und mein Überlebensinstinkt drängte mich zur Flucht. Es wollte mir einfach nicht gelingen, meine Nervosität abzuschütteln.
Normalerweise hielten mich meine angstlösenden Medikamente im Gleichgewicht, aber sie waren kein Allheilmittel. Ich musste lernen, mit stressigen Situationen umzugehen, und die Bewältigungsstrategien anwenden, die ich in meiner Therapie geübt hatte. Das Wichtigste war jedoch, dass ich ein Leben führte, mit dem ich mich wohlfühlte. Darum hatte ich mich entschieden, die ungute Situation mit Amy und Jeremiah am Memorial West hinter mir zu lassen und mir eine Stelle in einem anderen Krankenhaus zu suchen.
Und jetzt das!
Mir war klar, dass ich die Schwestern und Pfleger mit meiner verschlossenen Art auf keinen Fall für mich gewinnen würde, doch ich war so sehr in meiner Gedankenspirale gefangen, dass ich kein Wort herausbrachte. Offenbar war es mir gelungen, Amy und Jeremiah gegen ein ganzes Team von Leuten einzutauschen, die mich abgrundtief hassten.
Es war mir schon immer schwergefallen, Freundschaften zu schließen. In einem unvertrauten sozialen Umfeld wurde ich schnell nervös und sagte das Falsche oder gar nichts. Und so dauerte es zumeist eine Weile, bis andere sich für mich erwärmten. Vielleicht brauchte ich ja auch hier einfach nur Zeit. Allerdings hatte ich den Eindruck, dass es an diesem Krankenhaus anders zuging als am Memorial. Die Leute hier neigten so sehr zur Cliquenbildung, dass ich mir fast wieder wie an der Highschool vorkam. Ich war der Außenseiter und würde es auch bleiben, vor allem, wenn ich weiterhin so viel Mist baute wie bisher. Aber ich wusste nicht, was ich dagegen tun sollte.
Bis Schichtende war es nur noch eine Stunde, aber ich brauchte dringend eine Pause, um mich zu sammeln. Da ich keinesfalls noch mal dieser Frau begegnen wollte, machte ich einen großen Bogen um den Bereitschaftsraum und zog mich in den Vorratsraum zurück.
Der, wie sich herausstellte, nicht leer war …
3
Briana
Während ich mich um Benny kümmerte, schaffte ich es irgendwie, die Fassung zu wahren. Sobald ich konnte, machte ich mich jedoch davon, um meinen Tränen freien Lauf zu lassen.
Am liebsten weinte ich im Vorratsraum bei Gibsons Büro, den außer mir nur selten jemand betrat. Darin gab es einen Klopapierkarton, der mir als Sitz diente, und das Zeug in den Regalen dämmte den Schall so gut, dass niemand mein Schluchzen hörte.
Wie oft hatte ich mir in diesem Kabuff schon die Augen ausgeheult. Hierher ergriff ich die Flucht, wenn ich Patienten verlor. Hier hatte ich geweint, als ich erfuhr, dass Bennys Nieren kurz vor dem Versagen standen. Und ich hatte hier drinnen um Nick getrauert – und sogar ein bisschen um Kelly, diese sogenannte Freundin, die zwei Jahre lang hinter meinem Rücken mit meinem Mann geschlafen und sich dazwischen weiter mit mir zum Brunch getroffen hatte. In all der Zeit war nie jemand hereingekommen. Aber heute passierte es.
Die Tür ging auf, und ein Mann schlüpfte herein. Als er die Tür wieder zumachte und sich umdrehte, sah er mich vor sich, mit zwei dicken Rotzglocken unter den Nasenlöchern, die tränennassen Haare an die Wangen geklebt.
Dr. Death.
Wir sahen einander einen Sekundenbruchteil lang überrascht an – dann ergriff er die Flucht.
Ich stieß den angehaltenen Atem aus und vergrub das Gesicht wieder in den Händen.
War ja klar, dass ausgerechnet dieser Typ meinen heiligen Ort entweihen würde. Was für ein Fiesling.
Vorhin hatte er mir hinterhergeschrien. Ja, ich war in ihn reingelaufen, also klar, dass ihn das verärgert hatte. Aber dann war er mir in Bennys Zimmer gefolgt, um mir einen Vortrag darüber zu halten, dass man in Korridoren nicht rennen dürfe. Erst bekam er den roten Teppich ausgerollt, damit er sich möglichst bequem meinen Job unter den Nagel reißen konnte, und dann auch noch das. Es war wirklich nicht zu fassen …
Die Tür ging wieder auf. Er kam erneut herein, hockte sich vor mich und reichte mir einen nassen Waschlappen.
»Für Ihr Gesicht«, sagte er sanft. »Er ist warm.«
Seine hellbraunen Augen sahen mich so entwaffnend freundlich an, dass ich einen Moment lang beinahe vergaß, wie sehr er mir zuwider war.
Nach kurzem Zögern nahm ich den Waschlappen entgegen. »Danke«, schniefte ich.
Er lächelte verhalten, setzte sich hin und lehnte sich mit dem Rücken an die Tür.
Ich starrte ihn an und fragte mich, was in aller Welt er da tat. Ich wollte, dass er ging. Für uns beide war die Kammer viel zu klein, und ich würde auf keinen Fall weinen, solange er dort saß.
Doch dann wurde mir bewusst, dass er sich wahrscheinlich nur vergewissern wollte, dass mir nichts fehlte. Und dass es seltsam gewesen wäre, wenn er mir bloß einen Waschlappen gereicht hätte und mit einem aufmunternden »Schönen Zusammenbruch noch« wieder abgezogen wäre.
Ich seufzte resigniert und drückte mir den warmen Lappen auf die Augen. Das war tatsächlich richtig angenehm.
»Geht es Ihnen gut?«, fragte er leise.
Ich schniefte und nickte, wobei ich ihm bewusst nicht ins Gesicht sah.
Seine Hosenbeine waren ein bisschen hochgerutscht, sodass ich seine grauen Socken sehen konnte. Sie waren mit kleinen braunen Hunden bedruckt. Er trug eine schwarze Smartwatch, und seinen sommersprossigen Armen nach zu urteilen, trieb er Sport. Sein Namensschild klemmte an seinem Hemd, um seinen Hals hing ein Stethoskop. Als mein Blick seine Augen erreichte, sah er mich ebenfalls an. Auf seinem Gesicht lag ein Bartschatten, und er hatte dichte rotbraune Haare. Bei näherer Betrachtung sah er gar nicht übel aus. Ganz im Gegenteil sogar.
Attraktiven Männern misstraute ich prinzipiell. Nick war attraktiv, und man sah ja, wozu das geführt hatte.
Ich bemerkte, dass seine Augen rot waren, und fragte mich, ob sein Tag ähnlich unerfreulich verlief wie meiner. Vielleicht hatte er hier drinnen ja auch eine kurze Pause einlegen wollen.
»Und?«, fragte er. »Sind Sie öfter hier?«
»Im ganzen Krankenhaus der beste Ort zum Ausheulen«, erwiderte ich mit einem heiseren Lachen.
»Im Memorial West bin ich dazu immer am liebsten ins Treppenhaus gegangen.«
Ich nickte. »Auch eine gute Wahl. Für meine Zwecke ein bisschen zu viel Echo, aber für Klaustrophobiker eine vernünftige Alternative zum Vorratsraum.«
»Die Schlafräume sind auch nicht schlecht«, sagte er.
»Zu weit weg von der Notaufnahme. Ich mag meine kleine Tränenkammer hier. Die ist nahe genug für spontane Weinkrämpfe in der Mittagspause.«
»Das sind mir die liebsten«, sagte er müde.
Offenbar war er wirklich aus dem gleichen Grund wie ich hier.
»Ich heiße übrigens Jacob«, sagte er. »Ist es okay, wenn wir Du sagen?«
Ich nickte. »Briana.« In so einer Situation ist jede Förmlichkeit auch irgendwie fehl am Platz.
Damit verfielen wir wieder in Schweigen.
Es war eine angenehme Stille, die von gegenseitigem Verständnis zeugte.
Diese Situation hier erinnerte mich an eine Rucksackreise, die ich ein paar Jahre zuvor unternommen hatte. Nick hatte nicht mitkommen wollen, und so war ich allein unterwegs gewesen. Mittlerweile wusste ich nur zu gut, was oder besser wer ihn zurückgehalten hatte. Während ich ohne Handyempfang auf einem Berg unterwegs gewesen war, hatte er mich am liebsten betrogen. Wie auch immer … Ich war auf dem Super Hiking Trail gewandert und kurz nach Sonnenaufgang einem Bären begegnet. Wir waren beide stehen geblieben und hatten uns reglos angesehen. Er mit seinen Bärenpranken und Bärenzähnen. Ich mit meinem Bärenspray. Doch keiner von uns beiden hatte von seinen Waffen Gebrauch gemacht. Dafür gab es meiner Meinung nach nur eine Erklärung: Der Bär und ich waren stillschweigend übereingekommen, einander nichts anzutun.
Vielleicht war der Neue ja gar nicht so übel. Jedenfalls sah er nicht wie ein gemeiner Mensch aus. Eher müde und irgendwie verletzlich.
»Kennst du ihn?«, fragte er. »Den Dialysepatienten?«
Langsam stieß ich den Atem aus. »Er ist mein kleiner Bruder.«
»Was war der Auslöser?«
»Eine Autoimmunerkrankung. Sie hat ihn aus heiterem Himmel erwischt.«
Einen Moment lang saßen wir wieder schweigend da. Er mit dem Rücken an der Tür, ich auf dem Klopapierkarton.
»Es könnte schlimmer sein«, sagte er schließlich. »Mit Dialyse kann man jahrzehntelang leben.«
Ich zuckte zusammen.
Es könnte schlimmer sein?
Solche Sprüche hatte ich so satt.
Gott hat einen Plan.
Nichts geschieht ohne Grund.
Was dich nicht umbringt, macht dich stark.
Nichts von diesem ganzen Scheiß stimmte.
Es gab keinen Grund, weshalb diese Krankheit ausgerechnet Benny befallen hatte. Sie war nicht Gottes Plan und würde Benny ganz bestimmt nicht stärker machen. Und ja, vielleicht hätte es ihn wirklich noch härter treffen können. Aber was spielte das schon für eine Rolle? Das war der am wenigsten hilfreiche Kommentar von allen. Benny hatte jedes Recht, mit seinem Schicksal zu hadern und über den Verlust seines gewohnten Lebens und seines gesunden Körpers wütend zu sein. Egal, wie viel schlimmer es theoretisch noch hätte kommen können.
»Wieso zum Teufel sollte er noch jahrzehntelang mit Dialyse leben wollen?«, fuhr ich ihn an. »Er ist siebenundzwanzig. Er will spontan mit seinen Freunden nach Vegas reisen können, Bier trinken, Mädchen kennenlernen, Sex haben, ohne sich wegen der Schläuche zu schämen, die aus seiner Brust ragen.«
Er hob eine Hand. »Ich wollte nicht …«
»Ich hoffe sehr, dass so etwas niemals einem Menschen passiert, den du liebst. Oder dir selbst. Und vor allem hoffe ich, dass du deinen Patienten nicht auch so einen Schwachsinn erzählst.« Ich stand auf. »Lass mich raus.«
Er stieß den Atem aus und ließ kurz den Kopf zwischen die Knie sinken. Dann rappelte er sich auf und ging von der Tür weg.
Bevor ich sie aufmachte, sah ich ihn noch einmal an. »Und eins noch: Was ihr beide, du und Gibson, da abzieht, ist meines Erachtens komplett unmoralisch. Aber egal, es wird dir eh nichts nützen.« Ich sah ihm direkt in die Augen. »Das hier ist mein Team. Und mein Krankenhaus. Du wirst diesen Job nie bekommen, egal, wer für dich die Strippen zieht.« Damit trat ich auf den Korridor hinaus und knallte die Tür hinter mir zu.
4
Jacob
Wovon zum Teufel sprach sie da? Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Aber um es herauszufinden, hätte ich ihr nachgehen müssen, und das hielt ich für keine gute Idee. Stattdessen gab ich ihr einen Moment Vorsprung, bevor ich ebenfalls den Vorratsraum verließ. Bis zum Schichtende blieb ich in meiner eigenen Hälfte der Notaufnahme.
Ich wusste nicht, ob ich hier so weitermachen konnte. Es ging mir miserabel. Im Memorial war es nicht anders gewesen, und wahrscheinlich würde ich mich überall schlecht fühlen, ganz gleich, wohin ich ging. Das sollte jetzt also mein Leben sein? Von nun an nur noch existieren und jeden Moment meines Daseins hassen?
Vielleicht hatte Amy ja gar nicht anders gekonnt, als mich zu verlassen. Wie hätte sie mich lieben können, wenn es schon kaum möglich war, mich zu mögen?
Als ich meinen letzten Patienten abgefertigt hatte und zur Umkleide ging, sah ich Zander aus Raum Nummer sieben kommen, in dem Benny untergebracht war.
Er grinste mich an. »Maddox! Da bist du ja. Ich wollte mich gerade auf die Suche nach dir machen.«
Dr. Zander Reese war ein renommierter Nierenspezialist und außerdem mein bester Freund. Wir hatten während des Medizinstudiums und auch noch eine Weile danach zusammengewohnt. Er war einer der Gründe, weshalb ich mich für das Royaume entschieden hatte. Und tatsächlich war es schön, zur Abwechslung mal ein bekanntes Gesicht zu sehen, das sich bei meinem Anblick nicht sofort verfinsterte.
War Zander etwa für Benny zuständig? Ich versuchte, an ihm vorbei in den Raum zu spähen, doch die Vorhänge hinter der Glastür waren zugezogen.
Ich fragte mich, ob sie wieder da drinnen war. Wahrscheinlich.
Ich hatte das Gefühl, mich bei ihr für den Kommentar im Vorratsraum entschuldigen zu müssen, doch sie schien alles, was ich sagte, in den falschen Hals zu bekommen.
Zander gab mir einen Klaps auf die Schulter. »Hey, es tut mir leid, dass ich gestern nicht hier war. Ich hatte Visite auf der Dialysestation.« Er nickte den Gang entlang. »Du hast gerade Schluss, stimmt’s? Möchtest du mit Gibson und mir was essen gehen? Wir wollen ins Mafi’s.«
Das Restaurant mochte ich. Unter anderem, weil ich schon einmal dort gewesen war – wahrscheinlich hatte Zander es genau deswegen vorgeschlagen.
Lokale, die ich kannte, strengten mich weniger an, da ich vorab einschätzen konnte, wie laut und voll sie sein würden. Außerdem musste ich dort niemanden fragen, wo die Toiletten zu finden waren.
Wenn ich zu einem großen Abendessen oder einer Party mit vielen Gästen eingeladen wurde, googelte ich den Veranstaltungsort und besuchte ihn wenn möglich schon vorab, um beim eigentlichen Event zwischen all den Leuten so wenig Stress wie möglich zu haben.
Das Royaume hatte ich vor meiner Zusage sogar zweimal besichtigt. Dass Zander hier arbeitete, war ein großes Plus. Außerdem kannte ich Gibson, und ich hatte gewusst, was mich in dem Job erwarten würde. Der Wechsel war mir richtig erschienen.
Doch manche Dinge konnte man nicht vorhersehen …
Zander wartete noch immer auf meine Antwort.
Eigentlich wäre ich nach diesem Tag am liebsten direkt nach Hause gegangen, doch wenn ich nicht die ganze Nacht über das Gespräch im Vorratsraum nachgrübeln wollte, brauchte ich noch mindestens eine positive menschliche Interaktion.
»Gern«, sagte ich also. »Ich ziehe mich um und treffe euch beide dort.«
*
Als ich dreißig Minuten später das Restaurant betrat, saßen die beiden bereits an einem der Tische, und Gibson winkte mir freundlich zu. Er war ein umgänglicher, allseits beliebter Mann.
Wir kannten uns schon länger. Bislang noch nicht als Kollegen, aber wir hatten mehrere Jahre in der gleichen Funktion gearbeitet und waren uns immer wieder auf Konferenzen begegnet. Außerdem kannte Gibson, wie die meisten Mediziner, meine Mom, die ebenfalls eine angesehene Ärztin war.
»Wie geht’s Ihnen mit Ihrem neuen Job, Maddox?«
»Gut«, log ich.
»Und wie geht’s Amy?«, erkundigte er sich weiter.
»Auch gut. Wir haben uns vor acht Monaten getrennt.«
Er hob eine Augenbraue. »Autsch. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. War das der Grund für Ihren Wechsel?«
Ich nahm die Speisekarte und überflog sie, obwohl ich sie mir vorhin bereits online angesehen hatte. »Unter anderem«, sagte ich. »Sie wird bald heiraten. Meinen Bruder Jeremiah.«
Zander starrte mich an. »Das ist ein Witz, oder?«
»Ich fürchte, nein.«
Gibson lehnte sich zurück. »Und was hat Ihre Mutter dazu zu sagen?«
»Viel«, murmelte ich.
Zander nickte mir aufmunternd zu. »Wenigstens hast du den Hund bekommen.«
»Ja, zum Glück.«
Ich hatte Lieutenant Dan zu mir genommen, als ich mit Amy zusammen war. Er war mein Hund, aber Amy und ich hatten uns ungefähr gleich viel um ihn gekümmert, und sie liebte ihn genauso sehr wie ich. Ich hatte halb damit gerechnet, dass sie ein geteiltes Sorgerecht für ihn fordern würde, doch zum Glück hatte sie deswegen keinen Streit mit mir angefangen. Wenn ich es recht bedachte, hatte sie kaum etwas von mir verlangt. Andererseits gab es auch wenig, worum wir hätten streiten können, da wir nie zusammengewohnt und keine Kinder bekommen hatten.
Ich sah Gibson über die Speisekarte hinweg an. »Ich wollte Sie übrigens etwas fragen. Hier gibt es eine Ärztin, Briana …« Ich blickte Zander an. »Behandelst du nicht ihren Bruder?«
»Dr. Ortiz«, erwiderte Gibson misstrauisch. »Macht sie Ihnen Probleme?«
»Nein, sie hat nur gesagt, dass Sie irgendwelche Strippen für mich ziehen würden. Sie schien deswegen sehr verärgert zu sein. Wissen Sie vielleicht, was sie damit gemeint haben könnte?«
Gibson seufzte. »Sie will meine Nachfolgerin werden, wenn ich gehe. Ich habe ihr gesagt, dass ich meinen Ruhestand verschieben werde, damit das Personal Sie, den neuen Kollegen, kennenlernen kann, bevor wir über die zukünftige Leitung der Notfallmedizin abstimmen. Das hat ihr nicht gefallen.«
Ich presste die Lippen zusammen und nickte. Das erklärte ihr Verhalten mir gegenüber. »Ich bin an der Position nicht interessiert.«
Gibson sah mich überrascht an. »Nicht? Ich bin fest davon ausgegangen … Ihr Wechsel zu uns war ein großer Karriererückschritt.«
»Meine Zeit als Oberarzt liegt hinter mir. Ich bin hierhergekommen, um mein Leben zu vereinfachen.« Was mir allerdings komplett misslang, wie es aussah …
Er seufzte erneut. »Okay, das respektiere ich natürlich.«
»Es erscheint mir auch unfair, die Abstimmung meinetwegen hinauszuzögern«, fuhr ich fort. »Ich kann gut verstehen, dass sie deswegen enttäuscht ist.«
Gibson winkte ab. »Es spielt ohnehin keine Rolle. Nichts gegen Sie, Maddox … Ich bin sicher, Sie wären ein toller Kandidat, aber egal, wie lange ich warte, die Abstimmung würde so oder so mit ein Erdrutschsieg für Dr. Ortiz enden. Ihr Team liebt sie, und sie ist eine fantastische Ärztin.«
»Und was bezwecken Sie dann mit der Verschiebung der Wahl?«, fragte ich.
Gibson nahm ebenfalls seine Speisekarte in die Hand und ließ den Blick darüberwandern. »Ich finde, es macht keinen guten Eindruck, wenn sie außer Konkurrenz antritt. Damit würde ihre Beförderung weniger verdient wirken. Ich will nicht, dass nachher irgendwer hinter ihrem Rücken behauptet, sie hätte die Stelle nur bekommen, weil es keine anderen Bewerber gab. Das wäre ihr gegenüber nicht fair, und es wäre kein guter Start in eine Führungsposition.«
Zander nickte. »Dann wollen Sie also, dass Briana gegen einen vermeintlichen Favoriten antritt und ihn vernichtend schlägt.« Er sah beeindruckt aus. »Für dich wäre es blöd, Jacob, aber die Idee gefällt mir.«
Ich nickte. »Ein wirklich nobler Plan, aber ich bin trotzdem nicht mit von der Partie.«
Gibson zuckte die Achseln. »Verstehe. Ich werde dennoch ein bisschen abwarten, ob jemand kühn genug ist, Ortiz herauszufordern. Und um ehrlich zu sein, tun mir persönlich die zusätzlichen Monate auch ganz gut. Nach zwanzig Jahren fällt mir der Abschied doch ziemlich schwer. Und abgesehen davon habe ich keine Ahnung, ob ich wirklich schon dazu bereit bin, so viel Zeit mit Jodi zu verbringen.«
»Sind Sie nicht«, sagte Zander. »Vertrauen Sie mir. Ich freue mich das ganze Jahr auf die Curling-Trips meines Mannes, weil ich dann endlich mal etwas Ruhe habe.«
Gibson schüttelte den Kopf. »Ich schätze, einen Job wie diesen nimmt man nicht an, wenn man sich zu Hause wohlfühlt. Außer in Ihrem Fall, Maddox. Amy war ihr zeitraubender Job sicher egal. Sie beide haben sich ja ohnehin ständig bei der Arbeit gesehen.«
»Er war ihr nicht egal«, erwiderte ich, ohne weiter ins Detail zu gehen. »Ich wollte übrigens auch damals schon nicht Oberarzt werden. Das Team hat mich mehr oder weniger dazu gedrängt. Führungsverantwortung ist einfach nicht mein Ding.«
Gibson winkte ab. »Wenn Ihre Kollegen Sie dazu gedrängt haben, ist es Ihr Ding. Sie sind diplomatisch, fair und neigen nicht zu Gefühlsausbrüchen. Die haben Sie respektiert. Das Gleiche gilt übrigens auch für Briana. Obwohl sie ein bisschen strenger ist als Sie.«
Zander winkte einen Kellner herbei. »Briana wird eine gute Oberärztin sein – falls wir Sie jemals loswerden, Gibson.«
Gibson gluckste.
Zander sah mich an. »Wie sieht es aktuell mit deinen Angstzuständen aus?«
»Ganz okay«, erwiderte ich. Schon wieder eine Lüge.
»Ein Jobwechsel muss für dich die absolute Hölle sein«, fuhr Zander fort. »Wie vor einer neuen Klasse zu stehen und sich vorstellen zu müssen.«
Ich schnaubte. Das traf es genau. Nur dass ich zusätzlich nackt war und der Hund meine Hausaufgaben gefressen hatte.
Zum Glück kam in diesem Moment der Kellner an unseren Tisch, sodass ich nicht weiter darauf eingehen musste. Ich bestellte einen Salat für mich und Zander einen gemischten Vorspeisenteller für uns alle. Ich würde alles probieren, mich aber nicht mit fettigen und salzhaltigen Dingen vollstopfen.