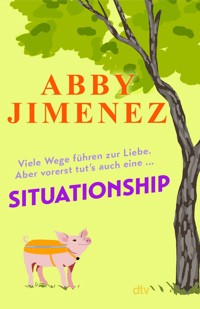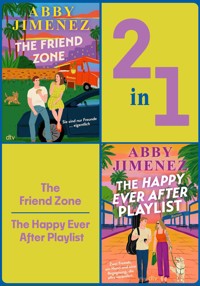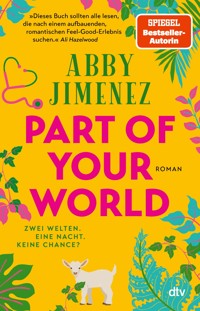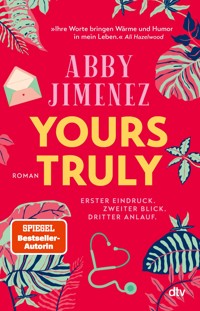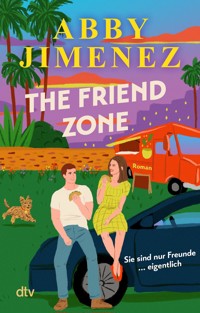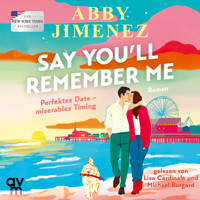
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Verlag München
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Perfekter Mann. Perfektes Date. Katastrophales Timing Nach ›Just for the Summer‹ der heiß ersehnte neue Roman der SPIEGEL-Bestsellerautorin Was für Samantha nur ein letzter unterhaltsamer Abend in Minneapolis werden sollte, erweist sich als das beste Date aller Zeiten – und als ein riesiger Fehler. Denn sie und der auf den ersten Blick abweisende Tierarzt Xavier sind ein Match Made in Heaven. Nicht nur, dass er extrem gut aussieht, er pflegt tagtäglich süße Katzenbabies gesund, arbeitet ehrenamtlich für die Hunderettung, und dann stellt er sich auch noch seinen Gefühlen und kann zugeben, wenn er im Unrecht ist. Kurz: Xavier ist alles, was Sam sich jemals von einem Partner gewünscht hat. Das Problem: Direkt am Morgen nach ihrer ersten Verabredung zieht Sam ans andere Ende der USA, da sie sich um ihre an Demenz erkrankte und pflegebedürftige Mutter kümmern muss. Die beiden werden sich also niemals wiedersehen. Und eine Fernbeziehung kommt gar nicht in Frage – aber sie bekommen einander einfach nicht aus dem Kopf. Denn keine Entfernung oder Zeit der Welt könnten sie dazu bringen zu vergessen, was sie hatten. Tropes: - Long Distance Relationship - He hates everyone but her - Grumpy meets Sunshine Große Begeisterung für ›Say You'll Remember Me‹: »Niemand schreibt witzige, emotionale, lebensbejahende Liebesgeschichten so wie Abby Jimenez. Sie übertrifft sich jedes Mal selbst.« – Emily Henry, ›New York Times‹-Bestsellerautorin »›Say You'll Remember Me‹ ist lustig und ergreifend, herzzerreißend und macht glücklich. Mit einem Wort: Es ist perfekt.« – Christina Lauren, ›New York Times‹-Bestsellerautorinnen Weitere Bücher von Abby Jimenez bei dtv – alle sind unabhängig voneinander lesbar: ›Part of Your World‹ ›Yours Truly‹ ›Just for the Summer‹ ›The Friend Zone‹ (bereits erschienen unter dem Titel ›Wenn aus Funken Flammen werden‹) ›The Happy Ever After Playlist‹ (bereits erschienen unter dem Titel ›Wenn in mir die Glut entflammt‹) ›Life's Too Short‹ ›Situationship‹ – Kurzgeschichte zum Kennenlernen von Maddie und Doug aus ›Just for the Summer‹ ›Der schlechteste Wingman aller Zeiten‹ – Kurzgeschichte in der Sammlung ›The Unexpected Meet Cute‹
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Xaviers gutes Aussehen kann nicht über sein abweisendes Verhalten hinwegtäuschen, doch bereits bei ihrem ersten Date reißt Samantha alle emotionalen Mauern ein, die er jahrelang um sich errichtet hat. Nach einer schweren Kindheit war in dem Herzen des Tierarztes bisher nur Platz für seine Patienten, aber je näher sich die beiden kommen, umso klarer wird, dass sie ein match made in heaven sind. Doch am Morgen nach ihrem unvergesslichen Date muss Sam ins dreitausend Kilometer entfernte Kalifornien ziehen, um ihre demenzkranke Mutter zu pflegen. Aber Xavier hat gerade erst seine eigene Praxis eröffnet, die sein Lebenswerk werden soll und mit der er sich seinen toxischen Eltern beweisen will. Die Praxis aufzugeben und Sam zu folgen, würde Xavier hoch verschulden und bedeuten, dass seine Familie mit allem recht behält. Sam und Xavier müssen also entscheiden, ob sich für die große Liebe aller Schmerz lohnt ...
Von Abby Jimenez ist bei dtv außerdem lieferbar:
Die Burning-Secrets-Reihe
The Friend Zone
(auch erschienen als: Wenn aus Funken Flammen werden)
The Happy Ever After Playlist
(auch erschienen als: Wenn in mir die Glut entflammt)
Die Royaume-Northwestern-Reihe
Part of Your World
Yours Truly
Just for the Summer
Abby Jimenez
Say You’ll Remember Me
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Urban Hofstetter
Für Lilia. Wir werden dich nie vergessen.
Hinweis der Autorin
Obwohl es sich bei all meinen Büchern um romantische Komödien handelt, berührt dieser Roman ein paar Themen, die unter Umständen verstörend wirken können. Wer Hinweise dieser Art nicht benötigt und sie als Spoiler betrachtet, sollte den nächsten Absatz überspringen und zum Anfang der Geschichte weiterblättern.
In diesem Buch werden detailliert die Symptome einer Person beschrieben, die an fortgeschrittener Demenz leidet. Es enthält Hinweise auf den Ehebruch einer Nebenfigur und auf einen in der Vergangenheit liegenden Fall von körperlicher und emotionaler Kindesmisshandlung. Außerdem wird Tierquälerei erwähnt. In einer Szene gerät ein Hund in Lebensgefahr. (Er stirbt nicht. Die Hunde meiner Hauptfiguren sterben NIEMALS.) Zudem erfahren wir nachträglich vom plötzlichen Herztod einer Nebenfigur.
1Xavier
»Wie bitte?«, fragte ich. »Was soll ich für Sie tun?«
Die Frau mittleren Alters stand auf der anderen Seite des Untersuchungstisches, ihr Hund zwischen uns. Er schaute zwischen unseren Gesichtern hin und her, als verstünde er, worüber wir uns unterhielten. Zu seinem eigenen Besten hoffte ich aus ganzem Herzen, dass er es nicht tat.
»Ich möchte, dass Sie ihn einschläfern«, wiederholte sie.
»Er ist doch vollkommen gesund«, erwiderte ich.
»Ich weiß.« Sie sah ihn traurig an. »Meine Mom hat sich vor ihrem Tod hingebungsvoll um ihn gekümmert.«
»Aber warum verlangen Sie das dann von mir?«
Sie stieß einen dramatischen Seufzer aus. »Sie hätte nicht gewollt, dass er den Rest seines Lebens ohne sie verbringen muss. Er würde sie zu sehr vermissen.«
»Er kann sich mit jemand anderem verbinden.«
Sie schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Dafür ist er zu alt.«
»Er ist erst vier.«
Sie sah mir fest in die Augen, als würden wir an der Supermarktkasse über abgelaufene Rabattmarken streiten. »Hören Sie, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Dass ich zu Ihnen gekommen bin, ist eine Kompromisslösung. Mein Mann wollte ihn in den Wald mitnehmen und erschießen, um uns die dreihundert Dollar zu sparen. Ich habe ihm gesagt, das wäre unmenschlich und dass meine Mom sich einen friedlichen Tod für ihn gewünscht hätte. Und deswegen bin ich jetzt mit ihm hier. Wenn Sie es nicht tun wollen, wird mein Mann es machen – und er ist kein besonders guter Schütze. Es könnte sein, dass es nicht gleich beim ersten Versuch klappt.«
Ich sah sie verständnislos an. Genau deswegen hasste ich Menschen. Sie waren die schlimmsten Tiere auf dem Planeten.
Der Hund sah traurig zu mir auf. »Euthanasie kostet vierhundert Dollar«, sagte ich kühl.
Das stimmte nicht. Die dreihundert Dollar waren ein Festpreis. Für alle bis auf sie.
Sie akzeptierte, und ich nahm den Hund mit und tat, was ich tun musste.
Eine Stunde später saß ich, noch immer gereizt, im Hinterzimmer und dokumentierte den Termin.
Tina, eine meiner beiden Helferinnen, stand mit verschränkten Armen vor mir und sah mich eindringlich an.
»Was ist los?«, fragte ich, ohne aufzublicken.
»Das wissen Sie ganz genau.«
Ich schaute sie an.
»Was soll ich ihr denn geben, wenn sie kommt, um seine Asche abzuholen?«
»Haben Sie einen Kamin?«, fragte ich.
»Nein.«
»Einen Kohlegrill?«
Nachdenklich legte sie die Stirn in Falten. »Ich glaube, unser Grill funktioniert mit Gas.«
Maggie, die andere Helferin, öffnete den Schrank und verstaute darin eine Akte. »Wir haben doch neulich diesen Rettungshund verbrannt«, sagte sie. »Sie wissen schon: den Bernhardinermischling. Dessen Asche könnten wir ihr doch überlassen.«
»Gut«, erwiderte ich. »Aber geben Sie ihr nur die Hälfte. Sonst ist es zu viel.«
Tina kraulte den ganz und gar nicht toten Hund unter dem Kinn. »Wie wollen Sie ihn nennen?«, fragte sie.
»Keine Ahnung«, murmelte ich und merkte, dass ich Kopfschmerzen bekam. Mit zusammengebissenen Zähnen stand ich auf. »Sie müssen ihm das Fell schneiden, vielleicht wie einem Schnauzer oder so. Er muss auf jeden Fall anders aussehen.«
»Aber er ist doch so süß wuschelig!«, protestierte Tina.
Ich sah den beiden fest in die Augen. »Ihnen ist sicher klar, dass ich wegen dieser Angelegenheit meine Zulassung verlieren könnte.«
Tina sah mich bewundernd an. »Das wissen wir. Sie sind ein wahrer Held.«
Maggie biss sich auf die Lippe und nickte.
Die beiden lächelten mich an. Sie strahlten geradezu.
Was mich nur noch gereizter machte.
»Posten Sie keine Fotos von diesem Hund«, sagte ich. »Und nennen Sie ihn nicht bei seinem richtigen Namen. Wir verlieren kein Wort über ihn, zu niemandem.«
»Wir werden schweigen wie ein Grab«, antwortete Tina und legte sich beide Hände auf die Brust.
»Notfalls werde ich auch vor Gericht für Sie lügen«, sagte Maggie. »Mit der Hand auf der Bibel und allem Drum und Dran.«
Tina nickte nachdrücklich.
»Ich weiß, dass Sie es nicht gerne hören«, sagte Maggie. »Aber Sie sind wirklich einer der besten Menschen, die ich kenne, Dr. Rush, und es ist mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten.«
Ich runzelte die Stirn. Komplimente und Schmeicheleien waren mir zuwider.
Was ich mochte, waren Hunde. Eigentlich alle Tiere, aber vor allem Hunde. Wir Menschen verdienten sie nicht – und für manche Leute galt das noch mehr als für andere.
»Sie haben noch eine letzte Patientin in Raum sechs«, sagte Maggie. »Gott segne Sie, Dr. Rush.«
Ich bedachte sie mit einem weiteren ausdruckslosen Blick und nahm im Hinausgehen das Tablet, das sie mir reichte. Die beiden sahen mir lächelnd hinterher.
Sie würden es niemandem erzählen. Ich war jederzeit bereit, meinem Team mein Leben – oder in diesem Fall meine Approbation – anzuvertrauen. Aber auf ihre schmachtenden Blicke hätte ich gern verzichtet.
Ich stieß die Tür auf und betrat, in das Aufnahmeformular vertieft, Raum Nummer sechs. Meine nächste Patientin war ein einsames Kätzchen, das vor ein paar Stunden in einem Holzhaufen entdeckt worden war.
»Ich bin Dr. Rush«, murmelte ich und wusch mir, ohne den Blick zu heben, die Hände. Als ich damit fertig war, stellte ich das Wasser ab, nahm ein Papierhandtuch und drehte mich zu der Frau um, die auf dem Besucherstuhl saß. Als ich sie sah, hielt ich überrascht inne.
Sie war schön, in meinem Alter – achtundzwanzig oder neunundzwanzig –, lange schwarze Haare, braune Augen, sinnlich.
Und sie hatte ein schlafendes Kätzchen im V-Ausschnitt ihres T-Shirts stecken.
»Hallo, Doc«, sagte sie und erhob sich. »Einen Moment, ich hole sie heraus. Ich glaube, dass es ein Weibchen ist, bin aber nicht sehr gut darin, winzige Kätzchen-Geschlechtsteile zu identifizieren.«
Sie zog das weiß-braune Fellknäuel heraus und legte es zwischen uns auf den Tisch. Es schnurrte.
Wäre ich dort drinnen gewesen, würde ich wahrscheinlich auch schnurren.
Ich räusperte mich und begann mit der Untersuchung.
»Sie ist ungefähr fünf Wochen alt«, sagte ich leise.
Ihr Zahnfleisch sah gut und rosig aus, ihre Augen waren klar. Sie hatte Untergewicht. Keine Flöhe. Ich warf einen Blick in ihre Ohren. Darin befanden sich Milben, aber nur ein paar. Ich tastete den Bauch ab, beugte ihre Beine und fuhr mit den Fingern an ihrem Rückgrat entlang, um es nach eventuellen Auffälligkeiten abzutasten. Die Frau sah mir dabei zu. Aus irgendeinem Grund machte mich das verlegen.
Normalerweise brachte mich nichts und niemand aus der Ruhe, doch unter ihrem Blick fragte ich mich sofort, ob ich mich am Morgen rasiert hatte.
Der Geruch des Kätzchens stieg mir in die Nase. Es duftete wie sie. Nach Blumen.
»Werden Sie es behalten?«, fragte ich.
Sie lehnte sich an den Untersuchungstisch. »Ich denke schon. Wenn einem das Schicksal eine Katze zuteilt, verweigert man doch nicht die Annahme.«
Meine Mundwinkel zuckten.
»Haben Sie sich am Fundort umgesehen?«, fragte ich, während ich die Lunge abhörte. »Um sicherzugehen, dass da nicht noch andere waren.«
»Ja, es war nur diese eine.« Sie sah mich lächelnd durch ihre dichten Wimpern an.
Mein Puls beschleunigte sich. Mein Gott, war diese Frau schön. Ich hängte mir das Stethoskop um den Hals und tat, als ließen mich ihre Blicke kalt, während ich mich daranmachte, die Temperatur des Tiers zu messen.
Ich hob seinen Schwanz an und erstarrte.
Die Frau sah mich prüfend an. »Was ist los?«
»Ich muss ein paar Aufnahmen machen.«
Eine halbe Stunde später waren sie entwickelt, und ich musste der Frau die schlechte Neuigkeit überbringen.
»Das Kätzchen hat einen angeborenen Defekt«, erklärte ich ihr. »Eine Analatresie – das bedeutet, dass ihr Rektum und der Anus nicht voll ausgebildet sind.«
Sie sah erst mich, dann das Kätzchen verdutzt an. »Entschuldigung. Wie bitte?«
»Sie besitzt keinen funktionsfähigen Anus.«
Die Frau hob die Augenbrauen. »Wollen Sie mir damit sagen, dass dieses Kätzchen kein Poloch hat?«
»Genau.«
Sie lüpfte ebenfalls seinen Schwanz. Ihre Augen wurden groß. Wo eigentlich der Anus des Tieres hätte sein sollen, befand sich eine kleine kahle Stelle, in der keine Öffnung war. Man sah es nur, wenn man genau hinschaute.
»Aber … aber sie kackt doch«, sagte sie. »Sie hat das Katzenklo verwendet.«
»Sie hat eine rektovaginale Fistel entwickelt und scheidet ihre Fäkalien durch die Vulva aus. Da sie von Magenparasiten befallen ist, ist ihr Stuhl wässrig. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie so lange überlebt hat. Es gibt eine OP, mit der man diesen Zustand möglicherweise beheben könnte. Aber die führe ich nicht durch. Sie müsste dafür zu einem Spezialisten, einem Facharzt für Veterinärchirurgie.«
Die Frau nickte. »Okay. Wie viel kostet so eine OP?«
»Zwischen fünf- und zehntausend Dollar.«
Ihr klappte der Mund auf.
»Ich rate Ihnen dazu, sie einzuschläfern«, sagte ich.
Sie sah kurz zu Boden und schaute gleich darauf wieder mich an. »Aber … aber sie ist doch glücklich. Sie ist ein fröhliches Baby. Ich werde sie auf keinen Fall einschläfern lassen.«
»Miss … Entschuldigen Sie, wie war noch mal Ihr Name?«, fragte ich.
»Samantha. Diaz.«
»Miss Diaz, in dieser Situation können zwei Dinge passieren: Sie wird entweder Verstopfung bekommen, leiden und sterben, oder sie bekommt eine Infektion, leidet und stirbt. Selbst mit der OP stehen ihre Chancen bestenfalls fünfzig-fünfzig. Und bis sie sich erholt, müsste sie rund um die Uhr betreut werden …«
»Ich arbeite im Home Office. Das kann ich tun.«
»Häufig kommt es zu weiteren Komplikationen, die zusätzliche Ausgaben erforderlich machen. Wenn Sie für die OP nicht aufkommen können oder wollen, ist eine Einschläferung die einzige Option.«
Sie hielt sich das Kätzchen an die Brust. »Das kann ich nicht tun.«
»Dann möchten Sie also eine Überweisung zu einem Chirurgen.«
»Dafür habe ich nicht genug Geld. Gibt es nicht irgendeine Vereinigung für notleidende Tiere, die in so einem Fall helfen kann?«
»Gerade ist Kätzchensaison«, erwiderte ich. »Die Tierheime sind gerammelt voll. Und mit dem Geld, das Sie in die Hand nehmen müssten, um möglicherweise dieses eine Tier zu heilen, könnten Sie hundert andere retten. Es steht Ihnen natürlich frei, bei ein paar Auffangstationen nachzufragen, aber ich glaube kaum, dass sich dort jemand bereit erklären wird, Ihnen zu helfen. Ich rate Ihnen daher eindringlich, sie einschläfern zu lassen«, wiederholte ich. »Und zwar sofort. Bevor sie Schmerzen hat. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen an mich? Wenn nicht, können Sie sich jetzt noch ein bisschen Zeit nehmen, um sich von ihr zu verabschieden.«
Sie starrte mich an. »Ich werde diese Katze auf keinen Fall einschläfern.«
Möglich, dass ich überreagierte, weil es das Ende eines harten Tages am Ende einer sehr langen Woche war und weil ich das Erlebnis mit der Frau und ihrem Hund noch nicht verdaut hatte, aber ich konnte meine Frustration nicht länger verbergen und verschränkte die Arme. »Wieso haben Sie sich eigentlich die Mühe gemacht, hierherzukommen und mich nach meinem fachkundigen Rat zu fragen, wenn Sie ihn gar nicht annehmen möchten?«
Sie blinzelte. »Es muss doch noch andere Optionen geben …«
»Nein, die gibt es nicht. Was werden Sie also tun?«
»Ich … ich weiß es nicht …«
»Verstehe. Dann soll die Kleine also leiden.«
Sie sah mich fassungslos an, doch das war mir egal.
Ich hatte schon viele abgrundtief böse Menschen in meine Praxis kommen sehen, aber genauso sehr hatte ich die Nase voll von dem Egoismus und der Dummheit, mit denen ich mich tagein, tagaus bei meiner Arbeit konfrontiert sah. Die Tiere, denen nichts fehlte, wollten die Leute einschläfern, und diejenigen, die leiden mussten, wollten sie am Leben erhalten. Sie vernachlässigten und misshandelten ihre Haustiere. Sie sterilisierten und kastrierten sie nicht, was dazu führte, dass die Auffangstationen aus allen Nähten platzten. Und wenn ihnen die Verantwortung zu viel wurde, setzten sie die armen Kreaturen kurzerhand aus.
Und auch eine gut gemeinte Dummheit, wie in diesem Fall, konnte riesigen Schaden anrichten. Die Frau würde das Leid dieses Tieres nur unnötig verlängern. Das ging mir gegen den Strich, und aus irgendeinem Grund missfiel es mir auch, dass ich deswegen eine schlechtere Meinung von ihr hatte. Irgendwie schien mich das von allem am meisten zu stören.
»Ist noch irgendetwas?«, fragte ich. »Oder sind wir hier fertig?«
Sie funkelte mich an. »Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie dringend an Ihren Manieren arbeiten sollten?«
»Ja, schon oft«, erwiderte ich und stieß mich vom Untersuchungstisch ab. »Geben Sie mir Bescheid, wenn die Kleine nichts mehr frisst und ihr Bauch sich so schmerzhaft aufbläht, dass Sie sich zu der schweren Entscheidung durchringen können, die man als Haustierhalterin in so einer Situation treffen muss.«
Damit ging ich hinaus.
Sie folgte mir. »Ich werde das Geld mit einem Spendenaufruf zusammenbekommen«, sagte sie zu meinem Rücken.
Ich schnaubte.
»Glauben Sie etwa, dass ich das nicht schaffe?«, rief sie hinter mir her. »Wieso?«
»Weil ich die Menschen kenne«, sagte ich und reichte Maggie, die mich mit großen Augen ansah, auf dem Weg zu meinem Büro das Tablet.
»Die Menschen sind im Grunde ihres Herzens gut«, sagte Samantha Diaz hinter mir. »Sie wollen helfen.«
Ich drehte mich um und sah sie eindringlich an. »Die Menschen sind von Natur aus Arschlöcher.«
»Ja?«, erwiderte sie. »Auf Sie trifft das auf jeden Fall zu.«
Sie stand mit rosigen Wangen vor mir. Der Kopf des Kätzchens ragte aus ihrem Ausschnitt.
Ich weiß nicht warum, aber in diesem Moment konnte ich nur darüber nachdenken, wie sexy sie war.
»Kann schon sein«, sagte ich, ging in mein Büro und zog die Tür hinter mir zu.
2Samantha
»Du hast es wirklich hinbekommen«, sagte Jeneva.
»Nichts motiviert mich mehr, als wenn jemand zu mir sagt, dass ich etwas nicht schaffen kann.«
Meine Schwester lachte.
Seit meinem Besuch bei Dr. Arschloch waren vier Tage vergangen. Mein GoFundMe-Aufruf hatte bislang fast 9000 Dollar eingebracht.
Pupi spielte mit dem klingelnden Katzenball, den ich ihr besorgt hatte. Sie schlug danach, jagte ihm quer durchs Wohnzimmer hinterher und stürzte sich darauf. Ich lächelte ihr auf dem Weg zur Couch zu.
»Der Slogan Pupi braucht ein Poloch war ein Geniestreich …«
Ich ließ mich mit meinem Eiskaffee auf die Couch sinken. »Das ist mein Beruf.«
»Ich hoffe, er sieht es«, sagte Jeneva.
»Das hoffe ich auch. So ein Trottel. Und weißt du, was noch schlimmer ist?«
»Nein. Was?«
»Er war extrem sexy, und als er gemein zu mir wurde, fand ich ihn noch heißer. Warum bin ich bloß so?«
Ich hörte Jeneva Geschirr wegräumen. »Hast du ihm eine vernichtende Bewertung hinterlassen?«
Ich zog mir die Decke über den Schoß. »Nein. Um ehrlich zu sein, habe ich mich wegen seiner positiven Bewertungen für ihn entschieden. In den Rezensionen stand, dass er ein Stinkstiefel, aber brillant sei, eine Art übellauniger Tierflüsterer.«
»Die Mürrischen lieben wir doch alle«, sagte Jeneva. Sie klang ein wenig abgelenkt.
»Ich meine, ich habe kapiert, warum er mir das alles gesagt hat, aber er hat sich komplett im Ton vergriffen. Ich werde nie verstehen, wieso weiße Männer so schlecht drauf sind. Schließlich leben wir in einem Patriarchat. Sie sind die privilegierteste Klasse der Welt und müssen nicht wie Wolverine mit den Schlüsseln zwischen den Fingern zu ihrem Auto laufen. Außerdem können sie selbst über ihre Körper bestimmen. Woher also diese miese Laune?«
»Wie hat er denn ausgesehen?«, fragte Jeneva.
»Wie ich mir Rhysand aus den Romanen von Sarah J. Maas vorstelle«, antwortete ich und steckte mir den Strohhalm zwischen die Lippen.
»Nein …«
»Ich schwöre es dir. Warte mal. Ich schau mal, ob ich ein Foto von ihm finden kann.« Ich stellte sie auf Lautsprecher, tippte Xavier Rush Tierarzt in die Google-Suchleiste und klickte auf Bilder.
Ein Foto erschien, auf dem er einen Preis hielt. Es stammte von der Website der Amerikanischen Gesellschaft für Veterinärmedizin. Letztes Jahr war er für seine zahlreichen Arbeitsstunden als freiwilliger Helfer in der Tierrettung ausgezeichnet worden.
Auf dem Bild wirkte er genervt, als wäre er lieber woanders. Wie ein gut aussehendes Entführungsopfer.
»Hier«, sagte ich und schickte Jeneva einen Screenshot. Dann nippte ich an meinem Kaffee und wartete darauf, dass sie es sich ansah.
»O ja …«, entfuhr es ihr.
»Er muss sich an Halloween unbedingt ein Fledermausflügel-Tattoo aufkleben«, sagte ich.
»Glaubst du, er lächelt wenigstens seine tierischen Patienten an?«, fragte sie.
»Wahrscheinlich nicht.«
»Mein toxischer Charakterzug ist, dass ich glaube, ich könnte ihn verändern«, sagte Jeneva.
»Ha. Mein toxischer Charakterzug ist, dass ich es gar nicht erst versuchen würde.«
Sie lachte.
Ich hörte, wie Mom die Küche betrat.
»Grüß sie von mir«, bat ich Jeneva.
»Samantha sagt Hallo.«
»Wer?«, fragte Mom.
»Samantha«, wiederholte Jeneva.
Am anderen Ende herrschte Schweigen. Mom erwiderte meinen Gruß nicht.
Ich sah Pupi an und versuchte, meine Gefühle in den Griff zu bekommen.
»Wie geht es ihr?«, fragte ich.
»Okay«, sagte Jeneva, dann, an Mom gewandt: »Ich mache dir was zum Abendessen. Es gibt Pasta … Nein, du musst nicht helfen. Ich schaffe das schon.«
Ich holte meinen Laptop unter dem Sofa hervor und checkte Pupis aktuellen Kontostand. Diese Spendenaktion hielt schon seit einer Woche meinen Serotoninspiegel aufrecht. Das Kätzchen natürlich auch. Aber die GoFundMe-Kampagne war für mich in vielerlei Hinsicht ein Erfolg: Damit konnte ich nicht nur mein Baby retten und mein ohnehin schon großes Vertrauen in die Menschheit weiter stärken. Der Erfolg dieser Aktion bewies auch, dass Dr. Arschloch unrecht gehabt hatte. Was zwar ein ziemlich schäbiger, aber dennoch befriedigender Grund zur Freude war.
Die Seite lud neu, und ich lächelte. Mittlerweile hatte ich die zehntausend Dollar schon fast zusammen und traute mich, den Termin auszumachen. Gerade noch rechtzeitig. In sechs Wochen würde ich nach Kalifornien aufbrechen und Pupi mitnehmen müssen. Je früher sie sich von der OP erholte, desto besser.
»Ich freu mich schon darauf, dir das Haus zu zeigen«, sagte Jeneva. »Wir haben einiges renoviert.«
Im Hintergrund war wieder Mom zu vernehmen.
»Es gibt Pasta, Mom«, sagte Jeneva. »Ja, ich mache dir das Abendessen … Nein, setz dich nur hin. Du musst mir nicht helfen. Das ist kein Problem.«
Ich entfernte das Handy ein Stück vom Mund, als könnte sie die Grimasse, die ich zog, andernfalls hören. Um mich von dem Kloß abzulenken, der sich in meinem Hals bildete, lud ich die Spendenseite noch mal neu.
Jemand hatte gerade vierhundert Dollar gespendet.
Ich setzte mich aufrecht hin.
Die meisten Leute gaben fünfundzwanzig Dollar, manche auch fünfzig, und ich hatte eine Handvoll Hundert-Dollar-Spenden erhalten, aber nichts in dieser Höhe. Ich las den Namen und riss die Augen auf.
Jeneva hatte mich offenbar nach Luft schnappen hören. »Was ist los?«, fragte sie.
»Der arrogante Tierarzt«, hauchte ich. »Er hat gerade einen dicken Batzen Geld für die GoFundMe-Kampagne überwiesen.«
»Wirklich?«
»Ja!«
Ich las die dazugehörige Nachricht. Sie bestand aus meinen drei Lieblingswörtern: Sie hatten recht.
3Xavier
»Das sieht furchtbar aus«, sagte ich.
Tina zuckte mit den Schultern. »Sie wollten, dass er anders ausschaut. Und das tut er jetzt.«
Mein Hund lächelte mich mit dem dämlichsten Fellschnitt an, den ich je gesehen hatte. Er hatte den Bart eines Schnauzers und die rasierten Beine eines Pudels. Hätte er sich etwas aus Äußerlichkeiten gemacht, wäre ihm sein Look sicher sehr peinlich gewesen.
Was soll’s?, dachte ich und seufzte. Lieber hässlich als tot.
»Hat er noch immer keinen Namen?«, fragte Tina.
»Nein, ich warte nach wie vor auf eine Eingebung«, erwiderte ich.
Seit seinem »Tod« war mehr als ein Monat vergangen. Sein Frauchen hatte schon vor Wochen die Asche des Bernhardiners abgeholt. Da sie voraussichtlich keinen Grund haben würde, noch einmal in die Praxis zurückzukehren, hatte ich den Hund heute zum ersten Mal zur Arbeit mitgenommen, sodass er nicht mehr länger allein zu Hause bleiben musste. Nun hatte er also einen neuen Fellschnitt und konnte sich in der Öffentlichkeit zeigen. Jetzt brauchte er nur noch einen neuen Namen.
»Sie wollen ihn also definitiv behalten?«, fragte Tina.
»Ich glaube, das muss ich. Ich kann ihn schließlich nicht auf irgendwelche Online-Adoptionslisten setzen.«
»Kann denn keiner Ihrer Freunde ihn nehmen?«
»Nein.«
Sie kraulte ihn hinter dem Ohr. »Jaaaa, du bist ein guter Junge.«
»Die sind alle gut«, murmelte ich.
Mein Magen knurrte. Ich sah auf die Uhr. Es war zwei. Ich hatte schon wieder die Mittagszeit durchgearbeitet.
Ich war in meiner Praxis der einzige Arzt. Wenn meine Patienten dringend einen Termin brauchten, schickte ich sie nur ungern in die Notaufnahme. Was dazu führte, dass ich nicht immer Pause machen konnte – um ehrlich zu sein, fast nie.
Tina schien meine Gedanken gelesen zu haben. »Wir haben Ihnen Hühnchen-Enchiladas mitgebracht. Sie sind im Kühlschrank.«
»Danke«, erwiderte ich.
Sie versorgten mich mit Essen, mittlerweile so regelmäßig, dass ich angefangen hatte, sie für die Lebensmittel zu bezahlen.
Ich öffnete den Laptop, um ein paar E-Mails zu beantworten. Mein Hund legte derweil das Kinn auf meinen Oberschenkel.
»Sie werden heute Abend also mit Chris zu dieser Veranstaltung gehen, richtig?«, fragte Tina, an den Türrahmen gelehnt.
»Das ist der Plan«, antwortete ich, ohne aufzublicken.
»Ist er noch immer Single?«
»Soweit ich weiß …« Chris, Mike, Jesse, Becca – sie alle waren meine besten Freunde, praktisch meine Familie.
»Fragen Sie ihn doch mal, ob er gern meine Schwester kennenlernen möchte«, fuhr sie fort. »Sie hat sich gerade von diesem Jugendpastor getrennt.«
»Chris ist zu beschäftigt für eine Beziehung«, sagte ich und überflog eine E-Mail, in der es um eine Impfklinik für die Tierrettung ging. »Und ich bin zu beschäftigt, um dafür den Mittelsmann zu spielen.«
»Was ist mit Mike?«, fuhr sie ungerührt fort. »Obwohl der vielleicht zu muskulös ist … Ich bin nicht sicher, ob ihr dieser Typ Mann gefallen würde. Schade, dass Jesse nicht Single ist. Der wäre perfekt. Meine Schwester arbeitet auch im Finanzwesen, wissen Sie? Aber Chris ist Apotheker, und das ist auch richtig gut. Außerdem liest er gern, und das tut sie ebenfalls. Ich bin mir sicher, dass sie gut zusammenpassen würden. Sie sollten ihn wirklich fragen.«
Woher Maggie und Tina so viel über meine Freunde wussten, obwohl sie jeweils nur ein paarmal hier gewesen waren und ich kaum je über sie sprach, war mir ein Rätsel.
Maggie stürmte herein. »Dr. Rush!«, keuchte sie. »Diese Dame ist hier.«
Ich sah sie verwirrt an. »Welche Dame?«
Sie machte große Augen. »Die mit der Poloch-Katze.«
Ich erstarrte. Samantha.
Nach meiner Spende im letzten Monat hatte ich eine allgemeine Dankes-E-Mail erhalten. Nicht dass ich mir mehr erwartet hätte. Ich hatte ihr das Geld nicht überwiesen, damit sie Kontakt mit mir aufnahm, sondern um zu helfen – und als Entschuldigung. Doch seither war viel Zeit vergangen …
»Was will sie?«, fragte ich.
»Eine Untersuchung«, erwiderte Maggie. »Sie sagt, dass sie mit der Katze fliegen wird und dafür ein Gesundheitszeugnis und ein Beruhigungsmittel braucht.«
Und weswegen kam sie damit zu mir?
Seit sechs Wochen ließ ich unsere Begegnung immer wieder vor meinem inneren Auge Revue passieren. Ich konnte nicht anders.
Ich hatte mich mies benommen. Mein Verhalten war unprofessionell und unangemessen gewesen. Ein Ausdruck meiner Erschöpfung und grundsätzlichen Unfähigkeit, mich mit anderen Menschen abzugeben. Aber ich hatte dafür Buße getan, und normalerweise wäre es damit für mich erledigt gewesen.
Doch ich bekam unsere Begegnung nicht mehr aus dem Kopf und wusste nicht, woran das lag.
Doch. Ich wusste es. Ihretwegen.
Normalerweise kümmerte es mich nicht, was andere über mich sagten. Ich war ein grober Klotz. Sie hatte jedes Recht gehabt, mich zu beschimpfen. Sie war auch weiß Gott nicht die Erste, die mich als Arschloch bezeichnet hatte. Doch in ihrem Fall hatte es mich betroffen gemacht. Dass ich diese Frau vor den Kopf gestoßen hatte, ließ mir keine Ruhe.
Während der letzten Wochen hatte ich mich bemüht, mit anderen freundlicher umzugehen. Als wüsste sie es, wenn ich jemanden unhöflich behandelte, und wäre deswegen noch enttäuschter von mir – was aus tausend verschiedenen Gründen albern war. Trotzdem tat ich es.
Und nun war sie hier.
Ich ging ins Bad, um meine Frisur zu checken. Was mich noch wütender auf mich selbst machte, weil sie nicht hier war, um mich zu sehen, sondern damit ich ihre Katze untersuchte. Ich verließ das Bad und trat rasch in den Korridor hinaus, um diese Angelegenheit so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Auf halbem Weg blieb ich stehen und drehte mich um. »In welchem Raum?«
Auf diese Frage hatte Maggie nur gewartet. »In der Zwei.«
Ich ging wieder los. Dann fiel mir etwas ein, und ich kehrte um. »Mein Tablet.«
Maggie stand lächelnd da und hielt es mir hin, als hätte sie gewusst, dass ich deswegen noch mal zurückkommen würde. Ich nahm es ihr mit zusammengekniffenen Augen aus der Hand und ging. Und diesmal wirklich.
Als ich die Tür zu Raum zwei öffnete, saß Samantha auf demselben Platz wie beim letzten Mal, wieder mit dem Kätzchen im Ausschnitt.
»Hallo, Dr. Rush«, sagte sie mit einem schiefen Grinsen.
Sie war sogar noch schöner als beim letzten Mal.
»Miss Diaz«, sagte ich leise und ging zum Waschbecken, um mir die Hände zu waschen. Vor allem aber, um noch ein bisschen Zeit zu schinden, bevor ich mit ihr sprach.
Als ich mich wieder zu ihr umdrehte, bedachte sie mich mit einem Lächeln. »Würden Sie gern das Poloch meines Kätzchens sehen?«
Leise glucksend richtete ich mich auf und warf das Papierhandtuch in den Müll. »Das möchte ich tatsächlich gern sehen.«
Sie zog die Katze aus ihrem BH und reichte sie mir.
Ich stellte sie auf den Untersuchungstisch und hob den Schwanz an. »Das ist ja ein wirklich hervorragend aussehendes Poloch«, sagte ich mit erhobenen Augenbrauen.
»Nicht wahr?« Sie grinste.
Nur mit Mühe gelang es mir, eine ernste Miene zu bewahren.
»Die Chirurgin meinte, die Missbildung sei geringfügiger, als wir angenommen hatten«, sagte sie und sah zu, wie ich Pupi untersuchte. »Sie hat die OP hervorragend überstanden, ohne Inkontinenz oder sonstige Beschwerden.«
»Und ihre Darmbewegungen sind normal?«, fragte ich und tastete ihren Bauch ab.
»Ja.«
»Wie oft am Tag hat sie Stuhlgang?«
»Zwei- bis dreimal.«
»Und wie sieht er aus?«
»Ich dachte mir schon, dass sie den vielleicht gern sehen würden, und habe ein Foto für Sie gemacht.« Sie holte ihr Handy heraus, wischte ein paarmal über das Display und hielt es mir hin.
Ich nickte zufrieden. »Perfekt.«
Während ich die Zähne und die Augen des Kätzchens inspizierte, spürte ich, wie sie mich beobachtete.
Die Katze roch wieder nach ihrem Parfüm, was mir auch diesmal gefiel.
Sie steckte ihr Handy wieder in die Handtasche und lehnte sich an die Wand. »Übrigens nehme ich Ihre Entschuldigung an.«
Ich sah zu ihr auf. »Ich muss zugeben, dass ich mich getäuscht habe. Ich habe die Menschen offensichtlich unterschätzt.«
»Nein, Sie haben mich unterschätzt – und wie witzig ich sein kann. Das ist viel schlimmer.«
Damit entlockte sie mir ein kleines Lächeln.
Ich zog mein Stethoskop aus der Tasche und hörte Pupis Herz und Lunge ab. »Sie haben mehr Geld eingenommen, als sie brauchten. Was haben Sie mit dem Rest gemacht?«
»Ich habe alles der Bitty Kitty Brigade gespendet.«
Ich nickte beifällig und legte mir das Stethoskop um den Hals. »Meines Erachtens ist sie in guter Verfassung«, sagte er. »Ich kann ihr die Flugerlaubnis erteilen. Und ich gebe Ihnen was für die Reise mit.«
»Danke.« Sie wartete und bedachte mich mit einem Uuuund?-Blick.
Jetzt oder nie.
»Würden Sie gern mit mir ausgehen?«, wagte ich mich vor.
»Absolut«, erwiderte sie wie aus der Pistole geschossen. »Aber wir müssen uns heute Abend sehen. Morgen fliege ich.«
»Soll ich Sie abholen, oder wäre es Ihnen lieber, dass wir uns irgendwo treffen?«, fragte ich.
»Abholen.«
»Um halb sieben?«
»Klingt gut«, erwiderte sie. »Meine Nummer steht in Pupis Patientenakte.«
Ich reichte ihr das Kätzchen, nahm im Austausch das Gesundheitszertifikat der Fluglinie entgegen, das sie mir mitgebracht hatte, und ging, um es auszufüllen.
Im hinteren Bereich der Praxis sah ich Tina. »Sie braucht ein Rezept für Gabapentin und einen Impfnachweis. Das Zertifikat fülle ich aus, bevor ich gehe.«
Während ich mit ihr sprach, suchte ich im Tablet nach Samanthas Nummer.
»O mein Gott, er lächelt ja«, sagte Tina.
Ich hob ruckartig den Kopf. »Wie bitte?«
Sie sah mich mit großen Augen an. »Sie lächeln.«
Maggie klappte der Mund auf. »Er lächelt tatsächlich. Ihretwegen? Mögen Sie sie etwa??«
Ehe ich mich dazu äußern konnte, schnappte Tina nach Luft und begann ausgelassen herumzuhopsen. »Er mag sie!«
»Hören Sie damit auf. Nein, tue ich nicht.«
Maggie ließ den Zeigefinger kreisen. »Doch, tun sie! Das ist offensichtlich.«
Ich sah sie ausdruckslos an und ging in mein Büro. Nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, blieb ich vor dem Schreibtisch stehen und fuhr mir mit einer Hand über den Mund.
Ich fühlte mich mies, weil ich gesagt hatte, ich würde sie nicht mögen. Das stimmte nicht.
Also ging ich wieder hinaus. »Ja, ich mag sie. Wir haben heute Abend ein Date miteinander. Ich will nichts darüber hören. Es ist keine große Sache.«
Anscheinend war es das doch, denn die beiden fingen an zu kreischen.
»Das ist nicht mein erstes Date«, sagte ich, ein wenig verstimmt.
»Oh, das wissen wir«, erwiderte Maggie strahlend. »Aber es ist anders als die bisherigen.«
»Inwiefern?«
»Sie hat Sie ein Arschloch genannt.«
Ich verzog den Mund zu einem freudlosen Grinsen.
»Normalerweise würde ich Ihnen raten, sich nicht so einschüchternd und ernst wie sonst zu geben, aber ich glaube, sie steht darauf«, sagte Tina.
»Vielen Dank, aber ich brauche Ihren Rat nicht. Es fällt mir nicht schwer, Frauen zu finden, die gern mit mir ausgehen möchten.«
Das tat es wirklich nicht. Ich hatte keine Ahnung, warum sie so aufgeregt waren.
»Sie verabreden sich immer mit einem ganz bestimmten Frauentyp«, sagte Maggie.
»Ach wirklich?«, erwiderte ich und verschränkte die Arme.
»Es sind jedes Mal Typ-A-Persönlichkeiten«, fuhr Maggie unbeirrt fort. »Sie haben Abschlüsse von den besten Universitäten, sind perfekt gekleidet und besitzen keinerlei Humor. Sie sind bei Ihren Dates intensiv und grüblerisch, und die Frauen an Ihrer Seite werden deswegen sauer und tippen wie wild in ihre Handys, weil sie CEOs, Anwältinnen oder irgendetwas anderes mit einem superstraffen Pferdeschwanz sind.«
»Stimmt, der Pferdeschwanz!«, warf Tina ein. »Den haben sie immer!«
»Die Letzte hatte keinen«, erwiderte ich genervt.
»Nein, aber sie sah aus, als hätte sie einen«, entgegnete Tina.
»Sie brauchen jemanden, der Ihnen Paroli bietet«, sagte Maggie. »Und Sie auflockert.«
»Jemand Nettes … aber nicht zu nett«, fügte Tina an. »Für besonders nette Frauen sind Sie zu Furcht einflößend.«
»Ich und Furcht einflößend«, schnaubte ich.
Die beiden Frauen sahen mich unter gesenkten Lidern hervor an.
»Sie lächeln nicht gerade viel, mein Lieber«, sagte Maggie.
»Außerdem sind Sie sehr groß«, warf Tina ein. »Sie können nicht eine finstere Miene ziehen und gleichzeitig groß sein. Das macht anderen Angst.«
»Wohin werden Sie mit ihr gehen?«, fragte Maggie.
»Es sollte ein öffentlicher Ort sein«, sagte Tina. »Für ein erstes Date an einem abgeschiedenen Ort schauen Sie zu finster drein.«
Ich sah sie an. »Ist mein Gesicht wirklich so ein Problem?«
Sie sogen beide zischend den Atem ein.
»Irgendwie schon«, sagte Tina ganz sachlich. »Im Grunde ist daran nichts auszusetzen. In einem Liebesroman wären Sie ein extrem männlicher Vampir. Was richtig gut ist.«
»Ein Werwolf«, korrigierte Maggie sie. »Er ist irgendwie knurrig.«
»Ein Werwolf«, wiederholte ich mit unbewegter Miene.
»Nein …«, sagte Tina an Maggie gewandt und machte eine dramatische Pause. »Rhysand.«
Maggie keuchte auf. »Jaaaaa! Weil er so kalt, gut und gefährlich aussieht.«
»Er sieht doch wirklich wie Rhys aus, wenn der ein Mensch wäre, nicht wahr?«
»O mein Gott. Total!«
Maggie und Tina kriegten sich gar nicht mehr ein, und ich wurde immer genervter von ihrem Wortwechsel. »Während Sie beide sich Gedanken machen, was für eine erfundene Figur ich sein könnte, mache ich mich mal wieder an die Arbeit.« Ich bedachte die beiden mit einem vielsagenden Blick. »Es wäre schön, wenn Sie sich irgendwann auch wieder dazu entschließen würden.«
Doch sie ließen sich nicht beirren und sprachen weiter über Feen mit Fledermausflügeln.
Bevor sie mir weitere Fragen stellen konnten, zog ich mich in mein Büro zurück. Kaum hatte ich am Schreibtisch Platz genommen, begann ich zu hinterfragen, ob das Event, zu dem ich Samantha mitnehmen wollte, wirklich eine gute Idee war.
Was es nur noch schlimmer machte, da ich als Nächstes zu hinterfragen begann, weshalb ich mich hinterfragte.
Normalerweise traf ich schnelle und souveräne Entscheidungen. Und in der Regel waren es die richtigen. Doch hierbei war ich mir aus irgendeinem Grund nicht sicher.
Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass ich bei Samantha nur einen Versuch haben würde. Und den wollte ich unbedingt nutzen. Warum ich das dachte, wusste ich nicht. Vielleicht weil dieses Date an sich schon eine unverhoffte zweite Chance war?
Und was meinten Maggie und Tina überhaupt damit, dass ich nie lächelte. Das stimmte doch gar nicht.
Ich sah über den Schreibtisch hinweg zu einem Foto von den beiden und mir, das Maggie gerahmt hatte. Es war vor zwei Jahren bei der offiziellen Einweihungsfeier der Praxis entstanden. An einem der glücklichsten Tage meines Lebens.
Okay, vielleicht lächelte ich wirklich nicht.
Daran sollte ich wohl arbeiten.
Ich seufzte tief und rief Jesses Freundin Becca an. Beim zweiten Läuten ging sie dran. Im Hintergrund wies eine gedämpfte Stimme sie gerade an, zum nächsten Fenster weiterzufahren. Offenbar befand sie sich in einem Drive-in.
»Xavier?«
»Hi. Kann ich dir eine Frage stellen?«
»Klar. Was ist los?«
»Bin ich Furcht einflößend?«
Einen Moment lang herrschte am anderen Ende Totenstille.
»Hallo?«, hakte ich nach.
»Ich denke darüber nach, wie ich es nett formulieren kann.«
Ich rieb mir die Schläfen.
»Du bist sehr groß, und du lächelst nicht viel«, sagte sie. »Du wirkst manchmal ein wenig mürrisch. Genau genommen glaube ich, dass du auch tatsächlich ein bisschen mürrisch bist.«
Ich kniff die Augen zusammen. Anscheinend besaß ich den Charme einer Gewitterwolke.
»Wieso? Gehst du etwa zu einem Date oder so was?«, fragte sie.
»Ja.«
»Willst du meine ehrliche Meinung hören?«, fragte sie. »Ich meine ganz frei von der Leber weg?«
Mein Schweigen hielt sie nicht davon ab fortzufahren.
»Sei einfach du selbst. Wenn sie ein Date mit dir ausgemacht hat, hat sie wahrscheinlich schon eine ungefähre Vorstellung von dir. Und sobald man dich näher kennenlernt, hat man keine Angst mehr vor dir.«
»Toll. Danke.«
»Ich meine es ernst. Es ist so. Du bist nicht charismatisch, extrovertiert oder lustig oder …«
»Ja, ja, schon gut. Du musst es mir doch nicht gleich so reinwürgen.«
»Nein, lass mich ausreden. Dafür hast du andere tolle Eigenschaften. Du bist verlässlich und loyal. Du bist berechenbar, zupackend und freundlich. Du tust immer das Richtige, und du bist unglaublich integer. Auf all das kommt es wirklich an.«
Ich entspannte mich ein bisschen.
»Dir ist doch sonst immer egal, was andere von dir halten«, sagte Becca. »Das muss ja ein echt wichtiges Date sein.«
Das ließ ich einfach mal so stehen.
»Moment, ich muss meinen Kaffee bezahlen.«
»Vielen Dank für dein Feedback«, sagte ich. »Damit hast du mir sehr geholfen.«
»Gern geschehen.«
»Erzähl Mike und Chris bitte nicht, dass ich dich angerufen habe«, sagte ich. »Und auch nicht Jesse.«
»Okay, ich werde schweigen. Versprochen. Lass einfach den finsteren Liebesroman-Helden von der Kette, der in dir steckt. Channele deinen inneren Rhysand.«
Na klar. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was sie mir damit sagen wollte, aber nachdem ich diesen Namen innerhalb von zehn Minuten schon zum zweiten Mal gehört hatte, beschloss ich, ihn bei Gelegenheit mal zu googeln.
»Viel Glück«, trällerte sie.
Ich legte auf und starrte das Foto an der Wand an. Also gut, ich würde nichts erzwingen und ganz ich selbst sein.
Hoffentlich gefiel ihr das.
4Samantha
»Ich habe ein Date mit ihm.«
Jeneva schnappte nach Luft. »Mit dem Tierarzt? Wie ist das denn passiert?«
»Er hat mich gefragt, als ich mit Pupi zur Untersuchung bei ihm war.«
Ich zog ein letztes Mal den Lidstrich nach, trat einen Schritt zurück und betrachtete mich im Badezimmerspiegel. Nicht schlecht, wenn man bedachte, wie unvermittelt das alles kam. Ich trug ein Sommerkleid und Sandalen. In meiner Handtasche steckte eine Sonnenbrille, und ich hatte meinen Strandhut auf. Schließlich wusste ich nicht, wie viel Zeit wir im Freien verbringen würden.
»Musst du nicht noch packen?«, fragte sie.
»Damit bin ich komplett fertig und hätte heute Abend sonst nichts vorgehabt. Ehrlich gesagt kann ich die Ablenkung gut gebrauchen.«
»Wohin führt er dich denn aus?«
»Keine Ahnung«, erwiderte ich, während ich nach meinem liebsten Lippenstift kramte. »Er hat mich gefragt, ob ich Boote mag. Ich wollte nicht allzu viele Fragen stellen. Ich finde es aufregend, nicht zu wissen, was passieren wird.«
»Na ja. Nicht zu wissen, was passieren wird, ist die beste Methode, sich umbringen zu lassen. Schreib mir, wenn ihr am Ziel seid. Holt er dich denn ab?«
»Ja, ich hielt es für besser, mir das Geld für das Uber zu sparen.«
»O Gott. Hast du denn noch nie eine True-Crime-Doku gesehen?«
»Pfff. Ich kann andere Leute ganz gut einschätzen. Ich finde, du solltest mir ein bisschen mehr zutrauen.«
Pupi rieb das Gesicht an meinem Bein. Ich hob sie hoch und setzte sie auf das Waschbecken.
»Wie auch immer. Falls du nicht spurlos vom Erdboden verschwindest, freue ich mich jedenfalls darauf, dich morgen zu sehen.«
»Wie geht es Mom?«
Jeneva schwieg einen Moment. »Wenn sie dich sieht, wahrscheinlich gut.«
Ich zögerte ebenfalls kurz. »Ja, kann sein.«
Tatsächlich wussten wir beide, dass es ihr ziemlich sicher nicht gut gehen würde. Das tat es schon seit einer ganzen Weile nicht mehr.
Unsere Mom litt unter Demenz. Sie war erst vierundfünfzig.
Es hatte vor ein paar Jahren mit Konzentrationsproblemen nach einer leichten Kopfverletzung begonnen. Sie dachte, die Gehirnerschütterung bräuchte nur etwas länger als üblich, um auszuheilen, und schob ihre Verwirrung außerdem zum Teil auch auf ihre Wechseljahre. Doch dann wurde es schlimmer. Immer wieder stellte sie mehrmals hintereinander dieselben Fragen, verirrte sich und knallte schließlich vor einem Supermarkt in Pasadena mit dem Auto gegen eine Palme, weil sie mit den Pedalen durcheinanderkam.
Und inzwischen kannte sie meinen Namen nicht mehr.
Das war der Grund, warum ich so schnell wie möglich nach Kalifornien zurückkehren wollte.
Ich war seit acht Monaten nicht mehr zu Hause gewesen. Sie hatte also schon eine ganze Weile mein Gesicht nicht mehr gesehen. Vielleicht erinnerte sie sich ja deswegen nicht mehr an mich. Gut möglich, dass sie nur mehr Kontext brauchte. Sobald ich mich im selben Raum aufhielt wie sie, würde ihr alles wieder einfallen. Zumindest hofften Jeneva und ich das.
»Wie ist es, bei Grandma zu wohnen?«
»Seltsam«, sagte sie. »Aber Brad und Holden lieben das Haus.«
»Es ist ja auch wirklich schön«, sagte ich und streichelte mein Kätzchen. »Habt ihr was von dem Schmuck wiedergefunden?«
»Kein Stück. Ich habe wochenlang alles danach abgesucht und den Jungs für jeden Fund fünf Dollar geboten.«
»Helfen sie dir denn wirklich suchen?«, fragte ich.
Sie schnaubte. »Nein. Vielleicht sollte ich sie stattdessen lieber mit Roblox-Karten ködern.«
Mom hatte in den Monaten, bevor Jeneva einzog, all ihren Familienschmuck verloren. Urgroßmutters Ehering und das Medaillon, das sie von ihr geerbt hatte. Außerdem das diamantbesetzte Armband, das Dad ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, ihre Diamantohrringe, ihren Verlobungsring und ihren eigenen Ehering – lauter unersetzliche Erinnerungsstücke, die sich irgendwo im Haus befanden. Und unsere beste Hoffnung, sie wiederzufinden, waren ein Elfjähriger und ein Zwölfjähriger mit ADHDS. Diese Schnitzeljagd würde das Erste sein, woran ich mich bei meiner Ankunft beteiligen würde.
»Ich wünschte, ich hätte rechtzeitig daran gedacht, die Sachen zu verstecken«, sagte Jeneva.
»Das konnten wir doch nicht ahnen.« Ich besprühte mein Make-up mit Fixierspray.
Am anderen Ende herrschte einen Moment lang Schweigen. »Bevor du kommst, muss ich dir noch was erzählen«, sagte meine Schwester.
Ich ließ die Hand sinken. »Sag mir nicht, dass du wieder mit deinem Ex zusammen bist …«
»Was? Igitt. Nein.« Sie atmete tief durch. »Das sollte ich wohl nicht sagen. Schließlich ist er der Vater meiner Jungs. Aber wirklich auf gar keinen Fall.« Ich stellte mir vor, wie sie erschauderte. »Nein, ich wollte dir sagen, dass Dad an allen Türen Kindersicherungen und Alarmvorrichtungen anbringen musste«, erklärte sie.
Mir wurde flau im Magen. »Wegen Mom? Ist sie wieder abgehauen?«
»Ja.«
Ich stieß einen langen Seufzer aus und setzte mich auf den Toilettendeckel.
Das hatte sie vor ein paar Jahren schon mal bei einem Besuch hier bei mir getan. Damals hatten wir zum ersten Mal gemerkt, dass es schlimmer um sie stand, als wir dachten. Sie hatte eine Blasenentzündung gehabt, von der wir nichts wussten, und die Krankheit hatte ihre Symptome verstärkt. Sie hatte nicht mehr gewusst, wo sie war, und war aus meiner Wohnung hinausspaziert. Ein paar aufmerksame Passanten hatten sie an einer Bushaltestelle entdeckt.
Seither war es nicht mehr vorgekommen. Doch nun hatte sich ihr Zustand verschlechtert. Uns war klar gewesen, dass es irgendwann gefährlicher für sie werden würde.
»Helfen die Kindersicherungen denn?«, fragte ich.
»Mehr oder weniger. Mom braucht eine Weile, um dahinterzukommen, wie man sie aufmacht. Meistens gibt sie vorher frustriert auf. Aber ich muss sie trotzdem die ganze Zeit im Auge behalten.«
»Können wir nicht einen GPS-Tracker an ihr befestigen?«
»Sie nimmt die Dinger ab. Dad hat es mit Halsketten und Armbändern versucht. Er hat einen AirTag in einem ihrer Schuhe versteckt, aber sie zieht nicht immer Schuhe an. Oder auch mal nur einen.«
Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, mir nicht vorzustellen, wie meine schöne, elegante und junge Mutter barfuß das Haus verließ. »Ich bin ja bald da, und dann könnt ihr auch mal Pause machen.«
Auf meinem Handy poppte eine Nachricht auf. Sie stammte von Xavier. Er stand draußen.
»Er ist da«, sagte ich. »Ich muss aufhören.«
»Schick mir die ganze Zeit Nachrichten.«
»Mach ich.«
Ich beendete das Gespräch und blieb einen Moment sitzen, um mich zu sammeln.
Seit dem Vorfall an der Bushaltestelle musste ich jedes Mal, wenn ich in den Nachrichten von einer vermissten Person hörte, an meine Mutter denken. Wie sie ziellos davonlief, sich verirrte, verletzte oder entführt wurde. Sie war wie ein Kleinkind in Erwachsenengestalt, das man ständig davon abhalten musste, sich aus Versehen umzubringen.
Dad arbeitete. Er konnte nicht die ganze Zeit bei ihr zu Hause bleiben. Deswegen waren sie zu Grandma gezogen, doch dann war Mom auch ihr zu viel geworden, und so war als Nächstes Jeneva eingezogen. Nun passten sie also zu dritt auf sie auf, aber ich machte mir dennoch Sorgen, dass sie vielleicht nicht imstande sein würden, sie zu beschützen. Sie in eine Pflegeeinrichtung zu stecken, kam für uns jedoch nicht infrage.
Darüber hatten wir uns alle schon recht früh geeinigt, als Mom noch selbst etwas zur Diskussion beitragen konnte. Wir würden sie auf keinen Fall in eine Demenzbetreuung abschieben.
Sie wollte zu Hause sein. Wir wollten, dass sie zu Hause war. Bei den Menschen, die sie liebten, und an einem Ort, der ihr so lange wie möglich vertraut sein würde. Sie war in diesem Haus aufgewachsen und kannte es in- und auswendig. Da das Langzeitgedächtnis als Letztes verschwand, würde sie diese Umgebung noch eine ganze Weile als tröstlich empfinden. Und so mussten wir unbedingt dafür sorgen, dass es funktionierte. Und das ging nur, wenn ich dabei half.
Aber darüber konnte ich jetzt nicht nachdenken. Das würde ich morgen tun, sobald ich dort war und sie vor mir sah.
Im Moment wollte ich das alles vergessen.
Ich erhob mich vom Toilettendeckel, besprühte mich mit Parfüm und ging zu meinem Date.
Als ich aus dem Haus trat, blickte ich in die sehr ernste Miene von Dr. Rush, der eine Sukkulente in der Hand hielt.
»Hi«, sagte ich und lehnte mich mit dem Rücken an die Tür.
»Hallo.«
Ich deutete mit dem Kopf auf die Topfpflanze. »Ist die für mich?«
»Ich wollte dir eigentlich Blumen mitbringen, aber du hast gesagt, dass du die Stadt verlässt.«
»Ooooh. Also hast du mir stattdessen etwas mitgebracht, das längere Einsamkeit und Vernachlässigung überleben kann? Das ist wirklich umsichtig von dir – und angesichts meiner zwei linken grünen Daumen auch absolut nötig.«
Seine Mundwinkel zuckten.
»Du siehst sehr hübsch aus.« Er sagte es, als wäre es seine Pflicht, mich darüber zu informieren. Damit brachte er mich zum Lachen.
Xavier sprach in nüchternem, fast grüblerischem Tonfall.
Und er sah sehr, um nicht zu sagen alarmierend, gut aus.
Er trug ein marineblaues Button-down-Hemd mit bis zum Ellbogen hochgekrempelten Ärmeln. Blau schien seine Lieblingsfarbe zu sein. Bei meinen beiden Besuchen in seiner Praxis hatte er unter seinem weißen Arztkittel marineblaue OP-Kleidung getragen. Wahrscheinlich war er sich bewusst, wie gut sie seine Augenfarbe zur Geltung brachte, ein sehr intensives Kristallblau. Seine Iris erinnerten mich ein wenig an Kaleidoskope. Außen dunkel und nach innen hin immer klarer und heller.
Es war ein Schock, ihn in Alltagskleidung zu sehen, allerdings ein positiver. Er verstand es definitiv, sich gut anzuziehen. Außerdem roch er fantastisch.
Intelligent, erfolgreich, sehr hübsch anzuschauen und außerdem freundlich zu kleinen, verwundbaren Geschöpfen. Mein Gott – dieser Mann konnte sich vor Verehrerinnen sicher kaum retten.
Er reichte mir die Pflanze und ich hielt sie hoch. »Danke. Ich bringe sie nur schnell rein und hole meine Handtasche.« Ich quetschte mich durch den Türspalt, stellte die Pflanze an einen Platz, an dem Pupi sie nicht umwerfen konnte, schnappte meine Tasche und ging wieder nach draußen.
»Und, was machen wir?«, fragte ich und ließ mich von ihm zu seinem großen schwarzen SUV führen.
»Eine Bootsfahrt bei Sonnenuntergang auf dem Lake Minnetonka.« Er öffnete die Beifahrertür für mich.
»Wird es dabei etwas zu essen geben?«, fragte ich und stieg ein. »Wenn nicht, müssen wir noch irgendwo anhalten und einen Milkshake oder etwas in der Art für mich besorgen.«
Er schloss die Tür und ging auf die andere Seite. »Es gibt etwas zu essen«, sagte er, während er ebenfalls einstieg. »Und Hundewelpen. Es ist eine Adoptions-Kreuzfahrt der Midwest-Tierrettung.«
Ich starrte ihn an. »Soll das etwa heißen, du führst mich zu einem perfekten Date aus?«
Um seine Augen bildeten sich kleine Lachfältchen.
Während er den Motor anließ und losfuhr, sah ich mich in seinem SUV um.
Er war sauber. Zumindest vorne. Hinten sah er wie ein Hundetransporter aus, was er wahrscheinlich auch war. Die Sitze in der dritten Reihe waren umgeklappt, und im Kofferraum standen zwei Zwinger. Die Schutzbezüge auf den beiden Sitzen in der zweiten Reihe waren voller Hundehaare.
Er bemerkte meinen Blick.
»Ich habe es leider nicht mehr geschafft, hier drinnen sauber zu machen, bevor ich losgefahren bin. Ich arbeite ziemlich viel für die Tierrettung.«
»Ich weiß, ich habe dich gegoogelt«, sagte ich. »Ich habe die Auszeichnung gesehen, die du dafür erhalten hast.«
Er antwortete nicht, doch in seiner Wange zuckte ein winziger Muskel. Offenbar fiel es ihm schwer, Komplimente anzunehmen. Was gut war, da er dann vermutlich nicht den ganzen Abend damit verbringen würde, in den höchsten Tönen von sich selbst zu schwärmen. Von solchen Dates hatte ich schon mehr als genug erlebt.
»Ist dir hier drinnen zu warm?«, fragte er. »Soll ich die Temperatur runterdrehen?« Er richtete einen der Lüftungsauslässe auf mich.
»Alles gut, vielen Dank«, sagte ich und begann mit meinem Fragenkatalog für erste Dates: »Also, Xavier, was tust du so, wenn du Spaß haben willst?«
»Letzte Woche habe ich in einer Kastrationsklinik gearbeitet«, antwortete er ohne den Hauch von Ironie.
Ich grinste ihn von der Seite an. »Das stelle ich mir befriedigend, aber nicht spaßig vor«, erwiderte ich. »Du weißt schon: Spaß. Etwas, das einen zum Lachen bringt und das Leben genießen lässt. Die Entfernung von Hoden rechnet man normalerweise nicht dazu.«
Damit hatte ich es geschafft: Sein Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln und sah damit plötzlich ganz anders aus.
Wow.
Was für ein wunderschöner Anblick. Ich wurde sofort süchtig danach.
»Ich mag ehrenamtliche Arbeit«, sagte er. »Sie macht mir Spaß. Zweimal im Jahr mache ich mit meinen Freunden Urlaub im Norden, aber sonst arbeite ich die meiste Zeit.« Er fuhr auf den Freeway und sah kurz zu mir herüber. »Und was machst du beruflich?«
»Ich arbeite als Social-Media-Managerin für eine Senffirma«, erwiderte ich. »Murkle’s Mustard. Sie bezahlen mich dafür, dass ich ihre Kunden beleidige.«
»Ich fürchte, das musst du mir genauer erklären.«
»Okay. Ich reagiere auf Social-Media-Kommentare mit witzigen, bissigen Bemerkungen. Außerdem erstelle ich Posts, schreibe den Newsletter und plane Kampagnen, die ich anschließend umsetze. Es ist der perfekte Job für mich. Ich kann von zu Hause aus arbeiten und den ganzen Tag im Internet verbringen.«
»Hast du einen Abschluss in Marketing?«
»Ja, aber an der Uni lernt man nicht wirklich, wie man so etwas macht. Ich meine, in gewisser Weise natürlich schon, aber wenn man in diesem Job richtig gut sein will, muss man sich in andere Leute hineinversetzen können.«
»Und das kannst du?«, fragte er.
»Ja. Wenn man jemanden nicht versteht, kann man ihm auch nichts verkaufen.«
Wieder sah er mich von der Seite an. »Das leuchtet mir ein. In meinem Beruf ist es ganz ähnlich. Um ein guter Tierarzt zu sein, muss man sich auch in Tiere einfühlen können.«
»Ist es schwer, Patienten zu verstehen, die nicht sprechen können?«
»Überhaupt nicht. Man muss nur ihre Sprache beherrschen.«
Ich lächelte.
Wir hielten auf einem Parkplatz am See, und er kam wieder auf meine Seite und öffnete die Tür für mich. Um zu den Anlegestegen zu gelangen, mussten wir eine Straße überqueren. Er hielt einen Arm vor mich, während wir am Rand standen und nach links und rechts schauten.
»Findet diese Kreuzfahrt jedes Jahr statt?«, fragte ich, als wir den Hafen erreichten. Ich sah sofort, zu welchem Boot wir mussten, da Hunde an Bord geführt wurden. Es handelte sich um eine staatliche Jacht.
»Ja, bislang zum dritten Mal.«
Er trat zur Seite und ließ mich als Erste die Gangway hinaufgehen.
Das Wetter war perfekt. Warm, mit einer leichten Brise, und die Sonne schien hell vom Himmel. Einer dieser kostbaren Tage, auf die man in Minnesota das ganze Jahr lang wartet. Schade, dass ich morgen abreisen würde. Auf Minnesota im Winter hätte ich besser verzichten können.
Auf halbem Weg zum Boot vibrierte mein Handy. »Entschuldige, ich muss nachsehen, wer das ist«, sagte ich und kramte in meiner Tasche. Wahrscheinlich war es nur ein Werbeanruf, aber es könnte auch sein, dass Jeneva mir irgendetwas über Mom mitteilen wollte. Inzwischen durften Anrufe, bei denen es um meine Mutter ging, grundsätzlich nicht mehr ignoriert werden.
Ich zog das Handy heraus – es war tatsächlich meine Schwester – und blieb mit dem Daumen am Riemen meiner Handtasche hängen, sodass es mir aus der Hand glitt und in den See fiel.
»Nein …«, keuchte ich. »Nein, nein, nein, nein, nein!«
Xavier lugte an mir vorbei. »Was ist los?«
Ich stellte meine Handtasche auf den Steg, kniete mich hin und spähte ins Wasser. »Ich habe gerade mein Handy da reinfallen lassen.«
Das war buchstäblich einer meiner schlimmsten Albträume.
Auf meinem Telefon dort unten befand sich alles, was ich in den nächsten Tagen dringend brauchen würde: die Apps, die ich für meine Arbeit benötigte, das Uber, das ich zum Flughafen nehmen musste, meine Flugtickets, Apple Pay … Ich würde nicht mal meine Schwester anrufen und ihr erzählen können, was geschehen war, denn ich kannte ihre Nummer nicht auswendig. Sie würde glauben, dass meine Verabredung mich in einen Kofferraum gesperrt hatte.
»Ich muss es rausholen«, sagte ich und stand auf.
Das Handy war in mindestens zwei Metern Tiefe.
Es lag auf dem sandigen Grund, und um das erleuchtete Display, auf dem noch immer die Anrufbenachrichtigung angezeigt wurde, schwammen Fische.
Ich würde komplett untertauchen müssen. Meine Haare, mein Make-up, das Kleid – alles würde nass werden. Der Stoff würde anschließend wahrscheinlich durchsichtig sein, aber das war egal – ich brauchte dieses Handy.
Resigniert streifte ich meine Sandalen ab.
»Tu’s nicht«, sagte Xavier neben mir. »Ich werde es holen.«
Ich schaute ihn an. Er knöpfte tatsächlich sein Hemd auf.
»Ich … nein, dabei wirst du doch klatschnass.«
»Schon gut«, sagte er in einem Tonfall, der keine Widerrede duldete.
Dann streifte er sich das Hemd ab, und mir fielen beinahe die Augen aus dem Kopf.
Heilige Scheiße, war dieser Mann durchtrainiert.
Ich fühlte mich wie in einem dieser Parfüm-Werbespots, in denen alles schwarz-weiß war und in Zeitlupe geschah. Mit offenem Mund sah ich zu, wie er das Hemd fallen ließ. Ihm schien gar nicht klar zu sein, wie sexy sein Anblick war.
Er zog sein Handy und die Brieftasche aus seinen Shorts und legte sie in seine Schuhe. Als er sich bückte, erhaschte ich einen Blick auf seinen Rücken, der genau wie seine Brust wie gemeißelt aussah. Auf der Jacht stieß jemand einen Pfiff aus. Xavier warf einen genervten Blick in Richtung Bug und sprang ins Wasser.
Ich glaube, ich hätte nicht mal angetaner von ihm sein können, wenn er mein Baby gerettet hätte.
Einen Augenblick später tauchte er mit dem Handy in der Hand wieder auf. Auf dem Boot erschollen Jubelrufe.
»Vielen Dank«, sagte ich, wieder auf den Knien. »Du hast gar keine Ahnung, wie sehr du mir damit geholfen hast.«
Er reichte es mir. »Sehr gern geschehen. Ich hoffe, es ist wasserdicht.«
»Ja.«
Er nickte zum Ufer. »Hier kann ich nicht auf den Steg zurückklettern. Er ist zu hoch oben. Ich muss an Land schwimmen.«
Während er zum Strand kraulte, hastete ich zum Boot und bat um ein Handtuch für ihn. Die Leute von der Bar gaben mir vier saubere Geschirrtücher, mit denen ich auf dem Steg zurückrannte, um ihn in Empfang zu nehmen, als er aus dem See stieg.
»Danke«, sagte er und nahm die Tücher entgegen.
»Möchtest du nach Hause und dich umziehen?«, fragte ich.
Er schüttelte den Kopf und wischte sich die prächtige Brust trocken. »Nein, dann würden wir die Kreuzfahrt verpassen.«
»Aber deine Shorts triefen vor Nässe.«
»Das ist schon okay. Es ist auch nicht anders, als in einer feuchten Badehose herumzusitzen. Ich werde schnell wieder trocken.«
Ich ließ die Schultern hängen. »Tut mir leid …«
»Denk dir nichts«, erwiderte er. »Das war ein Unfall.«
»Sie sehen gut aus, Dr. Rush!«, rief hinter mir eine Frau von der Jacht zu uns herüber. Mehrere andere Frauen kicherten.
Xavier wirkte kein bisschen amüsiert.
Seine zerzausten Haare und seine gebräunte Haut glitzerten im Sonnenlicht.
Ich verschränkte die Arme. »Das kannst du ihnen wirklich nicht krummnehmen, wenn du hier am Strand stehst und wie Chris Hemsworth aussiehst.«
Er schnaubte.
»Wie viel trainierst du denn?«, fragte ich.
»So viel, dass ich Hunde in jeder Größe tragen kann.«
»Natürlich.« Ich neigte den Kopf zur Seite. »Was wäre, wenn ich dich mit der Aktion nur dazu bringen wollte, dein Hemd auszuziehen?«
»Das hättest du auch leichter haben können.«
Ich lachte. Wusste Xavier eigentlich, wie lustig er war? Dann wurde ich wieder ernst. »Meine Mom ist krank. Der Anruf kam von meiner Schwester. Es war echt nett von dir, mein Handy zu retten.«
»Hast du sie schon zurückgerufen?«, fragte er.
»Noch nicht.«
»Ruf sie an.« Er nickte zu meiner Handtasche und ließ mich allein auf dem Strand zurück, um seine Klamotten zu holen.
Jeneva ging nach dem zweiten Läuten dran. »Hey, was gibt’s?«
»Nichts. Ich wollte nur sehen, ob du einen Notfallanruf brauchst, um dich vor deinem Date zu retten.«
Ich schaute verstohlen zu Xavier hinüber. »Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe ihn gerade halbnackt gesehen.«
»Ooooh! Und?«
Ich blickte über die Schulter und sah zu, wie er sein Hemd zuknöpfte. »Er hat was von einem griechischen Gott. Ich muss jetzt leider auflegen.«
»Hab viel Spaaaß.«
Ich beendete das Gespräch und ging Xavier entgegen. Wir trafen uns auf der Mitte des Stegs. Er war wieder komplett angezogen. »Alles okay?«, fragte er.
»Ja. Es war falscher Alarm.«
»Gut. Wollen wir?« Er bedeutete mir vorzugehen.
Die Jacht war zweistöckig. Oben gab es einen abgeschlossenen, restaurantartigen Sitzbereich und ein Außendeck mit Tischen und Stühlen. Auf der unteren Etage befand sich ein weiteres Speisezimmer mit Sitznischen, einer Kirschholzbar und einem Büfett. Überall standen freiwillige Helfer mit geretteten Hunden, die man streicheln durfte.
Xavier kannte jeden Hund beim Namen.
Da noch immer Passagiere eintrafen, führte Xavier mich zur Bar und bestellte uns zwei Salty Dogs, den Signature Drink dieser Veranstaltung. Seiner war alkoholfrei.
»Trinkst du nichts?«, fragte ich und lehnte mich an die Theke.
»Nein.«
»Grundsätzlich nicht oder nur heute?«
»Ich verliere nicht gern die Kontrolle. Außerdem werde ich dich nachher heimfahren.«
Okay. Das sprach für ihn. »Glaubst du, die finden alle ein neues Zuhause?«, fragte ich und sah zu, wie ein struppiger Mischling an einer Leine vorbeigeführt wurde.
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Die meisten nicht. Zumindest nicht hier. Das hier ist vor allem eine Spendenaktion.«
Ich sah mich um. »Wärst du auch ohne mich hergekommen?«
»Ja.«
»Und du hattest keine Begleitung?«
»Doch«, sagte er und schob mir meinen Drink zu. »Meinen Freund Chris.«
»Und was ist mit dem passiert?«
Er nahm sein Glas von der Theke. »Ich habe ihm gesagt, dass ich seine Eintrittskarte brauche«, sagte er und trank einen Schluck.
»Und wie fand er es, ausgebootet zu werden?«
»Er ist ein sehr guter Freund und weiß, dass ich ihn nie ohne guten Grund darum gebeten hätte.«
Ich lächelte. Es gefiel mir, ein guter Grund zu sein. »Willst du dich auf das Oberdeck setzen und von der Sonne trocknen lassen?«
»Gern.«
Er führte mich nach oben, und wir ergatterten einen Platz im Freien.
Kellnerinnen und Kellner gingen mit Tabletts voller Häppchen herum. Er ließ sich von jedem zwei Stück geben und schob mir meine Portionen wie kleine Opfergaben über den Tisch. Den letzten gefüllten Pilz überließ er kommentarlos mir.
Anschließend saßen wir schweigend da, nippten an unseren Drinks, und er bedachte mich mit einem nachdenklich wirkenden Blick.
Ich erwiderte ihn.
Seit dem Sprung in den See waren seine Haare zerzaust. Wegen des Windes musste er sie sich immer wieder aus der Stirn streichen. Sein markantes Kinn war von einem leichten Bartschatten bedeckt.
Sämtliche ehrenamtlichen Helfer und auch viele Gäste auf dem Boot kannten ihn und schienen ihn alle zu mögen. Sie begrüßten ihn im Vorbeigehen, offensichtlich erfreut, ihn hier zu sehen. Das verhaltene Lächeln, mit dem er reagierte, wirkte nicht unhöflich, nur zurückhaltend. Er neigte offensichtlich nicht zu Gefühlsausbrüchen.
Mein verstorbener Großvater war auch so gewesen. Nach innen gekehrt und trotzdem aufmerksam und – genau wie Xavier – längst nicht so einschüchternd, wie er auf den ersten Blick wirkte.
Wäre Xavier tatsächlich so Furcht einflößend, wie er aussah, hätten diese Leute es niemals gewagt, ihm zuzujubeln, wenn er kein Hemd trug, und wären auch nicht zu ihm gekommen, um Hallo zu sagen. Sie waren an ihn gewöhnt, sie mochten und respektierten ihn, und sie wussten, wie er war. Er war offensichtlich umsichtig. Und tierlieb. Vielleicht etwas mürrisch. Aber vermutlich nur, weil er die meisten Menschen für schlecht hielt. Im Ruhezustand wirkte sein Gesicht ein wenig abweisend, doch ansonsten war daran nicht das Geringste auszusetzen.
Nachdem ich ihm fünf Minuten lang dabei zugesehen hatte, wie er mit den Leuten und den Hunden auf dieser Jacht umging und wie er selbst wiederum mich beobachtete, wusste ich vermutlich mehr über ihn, als ich bei einem ungestörten Gespräch irgendwo anders hätte herausfinden können.
Und ich mochte ihn. Es schmeichelte mir, dass er mich gebeten hatte, ihn hierher zu begleiten.
»Wie war deine letzte Freundin?«, fragte ich.
Xavier blickte auf den See hinaus. »Carolyn war eine auf Firmenübernahmen spezialisierte Anwältin.«