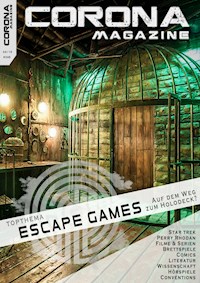Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: In Farbe und Bunt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Berlin, in einer nicht so fernen Zukunft.Die Menschheit hat die Sterne erreicht, doch ihre Erde stirbt. Und mit ihr auch die Errungenschaften der Zivilisation. Die meisten Überlebenden fristen ein erbärmliches, von Angst und Armut geprägtes Leben in den Dunklen Zonen. Das System hat sie vergessen und ermöglicht nur wenigen Auserwählten die Zuflucht in abgeschotteten Oasen.Aus den Ruinen West-Berlins macht sich Yula in den blühenden Osten der Stadt auf, um ihre Familie zu vereinen, beginnt damit aber eine Reise, die ihr eigenes Schicksal und das der gesamten Menschheit beeinflussen könnte ...Yulas atemlose Heldenreise findet ihren Abschluss. Lesen Sie die ganze Geschichte aus der Feder des DPP-Preisträgers Björn Sülter in dieser spannenden Gesamtausgabe!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Yula und die Sterne
Die Beyond Berlin-Saga
von Björn Sülter
Impressum
Originalausgabe | © 2023
in Farbe und Bunt Verlag
Am Bokholt 9 | 24251 Osdorf
www.ifub-verlag.de
www.ifubshop.com
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Veröffentlichung des Buches, oder Teilen daraus, sind vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Alle Rechte liegen beim Verlag.
Herausgeber: Björn Sülter
Lektorat & Korrektorat: Telma Vahey
Lektorat & Korrektorat: Helga Parmiter
Satz, Cover- & Innenseitengestaltung: EM Cedes
Cover- & Innenseitenillustrationen: Stefanie Kurt
Print-Ausgabe gedruckt von: Bookpress (Polen)
ISBN (Print): 978-3-95936-432-4
ISBN (Ebook): 978-3-95936-433-1
ISBN (Hörbuch-CD): 978-3-95936-435-5
ISBN (Hörbuch-DL): 978-3-95936-434-8
Inhalt
Teil 1: Ein kleiner Schritt für ein Mädchen
Prolog Schnee
Kapitel 1 Nachts
Kapitel 2 Hoffnung
Kapitel 3 Zu spät
Kapitel 4 Raus!
Kapitel 5 Tunnel
Kapitel 6 Licht
Kapitel 7 Nest
Kapitel 8 Yula 2.0
Kapitel 9 Endstation
Kapitel 10 Winter
Teil 2:
Prolog Regen
Kapitel 11 Hölle
Kapitel 12 Transit
Kapitel 13 Nao
Kapitel 14 Berlin
Kapitel 15 Parallaxe
Kapitel 16 Elefant
Kapitel 17 Drinnen
Kapitel 18 Draussen
Kapitel 19 Krater
Kapitel 20 Hütte
Kapitel 21 Brücken
Kapitel 22 Grenze
Kapitel 23 Jenseits
Kapitel 24 Limbus
Kapitel 25 Sonne
Teil 3: Aus der Asche
Prolog Bereit
Kapitel 26 Maschine
Kapitel 27 Sirene
Kapitel 28 Allein
Kapitel 29 Andere
Kapitel 30 Gitter
Kapitel 31 Liebe
Kapitel 32 Augen
Kapitel 33 Erwachen
Kapitel 34 Kälte
Kapitel 35 Mut
Kapitel 36 Neustart
Kapitel 37 Falsch
Kapitel 38 Endlich
Kapitel 39 Abschied
Widmung
Für alle, die daran glauben, dass in jedem von uns etwas Einzigartiges schlummert ...
Teil 1
Ein kleiner Schritt für ein Mädchen
Schnee
Yula presste den ramponierten Kopfhörer enger an ihre Ohren. All die zuvor betäubten Emotionen kehrten mit voller Wucht zurück. Mit letzter Kraft drückte sie die Taste ihres Abspielgeräts. Ihre Fingerkuppen waren blutverschmiert, der Bass donnerte in ihren Ohren, und Tränen liefen ihr über die Wangen.
Unter ihr starb eine Welt. Ihre Welt.
Bald schon würde nichts mehr an die einst blühenden Wiesen, die Tiere und die wunderbar frische Luft erinnern. Bald schon wäre selbst das wenige, was noch übriggeblieben war, vergangen.
Alles versank in ewigem Winter.
Nachts
Es gab nicht viel, auf das man sich in dieser Welt verlassen konnte. Doch eines war Yula absolut klar: Wenn sie aus dem Schlaf hochschreckte und durch die Ritzen in den Brettern vor ihrem Fenster keinen Lichtschein sah, war etwas nicht in Ordnung. Ganz und gar nicht in Ordnung. Die junge Frau hatte für gewöhnlich einen guten Schlaf, nahm allerdings auch jedes Geräusch wahr, das nicht zur normalen Soundkulisse ihres Hauses gehörte. Irgendetwas hatte sie geweckt.
Sie stieg, so leise sie nur konnte, aus ihrem Bett und tastete sich zum Fenster. Sie hatte recht gehabt. Es war mitten in der Nacht. Auf der Straße war nichts und niemand zu sehen. Yula verharrte einen Moment. Die schlanke Gestalt mit den schulterlangen dunklen Haaren zitterte, allerdings nicht nur vor Kälte. Fünf lange Minuten geschah nichts. Doch dann hörte sie erneut ein Knacken im Stockwerk unter ihr. Oder kam es bereits von der Treppe? Sie hatte ihr Haus sehr gut gesichert. Doch immer wieder gelang es jemandem, ihre Vorkehrungen zu überwinden. Meist waren es Drogensüchtige auf der Suche nach wertvollem Tauschmaterial. Hatte man Pech, konnte es aber auch ein perverser Vergewaltiger oder Mörder sein. Oder noch schlimmer, einer von den Schatten. Yula schlich zu ihrem Bett zurück, griff sich den Baseballschläger, glitt zur Zimmertür und öffnete sie nahezu geräuschlos. Den Schläger in der rechten Hand tastete sie sich an der Wand entlang zum Treppengeländer. Um sie herum war es totenstill und stockfinster. Das war allerdings kein Problem. Sie konnte sich mühelos im Haus orientieren. Schließlich hatte sie ihr ganzes Leben hier verbracht. Schritt für Schritt schlich sie die Treppe hinunter. Das Holz war inzwischen schon reichlich morsch geworden. Wenn man aber wusste, wo man hintreten musste, konnte man die Stufen fast lautlos überwinden. Genaugenommen war dies sogar eines ihrer besten Warnsysteme. Die Geräusche eben schienen allerdings eher aus dem Untergeschoss gekommen zu sein, vielleicht sogar aus dem Keller. Innerlich ärgerte Yula sich, dass sie die Kellerfenster aus reiner Faulheit noch immer nicht weiter verstärkt hatte. Nach einem Einbruch vor einiger Zeit hatte sie die Spuren nur notdürftig geflickt und sich seitdem um eine größere Aktion gedrückt. Wie nachlässig das war! Ihr Nachbar und bester Freund Gin hatte ihr sogar einige Metallstangen zum Verstärken angeboten.
Inzwischen war sie im Erdgeschoss angekommen und horchte. Erst hörte sie gar nichts, doch dann nahm sie ganz leise ein scharrendes Geräusch unter sich wahr. Es klang, als würde jemand oder etwas über den alten Fußboden im Keller robben. Einige Härchen in ihrem Nacken und an den Armen stellten sich auf. Sollte sie darauf hoffen, dass das, was auch immer sich da unten aufhielt, von alleine aus dem Keller verschwand, nur die Kellertür bewachen und sich für den Notfall bereithalten? Oder sollte sie lieber hinabsteigen und die Sache selbst in die Hand nehmen? Was, wenn da nicht nur einer war? Dann wäre es genauso schlecht, einfach zu warten. Yula entschied sich wie so oft für den Angriff als beste Verteidigung, schob fast lautlos den Riegel zur Kellertür beiseite und steckte den Kopf in das Loch, das noch schwärzer wirkte als der Rest ihrer Umgebung. Die Treppe nach unten war aus Stein, und die kahlen Stufen kamen ihren nackten Füßen heute Nacht besonders kalt vor. Seit dem letzten Scharren war nichts mehr zu hören gewesen. Sie entschied sich, zunächst nach links zu gehen. Groß war der Keller ohnehin nicht. Es gab einen Bereich, in dem früher die Vorräte gestanden, und einen auf der anderen Seite, den ihre Mutter als Waschraum genutzt hatte. Dort befanden sich auch die beiden Fenster. Obwohl Yula nichts hörte, spürte sie eindeutig eine Präsenz hier unten. Inzwischen konnte sie gut zwischen Einbildung und realer Bedrohung unterscheiden, und hier war definitiv jemand mit ihr im Raum. Jemand oder etwas. Nicht jedoch auf der linken Seite. Mit dem Baseballschläger im Anschlag und immer bereit, sofort fest zuzuschlagen, wechselte sie nun die Seite, als plötzlich etwas nach ihren Haaren griff. Sie schrie auf, wirbelte herum, ließ ihrem Angreifer den Holzschläger entgegenfliegen und traf. Die Finger ließen ihre Haare los, ein unheimliches Stöhnen war zu hören, und dann war alles still.
Wie angewurzelt blieb Yula stehen und traf eine Entscheidung. Sie hatte gelernt, in einer unsicheren Situation niemals Licht zu machen. Jetzt jedoch spürte sie keine Gefahr mehr. Sie tastete nach den kleinen, selbstgebauten Fackeln und dem Sturmfeuerzeug, das ihr ein freundlicher alter Herr am Ende der Straße regelmäßig befüllte oder reparierte. Die Flamme loderte hell und blendete sie. In einem solchen Moment konnte ein Angreifer die Verwirrung ausnutzen und sich einen Vorteil verschaffen. Doch nichts geschah. Als sich ihre Augen an die Helligkeit gewöhnt hatten, blickte sie zu Boden. Was da vor ihr lag, konnte unmöglich ein Mensch sein. Und wenn doch, dann war dieser auf eine Art deformiert, wie sie es noch nie gesehen hatte. Sie schnappte nach Luft, trat einmal gegen das Bündel vor ihren Füßen, und als es sich nicht regte, rannte sie leichenblass die Treppe hinauf und öffnete alle Schlösser an der Haustür.
Auf der Straße war es menschenleer. Sie legte die letzten Meter bis zu ihrem Ziel zurück und klopfte an die Tür des Hauses nebenan. Als nichts passierte, hämmerte sie so laut, wie sie nur konnte, gegen das spröde Holz und begann zu weinen. Erst jetzt fiel ihr ein, dass sie das Codewort vergessen hatte. »Alice«, jammerte sie. »Alice!«
»Ich komm ja schon, ich komm ja schon«, hörte sie von drinnen die vertraute Stimme.
Als die Tür sich öffnete, sank sie in die Arme ihres guten Freundes. Dieser sagte zuerst nichts, zog sie aber vorsichtshalber hinein, schloss die Tür und wartete, bis seine Nachbarin die Fassung ein wenig wiedergefunden hatte.
»Was ist los, Kleine?«
»Er ist tot«, platzte es aus ihr heraus.
»Wer ist tot?«, fragte Gin.
Wortlos löste sie sich aus seiner Umarmung und zog ihn mit sich.
»Wir sollten nicht mehr rausgehen. Es ist mitten in der Nacht. Du kannst gerne hierbleiben.«
»Nein! Ein Toter liegt in meinem Haus. Ich muss ihn wegschaffen!«, jammerte Yula.
Gin erkannte, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt für lange Diskussionen war. Er griff nach einer Waffe und folgte ihr über den Gehweg bis zu ihrem Haus. In der Eile hatte sie die Tür nicht geschlossen.
»Meinst du, es ist noch jemand drin ...?«, fragte sie wie erstarrt.
»Außer deinem angeblich toten Freund?«, entgegnete Gin. »Sicher nicht. Heute Nacht ist es eher ruhig.« Er zog die Tür ins Schloss, sicherte sie, blieb aber dennoch in Alarmbereitschaft. So ganz traute er seinem eigenen Optimismus offenbar doch nicht. »Also, wo ist der Kerl?«
»Eigentlich weiß ich nicht, was er ist. Ich glaube, es ist ein Schatten.«
Gins Gesicht wurde aschfahl. »Du sagst, du hast einen Schatten getötet, und der liegt jetzt hier in deinem Haus?«
Schweigend nahm Yula seine Hand und führte ihn die Stufen zum Keller hinunter. Unten bot sich den beiden ein grauenhaftes Bild. Wenn die Regierung recht hatte und es sich bei den Schatten nur um Süchtige handelte, die an den Folgen zu hohen Konsums verschnittener Drogen litten, waren die Auswirkungen mehr als bizarr. Das Wesen besaß zwar je zwei Beine und Arme; der restliche Körperbau hatte aber nichts Menschliches an sich. Das Gesicht bestand aus einer glatten Fläche ohne erkennbare Öffnungen. Es gab weder Augen noch Nase oder Mund. Dafür konnte man mehrere Schlitze und Erhebungen verschiedener Größe erkennen. Zusammen mit dem dürren Körperbau, den langen Gliedmaßen und den fehlenden Haaren sah dieses Individuum definitiv nicht wie ein Drogensüchtiger aus.
»Das ist nicht das, was der Kanzler uns immer erzählt. Ich habe zwar keine Sekunde an die Sache mit den Drogen geglaubt, aber das toppt wirklich alles«, sagte Gin fast belustigt.
»Denkst du, die Geschichten sind wahr?«, fragte Yula.
»Du meinst, ob das hier ein Außerirdischer ist?« Seine Freundin schwieg.
»Ich kann mir vieles vorstellen, Kleine. Aber lass uns für den Moment keine voreiligen Schlüsse ziehen, sondern erstmal etwas gegen unser Problem unternehmen. Ich habe eine Wanne, in der wir das Ding mit einem Gemisch aus Salzsäure und anderen Chemikalien auflösen können. Das sollte funktionieren, zumindest, wenn es halbwegs so beschaffen ist, wie wir.«
Yula riss die Augen auf. Sicher, sie hatte schon viele furchtbare Dinge gesehen und getan. Gins emotionsloser Vorschlag versetzte ihr aber einen Stich. Dennoch wagte sie nicht zu widersprechen. Ihr Freund holte einige große Decken hervor, in denen sie den Leichnam in seinen Keller beförderten. Yula selbst nahm die folgenden Stunden nur wie durch einen Schleier wahr. Sie folgte Gins Anweisungen und kam erst wieder ein wenig zur Besinnung, als er ihr erklärte, dass sich einige Teile der Kreatur nicht so gut auflösten wie erhofft. Er stopfte die Reste in einen Sack und spülte danach die Wanne. Yula kam das Ganze sehr fachmännisch vor, und sie wusste nicht, ob ihr der Gedanke gefiel. Danach reparierten die beiden noch das eingeschlagene Kellerfenster in ihrem Haus und schraubten zwei Eisenstangen davor. Gin versprach, in den nächsten Tagen alles noch einmal gründlich fest zu verschweißen, damit ab jetzt niemand mehr ins Haus gelangen konnte. Diesmal war es wirklich verdammt knapp gewesen!
»Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Kann ich dir vielleicht irgendetwas Gutes tun?«, fragte sie.
»Wenn du irgendwo etwas Gin findest ...?«
Ihr Freund hatte seinen Namen nicht ohne Grund erhalten. Für einen Tropfen dieser ekligen Brühe würde er glatt seine Mutter verraten. Hoffentlich bot ihm nie jemand eine Flasche im Tausch für die Wahrheit über die heutige Nacht an. Ihre Miene verfinsterte sich. So sehr man sich auch an liebe Weggefährten gewöhnen wollte, konnte man letztlich niemandem trauen. Ihrer Mutter war es sehr wichtig gewesen, diese Lektion ganz fest in ihrem Hirn zu verankern. Dazu hatte sie oft erzählt, wie Hajo, der beste Freund ihres Vaters, einst alle Besitztümer der Familie mitgenommen hatte, um für einen Transfer in die Habitatzone nach Ost-Berlin zu sorgen. Nach Stunden der Ungewissheit, ersten Zweifeln und Tagen der nagenden Vorahnungen hatten ihre Eltern die Wahrheit dann akzeptieren müssen: Der Jugendfreund des Vaters hatte das Vertrauen der Familie missbraucht und war dem Elend ihrer Existenz allein entflohen. Yula selbst war damals noch sehr klein gewesen und hatte die Sache erst viel später richtig verstanden. Dennoch: Gin wollte sie wirklich vertrauen. Er hatte nie irgendetwas anderes gefordert als ihre Freundschaft und ihr mehr als einmal aus der Patsche geholfen. Solange es Menschen wie ihn gab, bestand auch Hoffnung. Für den Moment war Yula erst einmal wieder sicher. Doch ihr war auch klar, dass sich bald etwas würde ändern müssen. Nur was?
Gin nahm sie noch einmal lange in den Arm; dann verabschiedeten sich die beiden. Als Yula kurz darauf in ihrem Bett lag, war von der Nacht nicht mehr viel übrig. Ihren Termin am nächsten Morgen durfte sie aber auf keinen Fall verpassen.
Hoffnung
Natürlich hatte Yula nicht verschlafen. Genaugenommen hatte sie gar nicht mehr geschlafen. Obwohl der heutige Termin nichts an ihrem Leben würde ändern können, musste sie ihn wahrnehmen; lieber früher als später. Mit jedem Jahr wurde die Zeitspanne, in der es überhaupt noch halbwegs hell wurde, kürzer. Und in dieser Jahreszeit war es am schlimmsten. In wenigen Stunden wäre es schon wieder Nacht, und Yula wollte gerne im Hellen zu Hause sein.
Es war Dienstag und empfindlich kalt. Damals hatte man diese Jahreszeit als Winter bezeichnet. Seit die Welt jedoch dauerhaft aus Schnee, grauen Wolken und Stürmen bestand, waren derartige Begrifflichkeiten nach und nach verlorengegangen. Yulas Gedanken schweiften ab. Manchmal hörte man Geschichten, dass es noch Flecke auf der Erde gab, wo das Wetter nicht so verrückt spielte. Die meiste Zeit nahm sie allerdings an, dass es sich dabei nur um den verzweifelten Versuch handelte, Hoffnung am Leben zu halten. Ihre Mutter hatte ihr mehr als deutlich gemacht, wie es seit vielen Jahrzehnten auf allen Kontinenten aussah. Über neunzig Prozent der Erde gehörten inzwischen zu den dunklen Zonen. In ihnen lebten, oder eher vegetierten, diejenigen vor sich hin, denen die Schatten noch nichts anhaben konnten, die sich Überfällen, Vergewaltigungen, Gewalt und der Willkür der Eingreiftruppen widersetzten oder die einfach nur aufgegeben hatten und auf den Straßen lebten. Die Welt war zu einem riesigen, dreckigen, albtraumhaften Ghetto verkommen. Was die restlichen zehn Prozent anging, hatten die Reichsten der Reichen dort ihre Paradiese gebaut.
In vielen einst blühenden Städten gab es die sogenannten Habitatzonen. Diese hellen, leuchtenden Kuppeln aus einer Legierung, deren Namen niemand aussprechen konnte, hielten nicht nur die gefilterte Luft im Innern, sondern sorgten sogar für Wärme und verhinderten das Eindringen von Bewohnern der dunklen Zonen. Zwar waren alle Habitatzonen großräumig eingezäunt und wurden streng bewacht, wenn man jedoch in deren Nähe kam, wirkte es den Erzählungen nach wie der Blick in eine fremde Welt. Yula hatte sich allerdings noch nie so nah herangetraut. All die schönen und erstrebenswerten Dinge lagen hinter einer Art Glasscheibe und strahlten wie im Sonnenlicht. In den Habitatzonen war es sauber, ordentlich, organisiert und kultiviert. Angeblich war die ganze Welt einst so gewesen. Das Ganze klang unvorstellbar. Yula kannte nur die Zeit des postnuklearen Schreckens; und die Kälte war ein fester Bestandteil ihres Lebens geworden. Sie zog sich den Kragen ihres abgetragenen Mantels ins Gesicht und bibberte. Zwischen der dicken Wollmütze und dem Schal leuchteten ihre klaren, blauen Augen wie Bergseen.
Nicht nur wegen der beißenden Temperaturen gehörte der Weg zum Center für Integration und Transfer, kurz CIT, zu den unerfreulichsten Aufgaben. Die Idee dahinter war dabei nicht das eigentliche Problem: Menschen aus den dunklen Zonen sollten die Möglichkeit erhalten, sich um einen Platz auf der Warteliste für den Transfer in die Habitatzonen zu bewerben. Dass es fast unmöglich war, auf diese Liste zu gelangen, die zudem so lang wie die Spree war, wurde dabei gerne unter den Teppich gekehrt. Dennoch zwang das Center jeden registrierten Bewohner der dunklen Zonen dazu, zwölfmal im Jahr einen Antrag einzureichen und persönlich im CIT zu erscheinen. Der eine von zwei wichtigen Gründen war, dass man ohne diesen Termin kein Anrecht auf das monatliche Hilfspaket besaß. Dieses durfte man sich immer pünktlich zur Monatsmitte im Charlottenburger Schloss ganz in der Nähe abholen. Früher war das ein prunkvoller und historisch wichtiger Bau mit einer bewegten Geschichte gewesen. Heute lebten dort die Ärmsten der Armen in einer Art riesiger Notunterkunft. Nur mit einem Stempel vom CIT konnte man das Hilfspaket im Verteilzentrum abholen. Es beinhaltete Milchpulver, einen Code für das Wasserreservoir, Trockenwurst und einige andere Dinge. Damit war es zwar fast unmöglich, über den ganzen Monat zu kommen, doch waren die Hilfspakete die einzige Chance, Plünderungen und Überfälle in Zaum zu halten. Woher sollte die Nahrung sonst auch kommen? Es wuchs nichts mehr, es gab keine offiziellen Geschäfte, und jeder kämpfte für sich allein ums Überleben. Doch gab es auch noch einen zweiten Grund, dem CIT den regelmäßigen Besuch abzustatten.
Auf Nichteinhaltung der Termine stand nämlich Arrest im ehemaligen Königlichen Untersuchungsgefängnis und der späteren Justizvollzugsanstalt im Stadtteil Moabit. Heute nannte man das Ganze – nicht vollkommen ironiefrei – Integrationslager. Integration war eines der wichtigsten Worte der aktuellen Regierung. Immer wollte man irgendwelche Menschen integrieren oder ihnen ein besseres Leben ermöglichen. Die Wahrheit sah jedoch anders aus: Es passierte nichts. Schöne Worte ohne Konsequenzen waren schon während Yulas ganzen Lebens das Markenzeichen des Kanzlers gewesen. Abgewählt wurde der aber nie. Kein Kunststück, da ohnehin nur noch die Bewohner der Habitatzonen zur Wahl gerufen wurden. Yula hatte einmal in einem Buch etwas über politische Systeme der Vergangenheit gelesen. Seitdem fragte sie sich oft, wie die Union, und somit Deutschland oder generell Europa, von den damals mehrheitlich demokratisch und humanitär geprägten Systemen zu dieser fast schon absurd-offensichtlichen Ungleichbehandlung von Menschen übergegangen war. Dabei ging es doch um Menschen, die einfach nur überleben wollten!
So waren die Integrationslager dann auch genau genommen simple Gefängnisse mit höchster Sicherheitsstufe. Während man dort immerhin etwas zu Essen bekam, sprach die hohe Gewaltbereitschaft der Insassen und Wärter aber eindeutig gegen einen Aufenthalt. Auch trennte man seit einigen Jahren Frauen und Männer nicht mehr voneinander, nachdem der Kanzler weitere Gelder gestrichen und die Gleichberechtigung der Frauen auch in diesem Bereich durchgesetzt hatte. Eines musste man ihm angesichts solcher Entscheidungen lassen: Der Mann besaß definitiv Humor, auch wenn einem das Lachen meist im Halse steckenblieb. Vergewaltigungen waren in den Integrationslagern seitdem nicht nur an der Tagesordnung, sondern sogar zu einer Art Sport geworden, bei dem die Wärter um hohe Summen wetteten, wer sich wem wie lange würde entziehen können. Nein, dann lieber einmal im Monat die immer gleichen Fragen beantworten. Positiv betrachtet, gab es dazu jedes Mal eine warme – wenn auch undefinierbare – Suppe und süßen Tee.
Als Yula sich mit ihrer Familie erstmals hatte vorstellen müssen, war ihr die Ausweglosigkeit der ganzen Angelegenheit noch nicht bewusst gewesen. Man hatte allen Implantate eingepflanzt und große Versprechungen gemacht. Damals träumte sie noch davon, mit ihren Eltern und ihrer Schwester Tara auf grünen Wiesen zu spielen, in Supermärkten einzukaufen, Licht und fließendes Wasser im Haus zu haben und vielleicht doch wieder eine Schule zu besuchen. Ihre war vor acht Jahren geschlossen worden, einen Monat vor dem ersten Besuch im CIT. Das war der Punkt gewesen, an dem die Lage langsam immer verzweifelter geworden und die Hoffnung geschwunden war, dass sich an den Lebensbedingungen noch etwas gravierend verbessern würde. Im Gegenteil: Die Umweltbedingungen wurden immer schlimmer, und nach und nach hörte das öffentliche Leben auf zu existieren. Vierundneunzig Mal war Yula seit diesem Tag im CIT gewesen, hatte den Tee getrunken, die Suppe gegessen und die Fragen beantwortet. Wir melden uns, vielen Dank, hatte man vierundneunzig Mal zu ihr gesagt. Passiert war allerdings nie etwas. Die letzten fünfunddreißig Male war sie allein im ehemaligen Bundeskanzleramt am Spreebogenpark gewesen. Mit dem Bau der Habitatzone war die Regierung nach Ost-Berlin umgezogen und nutzte die alten Gebäude im Westen zu anderen Zwecken – zumindest jene, die noch nicht einsturzgefährdet waren, seit die seismische Aktivität immer weiter zugenommen hatte.
Wenn sie ehrlich war, hasste Yula die sinnlosen Besuche im CIT. Inzwischen wäre es ihr fast lieber, zu all den namenlosen, vergessenen Menschen zu gehören, die des Nachts die Straßen bevölkerten und sich dem strengen Blick der Eingreiftruppen entzogen. Gin zum Beispiel lief schon seit sieben Jahren unter dem Radar. Sollte man ihn jemals mit abgelaufenem Implantat bei einer Kontrolle erwischen, würde er aus Moabit bis zu seinem Lebensende nicht mehr herauskommen.
Yula hatte die Richard-Wagner-Straße inzwischen verlassen. In dieser befand sich ihr Haus. Es hatte schon immer ihrer Familie gehört; heute fragte jedoch niemand mehr danach. Man konnte seinen Besitz nur auf eigene Faust verteidigen. Die Eingreiftruppe, die man früher als Polizei bezeichnet hatte, war zwar grundsätzlich dazu aufgerufen, die Ordnung aufrechtzuerhalten, gefiel sich die meiste Zeit aber nur darin, die ohnehin leidenden Bewohner zu schikanieren. Lust, sich zwischen die Fronten der rivalisierenden Gangs zu begeben, hatte niemand. Angesichts der schlechten Bezahlung verwunderte Yula das allerdings auch nicht. Man machte besser einen Bogen um sie.
Nach einer schier endlosen Allee sah sie den Ernst-Reuter-Platz, an dem manchmal – hier brauchte man jedoch viel Glück – ein Auto vorbeikam. Per Anhalter zu fahren war zwar ähnlich selbstmörderisch wie nachts aus dem Haus zu gehen, doch auf Dauer waren die langen Fußmärsche durch die Stadt auch ermüdend. Kaum jemand besaß mehr ein Auto, Benzin wurde als Tauschobjekt teuer gehandelt, und die Regierung gab nur selten kleine Mengen für die dunklen Zonen frei.
Heute war hier niemand zu sehen. Typisch. Yula setzte sich auf einen Hydranten und war bereit zu pokern. Sie wartete eine ganze Weile und beobachtete ein paar Raben, die in den überfüllten Mülltonnen nach Essbarem suchten. Man konnte der Regierung sicher viel vorwerfen, aber die Müllentsorgung hielten sie noch aufrecht. Unregelmäßig zwar, aber irgendwann waren die Tonnen plötzlich wieder leer. Dafür stank die Deponie aber auch bei jeder Windrichtung und schickte wabernde Schwaden durch die Straßen. Dass man den kompletten Bereich rund um das ehemalige Olympiastadion dafür verwendet hatte, amüsierte Yula immer wieder. Ihr Vater hatte einmal gesagt, es sei die gerechte Strafe für die Mannschaft, die dort zuletzt gespielt hatte und abgestiegen war, bevor man mit dem Profifußball in Deutschland komplett aufgehört hatte. Das war auch schon mehr als fünfzehn Jahre her.
Aus Richtung Hardenbergstraße näherte sich ein Auto. Nun gut, es besaß vier Räder, hatte die Form eines Automobils, war ansonsten jedoch weit davon entfernt, noch als Schmuckstück durchzugehen. Alle Scheiben zierten geklebte Risse, die Heckscheibe fehlte gänzlich. Zwischen Schrammen, Dellen und Rost konnte man hier und da so etwas wie grüne Farbe erkennen. Auf die Motorhaube hatte jemand das Wort STIRB gesprayt. Am Steuer saß ein alter Mann. Wobei alt eigentlich kein Ausdruck war. Yula schätze den Fahrer auf über neunzig. Langsam parkte er sein Fahrzeug, kletterte heraus und kam auf einen Stock gestützt zu ihr herüber.
»Was zur Hölle machst du hier so allein, Kind?«, krächzte er.
»Ich muss zum CIT. Können Sie mich mitnehmen?«
Der Alte kicherte. »Zum CIT musst du, junges Ding. Ich weiß zwar nicht, ob ich den Weg noch kenne, aber das kriegen wir schon hin. Wenn das Benzin reicht.« Ohne ein weiteres Wort hinkte er davon.
Wenn man das achtzigste Lebensjahr erreicht hatte, musste man sich nicht mehr monatlich um einen Platz auf der Warteliste bewerben. Dann nahm man automatisch an einer regelmäßigen Ernennungslotterie teil. Auf diese Weise wolle man verdienten älteren Mitbürgern einen schönen Lebensabend ermöglichen, so der Kanzler. Es war vermutlich reiner Zufall, dass Yula niemanden kannte, dem diese Ehre je zuteilgeworden war. Einmal war Kurt, ein Nachbar, plötzlich verschwunden, und man erzählte von seinem Glück und dem Transfer in die Habitatzone. Er sollte im Ortsteil Pankow, der sehr beliebt und begehrt war, ein kleines Haus mit Garten erhalten haben. Gin allerdings behauptete einige Wochen später, dass er Kurts Leiche auf der Müllkippe gesehen habe – weggeworfen wie einen alten Wäschesack. Sie schüttelte sich bei der Erinnerung.
Als der Alte sein Auto fast wieder erreicht hatte, drehte er sich ruckartig um. »Willst du hier Wurzeln schlagen? Gleich bin ich weg!«
Yula musste sich entscheiden. Gefährlich werden konnte der Greis ihr vermutlich nicht. Für den Notfall hatte sie immer noch ein Messer in ihrer Manteltasche. Aber das würde sie sicher nicht brauchen. Sie sprang auf, rannte zum Auto des Mannes hinüber und stieg ein.
»Hast du KACK?«, fragte der Mann plötzlich. Yula schüttelte den Kopf, als er sich zu ihr umdrehte. KACK stand für irgendwas mit Calcium, Kohlenstoff und Kalium und war die begehrteste Droge auf den Straßen. Eigentlich war die Schreibweise wohl CaCK, aber die andere Variante hatte sich irgendwann durchgesetzt. Dass man im Namen nur vollkommen unverfängliche und harmlose Bestandteile aufzählte und den Rest geheim hielt, war sicher nur Zufall. In ihrer reinsten Form war die Droge vollkommen harmlos, machte nicht süchtig und barg keine gesundheitlichen Risiken. Ihr einziger Zweck war es, dem Alltag für einige Stunden zu entfliehen. Außerdem wurde sie im medizinischen Bereich eingesetzt. Da man KACK in den dunklen Zonen inzwischen jedoch oft nur in verschnittener Form vorfand, wurde jede Einnahme zum Russisch Roulette. Je schlechter die Qualität, desto schneller wurde man davon abhängig und starb.
Yula hatte bisher nie dem Drang nachgegeben, ihrem Alltag und der immer gleichen Routine aus dem Absuchen von Mülltonnen und Verteidigen ihres Zuhauses durch irgendwelche Substanzen entfliehen zu wollen. Gin hingegen war regelmäßig stundenlang nicht ansprechbar. Er mischte fast täglich Alkohol, KACK und andere Drogen zu einem wilden Cocktail und spielte jedes Mal mit seinem Leben. Einmal musste Yula ihn im völligen Delirium von der Straße holen, kurz bevor ihn eine Eingreiftruppe erwischt hätte. Manchmal hasste sie ihren besten Freund dafür. Warum es bei der anhaltenden Ressourcenknappheit an Lebensmitteln, Strom und medizinischer Versorgung mangelte, Drogen aber dauerhaft verfügbar waren, konnte er ihr allerdings auch nicht erklären.
Der Alte riss sie aus ihren Gedanken. »Wenn du KACK hast und mir nichts abgibst, ist das nicht nett. Ein hübsches Mädchen wie du hat doch sicher einiges zu bieten.« Er lachte unangenehm dreckig.
»Ich nehme keine Drogen«, erwiderte Yula knapp.
»Schade, schade, wirklich schade.«
Als der Alte an der Siegessäule rechts abbog, zuckte Yula zusammen.
»Nur ein kleiner Umweg«, murmelte der Fahrer.
»Es ist nicht nötig, dass Sie mich weiter mitnehmen. Ich gehe den Rest der Strecke zu Fuß«, sagte sie schnell. Doch der Mann ging nicht darauf ein, sondern gab Gas. Als sie die Hand des Alten in ihrem Schritt spürte, tastete Yula nach dem Türöffner. Er rührte sich nicht. Ekel kroch in ihr hoch.
»Lassen Sie mich gehen«, brachte sie atemlos hervor. Sie versuchte, die verschrumpelten Finger von sich wegzudrücken, hatte die Kraft des Mannes allerdings unterschätzt.
»Du bleibst, wo du bist«, sagte der nun in erschreckend gefasstem Tonfall.
Yula wusste genau, dass man niemandem trauen konnte, dass niemand war, was er zu sein schien. Und trotzdem war sie auf den vermeintlichen Greis hereingefallen. Ihr Verstand suchte nach einem Ausweg, während ihr Herz fast aufhörte zu schlagen.
Das Auto hatte inzwischen die Tiergartenstraße erreicht und nahm immer noch an Fahrt auf. Yula reagierte schnell. Sie zog ihr Messer hervor, rammte es dem Mann in die Brust, löste seine Hand aus ihrem Schritt und schlug auf die ohnehin gerissene Scheibe ein. Das Glas gab nach und splitterte; Yula warf sich in voller Fahrt irgendwie über die verbliebenen Scherben hinaus und landete in einem Haufen aus Altkleidern. Der Wagen des Alten schleuderte wild hin und her und krachte mit voller Wucht gegen eine Hauswand. Yula verharrte. Alles an ihr schmerzte. Sie wollte weglaufen, konnte ihre Augen jedoch nicht von dem Fahrzeugwrack abwenden. Konnte der Mann überlebt haben? Noch bevor sie zu einer Entscheidung gelangt war, schwang die Fahrertür auf, und ein Bein wurde sichtbar. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen, ignorierte das Pochen in ihren Beinen und Armen sowie das Donnern im Kopf und rannte los. Sie wusste, dass sie ganz in der Nähe des Potsdamer Platzes war. Dort hatte es vor Jahren eine Sanitätsstation gegeben. Doch war die nicht geschlossen worden? Egal. Ohne sich umzublicken, rannte sie die Straßen entlang, ignorierte die obszönen Rufe einiger Männer, die vor einer Bar standen, und erreichte schließlich das Haus mit dem roten Kreuz an der Wand. Der Alte war nirgendwo zu sehen. Auf dem Schild vor dem Haus standen die Öffnungszeiten, waren allerdings mehrfach überklebt, wieder abgerissen und übermalt worden. Derartige Sanitätsstationen hatte es noch vor einigen Jahren überall in West-Berlin gegeben. Eine nach der anderen war dann aber geschlossen worden. Der Kanzler hatte davon gesprochen, dass man sie zu Kompetenzzentren zusammenlegen würde. Da mit der Schließung der einen jedoch auch immer ein Personalabbau der anderen einherging, konnte sich jeder seinen Teil denken. Überhaupt war die wichtigste Aufgabe der Stationen heute nur noch das Versorgen der Süchtigen mit Stoff. Seit die Regierung gelegentlich medizinisches KACK verteilte, konzentrierten sich Übergriffe durch Banden oder anderes Gesindel wenigstens nur noch auf Lebensmittel und Wertgegenstände zum Tauschen. Für Drogen reichte der Besuch beim Roten Kreuz.
Die Tür knarrte, als Yula sie vorsichtig aufstieß. Im Wartebereich roch es nach alten Linoleumböden, Desinfektionsmittel und Sternanis. Diese Zutat überlagerte den stechenden Geruch von verschnittenem KACK und war ein untrügliches Zeichen dafür, dass inzwischen nicht einmal mehr die Regierung die hochwertige Version der Droge an die Bedürftigen ausgab. Mit der Einnahme des puren Stoffes bestand zumindest eine Chance, die Sucht zu besiegen. Aufrichtig helfen wollte aber offenbar inzwischen niemand mehr. Auf der Bank vor dem Behandlungsraum saß eine Frau, die entweder schlief oder tot war. Die zweite Option war zwar eine furchtbare Vorstellung, angesichts ihrer Gesichtsfarbe und des strengen Geruches aber nicht ganz von der Hand zu weisen. Yula machte einen Bogen um sie und klopfte an die Tür. Zunächst passierte nichts. Dann sprang die Frau plötzlich auf und sah sie fassungslos an. »Was fällt dir ein, hier so einen Radau zu machen? Wer bist du eigentlich?«
»Mein Name ist Yula, und ich habe mich verletzt. Ich brauche Ihre Hilfe.«
»Yula? Ein merkwürdiger Name für einen Jungen«, lallte die Frau und wäre beinahe wieder auf ihren Stuhl zurück gesackt.
»Ich bin kein ...«, setzte sie an, drang aber nicht zu ihrem Gegenüber durch. Langsam setzte sich das Puzzle zusammen. Die Mittvierzigerin, die ungewaschen und mit wilden Haaren vor ihr stand, trug einen ausgewaschenen Kittel mit einem Namensschild: Dr. Richter.
»Wir haben schon längst geschlossen. Was zur Hölle willst du hier?«, krächzte die Frau mit bleierner Zunge und schwankte. Nun verstand Yula auch den Grund für den strengen Geruch: Dr. Richter war offensichtlich vollkommen betrunken.
»Ich wurde angegriffen und habe mich bei der Flucht verletzt. Meine Schulter tut weh, und ich blute am Bauch.«
»Angegriffen? Soso.« Die Frau wollte in ihr Behandlungszimmer gehen, fiel dabei aber fast auf ihre Patientin. Der starke Geruch nach billigem Hochprozentigem verschlug Yula fast den Atem. Einen Moment lang war sie unsicher, ob sie überhaupt bleiben sollte. Doch dann stützte sie die Ärztin bis in den kargen Raum, der außer einer Liege, einer flackernden Deckenlampe und einem Medikamentenschrank nichts zu bieten hatte. Yula legte sich auf die Liege und wartete, bis sich ihre potenzielle Retterin ein wenig sortiert hatte.
»Du musst entschuldigen«, sagte die schließlich. »Wir haben nur morgens geöffnet, und wenn ich Feierabend habe, trinke ich gerne mal einen Schluck oder zwei.«
»Können Sie mir helfen?« Yula wollte es nicht auf eine zu lange Unterhaltung anlegen.
»Dafür bin ich ja da. Und weil du so ein netter Junge bist, sogar zu dieser unmenschlichen Uhrzeit.« Sie torkelte in eine Ecke, in der früher vielleicht ein Schreibtisch gestanden hatte, wankte dann aber irritiert zurück zur Liege und begann umständlich, Yulas Schulter und Bauch abzutasten.
»So ein hübscher Junge und so eine alte Schachtel, was?«, kicherte sie.
Yula widersprach nicht. Ihr Vater hatte ihr beigebracht, in solchen Situationen an etwas Schönes aus der Vergangenheit zu denken. Also verließ sie diesen Ort und flüchtete in ihren Gedankenpalast. Das war der einzige Ort, an dem sie ihren Vater, ihre Mutter und ihre Schwester Tara noch treffen konnte. Lachend jagten die beiden Mädchen den Teufelsberg hinunter. Die Schlitten hatte ihr Vater selbst gebaut. Er stand oben am Hang, hielt ihre Mutter im Arm und grinste breit. Wenn schon fast immer nur Schnee lag, müsse man auch etwas damit anfangen, hatte er immer gesagt.
Ein stechender Schmerz riss sie zurück in die Realität. Linoleum, Desinfektionsmittel, Sternanis und billiger Fusel. Yula vermisste ihren Vater sehr, seit er vor zehn Jahren verschwunden war. Ihre Mutter hatte seinen Verlust nie verkraftet und kaum mehr von ihm gesprochen. Verdammt, wenn ihre Schulter doch nur aufhören würde zu brennen! »Entschuldige, mein Junge. Der Pieks musste sein. Du sollst ja wieder fit werden, was?«
Yula rieb sich die schmerzende Stelle. Dr. Richter plapperte einfach weiter. »Ich habe gestern am helllichten Tag eine Gruppe Schatten gesehen. Bin froh, dass ich mit dem Leben davongekommen bin.«
»Ja, es werden täglich mehr. Aber bisher sind mir bei Tageslicht noch keine begegnet«, murmelte Yula nachdenklich.
»Sei froh!«
Der Kanzler sagte bei jeder Gelegenheit, dass es keine Schatten gäbe es sich nur um Drogensüchtige handelte, die man ausmerzen müsse. Seit letzter Nacht wusste Yula es aber besser. Schaudernd erinnerte sie sich an die Leiche, die sie mit Gin entsorgt hatte.
»So, das war´s«, trällerte die Ärztin. Inzwischen schien sie fast wieder so etwas wie zurechnungsfähig zu sein.
»Danke«, entgegnete ihre Patientin knapp.
Die Frau zündete sich einen Stack an. Meist handelte es sich dabei um einen wilden Mix aus verschiedenen Drogen, Tabak und Kräutern, die man der Einfachheit halber in einen Geldschein drehte. Seit die Währung endgültig zusammengebrochen war, flog das ehemalige Zahlungsmittel in den Straßen umher. »Hier, nimm auch einen. Du kannst ihn sicher brauchen, wenn das Schmerzmittel nachlässt«, sagte Dr. Richter.
Yula zögerte einen Moment, griff dann aber zu. Was auch immer sie da für eine Wundertüte in der Hand hielt, war in einen 100.000-Euro-Schein gewickelt worden, der violett schimmerte. Wie auf jedem anderen Schein prangte auch darauf das unangenehme Lächeln des Kanzlers.
»Und pass auf dich auf, Junge. Die Stadt geht zum Teufel, und du bist zu nett, um draufzugehen.«
Die junge Frau nickte und war einen Moment später draußen an der Luft. Die Dunkelheit begann tatsächlich schon wieder, sich durch die Stadt zu fressen. Wie lange war sie bloß in der Sanitätsstation gewesen? Hatte sie das Bewusstsein verloren? Da man bereits seit Jahren auf jegliche Beleuchtung verzichtete, würde es schon bald stockfinster sein. Nur die Kuppel dort drüben im Osten der Stadt begann nun, ihr kühles Licht zu spenden wie ein zweiter Mond.
Yula stapfte los. Sie passierte ein Gebäude, das früher ein sogenanntes Kino gewesen war. Sie hatte jedoch nie einen Kinofilm gesehen. Ihre Eltern erzählten allerdings oft davon, wie man noch vor zwanzig Jahren in den Lichtspielhäusern bei Popcorn und Cola in bequemen Sesseln spannende Abenteuerfilme oder Liebeskomödien verfolgt hatte. Oft hatten ihr diese Geschichten aus der Vergangenheit geholfen, an eine bessere Zukunft zu glauben. Seit ihre Eltern und ihre Schwester weg waren, machte die Erinnerung sie aber nur noch traurig.
Als sie ihr Ziel fast erreicht hatte, zuckte ein Blitz über den Himmel. Eine Raumfähre startete vom Weltraumbahnhof in Marzahn. Das passierte ungefähr zweimal pro Woche. In Marzahn hatte die Vereinigte Regierung Europas den einzigen Weltraumbahnhof der gesamten Union gebaut. Es gab noch einen in Russland, zwei in den USA und mindestens einen weiteren irgendwo anders auf der Welt. Yula wusste aber nicht, wo. Das Ziel war es, verschiedene Kolonien auf anderen Planeten zu errichten, damit auf lange Sicht die Überlebenden der Erde dorthin umziehen konnten. Die Ressourcenknappheit gefährdete irgendwann bestimmt auch die Habitatzonen, und niemand konnte sagen, wie lange diese noch ihren Dienst tun würden. In Sydney war die letzte vor zwei Jahren sogar vollständig ausgefallen. Seitdem lebte der komplette Kontinent in der Dunkelheit. Die einzige Kolonie im Weltraum, von der Yula wusste, war New Berlin auf dem Mond. Da ein Großteil des für den Bau nötigen Materials aus Marzahn geliefert worden war, hatte man Deutschland die Ehre der Namensgebung zugesprochen. Den Erzählungen zufolge war die dortige Basis jedoch in den letzten Jahrzehnten zu einem Tummelplatz für einflussreiche Gauner aus aller Welt geworden. In New Berlin gab es auch den einzigen Knotenpunkt für längere Weltraumreisen. Die Fähren aus Marzahn flogen die Mondbasis an, und von dort aus hatte man dann Anschluss an einen Transfer nach Kapteyn oder Gliese. Yula hatte allerdings nicht die geringste Ahnung, was diese Begriffe bedeuteten. Sie empfand schon eine Basis auf dem Mond als pure Science-Fiction, wie sie in den Büchern von Isaac Asimov oder Arthur C. Clarke zu finden war, die ihr Vater ihr als Kind vorgelesen hatte. Dass es zudem irgendwo Basen auf fremden Planeten geben sollte, würde sie erst glauben, wenn sie es selbst sehen könnte – also nie.
Sie dachte an ihre Mutter und Schwester und erinnerte sich an den Tag, als die Nachricht gekommen war, die alles verändert hatte. Das war schon so lange her. Es hatte geheißen, dass jemand in der Habitatzone zwei Transfertickets für ihre Familie bereithielt. Tara hatte sofort vermutet, dass es sich um ihren Vater handeln müsse; Yula wollte sich aber keine zu großen Hoffnungen machen. Nach der erfolgreichen Übersiedlung der ersten beiden Familienmitglieder würde man sich dann aus der Habitatzone um das dritte kümmern. Yulas Mutter musste wählen und entschied sich, die zierliche, ruhige Tara mitzunehmen, da sie ihrer älteren Tochter Yula eher zutraute, einige Tage allein in der dunklen Zone zurechtzukommen. Seit dem Tag, als beide im CIT verschwunden waren, um ihren Transfer zu beginnen, hatte sie nichts mehr von ihnen gehört oder gesehen. Drei Jahre wartete sie nun schon auf eine Nachricht. Dass etwas schiefgegangen war, stand außer Frage. Vielleicht waren die beiden schon seit diesem Tag nicht mehr am Leben. Gin hatte wochenlang die Mülldeponie abgesucht, jedoch keine Spur von ihnen gefunden.
Zunächst war Yula verzweifelt gewesen, dann wütend. Inzwischen versuchte sie nur noch, nicht mehr allzuviel darüber nachzudenken. Doch jetzt konnte sie die bohrenden Fragen einen Augenblick lang nicht mehr ignorieren. Ob die beiden noch in Ost-Berlin lebten? Oder hatten sie die Erde vielleicht verlassen? Yula merkte, dass sie spät dran war, und nahm die letzten fünfhundert Meter im Laufschritt. Sie hatte wahrlich nicht getrödelt, aber ihre Schmerzen behinderten sie stärker, als sie zugeben wollte; die Kälte biss sich außerdem mit jeder Minute mehr durch ihre löchrige Kleidung. Auch der Umweg und die Zeit bei Dr. Richter hatten ihren Plan vollkommen durcheinandergebracht. Als das Ziel in Sichtweite kam, verfinsterte sich ihr Gesicht, und sie blieb wie angewurzelt stehen.
Vor ihr schlossen sich gerade die Türen des Centers für Integration und Transfer. Drinnen schaltete jemand das Licht aus. Es war zu spät.