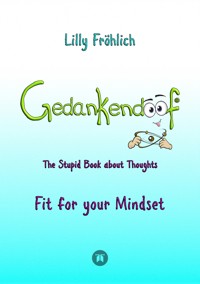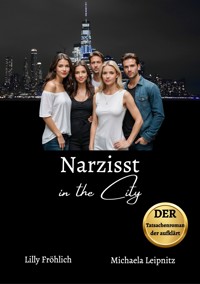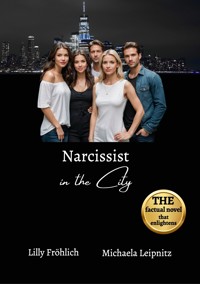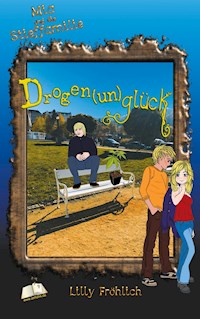Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Erde war einst ein Ort, an dem Menschen und Lichtwesen friedlich miteinander lebten. Doch eines Tages erklärte der machthungrige Zauberer Tarek Su Zabzarak den Krieg und tötete das gütige Herrscherpaar Lady Tizia und Lord Kodron. Dann stahl er den Elben das Lachen und die Musikinstrumente, so dass sie keine Menschen mehr heilen konnten. Zabzarak benötigte die menschlichen Seelen für sein Seelengewand, welches ihn als Halbmensch am Leben erhielt. Der Heilige Rat hatte dies kommen sehen und trennte die Menschen von den Lichtwesen durch den Schleier des Vergessens. Zabzarak krönte sich selbst und wurde zum Herrscher über Zaranien. Etwa tausend Jahre später half ein Junge namens Merlin seinen Freunden bei der Suche nach einem Kater. Dabei durchbrach er den Schleier des Vergessens. Jeremy und Lissy versuchten ihn aufzuhalten und landeten mit ihm in Zaranien, dem Land der Elben und Feen. Bevor ein Gnom sie an Zabzarak ausliefern konnte, wurden sie von Elben befreit. Sie waren voller Hoffnung, dass die drei Menschenkinder die Prophezeiung erfüllen würden. Aber sind die drei Freunde tatsächlich die Auserwählten? Können sie es mit dem schwarzmagischen Zauberer und seiner Armee aufnehmen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Mrs O’Meyers Sturz
Wo ist Kater Maunz?
Spieglein, Spieglein
Soleila
Veritana
Überfall
Cludo
Das Leben in Soleila
Nadja
Obscuritas
Lutin.
Wo steckt Pukis?
Diema-Noctis
Nöck
Der Kuss der Nixe
Das Wort eines Hornfrosches
Die Seelenprinzessin
Gegenzauber
Silva
Cara
Pans Flöte
Ravinia
Erdhennen
Skatus‘ Kauf
Zynthia
Gefährlicher Ausflug
Strafe muss sein
Noch ein Verlust
Boreus
Überraschung
Ankunft in Orientalis
Klotilde
Sappo und Flappo
Der Tauschhandel
Die Flucht
Kassiopeia
Der Blutsschwur
Vorbereitungen
Rettung in letzter Sekunde
Der Schutzwall
Das Wiedersehen
Angriff von allen Seiten
Sieg oder Niederlage
Die verschlossene Kammer
Abschied mit Hindernissen
PROLOG
Vor über eintausend Jahren trat der zehnköpfige Heilige Rat des Planeten Erde zusammen. Die gütige Herrscherin beider Erdvölker, den Menschen und den Lichtwesen, Lady Tizia hatte ihren eigenen Tod und den ihres Gatten vorausgesehen.
Die Sonnenelbe Veritana, als drittältestes Ratsmitglied ebenfalls eine Seherin, sagte: »Leider teile ich Lady Tizias Visionen. Tarek Su Zabzarak wird sie und Lord Kodron mithilfe eines Menschen ermorden und den Thron an sich reißen.«
»Dann wird dies das Ende des Zusammenlebens von Menschen und Lichtwesen sein«, warf Marla, die Beutelwölfin, ein.
Elisabeth, der einzige Mensch im Heiligen Rat, erschrak fürchterlich. »Ist das wirklich notwendig?«
»Ja, die Menschen sind ein kriegerisches Volk. Darum können wir Lichtwesen nicht länger mit euch Menschen zusammenleben«, beharrte Horas, der Zentaur, und alle übrigen acht Ratsmitglieder nickten.
Traurig ließ Elisabeth ihren Kopf hängen. »Es wird ein schmerzlicher Verlust für uns Menschen sein, auf eure Gesellschaft verzichten zu müssen.«
»Ihr werdet euch nicht an uns erinnern können«, versuchte der Eulaner, König Chamor, sie zu beruhigen.
»Königin Celina wird als Hüterin der Schlüssel über die sieben Portale wachen«, sagte Zynthia, die Greifendame.
Sie streckte ihren Adlerrücken durch und klapperte entschlossen mit ihrem kurzen Schnabel, während ihr langer Löwenschwanz nervös auf und nieder wippte.
»Der Schleier des Vergessens wird sich über die Menschen legen«, sagte Hamrir, der zweitausend Jahre alte Riese, »und kein Mensch wird sich je daran erinnern können, dass wir überhaupt existieren.«
MRS O’MEYERS STURZ
Jeremy Rossino saß an seinem Schreibtisch und blinzelte angestrengt gegen die Sonne zum Nachbargrundstück hinüber. Sein Zimmer schmückte ein riesengroßes Fenster. So konnte er nicht nur in Mrs O’Meyers Garten, sondern bis zu Lissy gucken.
Lissy Blue war seine Freundin, seitdem er laufen konnte.
Es verging kaum ein Tag, an dem sie nicht etwas zusammen unternahmen.
Die Matheaufgaben hatte er bereits erledigt und nun wusste er nichts mit sich anzufangen.
Lustlos fummelte er an seinem Walkie-Talkie herum.
»Lissy, kannst du mich hören?«
Es knackte und rauschte.
Jeremy musste eine Weile an den Reglerknöpfen drehen, bis er klaren Empfang hatte.
»Lissy, bist du da?«
Er wartete, doch es tat sich nichts.
Also erhob er sich schwerfällig und wollte gerade das Zimmer verlassen, als sich eine sanfte Stimme meldete.
»Jeremy?«
Jeremy rannte zum Schreibtisch zurück und riss das kleine, schwarze Gerät an sich. Hektisch hielt er es sich vor den Mund. »Klaro, bella mia! Was machst du gerade?«
Eine helle Mädchenstimme lachte. »Nichts. Soll ich rüberkommen?«
»Ja, das wäre toll.« Jeremy warf das Walkie-Talkie auf sein Hochbett und flitzte die Treppe hinunter.
»Ah, da bist du ja!« Erfreut hielt sein Vater ihn am Ärmel fest. »Du kannst heute mit deinem Papa Pizza backen, mio figlio!«
Jeremys Vater war Italiener. Er führte in San Carlos, Kalifornien, USA, einem kleinen gemütlichen Ort mit nur siebenundzwanzigtausend Einwohnern, zusammen mit seiner Frau Maria und seinem Bruder Alessandro ein Restaurant.
»Wir betreiben die beliebteste Pizzeria im Umkreis von einhundert Kilometern. Du bist zwölf Jahre alt«, sagte Luigi Rossino mit strenger Miene, »und das bedeutet, dass du mithelfen musst.«
»Ach, Papa! Ich bin mit Lissy verabredet. Muss ich Pizza backen?«
»Ja, bring deine kleine Freundin einfach mit! Ich bin sicher, sie will auch lernen, wie man die beste Pizza im ganzen Land backt.«
Jeremys Mutter steckte ihren Kopf aus der Küche. »Es ist schon wieder ein Kind verschwunden und sie haben noch immer keine Spur vom Täter. Luigi, nimm unseren Sohn mit in die Pizzeria, dann kann er uns nicht verloren gehen!«
Luigi Rossino winkte ab. »Jeremy ist ein Rossino, der geht nicht so einfach verloren, Maria«, sagte er schmunzelnd.
Er konnte ja nicht ahnen, dass sein Sohn eines der nächsten Kinder sein würde, das aus dem Sichtfeld der Menschen verschwinden und an den Ort des Verbrechens gelangen sollte.
Knurrend lief Jeremy aus dem Haus und stieß auf der Veranda fast mit Lissy zusammen. »Hallo! Da bist du ja schon!«
»Der Pizzaduft hat mich hergetrieben«, sagte seine Freundin grinsend.
»Mein Vater braucht Hilfe beim Pizzabacken, hast du Lust mitzumachen?«, erwiderte Jeremy gelangweilt, doch Lissys Augen strahlten. »Cool! Dürfen wir auch eine essen?«
»Klaro, hinterher«, lachte Jeremy, »komm! Mein Papa wartet schon auf uns.«
Eilig betraten sie die Restaurantküche durch die Hintertür.
»Ah, da sind ja meinen kleinen Helfer! Hier, bindet euch die Schürzen um und setzt euch eine Mütze auf! Meine Gäste sollen keine Haare im Essen finden. Gerade du, bella Lissia, musst deine langen, blonden Haare zusammenbinden. Also, anziehen, Hände waschen und ran an die Arbeit!«
Eine halbe Stunde später waren die beiden Freunde von oben bis unten mit Mehl vollgeschmiert. Sie hatten mächtig viel Spaß dabei, den Teig zu kneten. Meistens wirbelte Jeremys Papa ihn dann so lange mit einer Hand durch die Luft, bis er die Form einer dünnen Scheibe hatte. Kaum lag der dünne Pizzateig auf der Arbeitsplatte, belegten sie ihn mit Champignons, Zwiebeln, Tomaten und anderen leckeren Beilagen, die die Gäste bestellt hatten.
Nach einer Stunde setzte Luigi Rossino die beiden auf einen Stuhl und brachte ihnen eine große Pizza mit viel Gemüse und doppelt Käse. »So, mio diligentes, meine Fleißigen, diese Pizza ist für euch. Lasst sie euch schmecken!«
Bereits wenige Minuten später hatten sie das Essen verschlungen. Sie zogen ihre Schürzen und Mützen aus, wuschen sich die Teigreste von den Händen und verschwanden durch die Hintertür.
Schnurstracks liefen sie auf Lissys Haus zu. Sie wollten ein paar Kekse abstauben, denn Lissys Mutter war Konditorin.
Als sie am Haus von Mrs O’Meyer vorbeikamen, hörten sie jedoch plötzlich merkwürdige Geräusche. Neugierig blieben sie stehen.
»Was war das?«, flüsterte Lissy und lauschte angestrengt.
Jeremy zuckte nervös mit den Schultern. »Keine Ahnung, aber es hörte sich eigenartig an. Sollen wir nachsehen?«
»Gute Idee!«
Gemeinsam schlichen sie zum Haus.
Auf ihr Klingeln und Klopfen öffnete niemand.
Auch auf ihr Rufen blieb alles ruhig.
»Wir müssen uns verhört haben«, sagte Lissy und sprang die Verandastufen wieder hinunter.
Jeremy wollte ihr gerade folgen, als er wieder etwas hörte.
»Da! Da war es wieder!«
Lissy kam zurück und hielt ihr Ohr an die Tür. »Ich glaube, du hast Recht. Wir sollten hineingehen!«
Als Jeremy unsicher die Nase rümpfte, zog Lissy entschlossen an der Insektenschutztür und öffnete die dahinterliegende Haustür.
»Mrs O’Meyer?«, rief Lissy, doch niemand antwortete.
Sie durchsuchten jeden Raum im Erdgeschoss, aber sie fanden die alte Dame nicht.
»Sollen wir oben nach ihr sehen?«, flüsterte Jeremy.
Lissy schüttelte den Kopf und zeigte stumm auf die Kellertür.
Sie stand sperrangelweit offen.
Dahinter brannte Licht.
Vorsichtig näherten sie sich dem Türrahmen.
»Mrs O’Meyer, sind Sie da unten?«, rief Lissy und lauschte.
»Ja, ich bin hier im Keller! Lissy, bist du das?«, antwortete die alte Dame.
»Ja, Jeremy ist auch hier. Brauchen Sie Hilfe?«
»Oh ja. Ich bin gestürzt und kann nicht mehr alleine aufstehen. Ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen.«
Langsam stiegen die beiden die Treppe hinunter und hielten sich an dem wackeligen Holzgeländer fest. Die Treppe war ziemlich steil und für Mrs O’Meyer sicherlich sehr beschwerlich. Die alte Dame war annähernd hundert Jahre alt.
Als sie unten ankamen, lag Mrs O‘Meyer auf dem Fußboden und lächelte ihnen gequält entgegen.
Die beiden Freunde versuchten, ihr beim Aufstehen zu helfen, doch sie schafften es nicht.
»Ach, Kinder! Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Ich bin zu schwer für euch.«
Jeremy sprang auf. »Ich laufe rüber in die Pizzeria und hole meinen Vater.« Damit flitzte er die Treppe hinauf und war verschwunden.
Lissy blieb bei Mrs O’Meyer sitzen und streichelte mitfühlend ihre faltige Hand.
Kurz darauf kam Jeremy mit seinem Vater und dessen Bruder Alessandro zurück. Die beiden Männer hoben die alte Dame vom Fußboden hoch und trugen sie vorsichtig die Treppe hinauf ins Wohnzimmer. Dort legten sie sie auf das Sofa und stützten ihr Bein ab. »Haben Sie ein Telefon, Señora? Ich glaube, wir müssen einen Arzt rufen. Sie können ja gar nicht mehr laufen.«
Mrs O’Meyer nickte und zeigte in die gegenüberliegende Zimmerecke. Dort stand ein Telefon mindestens so alt wie sie selbst. Es hatte eine Drehscheibe mit Zahlen und einen goldenen Hörer mit Schnur.
Jeremys Vater bestellte einen Krankenwagen.
Fünf Minuten später kamen die Sanitäter, um Mrs O’Meyer abzuholen.
»Wer füttert denn jetzt meinen Kater und gießt die Blumen, wenn ich nicht da bin?«, fragte die alte Dame bestürzt.
»Das machen wir«, sagte Jeremy hilfsbereit. »Oder sollen wir Maunz in ein Katzenhotel bringen?«
»Bloß nicht«, sagte Mrs O’Meyer erschrocken. »Er muss unbedingt hierbleiben und das Haus hüten.«
»Dann kümmern wir uns um ihn«, versprach Jeremy, auch wenn er es reichlich merkwürdig fand, dass ein kleiner, schwarzer Kater ein Haus bewachen sollte.
Ein Lächeln huschte über das Gesicht der alten Dame. Sie reichte Jeremy den Haustürschlüssel und erklärte den beiden Kindern, wo sie das Fressen für ihren Kater finden konnten.
Dann wurde sie abtransportiert.
»Ihr braucht Maunz erst morgen früh wieder zu füttern und die Pflanzen könnt ihr übermorgen gießen. Vielen Dank, Kinder!«, rief ihnen Mrs O’Meyer noch zu, bevor sie im Krankenwagen verschwand.
Betreten blieben die beiden Freunde auf dem Rasen stehen und sahen dem Wagen nach, bis er um die Ecke verschwunden war.
WO IST KATER MAUNZ?
Am nächsten Morgen stand Lissy nervös auf der Veranda ihrer Nachbarin und schaute immer wieder auf die Uhr.
Um halb acht kam Jeremy endlich angerannt.
»Mensch, wo bleibst du denn? Ich warte bereits seit zehn Minuten auf dich«, beschwerte sich Lissy.
»Tut mir leid, ich habe verschlafen. Mein Bruder muss am Wecker herumgespielt haben.«
»Der kleine Racker kann mit seinen drei Jahren schon auf dein Hochbett klettern?«
»Wie ein Weltmeister«, sagte Jeremy, hechtete die Verandastufen hoch und öffnete die Tür. »Lass uns schnell den Kater füttern, sonst kommen wir zu spät zur Schule!«
Fünf Minuten später liefen sie die Straße hinunter. »Wir sollten heute Nachmittag gucken, wo Maunz steckt. Wenn er sein Essen nicht angerührt hat, müssen wir noch einmal das Haus absuchen«, sagte Jeremy japsend. »Vielleicht haben wir ihn aus Versehen irgendwo eingesperrt.«
Lissy nickte und flitzte hinter ihm her ins Schulgebäude.
***
Kaum läutete die Schulglocke gegen Mittag die Ferien ein, da eilten Jeremy und Lissy auch schon nach Hause.
Freitags aß Lissy immer in der Pizzeria mit zu Mittag und obwohl sie das Essen liebte, schlang sie heute ihre Spaghetti hinunter, als hinge ihr Leben davon ab.
Auch Jeremy holte keinen Nachschlag.
Ohne Nachtisch rannten die beiden schließlich aus dem Restaurant und ließen Jeremys Vater kopfschüttelnd zurück. »Santa Maria! Was ist nur mit den Kindern los, eh? Sie haben nicht mal nach ihrem Eis gefragt!«
***
Jeremy schlüpfte als erster in Mrs O’Meyers altes Haus.
Lissy folgte ihm zögernd.
Es war gespenstisch ruhig.
»Wir sollten dringend mal lüften«, sagte sie naserümpfend.
Jeremy lief zu einem der Wohnzimmerfenster und öffnete es.
»Maunz hat sein Fressen nicht angerührt«, rief Lissy aus der Küche.
»Wo steckt dieser Kater nur?«, überlegte Jeremy und suchte das Erdgeschoss ab.
»Hier unten ist er nicht«, sagte Lissy nach einer ganzen Weile, »lass uns oben nach ihm sehen.«
Keiner von ihnen war scharf darauf, im dunklen Keller nach Maunz zu suchen. Also schritten sie die schwach beleuchtete Treppe ins Obergeschoss hinauf.
Sie spähten als erstes ins Badezimmer.
Hier war der Kater nicht.
Auch im Schlafzimmer und im Nähzimmer der alten Dame war er nicht zu finden.
»Haben wir nicht schon genug zu tun? Jetzt müssen wir auch noch den Kater von Mrs O’Meyer suchen«, stöhnte Lissy genervt. »Meine Eltern stressen nur noch rum.
Mach dies, mach das. Ich weiß gar nicht, wann sie das letzte Mal gelacht haben.«
»Meine Eltern sind auch nur am Arbeiten. Und wenn ich keine Hausaufgaben machen muss, muss ich in der Pizzeria aushelfen«, pflichtete Jeremy ihr bei.
Ratlos standen sie im Flur und überlegten, wo sie ihn noch suchen konnten, als es plötzlich über ihren Köpfen laut rumpelte.
Erschrocken blickten sie nach oben.
»Was war das?«, flüsterte Lissy.
Jeremy zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Sollen wir nachsehen?« In der Zimmerdecke war eine verschlossene Dachbodenluke eingelassen. »Wir brauchen einen langen Eisenstab, damit wir die Dachluke öffnen können«, überlegte er und schaute sich suchend um.
Auf einem Wandregal stand eine hässliche, trollähnliche Skulptur mit zerzausten Haaren und riesigen Augen.
»Was ist das denn?«, fragte Lissy. Neugierig berührte sie das Ding am Kopf.
Plötzlich leuchteten die Augen gefährlich rot auf und wie durch Zauberhand öffnete sich die Dachbodenluke. Eine Treppe kam heruntergefahren, während gleichzeitig helles Licht abwärts tanzte.
Wie gebannt verfolgten die beiden das Schauspiel.
Zögerlich gingen sie schließlich nach oben.
Der Geruch von Staub und alten Büchern schlug ihnen entgegen, als sie den Dachboden erreichten.
Das Licht kam aus der gegenüberliegenden Ecke. Dort stand ein riesiges Ungetüm, auf dem ein schwerer, vergilbter Stoff hing.
Jeremy zog daran und legte einen übergroßen, antiken Spiegel frei. Der Rahmen war aus dunklem, edlem Holz geschnitzt und zeigte allerlei fremdartige Figuren, die sie noch nie zuvor gesehen hatten.
Ehrfürchtig berührte er eine der spitzen, hölzernen Nasen.
»Lass das! Wir sind doch keine Tiere aus dem Streichelzoo«, krächzte eine Stimme, die aus dem Spiegel zu kommen schien.
Erschrocken wichen die beiden Kinder zurück. Sie drehten sich um und rannten die Treppe hinunter, als sei der Teufel persönlich hinter ihnen her.
Im Vorbeilaufen rissen sie die goldene Kreatur vom Regal, beachteten sie aber nicht weiter und verließen das Haus von Mrs O’Meyer.
So bekamen sie nicht mit, dass sich die Dachbodenluke wieder wie von Geisterhand schloss.
Sie liefen und liefen, bis sie schließlich am Spielplatz der alten Dorfkirche ankamen.
Völlig außer Atem hielten sie an und ließen sich in den Sand plumpsen.
Trotz des schönen Wetters war der Spielplatz wie ausgestorben. Eine düstere Zeit war angebrochen. Niemand ging mehr dem Vergnügen nach. Die Erwachsenen empfanden keine Freude mehr und die Kinder bekamen das zu spüren.
Als Lissy und Jeremy wieder einigermaßen Luft bekamen, sahen sie sich an.
»Was war das denn eben?«, fragte Jeremy keuchend.
Lissy zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Aber ich habe mich zu Tode erschreckt, als ich das Krächzen hörte.«
»Ging mir genauso. Wo ist der Kater nur? Meinst du, er hat sich im Keller versteckt?«
»Vielleicht ist er draußen«, erwiderte Lissy.
Grübelnd fuhr sich Jeremy mit der Hand durch seine dunkle Igelfrisur. »Wenn ich es recht überlege, ist der Kater von Mrs O’Meyer nie draußen. Höchstens auf ihrem Schoß, wenn sie in ihrem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt und die Straße beobachtet. Wir müssen im Keller nachsehen.«
»Im Keller?« Trotz der Wärme bekam Lissy eine Gänsehaut. Sie mochte nicht einmal ihren eigenen Keller. »Mich bringen keine zehn Pferde mehr in das Haus.« Abwehrend hob sie die Arme. Beim Laufen hatte sich das Haargummi gelöst. Jetzt glänzte ihr langes, blondes Haar wie Honig in der Sonne.
Bewundernd betrachtete Jeremy sie.
»Wir brauchen Verstärkung. Merlin sitzt bestimmt zuhause an seinem Computer und jongliert mit irgendwelchen Zahlen herum. Den bitten wir um Hilfe«, schlug Lissy vor.
»Ja«, Jeremy sprang begeistert auf, »Merlin hat vor nichts und niemandem Angst. Er kommt sicher mit.«
Merlin Miller war ihr Freund und Klassenkamerad. Sie hatten schon viel zusammen unternommen, obwohl für ihn fast alles, was nicht mit Computern zu tun hatte, Zeitverschwendung war. Er las lieber ein gutes Buch, spielte am Computer oder schrieb Computerprogramme. Er war ein Genie und mit Abstand der schlaueste Junge der ganzen Schule, obwohl er wie sie erst in die siebte Klasse ging.
Fünf Minuten später öffnete ihnen Mrs Miller die Tür.
»Guten Tag, Lissy! Hallo Jeremy! Wie schön, euch zu sehen. Kommt doch bitte herein! Merlin ist oben in seinem Zimmer.«
Beide reichten Merlins Mutter die Hand und huschten an ihr vorbei ins Haus.
Sachte klopften sie an die Zimmertür, traten jedoch ein, ohne eine Antwort abzuwarten. Wenn Merlin am Computer saß, war er ohnehin kaum ansprechbar.
»Hallo Merlin!«
Überrascht drehte sich ein pummeliger Blondschopf um.
Dabei fing er seine viel zu große, schwarze Hornbrille auf, die ihm mal wieder von der Nase rutschte. »Hallo, ihr zwei! Was treibt euch in mein Reich? Probleme bei den Matheaufgaben?«
»Nee, wir brauchen deinen unerschrockenen Mut«, erwiderte Lissy grinsend. »Wir haben Mrs O’Meyer versprochen, ihren Kater zu füttern, solange sie im Krankenhaus ist. Die Ärmste hat sich doch gestern das Bein gebrochen.
Aber wir können Maunz nirgendwo finden. Da dachten wir, wir fragen dich, ob du uns bei der Suche im Keller helfen kannst.«
Nachdenklich zupfte Merlin an seinem Ohrläppchen herum. »Ich schätze, der Keller erfordert unerschrockenen Mut, richtig?«
Lissy verzog das Gesicht und nickte schweigend. Niemand konnte behaupten, dass Lissy nicht tapfer war, aber was Keller und dort hausende Geister anbelangte, war sie eher ein Hasenfuß.
»Na, dann lasst uns keine Zeit verschwenden!« Beschwingt sprang Merlin auf und lief aus dem Zimmer.
»Mom, hast du noch Katzenbonbons?«, rief er die Treppe hinunter.
»Ja, im Flurschrank, ganz unten, letzte Schublade«, antwortete Mrs Miller.
Mit Katzenleckerlies bewaffnet, verließen sie nur wenige Minuten später das Haus.
Kurz darauf standen sie in Mrs O’Meyers dunklem Hausflur.
»Maunz«, riefen die drei Freunde abwechselnd.
Sie suchten jeden Winkel des Erdgeschosses ab, während Merlin die Tüte mit den Katzenbonbons schüttelte.
Schließlich öffnete er die Kellertür und schaltete das Licht an. »Das ist also der gefürchtete Keller!« Grinsend wandte er sich um.
Lissy zuckte mit den Schultern. »Ich mag keine Keller.
Sie sind mir irgendwie unheimlich.«
Merlin winkte ab. »Papperlapapp! Was soll schon da unten sein, außer ein paar Spinnen und Kellerasseln? Geister gibt es nicht.« Vorsichtig stieg er die Treppe hinunter.
Lissy blieb oben am Treppenabsatz stehen, während Jeremy seinem Freund zögerlich folgte.
Der Keller bestand aus vier kleinen Räumen.
In drei von ihnen stapelten sich große Umzugskartons, im vierten standen Regale voll mit Einmachgläsern. Mrs O’Meyer hatte Erbsen, Bohnen, Möhren und sogar Kartoffeln eingekocht, als wollte sie sich auf einen Krieg vorbereiten.
Vom Kater jedoch fehlte jede Spur.
»Gut«, sagte Merlin nach einer Weile, »dann suchen wir ihn oben. Wäre doch gelacht, wenn wir das Vieh nicht finden.«
Jeremy atmete schwerfällig aus. »Wir waren vorhin schon auf dem Dachboden.«
Unerschrocken verließ Merlin den Keller. »Ihr mögt also auch keine Dachböden. Dann gehe ich besser voraus.«
»Da oben steht ein äußerst merkwürdiger, alter Spiegel«, sagte Jeremy unsicher.
Merlin blieb auf der Treppe stehen. »Ihr habt Angst vor einem Spiegel? Spiegel sind harmlos und ich liebe Spiegel. Sie haben so etwas Magisches an sich.« Er lachte leise auf und rieb sich voller Vorfreude die Hände. »Dieses ganze Geschwafel von gefangenen Seelen in Spiegeln ist doch Humbug. Wer glaubt schon an die Anderswelt?«
»Aber der Spiegel hat mit uns gesprochen«, sagte Lissy ehrfürchtig. Plötzlich lachte sie laut auf. »Wir sind ganz schöne Angsthasen, was? Spiegel können gar nicht sprechen.«
Merlin hob bestätigend den Daumen. »Das sehe ich auch so.«
»Also mir hat das Ding wirklich Angst eingejagt«, gestand Jeremy zähneknirschend.
Entschlossen trat Merlin vor. »Jetzt ist meine Neugierde geweckt. Im Übrigen gibt es nichts, was man nicht erklären kann. Ich habe einmal ein Buch über gespenstische Phänomene gelesen. In dem erzählte der Autor Geschichten von übersinnlichen Dingen, die Menschen erlebt haben wollen. Anfangs dachten die Betroffenen, dass sie es mit Geistern zu tun hatten. Aber letztendlich hatten alle Vorkommnisse einen natürlichen Ursprung. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es nicht doch so etwas wie Gespenster gibt, aber die sitzen ganz bestimmt nicht in Spiegeln, um harmlose Kinder zu erschrecken.«
Den Kater hatten sie vollkommen vergessen und so erschraken sie furchtbar, als Maunz an ihnen vorbei die Treppe hinunter preschte.
Dem Tier standen die Haare zu Berge, als er mit eingezogenem Schwanz winselnd im Wohnzimmer unter dem Sofa verschwand.
SPIEGLEIN, SPIEGLEIN
Kopfschüttelnd sah Merlin sich um. »Jetzt will ich wissen, was da oben los ist.«
Vor der verschlossenen Dachbodenluke blieb er stehen.
»Wie seid ihr da bloß hochgekommen?«, fragte er stirnrunzelnd, »ich sehe keinen Haken an der Wand, um an die Dachbodenluke heranzukommen.«
»Wir hatten sie vorhin gar nicht geschlossen, als wir aus dem Haus gerannt sind. Merkwürdig, dass sie jetzt zu ist«, sagte Lissy verwundert.
»Vielleicht schließt sie sich nach einiger Zeit automatisch«, mutmaßte Merlin.
Unsicher sahen sich die drei Freunde an.
Jeremy bückte sich und hob den kleinen goldenen Troll vom Fußboden auf, um ihn auf das Wandregal zurückzustellen.
Kaum stand dieser an seinem Platz, leuchteten die Augen rot auf. Die Dachbodenluke senkte sich und die Treppe wurde mit einem lauten Rumpeln heruntergefahren.
»Abgefahren! Ich wusste gar nicht, dass die alte O’Meyer so coole Sachen in ihrem Haus hat«, sagte Merlin beeindruckt. Er rüttelte an der Treppe, um die Sicherheit zu überprüfen und betrat die ersten Stufen.
Jeremy stöhnte innerlich. Er war nicht sonderlich scharf darauf, noch einmal auf den Dachboden zu gehen. Unterdessen folgte Merlin den Lichtkegeln wie hypnotisiert, die von oben herunter tanzten.
Das schwere, helle Tuch lag noch immer auf dem Boden und gab den Blick auf den pompösen Spiegel frei.
»Wow«, stieß Merlin beeindruckt hervor und blieb andächtig vor dem gewaltigen Monstrum stehen. »Seht euch diese Schnitzereien an! Die sind bestimmt aus der Zeit der Antike. Wahnsinn!«
»Antike, Bantike, Kantike…«, krächzte es leise, »ist doch egal, wo wir herkommen. Hör auf, uns anzugaffen!«
Merlin kniff beide Augen zusammen und drehte sich zu seinen beiden Freunden um. »Was habt ihr gerade gesagt?«
Beide zuckten kopfschüttelnd mit den Schultern. »Das waren wir nicht. Es kam aus dem Spiegel.«
Neugierig beugte sich Merlin nach vorne, um das Möbelstück genauer zu betrachten. »Spiegel können nur im Märchen sprechen.«
Im gleichen Moment huschte eine kleine Maus an ihm vorbei und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Um nicht mit der Nase gegen das Spiegelglas zu fallen, versuchte er, sich mit beiden Händen am Holzrahmen abzufangen.
Doch ihm war, als würde ihm etwas in die Finger beißen.
Schmerzerfüllt zuckte er zurück. Dann verschwand er geräuschlos kopfüber im Spiegel.
Erschrocken beobachteten Lissy und Jeremy, wie ihr Freund regelrecht in das Ungetüm hineingesogen wurde.
Sie packten ihn und versuchten ihn festzuhalten, doch Merlin war zu schwer. Gemeinsam flogen sie durch das Glas, das sich in Nebel aufzulösen schien.
***
Hart schlugen sie nur wenige Augenblicke später auf einer Wiese neben einem riesigen, flachen Felsstein auf.
Sie befanden sich auf einer großen Waldlichtung. Diese war umgeben von moosbewachsenen, hohen Bäumen, die zum Teil wie Schlangen am Boden entlang wuchsen.
Die Wiese war über und über mit merkwürdigen Blumen übersät. Sie sahen fast so aus, als hätten sie menschliche Gesichter und würden die Neuankömmlinge neugierig beobachten. Etwas derart Wunderliches hatten die drei Freunde noch nie gesehen.
Nach dem ersten Schock rappelte sich Jeremy auf und half Lissy mühsam auf die Beine.
Merlin tastete instinktiv das Gras nach seiner Brille ab, als ihm plötzlich etwas in den Finger zwackte.
Erschrocken zuckte er zurück. Etwas hatte ihn gebissen.
Bevor er weitersuchen konnte, stellte er fest, dass er erstaunlich gut sehen konnte, obwohl er sonst ohne Brille fast so blind war wie ein Maulwurf.
Ächzend erhob er sich und blickte sich um. »Wo sind wir hier?«, fragte er interessiert. Er entfernte sich ein paar Schritte von seinen Freunden und umrundete dabei instinktiv die Blumen, die ihn anglotzten.
Jeremy und Lissy blieben dicht aneinander gedrängt stehen. »Wo ist der Dachboden von Mrs O’Meyer?«, hauchte Jeremy, dem gar nicht wohl war in seiner Haut.
»Keine Ahnung«, erwiderte Lissy unsicher. »Eben standen wir noch auf dem Dachboden und jetzt sind wir hier in diesem merkwürdigen Waldstück.«
Über ihren Köpfen kreisten ein paar riesige, bunte Vögel am wolkenlosen Himmel. Sie hatten große Ähnlichkeit mit Flugsauriern. Hungrig kreischten sie, als begrüßten sie ihr frisches Futter ungeduldig. Trotz der gleißend hellen Sonne sahen die Kinder, dass sie eine Art Sattel auf dem Rücken trugen, als könnte man auf ihnen reiten.
Wenige Meter von den drei Freunden entfernt war ein großes Gebüsch. Bei dessen Anblick wurde man das Gefühl nicht los, dass man von Tausenden von Augenpaaren beobachtet wurde. Dahinter führte ein einziger Sandweg aus diesem dicht bewachsenen Waldabschnitt heraus.
Links und rechts vom Weg standen hohe Bäume mit violetten herzförmigen und andere mit grün-rot gezackten Blättern. In weiter Ferne sah man graues Felsgestein beeindruckend hoher Berge.
Obwohl die Landschaft malerisch schön und gleichzeitig auch beängstigend war, war sie, abgesehen von den fliegenden Todesboten am Himmel, wie ausgestorben. Und trotzdem hatten die Kinder den Eindruck, dass sie nicht die einzigen im Wald waren.
Neugierig näherte sich Merlin dem Busch.
Plötzlich sprang ein kleines Männchen mit flatterndem weißen Haar und runzeligem Gesicht dahinter hervor. Er hatte die dickste Knollnase, die ein Lebewesen wohl haben konnte. Wild fuchtelnd hielt er ihm einen dünnen Holzstab unter die Nase. »Wer seid ihr und was sucht ihr hier?« Seine Stimme knarzte wie eine alte, verrostete Säge.
Stumm vor Entsetzen schüttelte der sonst so unerschrockene Merlin den Kopf. Der Rest seines Körpers schien ihm nicht mehr zu gehorchen. Zum ersten Mal in seinem Leben verspürte er ein unangenehm schmerzhaftes Ziehen in der Magengrube. Seine Hände waren eiskalt, als er den Schweiß an seiner Hose abwischte. Verwundert über seine körperliche Reaktion schüttelte Merlin den Kopf und fing plötzlich unvermittelt an zu lächeln.
»Was grinst du so blöd?«, knurrte das Männchen und humpelte um ihn herum.
Merlin versteckte sein Grinsen hinter vorgehaltener Hand.
»Ich glaube, ich spüre so etwas wie Angst. Dieses Gefühl ist zwar äußerst merkwürdig, aber doch irgendwie gut.
Und ich muss gestehen, dass ich mich noch nie zuvor gefürchtet habe.«
»Dann wird es wohl Zeit, dass ich dich das Fürchten lehre, du freches Dickerchen!« Der kleine Mann schnipste in Richtung Busch und hielt prompt ein Seil in den Händen.
Er schnipste erneut und alle standen regungslos zusammen. Nun konnte er sie fesseln, während er leise vor sich hin schimpfte.
»Lumpenpack, ja, das seid ihr! Elendige Menschen! Ein Haufen nichtsnutziger, stinkender Taugenichtse…«
»Warum fesseln Sie uns? Was haben Sie mit uns vor?«, fragte Lissy mit aufkommender Panik.
»Was bist du für ein merkwürdiger Zwerg?«, platzte Merlin heraus.
Hektisch sah sich das Männchen nach allen Seiten um. Es zog das Seil immer fester um ihre Körper, bis sie sich keinen einzigen Millimeter mehr bewegen konnten. »Ich bin ein Gnom, der fette Beute gemacht hat.«
»Aua«, rief Lissy, als der Gnom das Seil so fest um ihre Handgelenke zerrte, dass ihre Haut einriss.
»Stell dich nicht so an, du dummes Ding«, meckerte der Kleine und zog das Seil noch enger.
Dann schnipste der Gnom mit den Fingern.
Wie aus dem Nichts tauchte ein Esel auf, der eine hölzerne Kutsche hinter sich herzog.
Und dieser Esel war höchst sonderbar. Seine Ohren sahen aus wie zerrupfte Salatköpfe, seine Augen leuchteten in hellem Violett und sein Fell glitzerte in der Sonne wie weißer Diamantenstaub.
Der Kleine schnipste ein zweites Mal mit den Fingern.
Bevor die Freunde blinzeln konnten, lagen sie auf der Ladefläche der Kutsche wie verschnürte Weihnachtspakete.
»Mir scheint, ich habe ein paar besonders leckere Exemplare der Spezies Mensch gefangen und dafür wird mich der Herrscher sehr reich belohnen«, sprach der Gnom zu sich selbst. »Wird es doch immer schwieriger, an euch Bälger heranzukommen bei all den gierigen Fängerbanden!«
Verschreckt blickten die Freunde sich an.
Keiner wagte es zu atmen.
Waren sie etwa bei Menschenfressern gelandet?
Als die Kutsche langsam anfuhr, sah Lissy aus den Augenwinkeln unversehens etwas in den Baumkronen aufblitzen. Sie kniff ihre Augen zusammen und inspizierte das dichte Blätterwerk.
Wieder blitzte etwas auf.
Das Männchen war zu beschäftigt, um es zu bemerken. Es sprang eilig auf den Kutschbock und trieb das Eselchen mit einem Peitschenhieb noch weiter an. Rumpelnd nahm das Gefährt Fahrt auf und verließ die Lichtung über den Sandweg.
Kaum fuhren sie unter den haushohen Bäumen hindurch, bemerkte Lissy drei grüngekleidete, menschenähnliche Wesen zwischen den violetten, herzförmigen Blättern sitzen. Das konnten keine Menschen sein. Sie hatten so lange, spitze Ohren, dass sie unter ihrer Mütze hervorlugten.
Sie hielten ein großes Netz in den Händen und deuteten Lissy mit einem Fingerzeig an, still zu sein. (Was natürlich völlig überflüssig war, da sie wie ihre Freunde geknebelt war und kaum einen Laut von sich geben konnte.)
Lissys Augen wanderten zurück zu dem kleinen Männchen, dessen hässlicher Buckel von dem langen grauen Haar verdeckt wurde. Er hatte die drei Gestalten nicht bemerkt und trieb den Esel peitschend an. »Lauf, du dummer Esel, ich muss die kostbare Fracht zum Herrscher bringen, bevor sie mir jemand abluchst!«
Auf einmal zischte es leise.
Noch während das große Netz auf den Gnom niedersauste, sprangen die drei Wesen vom Baum und brachten die Kutsche zum Stehen. In Windeseile hatten sie dem Kutscher die Augen verbunden und die Hände gefesselt.
»Ihr verdammten Elben! Lasst mich los! Lasst mich sofort wieder frei! Ich sehe nichts mehr und ohne meine Hände kann ich euch nicht verzaubern«, tobte der Gnom.
Erstaunt sahen sich die drei Freunde an.
Was waren Elben?
Wo, zum Teufel, waren sie eigentlich gelandet?
»Sei still, alter Mann!«, sagte einer der Elben und zwinkerte Lissy verschmitzt zu.
Noch während sich sein Mund verzog, bemerkte sie verwundert, dass er zu Lächeln versuchte. Aber es sah eher so aus, als hätte er in die sauerste Pampelmuse gebissen, die die Welt je geschmeckt hatte.
Der zweite Elb hüpfte auf die Ladefläche und löste das Seil, mit dem der Gnom die drei Kinder verschnürt hatte.
Die Elbe hielt unterdessen den Esel am Zügel fest.
»So«, sagte der Elb und half ihnen auf, »nun seid ihr wieder frei. Willkommen in Zaranien, dem Land der Elben und Feen! Ich bin Jamie.«
»Pah«, brummte der Gnom, »als wenn das euer Land wäre. Zaranien ist das Land aller Naturgeister und Lichtwesen und es befindet sich in der ungebrochenen Herrschaft des genialen Zauberers Tarek Su Zabzarak.«
»Sei still, Gnom!«, befahl Jamie.
Der andere Elb ignorierte den Gnom und reichte Lissy stattdessen die Hand. »Ich heiße Johnis.
Meinen jüngeren Bruder Jamie kennt ihr ja bereits und das ist meine Schwester Jana. Und wer seid ihr?«
»Ich bin Jeremy und das sind meine beiden Freunde Lissy und Merlin.«
»Merlin?« Beeindruckt hielt Johnis inne. »Dann müsst Ihr ein Nachfahre des größten Zauberers aller Zeiten sein. Es ist uns eine besondere Ehre, Euch kennenzulernen.«
»Vom wem ist er ein Nachfahre?«, fragte Jeremy verwirrt.
»Von Merlin Emrys, dem besten Zauberer, den die Menschheit je gesehen hat«, entgegnete Johnis.
Merlin lachte leise auf. »Das glaube ich kaum. Ihr müsst euch irren. Ich kann ja nicht einmal zaubern.«
»Elben irren sich nie!«, behauptete Jamie mit stolzgeschwellter Brust. »Du hast mit Sicherheit die Gabe der Weissagung, nur weißt du es nicht, weil ihr Menschen euch generell gegen alles verschwört, was ihr logisch nicht erklären könnt.«
»Ich bin immerhin zwölf und Wahrsagen ist Humbug«, sagte Merlin fast ein wenig beleidigt.
Jamie wackelte mit dem Kopf.
Er war offensichtlich anderer Meinung.
»Vermutlich bist du deshalb der schlaueste Schüler der ganzen Schule«, witzelte Jeremy, »du zauberst deine guten Noten, statt sie mit Arbeit und Schweiß wie wir Normalsterbliche zu verdienen.«
»Sehr witzig«, knurrte Merlin und setzte sich aufrecht hin.
»Warum beginnen eure Namen eigentlich alle mit ein und demselben Buchstaben?«, versuchte er abzulenken. »Ist das Zufall oder Absicht?« Natürlich war ihm diese Eigenartigkeit sofort aufgefallen. Er war nicht nur in Mathe ein Genie, er interessierte sich vor allem für die Eigenarten der vielen verschiedenen Sprachen, die auf der Erde gesprochen wurden.
»Wir sind die zehnte Familie in unserem Dorf und so müssen unsere Namen mit dem Buchstaben ›J‹ beginnen«, entgegnete Jamie.
»Die zehnte Familie aus dem Buchstabendorf?«, witzelte Jeremy grinsend. Er war erleichtert, dass sie dem bösartigen Gnom entkommen waren und war schon wieder dabei, seine üblichen Späße zu machen.
Wieder versuchten die Elben zu lächeln, doch es misslang ihnen kläglich.
»Es gibt sechsundzwanzig Familien in Soleila«, erklärte Jamie mit leiser Stimme, »unser Dorf liegt im Tal der Sonnenelben hinter dem dritten Berg.« Er blickte sich ängstlich um und gab seiner Schwester ein Zeichen, auf die Kutsche zu klettern.
»Und dort müssen wir jetzt auch hin! Mutter wartet sicherlich schon auf uns. Und ihr nehmt besser diese Tarnmützen! Als Menschen seid ihr Unberechtigte, die sich in Zaranien nicht frei bewegen dürfen.« Johnis richtete sich auf. Er reichte Merlin seine grüne Zipfelmütze und fing an, den Gnom zusammen mit dem Netz auf dem Kutschbock fest zu binden. »Betrachtet euch als unsere Gäste!«
»Wir können euch nicht begleiten. Wir müssen nach Hause«, sagte Lissy unsicher. »Unsere Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen.«
Das stimmte nicht ganz, denn in San Carlos war es jetzt Nachmittag und niemand würde sie vor dem Abendessen vermissen.
»Ich befürchte, so einfach ist das nicht«, sagte Jamie und sprang auf den Kutschbock. Er reichte Jeremy seine Mütze und Jana gab ihre an Lissy weiter.
Merlin räusperte sich. »Wieso? Wo ein Eingang ist, ist auch meistens ein Ausgang.«
»Das Portal in eure Welt ist geschlossen und wird sich für Menschen erst wieder öffnen, wenn der Neumond auf die Erde scheint. Ihr habt also keine andere Wahl, als uns zu begleiten. Hier ist es zu gefährlich für euch. Auf der Wiese der sprechenden Seelen lauern viele dunkle Gestalten, die nur darauf warten, menschliche Beute an den Herrscher auszuliefern. Nehmt Platz und setzt die Mützen auf!«
Die drei Freunde setzten sich die Tarnmützen auf und wurden unsichtbar. Zufrieden trieb Johnis das Eselchen an und lenkte die Kutsche auf die Berge zu.
Nachdenklich zupfte sich Merlin am Ohrläppchen herum.
»Menschliche Beute? Wie sollten die Menschen denn alle hierherkommen? Doch wohl kaum durch den Spiegel, durch den wir gekommen sind. Oder ist Mrs O’Meyers Dachboden eine Art Bahnhof für die Anderswelt?«, lachte er leise.
Johnis schüttelte den Kopf. »Das Portal auf der Wiese der sprechenden Seelen hat viele Ausgänge, schließlich gibt es viele Spiegel in eurer Welt. Aber euer Portal hat nur einen Ausgang in Zaranien, nämlich den Stein auf der Wiese der sprechenden Seelen.«
»Spiegel sind Portale in eure Welt?«, hakte Merlin verwundert nach.
Voller Entsetzen sah Lissy ihren Freund an, was er natürlich nicht bemerkte, da sie unsichtbar war. Sie liebte Spiegel und hatte eine regelrechte Sammelleidenschaft dafür entwickelt. Mittlerweile besaß sie zwanzig kleinere und größere Spiegel. Aber wenn sie so gefährlich waren, würde sie sie entsorgen müssen.
Johnis nickte. »Ja, aber nur holzgerahmte Spiegel mit Schnitzereien. Oftmals sind sie schon Hunderte von Jahren alt.«
Eilig überlegte Lissy, ob sie so ein alten Spiegel besaß.
Erleichtert atmete sie auf. Sie hatte nur neumodische Spiegel mit Metall- oder Plastikrahmen.
Als Jamie das Männchen mit einem Tuch geknebelt hatte, ließ er sich neben seinem großen Bruder auf dem Kutschbock nieder. Er wandte sich noch einmal an den zappelnden Gnom, bevor er seinem Bruder zunickte. »Mach ja keine Dummheiten, alter Mann!«
Der Weg war schmal und sehr uneben. Mitunter hingen die Zweige der Laubbäume so tief herab, dass sie sich ducken mussten, damit sie ihnen nicht ins Gesicht schlugen.
Einmal hatte Lissy sogar das Gefühl, als würden die Zweige nach ihr greifen. Ängstlich rückte sie näher an die Jungs heran.
»Fürchtet euch nicht«, sagte Jamie und zwinkerte ihnen zu, obwohl er sie nicht sehen konnte, »bald ist Neumond und da wird der Weg in euer Land wieder frei sein. Bis dahin seid ihr in unserem Dorf besser aufgehoben als hier.«
»Bald?«
»In ein paar Wochen«, sagte Jamie schulterzuckend.
»In ein paar Wochen?«, fragte Jeremy erschrocken.
»Ja, es wird euch gutgehen bei uns«, sagte Jana.
»Woher wissen wir, ob wir euch vertrauen können«, bemerkte Merlin misstrauisch. »Ich bin nämlich noch nie zuvor einer Elbe begegnet.«
Jamie blickte sich um. »Ihr seid in Zaranien, dem schönsten Fleck der Anderswelt.«
»Und ihr wisst nicht, ob ihr uns vertrauen könnt«, fügte Johnis mit zusammengekniffenen Lippen hinzu, »aber ihr habt keine andere Wahl, als es zu versuchen.«
Ein Zweig preschte so unvermittelt hervor, dass der Elb verstummte. Bevor jemand reagieren konnte, schnappte er sich Lissy. Diese kreischte laut auf, als sie in die Luft gehoben wurde. Lautlos purzelte ihr dabei die Tarnmütze vom Kopf.
Johnis stoppte die Kutsche. Er holte ein Seil aus seiner Tasche, welches augenblicklich Funken sprühte. Damit fing er den Zweig ein. Der Zweig fing Feuer und ließ Lissy augenblicklich los.
Unsanft landete sie auf dem Sandweg.
Geschwind sprang Jeremy von der Kutsche und half seiner Freundin beim Aufstehen. Unterdessen löschte Jamie das Feuer am Baum mit einem Schwall Wasser, welches er aus dem Nichts hervorzauberte.
»Setzt eure Tarnmützen wieder auf«, warnte Johnis und trieb den Esel wieder an.
»Heimtückische Bäume«, knurrte Lissy verärgert und verschwand wieder unter ihrer Tarnmütze.
Schweigend saßen die drei Freunde einfach nur da und sahen sich ängstlich um. Die Kutsche rumpelte über Stock und Stein, vorbei an Bäumen, die von Zeit zu Zeit gierig ihre Äste nach ihnen ausstreckten.
»Woher wisst ihr eigentlich, wann sich das Portal öffnet und wann es sich schließt?«, fragte Lissy nach einer ganzen Weile.
»Das ist kein Geheimnis in Zaranien«, sagte Jamie. »Die Portale öffnen sich nur in Neumondnächten.«
»Wir müssen so schnell wie möglich wieder nach Hause«, sagte Jeremy, »ich höre jetzt schon das Donnerwetter meiner Mutter, weil ich nicht pünktlich nach Hause komme.«
»Ihr habt keine andere Wahl«, brummte Johnis leise.
Der Wald wurde immer dichter und dunkler.
»Vielleicht gefällt es euch auch bei uns und ihr bleibt noch bis zum großen Fest der Frühjahrstagundnachtgleiche«, sagte Jana nachdenklich.
»Wird auf dem Fest auch getanzt?«, fragte Lissy neugierig. Sie liebte Musik und war in ihrer Freizeit in einem Tanzverein.
Traurig schüttelte Jana den Kopf. »Nein. Musik und Tanz sind verboten.«
»Warum?«
Johnis blickte sich nach allen Seiten um, bevor er antwortete: »Der mächtige Herrscher, Tarek Su Zab…«
»Still«, unterbrach ihn Jamie, »oder hast du vergessen, dass wir Unberechtigte transportieren? Die Blumen auf der Wiese der sprechenden Seelen werden dem Herrscher längst die Botschaft übermittelt haben, dass Menschenkinder in Zaranien sind, die nicht durch seine Untertanen gefangen wurden. Auf seinem Namen liegt nun der Auffindungsfluch.«
»Was bedeutet das?«, fragte Merlin neugierig.
»Sobald jemand seinen Namen nennt, tauchen seine bewaffneten Paladine auf«, erklärte Jamie.
Johnis nickte mit ernster Miene. »Verzeiht, das habe ich vergessen. Also«, setzte er erneut an, »unser heutiger Herrscher hatte sich einst selbst auf den Thron gesetzt, nachdem er Zaraniens damalige Herrscher Lady Tizia und Lord Kodron getötet hatte. Dann nahm er uns die Musikinstrumente weg. Wann immer wir neue schufen, verschwanden sie wie durch Zauberhand. Und mit ihnen die musizierenden Elben. Daher verbot unser Elbenkönig die Musik und den Tanz.«
Die Kutsche wurde langsamer. Der Weg lag so steil vor ihnen, dass der Esel seine liebe Mühe hatte, ein Bein vors nächste zu setzen.
»Was für ein Interesse hatte euer Herrscher an euren Musikinstrumenten?«, fragte Merlin überrascht.
Wieder hielt Johnis vorsichtig nach allen Seiten Ausschau, dann antwortete er hinter vorgehaltener Hand. »Elben können Menschen mit ihrer Musik heilen.«
»Davon habe ich noch nie gehört«, gab Jeremy zu.
»Ich glaube auch nicht daran«, sagte Merlin mit verbissener Miene, »sonst würde mein Vater ja noch leben.« Sein Vater war vor zwei Jahren an einer harmlosen Erkältung gestorben.
»Es ist sehr lange her, dass Elben Menschen heilen konnten«, sagte Jana betreten.
»Mindestens tausend Jahre«, fügte Jamie hinzu. »Also weit vor unserer Geburt.«
»Wie alt seid ihr denn?«, fragte Lissy überrascht.
Jana versuchte zu grinsen. »Jamie und ich sind erst zweihundertvierzig Jahre alt. Wir sind Zwillinge«, fügte sie hinzu. »Und Johnis ist schon vierhundert Jahre alt. Er ist der Älteste von uns vier Geschwistern.«
»Dann seid ihr ja steinalt«, schmunzelte Jeremy. Jana schüttelte grunzend (was wohl ein Lachen werden sollte) den Kopf. »Aber nein, wir sind jung. Selbst unsere Mutter ist mit ihren achthundert Jahren noch eine junge Elbe.
Unser Vater ist mit seinen eintausend Jahren ein durchschnittlich alter Elb.«
»Wie alt können Elben denn werden?«
Mit großen Augen schauten die Geschwister sich an und zuckten schließlich mit den Schultern.
»Also Veritana, unsere Dorfälteste, ist zweitausendvierhundert Jahre alt. Aber sie ist auch mit Abstand die Älteste im Dorf«, fügte Jana hinzu.
Hätten die drei Elben nicht so ernst dreingeschaut, hätte Jeremy laut losgelacht. Er hatte eine Großtante, die einhundertfünf Jahre alt war. Ihre graue, faltige Haut ähnelte der eines Elefanten. Er vermochte sich kaum vorzustellen, wie jemand aussah, der vierundzwanzigmal so alt war.
»Und was hat euer Herrscher für ein Interesse daran, dass die Menschen von euch nicht mehr geheilt werden? Vorausgesetzt, die Geschichte stimmt«, fügte Merlin eilig hinzu.
Wieder schauten sich die Elben nach allen Seiten um, als hätten die Bäume Ohren.
»Er braucht die menschlichen Seelen«, erklärte Johnis mit leiser Stimme, »denn er ist nur zur Hälfte ein Lichtwesen.«
»Und zur anderen Hälfte?«, fragte Lissy neugierig.
»Zur anderen Hälfte ist er ein Sterblicher, ein Mensch.
Um am Leben zu bleiben, hat er sich von seinem Vater ein Seelengewand anfertigen lassen, welches mit menschlichen Seelen gespeist wird.«
»Das ist echt gruselig«, flüsterte Jeremy leise. »Heißt das, er verhindert seit Jahren, dass Menschen von ihren Krankheiten geheilt werden können, damit sie sterben und er ihre Seelen einfangen kann, sobald sie ihren Körper verlassen?«, hakte Merlin nach.
»Richtig. Seine Zauberkräfte sind von Natur aus schwach.
Als Halbmensch wäre er ohne sein Seelengewand niemals so alt geworden.«
»Wie alt ist er denn?«, fragte Lissy mit großen Augen, obwohl sie die Wahrheit fürchtete.
»Er ist tausendfünfzig Jahre alt«, sagte Jamie leise mit ängstlichen Blicken in Richtung der Bäume.
»Und warum benehmt ihr euch, als hätten die Bäumen Ohren?«, fragte Jeremy.
Natürlich glaubte er keine Sekunde daran, dass die Bäume über irgendwelche Sinne verfügten. Umso überraschter war er, als Johnis einen Finger auf die Lippen legte. Er ließ sich Zeit mit der Antwort, bis sie den letzten Baum passiert hatten und am Gebirge angekommen waren. »Die männlichen Bäume vor den Bergen haben in der Tat Augen, Ohren und Hände. In diesem Teil des Landes sind sie Gehilfen des Herrschers. Hier befinden sich die Portale, durch die die Menschen ihre Welt verlassen. Sie werden hier eingefangen und zum Palast gebracht, wo der Herrscher ihre Seelen in sein Seelengewand einarbeitet.«
Fröstelnd zog Lissy ihren Pullover enger um sich. Sie kuschelte sich noch dichter an Jeremy heran. Beschützend legte Jeremy einen Arm um ihre Schultern.
»Dann wundert es mich, dass es euch möglich war, uns von einem Baum aus zu befreien«, bemerkte Merlin nachdenklich.
»Das war eine harmlose Brauwe«, gestand Jamie augenzwinkernd, »ein weiblicher Baum, der sich nicht durch Zauberkraft verwandeln lässt. Du erkennst ihn an seinen rosa- und lilafarbenen Blättern. Er ist sozusagen neutral und eignet sich hervorragend für einen Hinterhalt.«
Johnis trieb den Esel an, doch er blieb plötzlich stehen und rührte sich nicht mehr von der Stelle.
»Lauf weiter, du dummer Esel!« Er gab dem Tier einen sanften Hieb aufs Hinterteil, doch der Esel blieb stur.
»Sag, alter Mann, warum ist dein Lastentier so störrisch?«
Der Gnom brummte etwas Unverständliches.
»Er sagt, sein Esel gehorcht nur seinem Besitzer und dieser kann mit dem Knebel keine Befehle erteilen«, übersetzte Merlin das unverständliche Gestammel.
»Das hat er gesagt?« Jeremy hatte kein einziges Wort verstanden.
»Ja«, sagte Merlin leise.
»So langsam glaube ich, dass du wirklich ein Zauberer bist«, wisperte Jeremy.
Johnis sprang vom Kutschbock und holte eine blaue Rübe aus seinem grünen Gewand.
Neugierig musterte Lissy die seltsame Möhre, die der Esel hungrig verschlang. Dann beäugte sie den Elbenjungen (falls man einen vierhundert Jahre alten Elben noch als ›Jungen‹ bezeichnen konnte).
Johnis war ausgesprochen hübsch, trotz seiner sonderbaren Andersartigkeit. Seine spitzen Ohren lugten keck unter seinem vollen Haar hervor, welches leuchtete wie Waldhonig. Alle drei Geschwister trugen enge grüne Kleidung, wobei Jana statt einer Hose einen Faltenrock anhatte. Ihre Füße steckten in blätterartigen Schuhen, die mit rötlichen Zweigen verknotet waren. Kurzum, diese Elben waren wahrlich die wundersamsten Wesen, denen sie je begegnet war.
Am erstaunlichsten aber war, dass Johnis aus seiner scheinbar leeren Jackentasche eine Rübe nach der nächsten hervorzauberte. Binnen Sekunden wechselte sie die Farbe, als führte sie ein Eigenleben und könnte sich nicht entscheiden, welche Farbe ihr am besten gefiel.
Ganze fünf Rüben und zwei (pink gestreifte) Äpfel später war der Esel endlich gewillt, die Kutsche weiter zu ziehen.
SOLEILA
Hinter dem dritten Berg erreichten sie ein Tal, das wie ein bunter Flickenteppich vor ihnen lag.
»Das ist Soleila, das Tal der Sonnenelben«, sagte Johnis stolz. Er schnalzte mit der Zunge, um den Esel anzutreiben. »Ihr könnt die Tarnmützen nun abnehmen.«
Kaum hatten die drei Freunde ihre Mützen abgenommen, wurden sie wieder sichtbar.
Am Straßenrand tauchten die ersten Obstbäume auf. An der Form der Blätter hätte ein Mathematiker seine wahre Freude gehabt. Sie boten die ganze Palette der Geometrie.
Doch wenn man glaubte, dreieckige und rautenförmige Blätter seien schon ein Wunder der Natur, so musste man sich erst die Früchte ansehen. Sie lieferten sich einen Wettkampf an Farbe, Schönheit und verführerischem Duft. Manche schillerten sogar so bunt wie ein Regenbogen.
Es gab Tränenfrüchte (tropfenförmige blaue, rote und gelbe Mirabellen), Orbipruni (runde Pflaumen), Triangelbeeren (dreieckige Birnen) und Zyklusbeeren, die momentan lila-schwarz waren (sie ähnelten den Himbeeren bei den Menschen und veränderten je nach Jahreszeit ihre Farbe).
Die Bäume mit den quadratischen Blättern trugen allerdings keine Früchte, sondern schillernde Blüten in sämtlichen Rotschattierungen.
Wenn man ganz genau hinsah, konnte man kleine blauschwarz gestreifte Pummelchen mit glitzernden Flügeln beobachten. Sie flogen von Blüte zu Blüte und verloren immer etwas von ihrem pinken Blütenstaub. Eine von ihnen verließ plötzlich die Formation und flog mitten auf Lissys Kopf.
»Was ist das?«, quiekte diese erschrocken auf.
Jana verzog spöttisch den Mund. »Das ist ein harmloser Bläuling. Sie bestäubt die Obstblüten, damit die Bäume und Sträucher viele Früchte tragen. Sieh nur, sie mag dich!«
»Sie?«, fragte Merlin skeptisch und musterte das kleine hummelartige Wesen.
Jana nickte. »Ja, die männlichen Bläulinge sind zur Zeit nicht blau-schwarz gestreift, sie sind rot-schwarz gestreift.
Nur im Winter tarnen sie sich und sind genauso blau wie ihre Weibchen.«
»Welche Jahreszeit haben wir denn?«, fragte Lissy mit einem vorsichtigen Blick nach oben. Der Bläuling saß noch immer auf ihrem Kopf und schien sich auszuruhen.
»Frühling. Darum sind die männlichen Bläulinge so rot wie dieses Exemplar dort!« Johnis zeigte auf ein fettes, kleines, rot-schwarz gestreiftes, hummelartiges Tier, welches sich in rasantem Tempo auf Lissy zubewegte. Kurz vor ihrer Stirn bremste es ab.
Fast sah es so aus, als würden die beiden Bläulinge streiten. Sie summten ohrenbetäubend laut, bis der Bläuling auf Lissys Kopf schließlich nachgab und dem Männchen fast quakend folgte.
»Er hat seinen Bläuling zurück zur Arbeit gebeten«, erklärte Jamie.
»Nach einer Bitte hörte sich das aber nicht an«, bemerkte Merlin spöttisch, »es war eher ein Befehl.«
Jeremy runzelte die Stirn. Außer dem Summen der beiden Bläulinge war nichts zu hören gewesen.
Während sie durch den Ort fuhren, sahen sie Elben in verschieden farbigen Kleidern. Sie vertraten sich die Beine oder hielten ein kleines Schwätzchen am Wegesrand. Und wenn sie Appetit auf die herrlichen Früchte hatten, die an den vielen Bäumen hingen, musste sich keiner von ihnen strecken, um eine Frucht zu pflücken. Sie griffen einfach in ihre Taschen und zauberten die Früchte hervor, die eben noch am Baum hingen.
(Wobei die Früchte stets ihre Farbe wechselten, sobald die Elben sie aus ihren Taschen angelten. Es war fast so, als machten sie sich einen Spaß daraus, sich zu verändern.)
Staunend fuhren die drei Freunde an den Elben vorbei, die sie nicht weniger interessiert angafften.
In den kleinen Gärten, die dicht an dicht gedrängt durch niedrige Zäune abgetrennt waren, standen runde Hütten.
Sie waren aus Stein und Lehm gebaut. Sie hatten grasbewachsene Dächer, unförmige Fenster und jeweils eine ovale Tür, deren Mitte mit einem einzigen Buchstaben verziert war. Es sah aus, als hätte man riesige Findlinge abgeschnitten, wie einen Kürbis ausgehöhlt und mit einem Stück Wiese abgedeckt. Anschließend hatte man die Fenster ausgeschlagen, die so schief und krumm waren, wie der Hammer eben auf den Fels aufgetroffen war.
In einigen Gärten standen Tiere, die die drei Freunde noch nie zuvor gesehen hatten.
Bunte Ziegen mit gekringelten Hörnern; Schafe mit langen Spaghettihaaren, die regenbogenfarben schillerten; Pferde mit langem, zotteligem Fell, wie man es nur von schottischen Hochlandrindern kannte und finster dreinblickende Hunde mit Flügeln.
»Was sind das bloß für merkwürdige Tiere«, bemerkte Merlin, dem fast die Augen aus dem Kopf fielen. »Und warum müssen die so laut reden?«
»Die Tiere reden doch gar nicht. Sie grunzen, schnaufen und blöken«, bemerkte Jeremy und schaute seinen Freund an, als hätte dieser den Verstand verloren.
Jamie streckte stolz die Schultern durch. »Das sind unsere Haus- und Nutztiere. Siehst du die Ohr-Eierläufer dort drüben?« Er zeigte auf eine Schar von bunten Hühnern mit Ohren, von denen man meinen konnte, Mutter Natur hätte sie mit Hasen gekreuzt. An der Unterseite ihrer Bäuche trugen sie riesige Euter wie eine Kuh.
Merlin nickte kopfschüttelnd. »Das sind Ohr-Eierläufer?«
»Ja. Sie versorgen uns mit köstlichen Eiern und mit Milch.«
»Sie geben Milch?«, rief Merlin ungläubig aus.
»Darum die Euter«, sagte Jeremy trocken.
Johnis und Jamie legten erschrocken einen Finger auf die Lippen. »Leise! Schreit hier nicht so herum, sonst schreckt ihr noch die Flughunde auf.«
Kaum hatten sie dies ausgesprochen, sahen sie auch schon, wie sich ein Rudel von schwarz-braunen Hunden in die Luft erhob und zähnefletschend auf sie zugeflogen kam.
Ängstlich klammerte sich Lissy an Jeremys Hand, als sie die spitzen Zähne sah.
»Beißen die?«, fragte Jeremy nicht weniger erschrocken.
»Oh ja, und danach kannst du einen Sommer lang nicht mehr reden, weil deine Stimmbänder im Hals festkleben«, entgegnete Jamie mit ernster Miene.
»Ernsthaft?«, fragte Jeremy erschrocken.
»Ja.«
»Schöner Mist«, schimpfte Merlin leise, »und wie werden wir sie wieder los?«
Jamie und Johnis tauschten stumme Blicke aus, dann nickten sie sich zu und Jamie holte seufzend fünf kleine, niedliche Hasen aus seiner Tasche. »Wir besänftigen sie mit unseren Löfflern.«
Bevor die Kinder fragen konnten, was Löffler waren, warf Jamie jedem der Flughunde ein putziges Fellhäschen ins Maul.
»Oh nein, die armen Häschen«, jammerte Lissy leise.
»Besser die als unsere Stimmbänder, oder?«, knurrte Merlin und fasste sich schützend an seinen Hals.
»Fressen die denn nichts anderes als Hasen?«, fragte Jeremy.
»Seid nicht traurig«, entgegnete Jamie und verzog das Gesicht, »Das, was ihr Hasen nennt, sind bissige Löffler.
Die sehen nur so süß und flauschig aus. In Wirklichkeit haben sie messerscharfe Zähne und fressen Bläulinge.
Ohne Bläulinge aber haben wir kein Obst. Wir züchten die Löffler nur als Lieblingsspeise der Flughunde.«
»Und es gibt noch etwas, was unsere Flughunde gerne essen«, meinte Jana und zeigte auf einen Baum mit Blüten, »dort wachsen Hexagonäpfel. Aber wie ihr sehen könnt, sind die Bläulinge noch dabei, sie zu befruchten.
Erst zum Mittsommerfest werden die Hexagonäpfel reif sein. Flughunde lieben Hexagonäpfel.«
Merlin war beeindruckt: »Wahnsinn! Es gibt sechseckige Äpfel?«
»Ja, sie sind sehr vitaminreich und aromatisch«, sagte Jana.
»Woher weißt du, dass sie Äpfel sechseckig sind?«, fragte Jeremy seinen Freund ein wenig unwirsch.
Merlin lächelte und klopfte Jeremy auf die Schulter.
»Wenn du in Mathematik besser aufgepasst hättest, wüsstest du, dass ›hexagonal‹ sechseckig bedeutet.«
Jeremy schnitt eine Grimasse. Er wurde nicht gerne daran erinnert, dass er Sportler und kein Mathematiker war.
Gierig schnappten die Flughunde nach den Löfflern. Mit ihrer Beute machten sie schließlich in der Luft kehrt, um zu ihrem Felsen zurückzufliegen.
»Wozu hat man solche Viecher?«, wollte Merlin angewidert wissen. »So etwas schafft man sich doch nicht als Haustier an. Die sind ja lebensgefährlich.«
Jana schüttelte den Kopf. »Flughunde sind sehr nützliche Wachtiere. Sie beschützen uns. Und wenn Eindringlinge nach Soleila kommen, schlagen sie sofort Alarm.«
Sie fuhren an einer Gruppe blau gekleideter Elben vorbei und Merlin sagte fast geistesabwesend: »Ich schätze, die Familien haben nicht nur ihren eigenen Buchstaben, sondern auch ihre eigene Farbe, oder?«
»Richtig. Seht mal da drüben!« Jana zeigte auf einen lila gekleideten Elb, der ein Elbenkind an der Hand hielt. Beide hatten strohblonde Haare. »Das ist George mit seinem Sohn Gruno. Sie gehen zum Markt. Dort werden jede Menge Sachen feilgeboten. Georges Familie wohnt nur drei Häuser von uns entfernt. Es ist die siebte Familie«, fügte sie hinzu. Dann winkte sie dem kleinen Elben zu.
Ihr Mund verzog sich dabei zu einem angedeuteten Lächeln, aber es erreichte ihre Augen nicht.
Langsam lenkte Johnis die Kutsche durch das Dorf. Die Elben und Nutztiere mussten ihnen Platz machen, damit sie durch die engen Wege passten. Offenbar war es nicht üblich, ein so breites Gefährt zu nutzen.
An einer länglichen Hütte mit einem grünen Schild und einem goldenen ›J‹ an der Eingangspforte brachte Johnis den Esel zum Stehen.
»Hier wohnen wir«, sagte er stolz und winkte einer kleinen Elbe zu, die im Garten stand. »Hallo Julia! Bitte sage Mutter, dass wir uns etwas verspäten. Wir müssen noch einen Gefangenen zu König Alba bringen.«
Neugierig betrachtete das Mädchen die Gäste, dann nickte sie zögerlich.
»Steigen wir nicht aus?«, fragte Jeremy verwirrt, als Johnis das Eselchen erneut antrieb.
»Nein. Wir müssen zuerst zum König, um diesen Gnom hier abzuliefern.«
»Was passiert jetzt mit ihm?«, hakte Lissy nach.
Jana zuckte mit den Schultern. »Sie werden ihn vorerst in den Kerker werfen. Er ist ein Bewohner von Obscuritas, dem Dorf der Dunkelalben, und wird sicherlich gegen einen Gefangenen von uns eingetauscht werden.«
»Was sind Dunkelalben?«, fragte Merlin.
»Früher einmal«, setzte Johnis zur Erklärung an, »waren die Elben ein großes, mächtiges Volk. Zu ihnen zählten die Sonnenelben und die Dunkelalben. Lange kamen sie sehr friedlich miteinander aus. Doch dann kam eine Zeit, da gab es immer mehr Streit zwischen den Familien. Also beschlossen unsere Könige, die Dunkelalben umzusiedeln. Sie zogen in das Tal hinter dem vierten Berge – Obscuritas, dem Tal der Finsternis. Nicht alle waren damit einverstanden, aber es kehrte endlich Ruhe und Frieden in Soleila ein, so dass sich schließlich auch die Querköpfe damit abfanden.«
»Allerdings blieben die Dunkelalben im Laufe der Jahre nicht unter sich. Sie nahmen allerlei dahergelaufene, zwielichtige Gestalten bei sich auf – Gnome, Kobolde und noch viele andere. So kam es, dass unser König jedem Bewohner von Obscuritas verbot, sich Soleila zu nähern«, fügte Jamie leise hinzu.
»Zuerst ließ der König an den Grenzen des Tals Wachen aufstellen, dann belegte er es mit einem magischen Schutzwall, den kein Fremder mehr durchdringen kann«, erklärte Johnis und wich einem türkis-rotgemusterten Schaf aus. »Und wenn es doch einer schafft, dann warteten bereits die Flughunde auf ihn.«
»Und wieso konnten wir euer Dorf betreten?«, fragte Merlin verwirrt.
Johnis zügelte den Esel und drehte sich zu ihm um. »Unsere Einladung und Begleitung ist euer Freibrief für den Besuch unseres Tals«, sagte er und schlug dem Gnom so hart auf den buckeligen Rücken, dass dieser sich verschluckte und anfing zu husten.
»Solange wir nicht mit dem Gnom gemeinsam im Kerker landen, ist mir alles recht«, witzelte Jeremy und zwinkerte Lissy zu.
Jamie versuchte, laut aufzulachen, was ihm kläglich misslang. Krähend klopfte er sich auf die Schenkel. »Wir fangen keine Menschen. Nicht einmal die bösartigen, die sich hierher verirren…« Mit einem Seitenblick auf Johnis brach er ab und schaute zu Boden.
Johnis beugte sich zu ihnen hinunter. »Es gibt einige Portale, durch die Menschen versehentlich in unsere Welt stolpern. Sie werden aber in der Regel aufgegriffen und zum Herrscher gebracht. Seit Ewigkeiten hat allerdings kein Mensch mehr euer Spiegelportal benutzt, um in unser Land zu kommen. Um genau zu sein, seitdem der Herrscher Königin Celina in einen menschlichen Körper und durch dieses Portal in die Menschenwelt verbannte.«
»Ich frage mich, warum ihr durch das Spiegelportal von Königin Celina kommen konntet«, sagte Jamie leise. »Wir gingen davon aus, dass sie längst nicht mehr lebt.«
»Vielleicht erfüllt sich endlich die Prophezeiung«, warf Johnis vage ein.
»Eine Prophezeiung?«, horchte Merlin interessiert auf.
»Was besagt sie?«
»Es heißt, drei Menschenkinder, darunter ein Nachfahre des großen Zauberers Merlin, werden den Herrscher besiegen und unsere Musik zurückbringen«, erklärte Jana hinter vorgehaltener Hand. »Und wenn wir musizieren können, dann sind wir auch wieder in der Lage, zu lachen und Menschen zu heilen.«
Johnis trieb den Esel an und begrüßte hier und da ein paar Elben am Wegesrand. Einige von ihnen blieben verwundert stehen und steckten beim Anblick der Menschenkinder tuschelnd die Köpfe zusammen.
Schließlich hielt Johnis vor einer riesigen, flachen Hütte.
Das Dach erinnerte an ein welliges, grünes Meer, aus dem viele karminrote Schornsteine wie Periskope in den Himmel ragten. Die breite Eingangstür zierte eine goldene Krone mit einem ›A‹ darauf.
»So, wir sind da. Hier lebt unsere Königsfamilie. König Alba und seine Frau Augusta mit ihren Kindern Anne, Aileen und Antonio«, erklärte Jana. »Sie sind schon seit tausend Jahren im Amt.«
Während Johnis und Jamie den Gnom von der Kutsche hievten und zum Garten des Königspaares trugen, warteten die drei Freunde gemeinsam mit Jana auf der Ladefläche der Kutsche.
Zwei Wächter hielten die beiden Elben auf. Mit ihren metallischen Helmen, an denen seitlich Hörner von Schafböcken angebracht waren, sahen sie aus wie Wikinger.
Zunächst kontrollierten sie den verschnürten Gnom.
Nachdem sie ihm den Holzstab (der in Wirklichkeit eine Angstrute war und bei seinem Gegner Ängste auslöste) und ein kleines Samtsäckchen abgenommen hatten, winkten sie die beiden Elben mit dem Gefangenen durch.
Johnis klopfte an die schwere Holztür.
»Johnis, Jamie, was habt ihr uns denn Feines mitgebracht?«, fragte ein älterer Elb begeistert. »Das ist ja ein Gnom! Das wird Königin Augusta aber freuen. Soweit ich weiß, wurden Fridolin und David auf einem Erkundungsgang in der Nähe von Obscuritas von den Dunkelalben gefangen genommen. Nun können wir sie zurücktauschen.«
Die Elben verschwanden mit dem Gefangenen in der Hütte.
»Das war Walter, einer der Hauswächter des Königspaars.
Die dreiundzwanzigste Familie steht schon seit Generationen im Dienst der Königsfamilie«, erklärte Jana. »Sie bringen nun den Gnom in den Kerker unterhalb des Berges abseits von der königlichen Hütte. Die Türen sind magisch verriegelt. Sobald Beatrix, die Königin der Dunkelalben, die Nachricht erhalten hat, dass einer ihrer Bewohner gefangen genommen wurde, wird es einen Austausch geben.«
Merlin zupfte sich nachdenklich an seinem Ohrläppchen herum. »Warum lassen sich die Elben fangen?«
»Nun«, sagte Jana und versuchte zu lachen, »in der Regel sind wir schlau genug, um uns nicht fangen zu lassen.
Aber es kommt hin und wieder vor, dass sich die Dunkelalben nicht an die Abmachung halten und die Grenzen von Soleila belagern.«
Merlin nickte. Er lehnte sich entspannt gegen den Holzrahmen der Kutsche, der gefährlich anfing zu wackeln.
Schnell rückte er wieder in die Mitte, bevor das Gefährt noch auseinanderbrach.
Bereits nach kurzer Zeit kamen Janas Brüder zurück und schmissen sich beschwingt auf den Kutschbock. Eilig fuhren sie zurück zum Haus der J‘s, wo Johnis die Kutsche im Garten parkte.
Mit steifen Beinen kletterten die drei Freunde von der Ladefläche.
Neben der kleinen Holztür des Stalls lagen ein paar überreife Früchte im Gras, die mit blau-silbernen Punkten übersät waren. Sie glitzerten wie Diamanten in der Sonne.
»Was ist das?«, fragte Lissy neugierig und bückte sich.
Jana nahm eine Frucht in die Hand und deutete auf die kleinen Punkte. Sie entpuppten sich als eine Art Fliegen mit ahornblattförmigen Flügeln und großen Rüsseln wie Trompeten.
»Das sind Früchtelchen«, erklärte Jana, »sie essen faules Obst und sind daher sehr nützlich.«
Merlin, der sich nicht für die possierlichen Flugobjekte interessierte, wandte sich an Johnis. Dieser band gerade den Esel von der Kutsche los und führte ihn in den Stall. »Was passiert jetzt mit dem Esel und der Kutsche?«, fragte er.
Johnis zuckte mit den Schultern. »Sie gehören jetzt uns.«
Er nahm einen Topf grüne Farbe aus dem Stall und malte mit zwei schnellen Handbewegungen ein großes ›J‹ auf die Kutsche. Dann stellte er den Farbeimer wieder weg.
Empört stemmte Merlin, der über einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn verfügte, die Hände in die Hüften. »Ihr behaltet einfach die Sachen, die ihr findet?«
»Als Gefangener hat der Gnom sein Anrecht auf Kutsche und Esel verloren«, erwiderte Jamie. Mit diesen Worten ging er entschlossen durch den Garten und klopfte an die Haustür. »Mutter, wir sind wieder da!«
Die Tür wurde aufgerissen und eine stattliche Elbe kam heraus. Als sie die drei Menschenkinder sah, stockte sie.